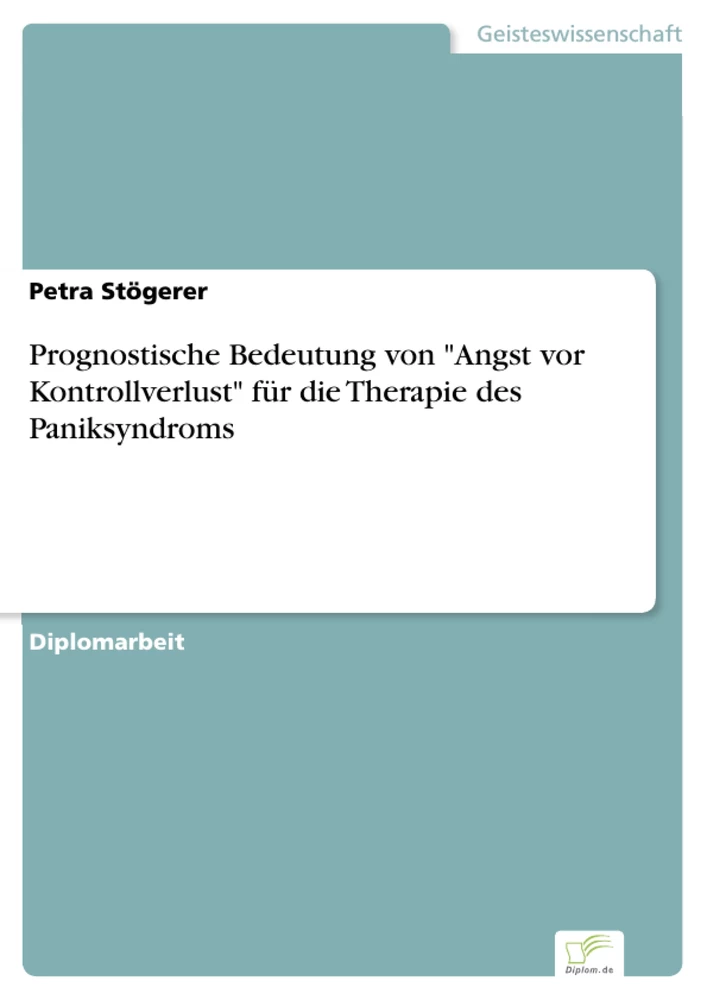Prognostische Bedeutung von "Angst vor Kontrollverlust" für die Therapie des Paniksyndroms
Zusammenfassung
Die Aufgabe der vorliegenden Arbeit bestand darin herauszufinden, ob die Angst vor Kontrollverlust prognostische Bedeutung für die Therapie bei PatientInnen mit Paniksyndrom hat. Zu diesem Zweck wurden 39 PatientInnen innerhalb eines Zeitraumes von sechs bis acht Wochen zweimal interviewt. Sie kamen aus der Panikattacken-Ambulanz der Universitätsklinik für Psychiatrie, wo die PatientInnen innerhalb des angeführten Zeitraumes je nach Bedarf zwischen drei- und fünfmal therapeutisch betreut wurden, aus der Station 5B der Universitätsklinik für Psychiatrie, wo mittels stationärer Verhaltenstherapie sowohl im Einzel- als auch im Gruppensetting gearbeitet wurde, und aus diversen Selbsthilfegruppen für Angststörungen, wo die untersuchten Personen kontinuierlich am Gruppenprozeß teilnahmen. Der Untersuchungszeitraum erstreckte sich von Jänner bis Juni 2000.
Die PatientInnen wurden zum ersten Zeitpunkt mittels des Strukturierten Interviews für DSM-IV und des Anxiety Sensitivity Index sowie zu beiden Zeitpunkten mit der Panic Disorder Severity Scale, dem State Trait Anxiety Inventory und der Befindlichkeitsskala getestet. Das Item 5 des Anxiety Sensitivity Index, welches das Ausmaß der Angst vor Kontrollverlust erhob, diente gleichzeitig als Teilungskriterium, um die an der Studie teilnehmenden Personen in Versuchs- und Kontrollgruppe einteilen zu können.
Die Auswertung der Daten sollten klären,
1) ob es in beiden Gruppen Veränderungen der psychischen Befindlichkeit und des Angstausmaßes zwischen den beiden Zeitpunkten bzw. ob es signifikante Behandlungseffekte gab,
2) ob alle Items in der Panic Disorder Severity Scale, dem State Trait Anxiety Inventory bzw.der Befindlichkeitsskala gleich große Veränderungen ausdrücken, und
3) ob es zwischen Versuchs- und Kontrollgruppe Unterschiede im Ausmaß der Veränderung gab.
Die zusätzlich erhobenen soziodemographischen Daten wurden mittels des Programmpaketes SPSS 7.0 verarbeitet und der Vergleich beider Gruppen graphisch dargestellt. Auffallend war, daß die Personen der Versuchsgruppe einen deutlich höheren Angstsummenscore im Anxiety Sensitivity Index aufwiesen und häufiger einen sich ständig verschlechternden Verlauf ihrer Erkrankung angaben, wohingegen die PatientInnen der Kontrollgruppe wesentlich häufiger über einen chronifizierten Krankheitsverlauf von 15 bis 40 Jahren berichteten. Außerdem war der Prozentsatz des Medikamentenmißbrauchs in der Kontrollgruppe höher.
Die für […]
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
INHALTSVERZEICHNIS
Einleitung
I. Theoretischer Teil
1. Definition von Angst
1.1 Allgemeine und biologische Definitionen
1.2 Psychoanalytisch orientierte Definitionen
1.3 Humanistisch orientierte Definitionen
2. Angst und Angststörungen
3. Prädispositionen zur Auslösung des Paniksyndroms
3.1 Grundängstlichkeit
3.2 Angstsensitivität
3.3 Andere individuelle Prädispositionen
3.4 Lerntheoretische und kognitive Modelle
3.4.1 Zwei-Faktoren-Theorie
3.4.2 Teufelskreis der Angst
3.4.3 Fehlattributionen und dysfunktionale Kognitionen
3.4.4 Vorhersagbarkeit und Kontrollierbarkeit
3.4.5 Klassische und operante Konditionierung
3.5 Neurobiologische Modelle
3.6 Psychoanalytisch orientierte Modelle
3.7 Integrierte Modelle
4. Phänomenologie
5. Diagnostik
5.1 Paniksyndrom
5.1.1 Differentialdiagnose
5.2 Paniksyndrom mit Agoraphobie
6. Epidemiologie
6.1 Komorbidität und Störungsbeginn
7. Verlaufsform und Prognose
8. Therapie
8.1 Pharmakotherapie
8.2 Kognitive Verhaltenstherapie
8.3 Psychoanalytisch orientierte Psychotherapie
II. Empirischer Teil
9. Veränderungsmessung
9.1 Klassische Probleme
9.2 Probabilistische Testmodelle
9.2.1 Das Lineare Rating Scale Modell (LRSM)
9.2.2 Veränderungsmessung mit dem LRSM
9.2.2.1 Likelihood-Quotienten-Test
9.2.3 Das Lineare Partial Credit Modell (LPCM)
9.2.4 Veränderungsmessung mit dem LPCM
9.2.5 Mehrdimensionalität der Items
10. Wirksamkeitskontrollstudie
10.1 Personengruppen
10.1.1 Versuchsgruppe
10.1.2 Kontrollgruppe
10.2 Zeitlicher Ablauf der Untersuchung
10.3 Untersuchungsinstrumente
10.3.1 Strukturiertes Interview für DSM-IV (SKID)
10.3.2 Anxiety Sensitivity Index (ASI)
10.3.3 The Panic Disorder Severity Scale (PDSS)
10.3.4 State Trait Anxiety Inventory (STAI)
10.3.5 Befindlichkeitsskala (Bf-S und Bf-S´)
10.4 Soziodemographische Daten im Vergleich
10.4.1 Stichprobenumfang
10.4.2 Geschlecht
10.4.3 Alter
10.4.4 Erkrankungsdauer
10.4.5 Erkrankungsverlauf
10.4.6 Vermeidungsverhalten
10.4.7 Komorbidität mit Depression
10.4.8 Weitere Komorbiditäten
10.5 Ergebnisse des „Anxiety Sensitivity Index“ (ASI) im Vergleich
10.6 Unterschiede zwischen Versuchs- und Kontrollgruppe
11. Fragestellungen und Ergebnisse
11.1 Hypothesen
11.2 Ergebnisse
11.2.1 Ergebnisse in der PDSS
11.2.2 Ergebnisse im STAI
11.2.3 Ergebnisse der Bf-S und Bf-S´
11.3 Beantwortung der Fragestellungen
11.4 Interpretation der Ergebnisse
11.5 Nebenfragestellungen
11.5.1 Teilung der Untersuchungsgruppen nach dem Angstscore
11.5.1.1 Ergebnisse in der PDSS
11.5.1.2 Ergebnisse im STAI
11.5.1.3 Ergebnisse der Bf-S und Bf-S´
11.5.2 Teilung der Untersuchungsgruppen nach dem Erkrankungsverlauf
11.5.2.1 Ergebnisse in der PDSS
11.5.2.2 Ergebnisse im STAI
11.5.2.3 Ergebnisse der Bf-S und Bf-S´
12. Kritische Reflexion
13. Zusammenfassung
III. Literaturverzeichnis
IV. Anhang
V. Curriculum vitae
EINLEITUNG
Die Frage, ob spezifische Persönlichkeitsmerkmale die Auslösung verschiedener psychischer Erkrankungen, in diesem speziellen Falle die des Paniksyndroms, begünstigen, beschäftigt die Forschung schon seit langem. Phänomene wie Grundängstlichkeit (Kast, 1996) und Angstsensitivität (Taylor & Cox, 1998) werden als mögliche prädisponierende Faktoren für die Entstehung des Paniksyndroms genannt. McNally und Lorenz (1987) definieren Angstsensitivität als personenspezifisches und situationsüberdauerndes Persönlichkeitsmerkmal. Auch Reiss (1991) in seiner Erwartungstheorie, s. auch Reiss und McNally (1985), Reiss et al. (1986), Taylor (1995) und Cox, Parker und Swinson (1996), mißt der Angstsensitivität erhebliche Bedeutung bei der Entstehung des Paniksyndroms zu.
Margraf und Schneider (1990) führen physiologische Prädispositionen sowie erhöhte Aufmerksamkeitszuwendung auf Gefahrenreize bzw. größere Akkuratheit der Interozeption an. Die Bedeutung von inadäquaten kognitiven Schemata sowie dysfunktionalen Kognitionen und Fehlattributionen bei der Auslösung von Panikattacken betonen Beck et al. (1985). Seligman (1971 und 1975) sowie Schneider und Margraf (1998) sehen die Variablen Vorhersagbarkeit und Kontrollierbarkeit als bedeutsam für die Entstehung von Angst an. Auch für Strian (1998) ist die Kontrolle über die Angst entscheidend. Selektive Informationsverarbeitung spielt laut Seligman (1975) ebenfalls eine wesentliche Rolle.
Aus lerntheoretischer Sicht sind vor allem die Zwei-Faktoren-Theorie von Mowrers (Schneider & Margraf, 1998), basierend auf klassischer und operanter Konditionierung, sowie der Teufelskreis der Angst (Margraf & Schneider, 1990) zu nennen. Überprotektive Eltern, allgemeine Ängstlichkeit, Selbstunsicherheit und Abhängigkeit werden von Margraf (1996) und Schneider und Margraf (1998) als möglicherweise die Ausbildung von Panikattacken begünstigende Faktoren erwähnt. Diese Theorien, ebenso wie jene von Goldstein und Chambless (1978), wurden jedoch nicht empirisch bestätigt.
Auch neurobiologische Ansätze von Schneider und Margraf (1998) und Strian (1998) sowie die psychoanalytisch geprägte Darstellung von Marks (1970), daß Angst aufgrund des Konfliktes zwischen Autonomiestreben und Abhängigkeitswünschen entsteht, sind zu beachten.
Riemann (1961) hebt hervor, daß das Phänomen Angst bei jedem Menschen eine persönliche Prägung aufweist. Beginn und Fluktuation der Symptome hängen mit den jeweiligen Lebensereignissen und Belastungen zusammen (Margraf & Schneider, 1990).
Zusammenfassend kann man sagen, daß bisher noch kein „Bündel“ von Persönlichkeitsmerkmalen herausgefunden und empirisch belegt werden konnte, welches allein für die Auslösung des Paniksyndroms verantwortlich ist. In der vorliegenden Untersuchung soll nun geprüft werden, ob das Persönlichkeitsmerkmal „Angst vor Kontrollverlust über die Gefühle“ prädisponierend für die Ausbildung des Paniksyndroms ist. (Die Kenntnis der auslösenden Faktoren würde eine individuelle Therapieplanung jedenfalls begünstigen).
I. THEORETISCHER TEIL
1. Definition von Angst
1.1 Allgemeine und biologische Definitionen
Angst ist eine lebensnotwendige Reaktion und Erfahrung, die der Bewältigung realer oder vorgestellter Bedrohungen durch die unmittelbare psychophysische Aktivierung und durch die dadurch veranlaßten Lösungsstrategien dient. Angst ist immer ein psychisches und körperliches Geschehen und erstreckt sich auf alle Wahrnehmungs-, Vorstellungs- und Verhaltensbereiche des Menschen. Da die Angst im biologischen Bereich eine elementare, zum Überleben notwendige Alarmreaktion darstellt, existiert hierfür eine Art biologisches Alarmsystem. Das Warnsignal „Angst“ benutzt neurobiologische Mechanismen, um die Prioriät gegenüber allen anderen Wahrnehmungen zu gewährleisten. Entwicklungsgeschichtlich gesehen, stellen die Angststrukturen alte Gehirnanteile dar (Strian, 1998).
Kasper und Möller (1995) definieren Angst in phänomenologischer Hinsicht auf drei Ebenen, nämlich der subjektiven (kognitiven) Ebene, der Verhaltensebene und der physiologischen Ebene. Pathologische Angst unterscheidet sich durch folgende Kriterien von ”normaler” Angst:
- Die Angstreaktion ist der Situation unangemessen.
- Die Angstreaktionen sind überdauernd; das heißt es liegt Chronizität vor.
- Der Patient hat keine Möglichkeit der Erklärung, Reduktion oder Bewältigung der Angst.
- Es kommt zu einer (massiven) Beeinträchtigung der Lebensqualität.
Riemann (1961) betont, daß Angst einen Doppelaspekt hat: einerseits kann sie uns aktiv machen, andererseits lähmen. Angst ist immer ein Signal und eine Warnung bei Gefahren, die gleichzeitig den Aufforderungscharakter, nämlich den Impuls, enthält, sie zu überwinden. Demzufolge können das Annehmen der Angst und die Auseinandersetzung mit ihr nicht nur Angstreduktion, sondern auch persönliche Weiterentwicklung bewirken.
Die krankhafte Angst stellt eine eskalierte, verselbständigte Form von Angst dar, die ihrem eigentlichen Sinn, nämlich der Entscheidungsfindung und der Entwicklung von Bewältigungsstrategien, im Weg steht. Sie unterscheidet sich durch ihre Intensität, Dauer und Unangemessenheit zum situativen Kontext, aber auch durch die Angstform als solche, von ”normaler” Angst. Sie steht also entweder in Diskrepanz zur aktuellen Bedrohungssituation, tritt überhaupt losgelöst von äußeren Bedingungen auf oder entwickelt sich aus einer anfänglich angemessenen Angst, bei der die zugrundeliegende, konkrete Bedrohung aber so massiv ist, daß die zunächst notwendige Angst eskaliert, außer Kontrolle gerät und zu einer eigenständigen Angstkrankheit wird (Strian, 1998).
Die erste Angst des Menschen ist laut Cavelius (1997) die Trennungsangst, die in der Entwicklungsgeschichte des Menschen begründet ist. Das Menschenkind ist von Anfang an abhängig von einer Person, die es mit Nahrung und Zuneigung versorgt. Im Gegensatz zum Tierreich ist es sonst nicht überlebensfähig. Säuglinge, die Nahrungs- und/oder Zärtlichkeitsdeprivation ausgesetzt sind, durchleben schlimmste Verlassensängste, entwickeln kein Urvertrauen und leiden als Erwachsene unter geringem Selbstbewußtsein.
1.2 Psychoanalytisch orientierte Definitionen
Morschitzky (1988) veranschaulicht zusammenfassend die Angstentstehungsmodelle der Psychoanalyse. In Siegmund Freuds erster Angsttheorie, einer biologisch orientierten Theorie, wird Angst als die Folge der Blockierung von körperlicher Erregung oder Triebansprüchen, vor allem von sexuellen und aggressiven Impulsen, angesehen. Die Stauung libidinöser Triebenergie setzt sich mangels adäquater körperlicher Abfuhr im psychischen Erleben als Angst um, wobei es zusätzlich zu körperlichen Begleiterscheinungen kommt. Angst wird als pathologische Manifestation von nicht abreagierter Triebenergie verstanden.
Im Gegensatz dazu bezeichnet Freud in seiner zweiten Angsttheorie nicht das ”Es” (die Triebe), sondern das ”Ich” als Ort, wo die Angst auftritt. Daher ist die Angst umso größer, je mehr sich das Ich bedroht fühlt. Die Fähigkeit zur sinnvollen Kontrolle der Angst ist ein Maß für die Ich-Reife. Nicht die Verdrängung erzeugt Angst, sondern die Angst erzeugt Verdrängung. Triebimpulse führen zu Angst, wenn deren Regung durch äußere oder innere Verbote nicht akzeptiert werden kann. Die Abwehrmechanismen der Verdrängung und Unterdrückung werden in Gang gesetzt, um mit der Angst fertig zu werden.
In der neueren Psychoanalyse werden neben dem ursprünglichen Modell, wo Angst als Triebstau angesehen wird, drei Modelle der Angstentstehung unterschieden, nämlich:
- Angst als Folge eines Konfliktes (Konfliktmodell)
- Angst als Folge von Ich-Schwäche (Strukturschwächemodell)
- Angst als Bindungsverlustangst (bindungstheoretisches Modell)
1.3 Humanistisch orientierte Definitionen
Als Beispiel für das humanistische Angstmodell, das Angst als Folge bedrohter Selbstverwirklichung ansieht, zieht Morschitzky (1988) das Modell von Carl Rogers, dem Begründer der klientenzentrierten Psychotherapie, heran. Dieser versteht Angst als die gefühlsmäßige Bedrohung der Selbst-Struktur, die eine Abwehrreaktion des Organismus zur Folge hat. Angst resultiert aus dem Erleben einer Inkongruenz zwischen Selbstkonzept und der Gesamtheit der Erfahrungen. Wenn der Mensch erkennt, daß das, was für die Entwicklung seines Selbst wesentlich ist, und das, was er an aktuellen Gegebenheiten und realer Lebenssituation vorfindet, nicht zusammenpassen, entwickelt er Angst. Derartige Erkenntnisse gelangen in Form von Panikattacken unvermittelt und nicht mehr abwehrbar an die Oberfläche. Der Grundkonflikt bei Angststörungen, insbesondere bei Panikattacken, besteht in dem Konflikt zwischen dem Bedürfnis nach Autonomie und dem Bedürfnis beziehungsweise der Tatsache von Abhängigkeit. Panikattacken schützen die Betroffenen vor der vollständigen Wahrnehmung ihrer inneren Befindlichkeit, die einen Zusammenbruch der Selbststruktur zur Folge hätte.
In der Logotherapie nach Viktor Frankl wird ein Mangel an Lebenssinn als existentiell verunsichernd und angstmachend beschrieben.
2. Angst und Angststörungen
Angst ist, wie schon vorher beschrieben, eine biologisch sinnvolle Reaktion bei realer äußerer Bedrohung. Die damit verbundene Arousal-Reaktion dient zur Vorbereitung der Kampf/Flucht-Reaktion, diese wiederum zur Bewältigung der Gefahrensituation. Bei der Angsterkrankung kommt es nun zu den Symptomen einer Kampf-Fluchtreaktion, ohne daß eine reale äußere Bedrohung vorliegt. Die Bedrohung kommt vielmehr von innen her. Das Alarmsystem Angst ist überempfindlich geworden und kann schon bei kleinsten ungefährlichen Veränderungen in der Umwelt oder auch im Körper ausgelöst werden. (Lenz & Küfferle, 1998).
Angst manifestiert sich in drei Komponenten, nämlich einer körperlichen Komponente, einer Gedanken-Komponente und einer Verhaltenskomponente.
Die körperliche Komponente betrifft das Zentral-Nervensystem (Wachheit, Anspannung, Aufregung), das Herz-Kreislauf-System (Erhöhung der Pulsfrequenz, blasse Haut, vermehrte Durchblutung der Muskulatur), die Atmung (verstärkte Atmung bis Hyperventilation, verbunden mit Beklemmungsgefühlen, Unwirklichkeitsgefühlen, Paraesthesien) und die Schweißdrüsen (vermehrtes Schwitzen). Außerdem können als Symptome trockener Mund, Durchfall oder Verstopfung und Zittern auftreten.
Was die Gedankenkomponente betrifft, so ist Angst meist verbunden mit Gedanken,wovor man sich fürchtet, zum Beispiel Angst vor Herzinfarkt, Angst zu kollabieren, Angst vor Ersticken, Angst, verrückt zu werden sowie Angst, die Kontrolle zu verlieren.
Die Verhaltenskomponente besteht aus Vermeidungs- und/oder Fluchtverhalten. Die Angst vor Kontrollverlust ist einer der häufigsten Faktoren bei allen Vermeidungsreaktionen, wobei nicht die Angst selbst in diesem Fall der Auslöser ist, sondern die Angst davor, in dieser Situation die Kontrolle über sich zu verlieren (Cavelius, 1997).
Grundsätzlich können die Angststörungen in zwei große Gruppen unterteilt werden, nämlich in solche mit ungerichteter, diffuser Angst, wozu das Paniksyndrom mit anfallsartiger Angst und die Generalisierte Angststörung mit andauernder Angst zählen, und in solche mit gerichteter Angst. Zu dieser Kategorie gehören die Agoraphobie, die Sozialphobie sowie die Spezifische Phobie (Lenz & Küfferle, 1998).
3. Prädispositionen zur Auslösung des Paniksyndroms
Laut Margraf & Schneider (1990) spielen physiologische Prädispositionen eine Rolle. Auf psychischer Ebene ist bei der Aufrechterhaltung von Angst die Sorge, einen weiteren Anfall zu erleben, entscheidend. Körperliche Empfindungen werden besonders stark wahrgenommen, was auf andere psychische Prädispositionen, wie Aufmerksamkeitszuwendung auf Gefahrenreize und größere Akkuratheit der Interozeption, zurückzuführen ist. Die Verknüpfung dieser Empfindungen mit unmittelbarer körperlicher oder psychischer Gefahr hängt von der Lerngeschichte und kognitiven Stilen (z.B. Kausalattribution) ab. Operantes und Modellernen spielen ebenfalls eine Rolle.
Patienten mit Angstanfällen zeigen selektive Informationsverarbeitung von Gefahrenreizen und interpretieren körperliche Symptome als gefährlicher im Vergleich zu Kontrollpersonen oder erfolgreich behandelten Patienten.
3.1 Grundängstlichkeit
Kast (1996) setzt sich mit dem Phänomen der Grundängstlichkeit auseinander. Hierbei handelt es sich um Ängstlichkeit als Eigenschaft, um Trait-Angst. Menschen mit einer hohen Grundängstlichkeit sehen überall eine Bedrohung, erwarten geradezu überall eine. Diese Grundängstlichkeit ist häufig mit Aggressionshemmung gekoppelt. Von dieser Grundängstlichkeit unterscheidet sie aktuelle Angsterlebnisse, nämlich die State-Angst. Einzelne Lebenssituationen sind angstbesetzt, lösen aktuelle Angsterlebnisse aus und werden von Menschen mit einer höheren Grundängstlichkeit als bedrohlicher empfunden als von Menschen mit niedriger Grundängstlichkeit.
Cavelius (1997) definiert Grundängstlichkeit als die Bereitschaft des Menschen zum Angstempfinden. Jeder Mensch unterliegt einem für ihn charakteristischen Grad an Ängstlichkeit, nämlich der Grundängstlichkeit, die die Bereitschaft des Menschen zum Angstempfinden umschreibt. Auch sie betont, daß Menschen mit hoher Grundängstlichkeit häufig unter Aggressionshemmungen leiden. Akute Angsterlebnisse werden desto bedrohlicher empfunden, je höher die Grundängstlichkeit ist.
3.2 Angstsensititvität
Laut Taylor und Cox (1998b) spielt die Angstsensitivität, die Furcht vor angstbesetzten Gefühlen, eine wichtige Rolle in der Ätiologie und Aufrechterhaltung von Angststörungen, im speziellen des Paniksyndroms. Die Angstsensitivität basiert auf dem Glauben, daß diese Gefühle schwerwiegende Folgen, abgesehen vom sofortigen Unlustgefühl, haben (Taylor & Cox, 1998a). Gemäß Reiss´s (z.B. Reiss, 1991) Erwartungstheorie verstärkt die Angstsensitivität die Furcht- und Angstreaktionen. Reiss´s Erwartungstheorie besagt, daß Panikattacken, Phobien und andere Angstreaktionen aus drei grundlegenden Ängsten (Sensitivitäten) entstehen, nämlich der Angstsensitivität, der Angst vor negativer Bewertung und der Verletzungs-bzw. Krankheitssensitivität (Taylor, 1993). In Taylor´s Studie wurden Messungen von fundamentalen Ängsten, von üblichen Ängsten und von Trait-Angst durchgeführt. Die Ergebnisse bestätigten Reiss´s Theorie. Die fundamentalen Ängste waren faktoriell verschieden, nur minimal interkorreliert und bestimmten in signifikantem Maß die Varianz bei der Messung von anderen Ängsten und Trait-Angst.
Laut McNally und Lorenz (1987) tragen Menschen mit hoher Angstsensitivität ein erhöhtes Risiko, an Angststörungen, im speziellen an einer Agoraphobie, zu erkranken. Menschen, die davon ausgehen, daß Angst eine negative Konsequenz hat, tendieren zu der Annahme, daß sie auch noch andere negative Folgen hat. Unvorhersehbare Panikattacken, kombiniert mit dieser Bedingung, scheinen für Menschen, die glauben, daß Angst schädlich ist, äußerst pathogen zu sein. Reiss et al. (1986) gehen von der Annahme aus, daß Angstsensitivität bei Angststörungen im allgemeinen und bei Agoraphobie im speziellen eine Rolle spielt.
Cox, Parker und Swinson (1996) definieren Angstsensitivität als ein psychologisches Konstrukt, welches notwendig ist, um die Entwicklung von pathologischer Angst, im speziellen des Paniksyndroms, zu verstehen. Die Forschung schenkt diesem Konstrukt mittlerweile ein bemerkenswertes Maß an Aufmerksamkeit. McNally und Lorenz (1987) definieren Angstsensitivität als personenspezifisch und situationsüberdauernd. Da Angstsensitivität jede Angstreaktion verstärkt, erhöht sie sowohl die Anzahl der Situationen, in denen der Betroffene Erfahrungen von überdauernder Angst macht, als auch die Stärke dieser Ängste. Die Autoren gehen davon aus, daß eine verhaltenstherapeutische Behandlung das agoraphobische Vermeidungsverhalten zu reduzieren imstande ist, ohne daß die Angstsensititivität verschwindet, da die Angstsensitivität eine relativ stabile Persönlichkeitsvariable ist. Reiss und McNally (1985) weisen darauf hin, daß Angstsensitivität nicht nur ein Resultat von Panikattacken ist, sondern einen Risikofaktor für die Entstehung von Agoraphobie und anderen Angststörungen darstellt. Tatsächlich scheint das Auftreten von Panik nicht auszureichen, um eine Agoraphobie auszulösen, außer der Betroffene verfügt schon ursprünglich über ein hohes Maß an Angstsensitivität.
Neueste Erkenntnisse lassen vermuten, daß die Angstsensitivität über eine hierarchische Struktur verfügt, bestehend aus mehreren untergeordneten Faktoren, die auf einem einzigen übergeordneten Faktor laden. In Faktorenanalysen ergaben sich vier untergeordnete Faktoren, nämlich Angst vor Atemproblemen, Angst vor öffentlich bemerkbaren Angstreaktionen, Angst vor kardiovaskulären Symptomen und Angst vor kognitivem Kontrollverlust. Die Angst vor kognitivem Kontrollverlust korrelierte am höchsten mit Depression. Patienten mit einer Panikstörung erzielten die höchsten Scores bei jedem der genannten Faktoren, verglichen mit Patienten mit anderen Angststörungen und mit jenen mit anderen Störungen als Angststörungen. Die Ergebnisse legen nahe, daß Angstsensitivität das Produkt eines allgemeinen Faktors ist mit voneinander unabhängigen Beiträgen von vier spezifischen Faktoren (Taylor & Cox, 1998b).
Schon 1995 hatte Taylor herausgefunden, daß Leute mit erhöhter Angstsensitivität, verglichen mit jenen mit niedriger Angstsensitivität, eher zu Panikattacken neigen. Angstsensitivität unterscheidet sich von anderen grundlegenden Ängsten dadurch, daß sie in stärkerem Zusammenhang zur Agoraphobie steht als andere Ängste. Taylor betrachtet Angstsensitivität als einen Subfaktor von Trait-Angst. Zwar kann Angstsensitivität als ein Subfaktor von Trait-Angst angesehen werden, doch erhebt sich die Frage, ob Angstsensitivität ein Auslöser der Trait-Angst ist (Taylor, 1995).
Der Zweck einer Studie von Hazen, Walker und Eldridge (1996) war es, den Zusammenhang zwischen einer Veränderung der Angstsensititivität, wie sie der Anxiety Sensitiy Index (ASI), der in der Folge näher beschrieben werden wird, mißt, und dem Behandlungserfolg bei Patienten mit der Diagnose Paniksyndrom laut DSM-III-R zu untersuchen. (Als Therapiemethode kam dabei kognitive Verhaltenstherapie zum Einsatz.) Die Ergebnisse zeigten, daß Testpersonen, die eine aktive Behandlung bekommen hatten, signifikant niedrigere Angstsensititivitätsscores bei der Nachbehandlung aufwiesen als die Warteliste-Kontrollgruppe, die keiner Behandlung unterzogen worden war. Außerdem waren die Einflußgrößen, die mit dem ASI erzielt wurden, bedeutender als jene, die von anderen weitverbreiteten Angstmessungen stammten. Daraus resultierend kann man sagen, daß die vorliegenden Ergebnisse für die Verwendung des ASI als Wirksamkeitsmaß in der Paniksyndrom-Forschung sprechen.
3.3 Andere individuelle Prädispositionen
Gemäß Margraf (1996) besteht Einigkeit darüber, daß Patienten mit Angststörungen bereits oft in ihrer Kindheitsentwicklung durch Auffälligkeiten im Sinne einer erhöhten Abhängigkeit von ihren Eltern, einer überprotektiven Einstellung der Eltern und Trennungsangst charakterisiert sind. Spezifische Prädispositionen und Auslöser, wie allgemeine Ängstlichkeit, Selbstunsicherheit, Abhängigkeit und die Unfähigkeit, die Auslöser unangenehmer Emotionen adäquat zu identifizieren, werden diskutiert, konnten von der empirischen Forschung jedoch noch nicht bestätigt werden (Schneider & Margraf, 1998). Jedoch spielen individuelle Prädispositionen einer Person, wie Aufmerksamkeitszuwendungen auf Gefahrenreize und eine bessere Interozeptionsfähigkeit eine Rolle (Margraf, 1996).
Cavelius (1997) hält bestimmte Kindheitserfahrungen, wie körperlichen, seelischen oder sexuellen Mißbrauch, Vernachlässigung, Alkoholismus der Eltern, Eltern mit rigiden Strukturen und Hang zum Perfektionismus sowie starre Familienregeln, Übertonung von Äußerlichkeiten, Überbehütung, Unterdrückung und Verleugnung von Gefühlen, Überforderung durch Rollenwechsel und Zuwendung, die nur abhängig von persönlichen Leistungen gewährt wird, für prädisponierend zur Entwicklung einer ängstlichen Persönlichkeit.
Goldstein und Chambless (1978) unterscheiden zwei Formen der Agoraphobie, nämlich eine einfache und eine komplexe. Für die seltenere einfache Agoraphobie nehmen sie an, daß die Patienten die phobische Situation an sich fürchten. Als Auslöser der Phobie lassen sich bei diesen Patienten üblicherweise traumatische Erfahrungen mit der gefürchteten Situation finden. Bei der weitaus häufigeren komplexen Form der Agoraphobie hingegen fürchten die Patienten vor allem die Konsequenzen der Angst. Im Unterschied zu der ersten Gruppe zeichnen sich diese Patienten also durch die Erwartungsangst aus. Die Autoren streichen heraus, daß sie eine Gruppe von Anzeichen und Symptomen herausfinden konnten, die bei der komplexen Agoraphobie vorkommt. Marks (1970) weist darauf hin, daß es im Falle von komplexer Agoraphobie eine gewisse Vorhersagbarkeit und Konsistenz von Anzeichen und Symptomen gäbe.
Die notwendigen und hinreichenden Merkmale für diese Kategorisierung sind:
- Angst vor der Angst als zentrales phobisches Element,
- niedrige Ausprägung von Unabhängigkeit und Selbständigkeit aufgrund von Angst, einem Mangel an Fertigkeiten, oder beidem, und
- eine Tendenz, die Gründe und Auslöser von unangenehmen Gefühlen falsch zu interpretieren.
Der Beginn der Symptome fällt meistens auf eine Periode eines allgemeinen Konfliktes.
Die Autoren konnten feststellen, daß Patienten mit komplexer Agoraphobie sich, was die geringere Selbständigkeit und Unabhängigkeit betrifft, von jenen mit anderen Phobien signifikant unterschieden. Außerdem liegt bei der komplexen Agoraphobie der Beginn in Zeiten von hohen interpersonellen Konflikten ohne spezielle Auslöser. Schließlich unterscheidet sich die Agoraphobie von anderen Phobien durch die Art der befürchteten Konsequenzen, zum Beispiel der Angst, die Kontrolle zu verlieren, Angst, ohnmächtig zu werden, verrückt zu werden, oder eine Herzattacke zu erleiden.
Laut Goldstein und Chambless zeigen Angstpatienten das Bild von anspruchslosen, furchtsamen Leuten, die sich selbst nicht für unabhängig ”funktionierend” halten. Als Folge treten meist Angst vor Verantwortung und soziale Ängste in dieser Gruppe auf. Aufgrund ihrer abhängigen Persönlichkeitsstruktur sind sie besonders ängstlich gegenüber sozialen Anforderungen und Verantwortlichkeiten. Anstelle angemessener Bewältigungsstrategien tendieren sie zu Ambivalenz und Unentschiedenheit, die die Ängstlichkeit verstärken. Die agoraphoben Symptome selbst entwickeln sich dann als Ausdruck des Konfliktes zwischen dem Bedürfnis nach Abhängigkeit und Verselbständigungsstreben, welcher die Ambivalenz und als Folge davon das hohe Sicherheitsbedürfnis der Patienten verstärken (Klicpera & Gasteiger-Klicpera, 1996).
Ein weiteres Merkmal ist die Unfähigkeit, emotionale Reaktionen genau mit den verursachenden Ereignissen zu verbinden. Die Angst scheint, von nirgendwo herzukommen.
Die Ätiologie dieser Art und Weise, mit Gefühlen umzugehen, könnte aus familiären Konstellationen stammen, in denen der Ausdruck von Gefühlen so bestraft wurde, daß schon das Empfinden eines Gefühles, wie zum Beispiel Zorn, bei diesen Menschen Angst auslöst. Daher versuchen sie, dieses Gefühl zu unterdrücken. Eine andere Erklärung könnte sein, daß das Gefühl durch Modell- bzw. Beobachtungslernen zu Angst konditioniert wurde, wenn ein Kind bei einem Elternteil miterlebt, wie dieser Gefühle, wie Zorn, Ärger oder schwere Depression, unkontrolliert auslebt. Nach einiger Zeit wird diese Reaktion automatisiert bis zu dem Ausmaß, daß das Gefühl gar nicht mehr auftritt, sondern nur noch diffuse Angst empfunden wird.
Klicpera und Gasteiger-Klicpera (1996) beschreiben Patienten mit einer Panikstörung, insbesondere jene mit agoraphober Symptomatik, häufig als ängstliche, scheue, abhängige bis passive Menschen, die sich durch gute Arbeitsleistungen auszeichnen und eine Tendenz zu Ordnungssinn und Perfektionismus aufweisen. Nach DSM-IV wird dieses Verhalten, wenn es zu einer chronischen Beeinträchtigung der Lebensführung führt, als eine Form der Persönlichkeitsstörung (abhängige Persönlichkeit) betrachtet. Die Autoren betonen jedoch auch, daß es auch bei leistungsbetonten, kontaktfähigen Personen zur Entwicklung einer Agoraphobie kommen kann. Gleichzeitig werden häufig auch Auffälligkeiten in den Partnerbeziehungen berichtet. Die Familienverhältnisse werden als besonders stabil und eng geknüpft beschrieben, die Familie stellt einen Zufluchtsort für die Patienten dar. Soziale und gesellschaftliche Aktivitäten außerhalb des familiären Umfelds sind jedoch stark reduziert.
Goldstein (1970, 1973) streicht heraus, daß sich die meisten agoraphobischen Erkrankungen in Ehen oder Beziehungen manifestieren, aus denen die Betroffenen ausbrechen wollen, es jedoch aufgrund von Angst vor Unabhängigkeit bzw. vor dem Alleinsein nicht können.
Klinische Eindrücke über disponierende Persönlichkeitsmerkmale (z.B. Passivität, Schüchternheit, Abhängigkeit) ließen sich empirisch nicht bestätigen (Marks 1987a). Ebenso fanden sich keine Belege für eine schlechte, prämorbide sexuelle Anpassung, überprotektives Verhalten der Mütter oder instabile Familienverhältnisse . Allerdings fehlen prospektive Studien zu diesen Faktoren völlig. Die meisten Familienstudien zeigten eine Häufung von Angststörungen, Phobien, Depressionen und zum Teil Alkoholismus. Der Einfluß von genetischen Faktoren und sozialen Einflüssen ist noch unklar, da Adoptionsstudien bisher völlig fehlen. Weitgehende Einigkeit besteht darüber, daß Beginn und Fluktuationen der Symptomatik mit Belastungen und Lebensereignissen zusammenhängen (Margraf & Schneider, 1990).
Riemann (1961) verweist recht allgemein darauf, daß das Phänomen Angst bei jedem Menschen eine persönliche Prägung hat, die mit seinen individuellen Lebensbedingungen, seinen Anlagen und seiner Umwelt zusammenhängt.
3.4 Lerntheoretische und kognitive Modelle
3.4.1 Zwei-Faktoren-Theorie
Der einflußreichste theoretische Ansatz zur Ätiologie agoraphobischen Verhaltens war lange Zeit die Zwei-Faktoren-Theorie von Mowrer (1960). Bei den beiden Faktoren handelt es sich um die klassische und die operante Konditionierung. Mowrer nahm an, daß bei Phobien ursprünglich neutrale Reize (z.B. Kaufhaus) aufgrund traumatischer Ereignisse (z.B. Ohnmacht) mit einem zentralen motivationalen Angstzustand assoziiert (klassische Konditionierung) und die darauf folgende Vermeidung dieser Reize durch den Abbau dieses unangenehmen Zustandes verstärkt werden (operante Konditionierung). Diese Theorie ist als Erklärung für klinische Phobien allerdings nicht ausreichend, da sich ein großer Teil der Phobiker nicht an traumatische Ereignisse zu Beginn der Störung erinnern kann (Schneider & Margraf, 1998). Viele Agoraphobiker berichten, daß sie zu Beginn der Störung plötzlich und ohne erkennbare Ursache Angst bekamen, oft in Form eines Angstanfalls (Margraf & Schneider, 1990). Laut Schneider & Margraf (1998) können individuelle Prädispositionen einer Person bereits vor dem ersten Panikanfall bestehen. Sie könnten durch Modellernen erworben oder auch genetisch bedingt sein. Ebenso können kognitive Stile die Assoziation körperlicher oder kognitiver Veränderungen mit unmittelbarer Gefahr beeinflussen.
3.4.2 Teufelskreis der Angst
Psychophysiologische oder kognitive Modellvorstellungen besagen, daß Panikanfälle durch positive Rückkopplung zwischen körperlichen Symptomen, deren Assoziation mit Gefahr und der daraus resultierenden Angstreaktion entstehen (Margraf, 1996). Diese Modelle betonen die Rolle interner Angstauslöser. Margraf und Schneider (1990) stellen das psychophysiologische Modell der Angstanfälle vor. Es geht dabei um einen positiven Rückkoppelungskreis, den sogenannten Teufelskreis der Angst, dessen Aufschaukelungsprozeß an jedem seiner folgenden Elemente beginnen kann:
Physiologische oder kognitive Veränderungen treten als Folge verschiedener Ursachen, wie etwa körperlicher Anstrengung, chemischer Substanzen oder situationaler Stressoren auf.
Die Person nimmt diese Veränderungen wahr. Die positive Rückkoppelung kann an dieser Stelle beginnen, da Veränderungen körperlicher Empfindungen physiologische Prozesse nicht unbedingt exakt wiedergeben.
Die körperlichen oder kognitiven Veränderungen werden mit unmittelbarer Gefahr assoziiert. Nicht alle Empfindungen werden gleich wahrscheinlich mit Gefahr in Verbindung gebracht. Empfindungen im Zusammenhang mit lebenswichtigen Körperfunktionen, wie etwa Herzklopfen oder Atemnot, werden bedrohlicher erlebt als zum Beispiel Hitzewallungen. Ebenso werden Symptome mit einem plötzlichen, akuten Beginn eher mit unmittelbarer Gefahr assoziiert. Die positive Rückkoppelung kann an dieser Stelle ohne vorherige körperliche Veränderungen beginnen, wenn situationale Variablen mit unmittelbarer Gefahr assoziiert sind. So können phobische Patienten einen Angstanfall erleben, wenn sie mit ihrem phobischen Stimulus konfrontiert werden.
Die Person reagiert auf die wahrgenommene Bedrohung mit Angst, die zu physiologischen Veränderungen, körperlichen Empfindungen und/oder kognitiven Symptomen führt (positive Rückkoppelung). Diese Symptome werden wahrgenommen, mit Gefahr assoziiert, wodurch es zu einem weiteren Ansteigen der Angst, eventuell zu einer Panikattacke, kommt. Da positive Rückkoppelung ein schneller Prozeß ist, ist es unklar, ab welchem Punkt die Angst Panik genannt werden kann. Da Angstanfälle kein Alles-oder-Nichts-Phänomen sind, ist dies wahrscheinlich eine reine Frage des Schweregrades.
Den Effekten der positiven Rückkoppelung wird durch gleichzeitige negative Rückkoppelungsprozesse entgegengewirkt. Die Mechanismen wirken auf alle Komponenten des positiven Rückkoppelungskreises und führen zu einer Angstreduktion. Da negative Rückkoppelung langsamer ist als positive, kann ein Angstanfall zwar schnell entstehen, benötigt aber eine gewisse Zeit, um abzuklingen. Beispiele für negative Rückkoppelung sind Habituation, selbstbegrenzende homöostatische Mechanismen bei der Hyperventilation oder kognitive Neubewertung. Auch die wahrgenommene Verfügbarkeit von Bewältigungsstrategien führt zur Angstreduktion (zum Beispiel flaches Atmen, Ablenkung, hilfesuchendes Verhalten und natürlich Vermeidungsverhalten). Ein Versagen von Bewältigungsversuchen führt andererseits wieder zu einem Angstanstieg.
Eine Reihe interner und externer Variablen beeinflussen die Wahrscheinlichkeit, einen Angstanfall zu erleben, indem sie die Komponenten des positiven Rückkoppelungskreises starten können. Hier wären interne oder externe Stressoren, physiologische Prädispositionen, das Ausmaß der Erwartungsangst, psychische Voraussetzungen, wie Aufmerksamkeitszuwendung auf Gefahrenreize und größere Akkuratheit der Interozeption, die Lerngeschichte, kognitive Stile (zum Beispiel Kausalattributionen) und situationale Faktoren zu nennen, wie schwierige Lebenssituationen oder belastende Lebensereignisse (Schneider & Margraf, 1998). Patienten mit Angstanfällen weisen häufig eine selektive Informationsverarbeitung von Gefahrenreizen auf und interpretieren körperliche Symptome als gefährliche im Vergleich zu Kontrollpersonen oder erfolgreich behandelten Patienten.
3.4.3 Fehlattributionen und dysfunktionale Kognitionen
Beck et al. (1985) halten inadäquate kognitive Schemata (zum Beispiel Fehlattributionen, externe Kontrollüberzeugung, Erwartung katastrophaler Konsequenzen) , die die Wahrnehmung und Interpretation der Umgebung durch die Person steuern, für Angststörungen verantwortlich. Die betroffenen Personen hielten sich für besonders verletzbar und zeichneten sich durch kognitive Verzerrungen in der Beurteilung potentieller Gefahren aus. Unter Belastung sei es für die Betroffenen schwer, ihre emotionalen Reaktionen auf diese Situationen zu modulieren und die übertriebenen Ängste auf ihren Realtitätsgehalt zu prüfen. Die eigenen Angstreaktionen würden als Anzeichen interpretiert, nicht richtig funktionieren zu können und keine Kontrolle über externe und interne Situationen zu haben, also insgesamt gefährdet zu sein. Angstanfälle entstünden durch Fehlattribution von körperlichen Symptomen, katastrophierende Gedanken und Vorstellungen. Die Autoren gehen also davon aus, daß Ängste vor den agoraphobischen Situationen bereits vor dem ersten Angstanfall vorlagen (Margraf & Schneider, 1990).
Die Studie von Van Hout et al. (1994) über negative Kognitionen während einer verhaltenstherapeutischen Expositionsbehandlung stellt auch ein gutes Beispiel dafür dar, welche Bedeutung den dysfunktionalen Kognitionen in der Therapie mit Panikpatienten zukommt, und daß diese Kognitionen ein prognostisches Kriterium für den weiteren Therapieverlauf darstellen können. Zweck dieser Studie war es, ein Muster von kognitiven Veränderungen, und im speziellen die Rolle von negativen Selbstbehauptungen in bezug auf Verbesserungen, während einer In-vivo-Expositions-Behandlung zu erkennen. Acht Panikpatienten mit Agoraphobie wurden standardisierten agoraphobischen Bedingungen ausgesetzt. (Bei vier von ihnen waren schon deutliche Verbesserungen erzielt worden, bei den anderen vier Patienten kaum). Während der Exposition wurden der Puls, Selbstbehauptungen und die subjektive Angst während der Sitzungen aufgezeichnet. Für die Habituierung des Pulsschlags und die Reduzierung der subjektiven Angst während einer Sitzung wurden fixe Kriterien festgelegt. Die Ergebnisse zeigten, daß die Anzahl der negativen Selbstbehauptungen sowohl am Beginn als auch während und am Ende der Behandlung sehr gut zwischen den fortgeschrittenen und den kaum fortgeschrittenen Patienten differenzierte. Aufgrund dieser Resultate könnte es therapeutisch wichtig sein, eine Expositionsbehandung nicht nur bis zur subjektiven und physiologischen Habituierung der Angst, sondern bis zur Reduzierung der negativen Selbstbehauptungen auf Null fortzusetzen.
Auch Cox (1996) beschäftigt sich mit der Herkunft und Einschätzung von Katastrophengedanken beim Paniksyndrom. Er unterscheidet dabei die Zustands-Katastrophen-Kognitionen (automatische Gedanken) von den zugrundeliegenden Trait-kognitiven Faktoren (Einstellungen). Die im DSM-IV und im Anxiety Sensitivity Index angeführten kognitiven Symptome dienen derzeit als nützliches Maß zur Einschätzung der entsprechenden Bereiche. Die Trait-kognitive Dimension wird als multidimensional betrachtet. Übereinstimmung mit internen oder externen Reizen ist erforderlich, um Katastrophengedanken und begleitende Panikattacken auszulösen.
3.4.4 Vorhersagbarkeit und Kontrollierbarkeit
Seligman (1971) nahm an, daß bestimmte Reiz-Reaktions-Verbindungen leichter gelernt werden, weil sie biologisch vorbereitet sind (preparedness). Tatsächlich tauchen nicht alle Reize mit gleicher Wahrscheinlichkeit als phobische Objekte auf. Die auslösenden Reize für phobische Ängste weisen eine charakteristische und über verschiedene Kulturen hinweg stabile Verteilung, die weder der Häufigkeit dieser Reize im täglichen Leben noch der Wahrscheinlichkeit unangenehmer (traumatischer) Erfahrungen entspricht, auf. Laborexperimente und die Verteilung klinischer Phobien sprechen für diese Annahme (Schneider & Margraf, 1998). Außerdem stellte Seligman (1975) fest, daß unvorhergesehene und unkontrollierbare negative Reize stärker aversiv wirken.
Seligman definiert Angst als chronische Furcht, die sich einstellt, wenn ein bedrohliches Ereignis in der Luft liegt, aber unvorhersagbar ist. In seiner Sicherheitssignal-Hypothese betont der Autor, daß Menschen, und auch Tiere, nach traumatischen Erfahrungen zu jeder Zeit Ängste erleben außer in Anwesenheit eines Stimulus, der zuverlässig Sicherheit voraussagt. Ohne solch ein Sicherheitssignal bleiben sie in einem Zustand von Angst und chronischer Furcht, da ja das traumatische Ereignis jederzeit wieder eintreten könnte. Daher sind diese Menschen ständig auf der Suche nach Sicherheitssignalen. Da traumatische Ereignisse vorhersagbar sind, ist auch das Ausbleiben des traumatischen Ereignisses vorhersagbar, nämlich durch Ausbleiben eines Warnsignals. Sind traumatische Situationen jedoch unvorhersagbar, dann ist auch Sicherheit unvorhersagbar, da es weder ein Warn- noch ein Sicherheitssignal gibt.
Die Emotion Angst oder Furcht wird gemäß dieser Hypothese auf jeden Fall intensiver, wenn traumatische Bedingungen unvorhersagbar sind. Während das Individuum unter der Bedingung unvorhersagbarer Schocks andauernd Angst erlebt, hat es bei vorhersagbaren Schocks nur während des den Schock ankündigenden Signales Angst und kann sich während der übrigen Zeit entspannen. Eine solche Präferenz, daß vorhersagbare schädigende Bedingungen unvorhersagbaren vorgezogen werden, ist experimentell sowohl bei Menschen als auch bei Tieren viele Male in Untersuchungen nachgewiesen worden. Darin spiegelt sich wider, wie wichtig der Sicherheitsaspekt ist, der nur unter vorhersagbaren Bedingungen gegeben ist.
Bedeutend für das Ausmaß der Angst ist aber nicht nur die Variable Vorhersagbarkeit, sondern auch jene der Kontrollierbarkeit. (Diese Variablen lassen sich nur sehr mühsam voneinander trennen; denn wenn Kontrolle besteht, ist auch Vorhersage gegeben). Kontrollierbarkeit dürfte in ihren Auswirkungen auf Angst mehr als einfach Vorhersagbarkeit sein. Ein aversiver Reiz, der vorhersagbar und nicht modifizierbar ist, und den man sich selbst verabreichen kann, also Kontrolle darüber hat, wird dem gleichen aversiven, vorhersagbaren und nicht modifizierbaren Stimulus, der durch jemand anderen verabreicht wird, und daher nicht kontrollierbar ist, deutlich vorgezogen. Diverse Untersuchungsergebnisse lassen auch vermuten, daß Kontrollierbarkeit um ein gewisses Maß mehr zum Abbau von Angst beiträgt als Vorhersagbarkeit.
Experimentell konnte ebenfalls festgestellt werden, daß bereits vermeintliche, aber nicht faktische Kontrollierbarkeit über die Wirkung von Vorhersagbarkeit hinaus zum Angstabbau beiträgt. Gruppen, die von ihrer Kontrollmöglichkeit überzeugt waren, waren weniger ängstlich als jene, die diese Überzeugung nicht hatten. Es verringerte sich also die Angst, wenn Versuchspersonen glaubten, Ereignisse kontrollieren zu können, selbst wenn sie faktisch keine Kontrolle hatten. Um Angstreduktion, zum Beispiel therapeutisch, zu erreichen, dürfte also nicht nur faktische Kontrolle, sondern auch vermeintliche Kontrolle bereits eine Rolle spielen. Der Autor stellt die Hypothese auf, daß die Dimensionen Vorhersagbarkeit und Kontrollierbarkeit, die eine so bedeutende Rolle beim Abbau von Ängsten spielen, ein aktiver Wirkungsparameter der Systematischen Desensibilisierung sind.
Auch Strian (1998) weist darauf hin, daß schon eine rein fiktive Kontrolle über eine Situation angstmindernd wirken kann. Da Angst eine erlernte Hilflosigkeit ist, wirkt bereits die vermeintliche Kontrolle einer Bedrohungssituation angstreduzierend. Angstbewältigung bedeutet in diesem Fall, Situationen angemessen einschätzen zu können und Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten zu entwickeln. Ängstliche Personen scheinen außerdem zur Katastrophisierung von Situationen zu tendieren im Sinne einer self-fulfilling prophecy und blockieren dadurch in Konflikten angemessene Verhaltensreaktionen durch eine ambivalente Situationseinschätzung.
Laut Margraf & Schneider (1990) kann auch Hyperventilation eine wichtige Rolle als Auslöser und als disponierende Bedingung für Panikattacken spielen. Welkowitz et al. (1999) untersuchten in einer Studie den Einfluß verschiedener Instruktionen auf die Panik- und physiologischen Reaktionen auf die Inhalation von Kohlendioxid (CO2). (Frühere Studien hatten die Tendenz festgestellt, daß Manipulationen bei der Instruktion der Patienten vor der Inhalation von CO2 die angstauslösenden Wirkungen abgeschwächt hatten). Es wurden 37 Panikpatienten und 16 Versuchspersonen ohne Panikattacken unter drei verschiedenen Instruktionsbedingungen CO2-Inhalation ausgesetzt. Die Versuchspersonen wurden den drei Versuchsgruppen randomisiert zugewiesen. Die erste Bedingung war ”Rückversicherung”; das heißt den Patienten wurden etwaige Gefahren des Vorganges genau und wiederholt erklärt. Die zweite Bedingung hieß ”Regelskala”, bei der den Patienten genau erklärt wurde, wie sie die CO2-Konzentration beim Einatmen selbst reduzieren können, und die dritte Bedingung lautete ”grundsätzliche Anweisungen”. Hier wurden den Patienten nur die Standardinformationen über diese Studie mitgeteilt. Daher ermöglichte dieses Versuchsdesign sowohl die Erfassung der subjektiven Berichte über die Angst als auch die unabhängige Bewertung der Panik. Das Experiment war in fünf Abschnitte gegliedert: am Beginn wurde20 Minuten bei Raumluft geatmet, dann folgten 20 Minuten Atmen eines Gemisches mit 5% CO2. Im dritten Abschnitt wurde wieder Raumluft geatmet, dann ein Gemisch mit 7% CO2. Der fünfte Zeitraum beinhaltete wieder das Atmen von Raumluft. (Auch die letzten drei Perioden dauerten jeweils 20 Minuten).
Die Manipulation der Instruktionsanweisungen konnte die Unterschiede im Angstausmaß zwischen den verschiedenen Patienten nicht beeinflussen. Dennoch konnte bei der Rückversicherungs-Bedingung ein signifikanter Rückgang in der wahrgenommenen Atemlosigkeit nachgewiesen werden. Zwar konnte nicht bestätigt werden, daß die Illusion von Kontrolle, herbeigeführt durch eine unbekannterweise nicht funktionierende Regelskala, die Angstreaktionen abschwächte, dennoch berichteten Patienten aus der Rückversicherungs-Gruppe, daß sie ihre Instruktionen als eine Art Coping-Mechanismus während des Experimentes nützten. Es zeigte sich also, daß kognitive Variablen sehr wohl die subjektiv empfundene Angst beeinflussen konnten. Der Einsatz von beruhigenden und rückversichernden Worten verursachte eine zeitweise Veränderung in den Kognitionen. Verhaltenstherapeutisch betrachtet, scheint bei der Behandlung von Angst die Rückversicherung von Sicherheit ein effektiver Zugang zu sein. Patienten, die ihre Angst weniger stark empfinden, und eher das Gefühl haben, alles unter Kontrolle zu haben (auch während einer Panikattacke), könnten somit durchaus eine bessere Prognose für ihren Therapieverlauf aufweisen. Auch in dieser Studie wird die Bedeutung des Gefühls der Kontrollierbarkeit für Panikpatienten und als Folge davon die Angst vor Verlust derselben deutlich.
3.4.5 Klassische und operante Konditionierung
Goldstein und Chambless (1978) halten es für wahrscheinlich, daß der erste Angstanfall selbst als traumatischer Stimulus wirkt und durch interozeptives Konditionieren körperliche Vorgänge zu konditionierten Reizen für Angstreaktionen werden. In ihrem Artikel beziehen sich die Autoren auf die beiden Modelle der Konditionierung, klassisch und operant, bei der Entstehung und Aufrechterhaltung von Angst. Da ich diesen Erklärungsansatz schon anhand der Zwei-Faktoren-Theorie (Mowrers, 1960) in Abschnitt 3.4.1 ausgeführt habe, möchte ich nun nicht im Detail darauf eingehen. Goldstein und Chambless (1978) ziehen zusätzlich als möglichen Verstärker soziale Bestätigung von anderen in Form von Aufmerksamkeitszuwendung an.
Auch Seligman (1973) erklärt den Verlauf des Auftretens von Panikattacken durch Konditionierungsmodelle. Haben die Menschen eine oder mehrere Panikattacken erlebt, beobachten sie ihre Gefühle übergenau und interpretieren diese Gefühle von leichter bis mittlerer Angst als Zeichen einer beginnenden Panikattacke und reagieren mit einer derartigen Angst, daß die befürchtete Attacke tatsächlich kommt. Die eigenen physiologischen Erregungsanzeichen eines Menschen werden so für ihn zum konditionierten Reiz für die konditionierte Antwort einer Panikattacke. Als Folge davon tendiert die Phobie zur Generalisierung, und die Betroffenen leiden häufig unter der sogenannten frei flottierenden Angst.
3.5 Neurobiologische Modelle
Schneider & Margraf (1998) weisen darauf hin, daß physiologische Dispositionen eine Begünstigung für den Beginn des Angst-Aufschaukelungsprozesses darstellen. Eine erhöhte Sensitivität des Locus coeruleus, der zentralen Chemorezeptoren und des serotinergen Systems, sowie auch mangelnde körperliche Fitneß, können prädispositionierend wirken.
Strian (1998) weist darauf hin, daß unterschiedlichste Prozesse in den Alaramstrukturen des Gehirnes, wie zum Beispiel Störungen der Hormonachsen und der Rezeptoren-, Neurotransmitter- und Neuromodulatorensysteme, Anfallsangst auslösen können. Außerdem können unterschiedlichste Krankheitsprozesse des Gehirns, wie Tumore, Verletzungen, Entzündungen und ähnliches, auch Anfallsangst auslösen, die sich vielfach nicht von Panikattacken unterscheidet.
Neuroendokrinologisch betrachtet, könnte eine Mehrausschüttung des Neuropeptides Corticotropin-Releasing-Hormon (CRH) eine unmittelbare Ursache für Angst oder Panikattacken sein, da CRH neben vielfältigen anderen Verhaltenseffekten auch angstauslösend wirken kann. Umgekehrt wird durch einige Benzodiazepine die CRH-Konzentration in bestimmten limbischen Kerngebieten, zum Beispiel im Locus coeruleus, reduziert und die Streßreaktion dadurch abgeschwächt (Strian, 1998).
3.6 Psychoanalytisch orientierte Modelle
Meist bricht die Panikstörung nicht vor der Pubertät aus (Marks, 1970), in der der Konflikt zwischen dem Autonomiestreben und Wunsch nach Individualisierung dem Verbleiben in der Abhängigkeit in der familiären Umgebung gegenübersteht. Diese Krise wird häufig dadurch vermieden, daß die Abhängigkeit von den Eltern durch jene von einem (Ehe-) Partner ersetzt wird. So wird der Konflikt nicht aufgelöst und für später konserviert. Aufgrund von ihren Trennungsängsten und mangelnden Coping-Strategien gelangen die Patienten häufig in Situationen, die sie nicht lösen können. So erscheint es ihnen immer besser, in einer schlechten, aber sicheren Partnerschaft zu bleiben, als auf sich selbst gestellt zu sein. Außerdem empfinden sie große Schuldgefühle dem Partner gegenüber. Besteht der interpersonelle Konflikt lang genug, kann es zum Auftreten von starken Panikattacken kommen. Da eine Panikattacke eine Grenzerfahrung ist, verstärkt sie die Überzeugung des Patienten, daß sich jemand um ihn kümmern muß, wenn sie gemeinsam mit geringer Selbständigkeit und Unabhängigkeit auftritt. Dadurch verstärken Panikattacken Gefühle von Abhängigkeit und Hilflosigkeit, und die Wahrscheinlichkeit, in dem Konflikt, der die Panikattacken verursacht, zu verbleiben, steigt. Diese Situation entsteht analog zu Seligman´s Paradigma der ”erlernten Hilflosigkeit” (1973).
3.7 Integrierte Modelle
Mathews et al. (1981) legen ein integriertes Modell der Agoraphobie vor. Als mögliche Vulnerabilitätsfaktoren nehmen sie die familiäre Umgebung in der Kindheit, eine hohe genetische Ladung für Trait-Angst und non-spezifische Belastungen an. Entscheidend für die Entwicklung der Störung ist der erste Angstanfall. Diese Erfahrung aktiviere einen vermeidenden, abhängigen Bewältigungsstil, der wahrscheinlich in der Kindheit gelernt sei. Eine ängstliche Persönlichkeitsstruktur disponiert zu abnormer psychophysiologischer Aktivierung und damit zur Auslösung akuter Angstattacken. Die bei der Auslösung dieser Angstattacken angetroffenen situativen Bedingungen bestimmen dann die weiteren Vermeidungs- und Angstabwehrstrategien. Die agoraphobe Fixierung entsteht auch aufgrund des charakteristischen Angstbewältigungsstils der Patienten, wofür geringes Selbstvertrauen und Abhängigkeitstendenzen sowie die Projektion des Angsterlebens nach außen bezeichned sind. Die Autoren weisen darauf hin, daß viele der postulierten Variablen spekulativ und ergänzungsbedürftig sind und durch empirische Befunde erhärtet werden müßten. Die Vielzahl der von Mathews et al. angenommenen Faktoren scheint der Komplexität des klinischen Phänomens gerechter zu werden (Margraf & Schneider, 1990).
Zusammenfassend kann man sagen, daß die meisten der oben genannten Autoren bestimmte Persönlichkeitsvariablen bei Panikstörungen für fehlentwickelt halten. Hauptsächlich wurden die Merkmale allgemeine Ängstlichkeit, Selbstunsicherheit, Abhängigkeit und Unfähigkeit, die Auslöser unangenehmer Emotionen adäquat zu identifizieren als prädisponierend, an einer Panikstörung zu erkranken, genannt. Oft wurden auch Passivität und Schüchternheit als Vulnerabilitätsfaktoren genannt, die aber als prädisponierende Persönlichkeitsvariablen für Panikstörungen empirisch nicht nachgewiesen werden konnten. Trotzdem sind sich die Autoren weitgehend einig, daß es ein Bündel von Persönlichkeitsmerkmalen gibt, das die Ausbildung einer Panikstörung zumindest begünstigt. Auch Strian (1998) weist auf die mehrfaktorielle Entstehung des Paniksyndroms hin. Die Persönlichkeitsmerkmale Selbstunsicherheit, Ängstlichkeit, Abhängigkeit sowie das ständige Bedürfnis nach Kontrollescheinen dabei eine besondere Rolle zu spielen.
Weiters geht man nach heutigem Kenntnisstand sogar davon aus, daß für verschiedene Angststörungen jeweils individuelle Faktorenbündel prädisponierend wirken könnten.
[...]
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Originalausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2000
- ISBN (eBook)
- 9783832452971
- ISBN (Paperback)
- 9783838652979
- DOI
- 10.3239/9783832452971
- Dateigröße
- 7.3 MB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- Universität Wien – Grund- und Integrativwissenschaftliche Fakultät
- Erscheinungsdatum
- 2002 (April)
- Note
- 1,0
- Schlagworte
- therapieevaluationsstudie klinische psychologie statistik auswertung modellen testtheorie
- Produktsicherheit
- Diplom.de