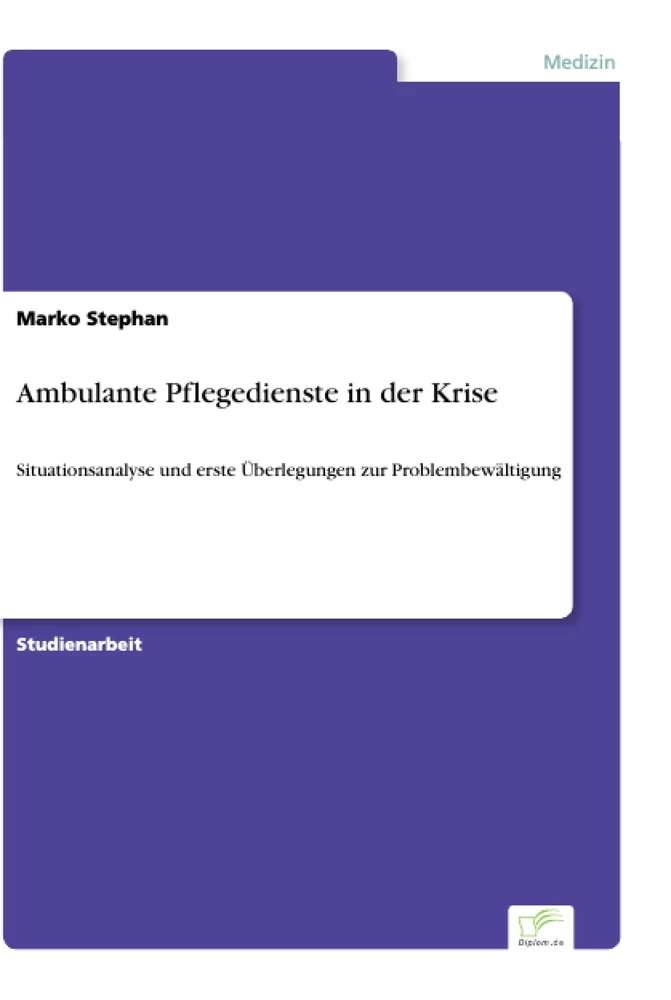Ambulante Pflegedienste in der Krise
Situationsanalyse und erste Überlegungen zur Problembewältigung
©2001
Studienarbeit
66 Seiten
Zusammenfassung
Inhaltsangabe:Einleitung:
In Zeiten vermehrter Reformen im Sozialbereich wird der Trend zu mehr Eigenverantwortung seitens der Leistungserbringer sowie der Leistungsempfänger immer deutlicher. Ambulante Pflegedienste müssen ihre Leistungen seit Einführung der Pflegeversicherung unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten qualitätsgesichert anbieten. Auch ein verstärktes Werben um den Pflegebedürftigen, der immer mehr die Rolle des Kunden annimmt - und die damit einhergehende Konkurrenz zwischen den Pflegediensten - sind Zeichen eines sich öffnenden Pflegemarktes. Die daraus resultierenden Ansprüche sind Herausforderung und Schwierigkeit zugleich.
Inhalt dieser Studienarbeit sind die Analyse und Darstellung der Auswirkungen, die in Folge der praktischen Umsetzung der Pflegeversicherung zu erkennen sind. Vor allem das Spannungsfeld aus Wirtschaftlichkeit, Qualitätssicherung und Kundenorientierung ist Betrachtungsgegenstand. Zur Lösung dieser Problemfelder ist der Einsatz von wirtschaftlichen Instrumenten notwendig. Im Rahmen der Studienarbeit wird dabei das Controlling als ein möglicher Lösungsansatz vorgestellt. Aufgrund der speziellen Bedingungen des ambulanten Pflegemarktes macht sich eine Modifizierung des klassischen Controllingverständnisses erforderlich. Diese Anpassung der Controllingsichtweise wird im letzten Teil der Arbeit einführend beschrieben.
Inhaltsverzeichnis:Inhaltsverzeichnis:
1.Einleitung5
2.Wesen und Angebot der ambulanten Pflegedienste6
2.1Bedeutung und Definition der ambulanten Pflegedienste6
2.2Leistungen und Leistungsträger der ambulanten Pflegedienste9
2.2.1Gesetzliche Krankenversicherung10
2.2.2Soziale Pflegeversicherung11
2.2.3Sozialhilfeträger11
2.2.4Selbstzahler12
3.Veränderte rechtliche Rahmenbedingungen und deren Auswirkungen auf die ambulanten Pflegedienste13
3.1Problematik der Festpreise15
3.2Verlagerung von Zuständigkeiten der Leistungsträger17
3.3Nicht refinanzierbare Leistungen21
4.Veränderte wirtschaftliche Rahmenbedingungen und deren Auswirkungen auf die ambulanten Pflegedienste23
4.1Zunehmende Konkurrenz auf dem Pflegemarkt23
4.2Wirtschaftliche Auswirkungen der Qualitätssicherung26
4.3Verstärkte Orientierung am Pflegebedürftigen31
5.Ansätze zur Lösung wirtschaftlicher Problemstellungen37
5.1Notwendigkeit der wirtschaftlichen Betrachtungsweise37
5.2Controlling als ein möglicher Ansatzpunkt40
6.Schlussbetrachtung44
Literaturverzeichnis47
Verzeichnis der Abbildungen und Anlagen50
Anlage 1: […]
In Zeiten vermehrter Reformen im Sozialbereich wird der Trend zu mehr Eigenverantwortung seitens der Leistungserbringer sowie der Leistungsempfänger immer deutlicher. Ambulante Pflegedienste müssen ihre Leistungen seit Einführung der Pflegeversicherung unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten qualitätsgesichert anbieten. Auch ein verstärktes Werben um den Pflegebedürftigen, der immer mehr die Rolle des Kunden annimmt - und die damit einhergehende Konkurrenz zwischen den Pflegediensten - sind Zeichen eines sich öffnenden Pflegemarktes. Die daraus resultierenden Ansprüche sind Herausforderung und Schwierigkeit zugleich.
Inhalt dieser Studienarbeit sind die Analyse und Darstellung der Auswirkungen, die in Folge der praktischen Umsetzung der Pflegeversicherung zu erkennen sind. Vor allem das Spannungsfeld aus Wirtschaftlichkeit, Qualitätssicherung und Kundenorientierung ist Betrachtungsgegenstand. Zur Lösung dieser Problemfelder ist der Einsatz von wirtschaftlichen Instrumenten notwendig. Im Rahmen der Studienarbeit wird dabei das Controlling als ein möglicher Lösungsansatz vorgestellt. Aufgrund der speziellen Bedingungen des ambulanten Pflegemarktes macht sich eine Modifizierung des klassischen Controllingverständnisses erforderlich. Diese Anpassung der Controllingsichtweise wird im letzten Teil der Arbeit einführend beschrieben.
Inhaltsverzeichnis:Inhaltsverzeichnis:
1.Einleitung5
2.Wesen und Angebot der ambulanten Pflegedienste6
2.1Bedeutung und Definition der ambulanten Pflegedienste6
2.2Leistungen und Leistungsträger der ambulanten Pflegedienste9
2.2.1Gesetzliche Krankenversicherung10
2.2.2Soziale Pflegeversicherung11
2.2.3Sozialhilfeträger11
2.2.4Selbstzahler12
3.Veränderte rechtliche Rahmenbedingungen und deren Auswirkungen auf die ambulanten Pflegedienste13
3.1Problematik der Festpreise15
3.2Verlagerung von Zuständigkeiten der Leistungsträger17
3.3Nicht refinanzierbare Leistungen21
4.Veränderte wirtschaftliche Rahmenbedingungen und deren Auswirkungen auf die ambulanten Pflegedienste23
4.1Zunehmende Konkurrenz auf dem Pflegemarkt23
4.2Wirtschaftliche Auswirkungen der Qualitätssicherung26
4.3Verstärkte Orientierung am Pflegebedürftigen31
5.Ansätze zur Lösung wirtschaftlicher Problemstellungen37
5.1Notwendigkeit der wirtschaftlichen Betrachtungsweise37
5.2Controlling als ein möglicher Ansatzpunkt40
6.Schlussbetrachtung44
Literaturverzeichnis47
Verzeichnis der Abbildungen und Anlagen50
Anlage 1: […]
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
ID 5262
Stephan, Marko: Ambulante Pflegedienste in der Krise: Situationsanalyse und erste
Überlegungen zur Problembewältigung / Marko Stephan - Hamburg: Diplomica GmbH, 2002
Zugl.: Plauen, Studienarbeit, 2001
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte, insbesondere die
der Übersetzung, des Nachdrucks, des Vortrags, der Entnahme von Abbildungen und Tabellen,
der Funksendung, der Mikroverfilmung oder der Vervielfältigung auf anderen Wegen und der
Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen, bleiben, auch bei nur auszugsweiser Verwertung,
vorbehalten. Eine Vervielfältigung dieses Werkes oder von Teilen dieses Werkes ist auch im
Einzelfall nur in den Grenzen der gesetzlichen Bestimmungen des Urheberrechtsgesetzes der
Bundesrepublik Deutschland in der jeweils geltenden Fassung zulässig. Sie ist grundsätzlich
vergütungspflichtig. Zuwiderhandlungen unterliegen den Strafbestimmungen des
Urheberrechtes.
Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in diesem
Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme, dass solche
Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei zu betrachten
wären und daher von jedermann benutzt werden dürften.
Die Informationen in diesem Werk wurden mit Sorgfalt erarbeitet. Dennoch können Fehler nicht
vollständig ausgeschlossen werden, und die Diplomarbeiten Agentur, die Autoren oder
Übersetzer übernehmen keine juristische Verantwortung oder irgendeine Haftung für evtl.
verbliebene fehlerhafte Angaben und deren Folgen.
Diplomica GmbH
http://www.diplom.de, Hamburg 2002
Printed in Germany
Inhaltsverzeichnis
Seite
Verzeichnis der verwendeten Abkürzungen und Symbole ...4
1 Einleitung...5
2 Wesen und Angebot der ambulanten Pflegedienste ...6
2.1 Bedeutung und Definition der ambulanten Pflegedienste...6
2.2 Leistungen und Leistungsträger der ambulanten Pflegedienste...9
2.2.1 Gesetzliche Krankenversicherung...10
2.2.2 Soziale Pflegeversicherung ...11
2.2.3 Sozialhilfeträger...11
2.2.4 Selbstzahler...12
3 Veränderte rechtliche Rahmenbedingungen und deren
Auswirkungen auf die ambulanten Pflegedienste...13
3.1 Problematik der Festpreise...15
3.2 Verlagerung von Zuständigkeiten der Leistungsträger ...17
3.3 Nicht refinanzierbare Leistungen...21
4 Veränderte wirtschaftliche Rahmenbedingungen und deren
Auswirkungen auf die ambulanten Pflegedienste...23
4.1 Zunehmende Konkurrenz auf dem Pflegemarkt ...23
4.2 Wirtschaftliche Auswirkungen der Qualitätssicherung...26
4.3 Verstärkte Orientierung am Pflegebedürftigen ...31
5 Ansätze zur Lösung wirtschaftlicher Problemstellungen...37
5.1 Notwendigkeit der wirtschaftlichen Betrachtungsweise ...37
5.2 Controlling als ein möglicher Ansatzpunkt...40
6 Schlussbetrachtung ...44
Literaturverzeichnis ...47
Verzeichnis der Abbildungen und Anlagen...50
3
Verzeichnis der verwendeten Abkürzungen und Symbole
AWO
Arbeiterwohlfahrt
ABVP
Arbeitgeber-
und
Berufsverband
Häusliche Krankenpflege e. V.
Art.
Artikel
BGBl
Bundesgesetzblatt
BSHG
Bundessozialhilfegesetz
d.
h.
das
heißt
DRGs
Diagnosis
Related
Groups
GG
Grundgesetz
LK
Leistungskatalog
MDK
Medizinischer Dienst der Krankenkassen
m.
E.
meines
Erachtens
O.
V.
Ohne
Verfasser
PBV
Pflegebuchführungsverordnung
PQsG
Pflege-Qualitätssicherungsgesetz
SGB V
Sozialgesetzbuch - Fünftes Buch - Gesetzliche Krankenver-
sicherung
SGB XI
Sozialgesetzbuch - Elftes Buch - Soziale Pflegeversicherung
u. ä. m.
und ähnliches mehr
u.
a.
unter
anderem
Vgl.
Vergleiche
z.
B.
zum
Beispiel
4
1 Einleitung
Mit dem Inkrafttreten des Gesetzes zur Absicherung des Risikos der Pflegebedürftig-
keit am 01.01.1995 wurde die soziale Pflegeversicherung als neuer, eigenständiger
Zweig der Sozialversicherung begründet. Anliegen des Gesetzgebers war es in ers-
ter Linie, den Pflegesektor in Form eines an Angebot und Nachfrage orientierten
Marktes zu öffnen. Damit verbunden waren auch eine gesetzlich festgeschriebene
Qualitätssicherung sowie die Wandlung des Pflegebedürftigen zum Kunden. Die
Konkurrenz unter den ambulanten Pflegediensten nahm in Folge dessen in einem so
starken Umfang zu, dass bereits einige Anbieter ambulanter Pflegeleistungen aus
dem Markt ausgeschieden sind.
Diese Studienarbeit befasst sich mit der Analyse der Auswirkungen, die sich bei der
praktischen Umsetzung der Pflegeversicherung ergeben. Zu Beginn erfolgt eine kur-
ze Beschreibung des ambulanten Leistungsangebotes sowie deren Leistungsträger.
Dem schließen sich die ausführliche Darstellung der veränderten rechtlichen und
wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und die daraus resultierenden Problemstellun-
gen an. Vor allem die Zusammenhänge zwischen betriebswirtschaftlicher Sichtweise,
den Ansprüchen der Pflegenden und der Pflegebedürftigen sowie die gesetzlichen
Anforderungen des Sozialgesetzbuches sind Untersuchungsgegenstände dieser Ar-
beit.
Im letzten Teil der Studienarbeit wird auf die Notwendigkeit der wirtschaftlichen Be-
trachtungsweise verwiesen, da letztlich die analysierten Spannungsfelder Einfluss
auf die wirtschaftliche Lage der ambulanten Dienste haben. In diesem Zusammen-
hang wird das Instrument des Controllings als ein möglicher Ansatzpunkt zur Lösung
wirtschaftlicher Probleme vorgestellt. Der Controllingbegriff ist gegenüber der klassi-
schen Sichtweise um die Aspekte Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit, Image eines
Pflegedienstes sowie die Qualität der Leistungserbringung zu erweitern. Aufgrund
der Begrenztheit dieser Arbeit kann auf den Controllingumfang für ambulante Pflege-
dienste nur einführend eingegangen werden.
5
Abschließend ist zu bemerken, dass sich die Ausführungen ausschließlich auf den
Bereich der ambulanten Pflegedienste beziehen, da diese die primären Leistungs-
erbringer pflegerischer Dienstleistungen sind (§ 3 Satz 1 des Pflegeversicherungsge-
setzes fordert den Vorrang ambulanter Pflege vor stationärer Pflege).
2 Wesen und Angebot der ambulanten Pflegedienste
2.1 Bedeutung und Definition der ambulanten Pflegedienste
Die ambulante Versorgung der Bevölkerung mit pflegerischen Dienstleistungen ge-
winnt immer mehr an Bedeutung im Gesundheitswesen der Bundesrepublik Deutsch-
land. Mit der steigenden Lebenserwartung infolge des demographischen Wandels
geht auch eine Zunahme der Krankheiten bzw. deren Häufigkeit und Dauer einher.
Charakteristisch für das steigende Alter ist das Auftreten mehrerer Krankheiten zur
gleichen Zeit, wie z. B. Herz- und Kreislaufbeschwerden, Altersdiabetes und psychi-
sche Erkrankungen (Multimorbidität). Den Prognosen zufolge wird der Anteil der
pflegebedürftigen, älteren Menschen, die zu Hause versorgt werden, auch weiterhin
zunehmen. Grafisch dargestellt wird dies in Abbildung 1:
Abbildung 1: Prognose der Entwicklung der Zahl der Pflegebedürftigen nach
Pflegeart 1994 bis 2040
1)
1)
Vgl. Poser, Maerle / Schlüter, Wilfried: Kundenorientierung & Beschwerdemanagement, München,
Verlag Neuer Merkur GmbH, 2001, S. 88
6
Die wachsende Bedeutung der ambulanten Pflegedienste lässt sich aber auch auf
den Fortschritt der medizinischen Entwicklung (vor allem in der Intensivmedizin) und
den damit einhergehenden kürzeren Krankenhausverweildauern zurückführen. Diese
Entwicklung ist wiederum mit Problemen (z. B. arbeitsintensivere Pflege, soziale De-
fizite oder auch das Gewährleisten des Rechts auf ein menschenwürdiges Sterben)
behaftet, die jedoch im Rahmen dieser Arbeit nur im Ansatz betrachtet werden kön-
nen.
Ein weiterer Grund für die zunehmende Wichtigkeit der ambulanten Versorgung ist
die sozialpolitische Forderung ,,ambulant vor stationär", die im § 3 SGB XI (Elftes So-
zialgesetzbuch Soziale Pflegeversicherung) festgeschrieben ist:
,,Die Pflegeversicherung soll mit ihren Leistungen vorrangig die häusliche Pflege und
die Pflegebereitschaft der Angehörigen und Nachbarn unterstützen, damit die Pfle-
gebedürftigen möglichst lange in ihrer häuslichen Umgebung bleiben können. Leis-
tungen der teilstationären Pflege und der Kurzzeitpflege gehen den Leistungen der
vollstationären Pflege vor."
2)
Hintergrund dieser Forderung ist die Tatsache, dass aufgrund der sinkenden Pflege-
bereitschaft und möglichkeit der nächsten Angehörigen der Staat als ,,sozialer Bun-
desstaat"
3)
mit einer sozialen Absicherung in die Pflicht genommen werden soll. Der
Staat hat im Sinne des Sozialstaatsprinzips für ein menschenwürdiges Existenzmi-
nimum (z. B. die Hilfeleistung für Bedürftige) für alle zu sorgen und die Lebensver-
hältnisse in sozialer Gerechtigkeit und sozialer Sicherheit zu gestalten.
4)
Allerdings ist
diese sozialpolitische Forderung nicht nur allein aus der Fürsorge für Bedürftige ent-
standen, sondern auch Konsequenz der steigenden Kosten und Resultat des Zwan-
ges zu kostensparenden Lösungen. Inwieweit dies die Menschenwürde achtet, er-
scheint einer differenzierten Betrachtung (jedoch nicht im Rahmen dieser Studienar-
beit) wert.
2)
Sozialgesetzbuch (SGB)-Elftes Buch (XI)-Soziale Pflegeversicherung (Art. 1 des Gesetzes vom
26.05.1994 I 1014), 26.05.1994, BGBl I 1994, 1014, 1015
3)
Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland (GG) Art. 20 Absatz 1, 23.05.1949, BGBl 1949, 1
4)
Vgl. Waltermann, Raimund: Sozialrecht, 2. Aufl., Heidelberg, C. F. Müller Verlag, 2001, S. 5
7
Ambulante Pflegeeinrichtungen werden nach § 71 Absatz 1 SGB XI definiert als:
,,(...) selbständig wirtschaftende Einrichtungen, die unter ständiger Verantwortung
einer ausgebildeten Pflegefachkraft Pflegebedürftige in ihrer Wohnung pflegen und
hauswirtschaftlich versorgen."
5)
Unter diese weite Definition fallen sowohl die Sozialstationen in frei-gemeinnütziger
oder kommunaler Trägerschaft wie auch alle privaten Pflegedienste.
Die Angebote eines ambulanten Pflegedienstes werden hauptsächlich bestimmt
durch vier, nachfolgend beschriebene Faktoren:
6)
a) Faktor Ort:
Der Ort der Dienstleistung ist immer der Ort des Bedarfes, also
die Wohnung des Pflegebedürftigen.
b) Faktor Zeit:
Im Gegensatz zur stationären Pflege ist die Pflegedauer auf be-
stimmte
Tageszeiten
begrenzt
und erfolgt nicht kontinuierlich
über den ganzen Tag und die ganze Nacht.
c) Faktor Inhalt:
Inhalt der Dienstleistungen sind vor allem die Grund- und Be-
handlungspflege nach den Bestimmungen der Kranken- (SGB V)
bzw. der Pflegeversicherung (SGB XI), aber auch die Erbringung
von hauswirtschaftlichen Leistungen (SGB V und SGB XI).
d) Faktor Personal: Erbringung der Dienstleistungen, die sehr stark personenbezo-
gen
sind;
Unterscheidung
nach
Qualifikation: examiniertes Pfle
gepersonal
(Pflegedienstleitung, Krankenpfleger, -schwestern
und
Altenpfleger/innen)
sowie
ungelerntes Hilfspersonal (Pflege-
hilfskräfte
und
Praktikanten);
5)
Sozialgesetzbuch (SGB)-Elftes Buch (XI)-Soziale Pflegeversicherung (Art. 1 des Gesetzes vom
26.05.1994 I 1014), 26.05.1994, BGBl I 1994, 1014, 1015
6)
Vgl. Poser / Schlüter, 2001, S. 86
8
Die Qualifikation ist hinsichtlich der Eingruppierung bei tarifge-
bundenen Pflegediensten und der gesetzlichen Vorschriften
(Pflegedienstleitung als Zulassungsvoraussetzung sowie exami-
niertes Personal für die Erbringung von SGB V Leistungen) von
besonderer Bedeutung
7)
Mit den Faktoren Ort, Zeit, Inhalt und Personal bei der Vergütung von Dienstleistun-
gen verknüpft sich eine technokratische Betrachtungsweise, welche die sich im Zeit-
ablauf wandelnden sozialen Erfordernisse und die ,,personale Subjektstellung" des
Leistungsempfängers außer acht lässt. Somit erscheint eine solche Betrachtungs-
weise als eher problematisch und nicht ausreichend, denn der Mensch ist nicht nur
eine exakt erfassbare ,,Maschine" (und damit Objekt), sondern er ist Subjekt im
Handlungsablauf.
2.2 Leistungen und Leistungsträger der ambulanten Pflegedienste
Das Leistungsspektrum eines ambulanten Pflegedienstes kann in verschiedene Fi-
nanzierungszuständigkeiten aufgeteilt werden:
8)
- Leistungen der Gesetzlichen Krankenversicherung
- Leistungen der Sozialen Pflegeversicherung
- Leistungen der Sozialhilfeträger
- Leistungen der Selbstzahler
Diese vier hauptsächlichen Leistungsträger werden in den nächsten Unterpunkten
näher dargestellt.
7)
Vgl. Gabanyi, Monika: Ambulante Pflegedienste im Spannungsfeld zwischen Wirtschaftlichkeit, Qua-
lität und Kundenorientierung, Augsburg, BASYS Beratungsgesellschaft für angewandte Systemfor-
schung mbH, 1997, S. 29ff
8)
Sießegger, Thomas: Handbuch Betriebswirtschaft: Wirtschaftliches Handeln in ambulanten Pflege-
diensten, Hannover, Vincentz Verlag, 1997, S. 14
9
2.2.1 Gesetzliche Krankenversicherung
Leistungen der Krankenversicherung nach SGB V (Fünftes Sozialgesetzbuch Ge-
setzliche Krankenversicherung) können unterteilt werden in:
- Krankenhausvermeidungspflege nach § 37 Absatz 1 SGB V,
- Behandlungspflege nach § 37 Absatz 2 SGB V sowie
- Haushaltshilfe nach § 38 SGB V.
Für den Großteil dieser Leistungen ist der Einsatz von examiniertem Personal not-
wendig und vorgeschrieben. Aus diesem Grunde gelten für diesen Bereich höhere
Vergütungssätze als für den Leistungsbereich der Pflegeversicherung.
Für Leistungen der Gesetzlichen Krankenversicherung gilt im § 132a SGB V die For-
derung nach wirtschaftlicher und qualitätsgesicherter Erbringung:
,,(1) (...) In den Rahmenempfehlungen sind insbesondere zu regeln:
1. Inhalte der häuslichen Krankenpflege einschließlich deren Abgrenzung,
2. Eignung der Leistungserbringer,
3. Maßnahmen zur Qualitätssicherung,
4. Inhalt und Umfang der Zusammenarbeit des Leistungserbringers mit dem verord-
nenden
Vertragsarzt und dem Krankenhaus,
5. Grundsätze der Wirtschaftlichkeit der Leistungserbringung einschließlich deren
Prüfung
und
6. Grundsätze der Vergütungen und ihrer Strukturen.
(2) (...) Die Krankenkassen haben darauf zu achten, daß die Leistungen wirtschaft-
lich und preisgünstig erbracht werden. (...)"
9)
9)
Sozialgesetzbuch (SGB)-Fünftes Buch (V)-Gesetzliche Krankenversicherung (Art. 1 des Gesetzes
vom 20.12.1988, BGBl. I S. 2477), 20.12.1988, BGBl I 1988, 2477, 2482
10
2.2.2 Soziale Pflegeversicherung
Für die Leistungen der Sozialen Pflegeversicherung werden die Pflegebedürftigen
durch den Medizinischen Dienst der Krankenkassen (MDK) begutachtet. Dabei er-
folgt eine Eingruppierung in die Pflegestufen I, II, III oder Härtefall auf der Grundlage
der Pflegebedürftigkeitsrichtlinien nach SGB XI. Pflegebedürftige haben demnach
einen Leistungsanspruch entsprechend den gesetzlichen Regelungen der §§ 36 und
37 SGB XI. Eine Übersicht über die häuslichen Pflegeleistungen findet sich in Anlage
1. Die Leistungen sind insbesondere die in den jeweiligen Bundesländern definierten
Leistungskomplexe, die in einem ambulanten Leistungskatalog zusammengefasst
sind.
10)
. Der ambulante Leistungskatalog für den Freistaat Sachsen ist als Anlage 2
abgedruckt.
2.2.3 Sozialhilfeträger
Für Pflegebedürftige, die keinen ausreichenden Anspruch auf die Leistungsüber-
nahme durch die Pflegekassen haben und deren Einkommen den Lebensunterhalt
nicht sichern kann, gewährt der Sozialhilfeträger (Landeswohlfahrtsverband bzw.
Kommune) unter im Gesetz bestimmten Voraussetzungen Beihilfen zu den Pflege-
kosten. Zu nennende gesetzliche Vorschriften sind dabei vor allem die §§ 68 bis 69
BSHG
11)
(Bundessozialhilfegesetz), welche Regelungen zur Finanzierung der häusli-
chen Pflege, zum Pflegegeld und zu anderen Aspekten der Leistungsübernahme
enthalten.
10)
Vgl. Sießegger, 1997, S. 15
11)
Vgl. Bundessozialhilfegesetz (BSHG), 30. 06 1961, BGBl I 1961, 815, 1875
11
2.2.4 Selbstzahler
Unter diese Rubrik sind alle Leistungen gefasst, die weder von der Pflegekasse,
noch von der Krankenkasse übernommen werden. Es handelt sich dabei um in An-
spruch genommene Leistungen, die über den Leistungsanspruch an die gesetzliche
Pflegekasse hinausgehen. Dieser Restbetrag muss demzufolge als selbständige Fi-
nanzierung in Form einer Zuzahlung erbracht werden.
Abzugrenzen dazu ist der Begriff des Privatzahlers, der keinen Leistungsanspruch
nach SGB XI besitzt und demzufolge alle in Anspruch genommenen Leistungen pri-
vat finanzieren muss.
12)
Im sich anschließenden 3. Kapitel wird näher untersucht, in welcher Weise sich die
veränderten rechtlichen Rahmenbedingungen auf die ambulanten Pflegedienste
auswirken. Vor allem die Problematik der Festpreise, die Verlagerung von Finanzie-
rungszuständigkeiten und die nicht refinanzierbaren Leistungen stehen im Vorder-
grund der Betrachtungen.
12)
Vgl. Sießegger, 1997, S. 17
12
3 Veränderte rechtliche Rahmenbedingungen und deren Auswirkungen auf die
ambulanten Pflegedienste
Das Pflegeversicherungsgesetz SGB XI soll das Risiko der Pflegebedürftigkeit absi-
chern und regelt gleichzeitig die Finanzierung, die Leistungsausgestaltung und die
Trägerschaft der Pflegekassen. Nach insgesamt 17 Gesetzesentwürfen und einer
vorangegangenen 20jährigen Diskussion wurde es am 22. April 1994 vom Bundes-
tag und am 29. April 1994 vom Bundesrat angenommen. Seit 01. Januar 1995 ist es
in Kraft und enthält neben den Regelungen zur stationären Pflege auch Regelungen
zur häuslichen Pflege. Die dabei geltenden Regelungen der ambulanten Kranken-
pflege nach § 37 SGB V bleiben von diesem neuen Gesetz allerdings weitgehend
unberührt.
13)
Anders als bei der Gesetzlichen Krankenversicherung sind die Bei-
tragshöhe und die Höhe der monatlichen maximalen Leistungen gesetzlich fixiert.
Durch die Einführung des Pflegeversicherungsgesetzes entstanden aus Sicht der
Pflegedienste Vor-, aber auch Nachteile. Vorteile ergaben sich vor allem auf dem
Gebiet der Qualitätssicherung, die nun gesetzlich gefordert wurde. Ferner erhalten
Pflegebedürftige höhere Leistungen als vor Einführung des SGB XI. Mit der gesetzli-
chen Definition der Leistungen ist auch eine stärkere Transparenz der Leistungsan-
bieter verbunden. Das Prinzip der Selbstkostendeckung und die damit verbundenen
finanziellen Unterstützungsmaßnahmen (Betriebskostenzuschüsse) des Bundes, der
Länder und der Kommunen wurden ganz bzw. teilweise eingestellt.
14)
Der bis dahin
starke staatliche Einfluss sank und es entstand ein sich öffnender Pflegemarkt, der
vorher nur von den Diensten der freien Wohlfahrtspflege bestimmt wurde.
Nachteilig aus Sicht der Pflegedienste sind vor allem die in den nachfolgenden Ab-
schnitten beschriebenen Probleme, wie z. B. der zunehmende Konkurrenzdruck, die
Auswirkungen der Qualitätsanforderungen und auch die steigende Bedeutung der
Kundenorientierung.
13)
Vgl. Gabanyi, 1997, S. 3
14)
Vgl. Gabanyi, 1997, S. 12
13
WIORKOWSKI vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend
stellt in diesem Kontext fest:
,,Die Dienste in der Altenhilfe stehen unter Druck: Unter Kostendruck durch niedrige
Verhandlungsabschlüsse einerseits und unter dem Druck ihren Kunden und der
wachsenden Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit gegenüber die Qualität ihrer Dienst-
leistungen nachweisen zu müssen auf der anderen Seite."
15)
Diese Probleme resultieren eben zu einem großen Teil aus der Einführung der Pfle-
geversicherung und den damit einhergehenden Änderungen.
Darüber hinaus wurde erstmals davon gesprochen, dass jeder zugelassene Pflege-
dienst unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten, also unter finanzieller Eigenverantwor-
tung der jeweiligen Träger geführt werden muss.
16)
(Näheres zu dieser Thematik im
Punkt 5.1).
Neben den qualitativen Anforderungen werden also auch wirtschaftliche Anforderun-
gen erhoben, die gemäß § 79 SGB XI überwacht und kontrolliert werden:
,,(1) Die Landesverbände der Pflegekassen können die Wirtschaftlichkeit und Wirk-
samkeit der ambulanten, teilstationären und vollstationären Pflegeleistungen durch
von ihnen bestellte Sachverständige prüfen lassen; (...) Bestehen Anhaltspunkte da-
für, daß eine Pflegeeinrichtung die Anforderungen des § 72 Abs. 3 Satz 1 nicht oder
nicht mehr erfüllt, sind die Landesverbände zur Einleitung einer Wirtschaftlichkeits-
prüfung verpflichtet.
(2) Die Träger der Pflegeinrichtungen sind verpflichtet, dem Sachverständigen auf
Verlangen die für die Wahrnehmung seiner Aufgaben notwendigen Unterlagen vor-
zulegen und Auskünfte zu erteilen.
(3) Das Prüfungsergebnis ist, unabhängig von den sich daraus ergebenden Folge-
rungen für eine Kündigung des Versorgungsvertrags nach § 74, in der nächstmögli-
chen Vergütungsvereinbarung mit Wirkung für die Zukunft zu berücksichtigen."
17)
15)
Wiorkowski, Michael: Entwicklungstendenzen in den Ambulanten Diensten: Qualität und Wirtschaft-
lichkeit aus Sicht des Bundesministeriums, Saarbrücken, iSPO-Institut Saarbrücken, 2001, S. 12
16)
Vgl. Gabanyi, 1997, S. 12
17)
Sozialgesetzbuch (SGB)-Elftes Buch (XI)-Soziale Pflegeversicherung (Art. 1 des Gesetzes vom
26.05.1994 I 1014), 26.05.1994, BGBl I 1994, 1014, 1015
14
Dies stellt Pflegedienste vor allem die bis dahin durch Selbstkostendeckung finan-
zierten vor das Problem der Nachweispflicht über die wirtschaftliche Führung ihres
Dienstes.
Bisher weniger beachtete Gebiete wie die Pflegebuchführungsverordnung (PBV),
Controlling, Ausbau der Finanzbuchhaltung oder kassenspezifische Abrechnungs-
modalitäten gewinnen an Bedeutung und konfrontieren die Pflegedienste zusätzlich
zu ihrem Tagesgeschäft mit neuen betriebswirtschaftlichen Aufgaben.
Nachfolgend sollen einzelne Problemkreise, denen sich ambulante Pflegedienste
verstärkt gegenüber sehen, näher beschrieben werden.
3.1 Problematik der Festpreise
Die genannte Forderung nach Wirtschaftlichkeit wird verschärft und untermauert
durch ein neues Vergütungsmodell in Form des bereits erwähnten Leistungskatalo-
ges. Zugrunde liegt ein System aus Teilleistungen (Leistungskomplexe) mit festge-
legten Verrichtungen und festgelegter Punktzahl (Pfennig pro Punkt). Der mit der
Pflegekasse abrechenbare Betrag ergibt sich aus Multiplikation des Einzelwertes pro
Punkt mit der Gesamtzahl der Punkte je Teilleistung.
18)
Problematisch dabei ist die verschiedene Handhabung in den jeweiligen Bundeslän-
dern. Die Punktwerte basieren auf einer bestimmten Zeitvorgabe, die in jedem Bun-
desland unterschiedlich geregelt ist. Dies hat zur Folge, dass die Leistungskomplexe
hinsichtlich Leistungsinhalt und Punktwert kaum verglichen werden können.
19)
Denn
vor allem die eingangs beschriebenen Faktoren Ort und Personal erfahren bei der
Festlegung der Punktwerte eine unterschiedliche Beachtung. So ist es beispielswei-
se im Freistaat Sachsen nicht von Bedeutung, ob ein Pflegedienst im Ballungsraum
einer Stadt oder auf ländlichem Gebiet mit längeren Wegstrecken tätig ist oder aber
mehr qualitativ gute Fachkräfte beschäftigt als andere Dienste.
18)
Vgl. Gabanyi, 1997, S. 12
19)
Vgl. Sießegger, 1997, S. 15
15
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Originalausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2001
- ISBN (eBook)
- 9783832452629
- ISBN (Paperback)
- 9783838652627
- DOI
- 10.3239/9783832452629
- Dateigröße
- 868 KB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- Berufsakademie Sachsen in Plauen – Wirtschaftswissenschaften
- Erscheinungsdatum
- 2002 (März)
- Note
- 1,3
- Schlagworte
- qualitätssicherung ambulanter pflegedienst pflegeversicherung controlling wirtschaftlichkeit
- Produktsicherheit
- Diplom.de