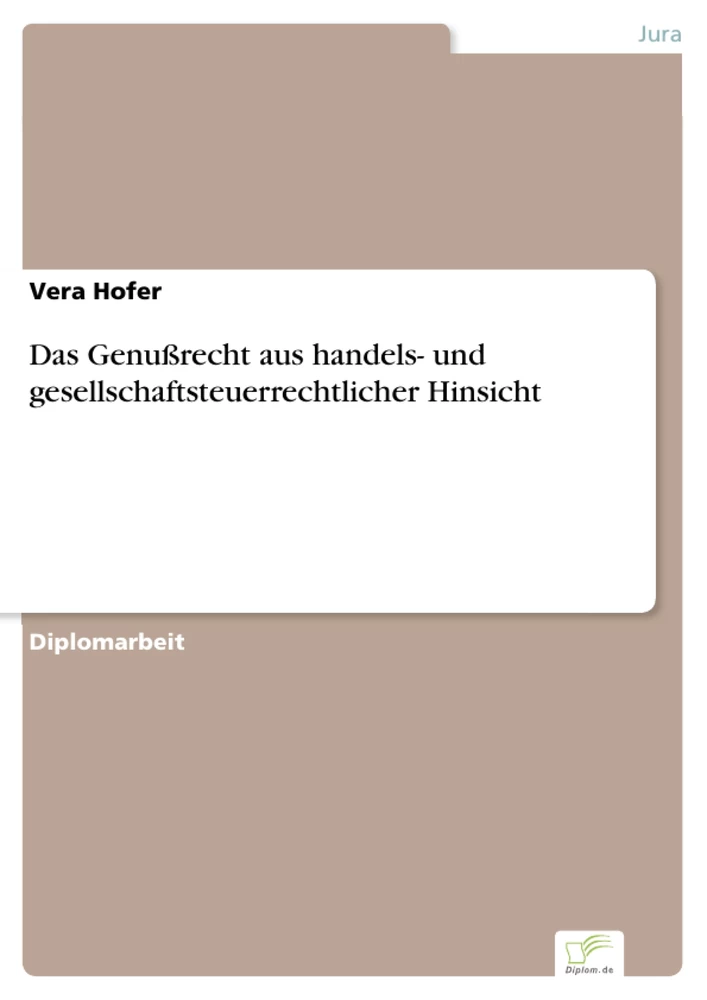Das Genußrecht aus handels- und gesellschaftsteuerrechtlicher Hinsicht
Zusammenfassung
Genussrechte als charakteristischer Inhalt eines Genussrechtsverhältnisses sind typische Vermögensrechte eines Aktionärs, auch wenn sie nicht exakt wie diese ausgestaltet sein müssen. Herrschaftsrechte können in beschränktem Maße eingeräumt werden. Sie werden in einem schuldrechtlichen Vertrag begründet, wobei die Rechtsform des Emittenten nicht über die Zulässigkeit der Ausgabe entscheidet. Als Berechtigte kommen natürliche wie juristische Personen, Gesellschafter oder Dritte in Frage. Genussrechte verschaffen bloß gläubigerrechtliche Stellung, begründen also keine Mitgliedschaft in handelsrechtlicher Sicht.
Die Abgrenzung zu anderen Rechtsverhältnissen, die z.B. für die Beurteilung steuerrechtlicher Fragen entscheidend ist, kann mitunter Probleme bereiten, da die Privatautonomie eine atypische Gestaltung von Rechtsverhältnissen ermöglicht. Genussrechtsverhältnisse spielen eine wichtige Rolle in der Unternehmenssanierung, weil der Verzicht auf Forderungen unter Einräumung von Genussrechten vor einer Überschuldung bewahren kann. Häufig werden sie als Finanzierungsinstrument eingesetzt, weil die vielfältigen Gestaltungsmöglichkeiten eine handelsrechtliche Einstufung als Eigenkapital, aber steuerrechtliche Behandlung als Fremdkapital gestatten. Genussrechte bieten gegenüber einem Darlehen den Vorteil, dass nicht laufend Zinsen anfallen, sondern Zahlungen an Genussrechtsberechtigte nur erfolgen müssen, wenn ein Gewinn anfällt. Wandel- und Gewinnschuldverschreibungen und partiarische Darlehen zählen zu den Genussrechten, die darüber hinaus aber auch andere Ausgestaltungen annehmen können.
Das KVG erwähnt Genussrechte, ohne sie zu definieren. Daher greift der VwGH in seiner Jud auf das Handelsrecht zurück. Genussrechte lösen unabhängig von ihrer handelsrechtlich zulässigen Ausgestaltung Gesellschaftsteuerpflicht aus. IU zum Handelsrecht werden sie jedoch ausdrücklich zu den Gesellschaftsrechten gezählt. Seit 1995 setzt das KVG die Kapitalansammlungs-RL um. Aus der Sicht des Europarechts problematisch ist die Einhebung der Gesellschaftsteuer für die Ausgabe von Genussrechten an Personen, die nicht die Stellung eines Gesellschafters im handelsrechtlichen Sinn innehaben, da nach dem Wortlaut der RL nur Leistungen eines Gesellschafters der Gesellschaftsteuer unterworfen sind. Der VwGH hat dazu ein Vorabentscheidungsverfahren eingeleitet. Auch die Besteuerung von Genussrechten mit Fremdkapitalcharakter ist aus der Sicht der […]
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Der Begriff des Genussrechtes aus handelsrechtlicher Sicht
2.1. Das Genußrechtsverhältnis iSd § 174 AktG
2.1.1. Das Genußrecht
2.1.1.1. Die Gewinnbeteiligung
2.1.1.2. Der Liquidationserlös/-gewinn
2.1.1.3. Benutzungsrechte
2.1.1.4. Umtauschrechte, Bezugsrecht auf Genußrechte oder Aktien
2.1.1.5. Weitere Rechte
2.1.1.6. Herrschaftsrechte
2.1.1.7. Kern- und Nebenrechte
2.1.2. Motive der Einräumung von Genußrechten
2.1.3. Gegenleistung
2.1.4. Abschluß des Genußrechtsvertrages
2.1.4.1. Parteien
2.1.4.2. Die Einräumung der Genußrechte
2.1.4.3. Bezugsrecht
2.1.4.4. Abstraktes oder kausales Rechtsverhältnis
2.1.5. Verbriefung
2.1.6. Individuelle und verbandsrechtliche Genußrechte
2.2. Ausgabeberechtigte
2.3. Einteilung der Genußrechte
2.3.1. Genußrechte im engeren/weiteren Sinn
2.3.2. Das aktiengleiche Genußrecht
2.3.3. Aktienähnlichkeit/Obligationsähnlichkeit
2.3.4. Genußrechte mit Eigen-/Fremdkapitalcharakter/erfolgswirksame Vereinnahmung
2.3.4.1. Eigen-/Fremdkapital
2.3.4.2. Einordnung des Genußrechts
2.3.4.3. Erfolgswirksame Vereinnahmung
2.3.5. Einteilung nach dem Zeitpunkt der Begebung
2.3.6. Genußrechte zur Kapitalbeschaffung/als Kapitalersatz
2.3.7. Der Partizipationsschein
2.3.8. Genußrechte nach dem BFG
2.3.9. Der Besserungsschein
2.4. Die Rechtsnatur von Genußrechten/Genußrechtsverhältnissen
2.4.1. Die Rechtsnatur des Genußrechtes
2.4.1.1. Mitgliedschaftsrecht
2.4.1.2. Zwischenform zwischen Mitgliedschafts- und Gläubigerrecht
2.4.1.3. Gläubigerrecht
2.4.2. Das Genußrechtsverhältnis
2.4.2.1. Wandelschuldverschreibungen
2.4.2.2. Gewinnschuldverschreibung
2.4.2.3. Partiarisches Rechtsverhältnis
2.4.2.4. Stille Gesellschaft
2.4.2.5. Gesellschaft bürgerlichen Rechts
2.4.2.6. Agrargemeinschaften
2.5. Bilanzierung von Genußrechten
2.6. Genußrechte aus der Sicht des Insolvenzrechtes
2.6.1. Konkurs des Genußrechtsberechtigten
2.6.2. Konkurs des Genußrechtsemittenten
3. Der Begriff des Genussrechtes aus der Sicht des öster-reichischen Gesellschaftsteuerrechts
3.1. Allgemeines über die Gesellschaftsteuer
3.2. Europarechtlicher Einfluß
3.3. Genußrechte aus der Sicht der Kapitalansammlungsrichtlinie
3.3.1. Parteien
3.3.2. Gegenstand der Steuer
3.3.3. Wandelschuldverschreibungen
3.3.4. Gewinnschuldverschreibung
3.3.5. Partiarisches Rechtsverhältnis
3.3.6. Stille Gesellschaft
3.4. Das Genußrecht im Sinne des § 5/1/2 KVG
3.4.1. Die Gewinnbeteiligung
3.4.2. Umtausch- und Bezugsrechte
3.4.3. Liquidationserlös, Liquidationsüberschuß
3.5. Eigenkapital/Fremdkapital
3.6. Individuelle/verbandsrechtliche Genußrechte
3.7. Rechtsnatur der Genußrechte
3.7.1. Objektive Seite der Gesellschafsteuer
3.7.2. Subjektive Seite der Gesellschaftsteuer
3.7.3. Rechtsnatur
3.8. Bedeutung der Gesellschafterstellung des Genußrechtsberechtigten
3.9. Abgrenzung zu anderen Rechtsgeschäften
3.9.1. Wandelschuldverschreibung
3.9.2. Gewinnschuldverschreibungen
3.9.3. Partiarisches Rechtsverhältnis
3.9.4. Stille Gesellschaft
3.9.5. Partizipationskapital
3.9.6. Besserungsvereinbarung
3.10. Verhältnis der Genußrechte aus der Sicht des österreichischen KVGs zur Kapitalansammlungs-RL
3.10.1. Gesellschafterstellung des Genußrechtsberechtigten
3.10.2. Kapitalgesellschaften iSd KVG
3.10.3. Zeitpunkt der Begebung
3.10.4. Genußrechte mit Fremdkapitalcharakter
3.10.5. Partiarische Miete/Pacht
Literaturverzeichnis
Entscheidungsverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
1. Einleitung
Genußrechte und Genußscheine sind Instrumente, die seit etwa der Mitte des 19. Jahrhunderts im Wirtschaftsleben zu unterschiedlichen Zwecken (zB Finanzierung, Amortisation, Mitarbeiter-beteiligung) eingesetzt wurden. Dennoch hat der Gesetzgeber es vorgezogen, diese keiner näheren gesetzlichen Ausgestaltung zu unterwerfen. Daß er auf eine Legaldefinition nicht zufällig verzichtete[1], läßt sich aus der Begründung zum Entwurf des deutschen Aktiengesetzes 1937, das Österreich 1945 übernommen hat, ableiten: „ Von einer besonderen Regelung ... der Genußscheine ... sieht der Entwurf ab. Sie sind ihrer Ausgestaltung und ihrem Zweck nach derart mannigfaltig und ihre Entwicklung ist noch so sehr im Fluß, daß eine ins einzelne gehende Regelung auf diesem Gebiet nur hemmend wirken könnte.“ Aus diesem Grund wurde „ auch von einer Begriffsbestimmung von Genußscheinen Abstand genommen ... “ und „ ihre nähere Ausgestaltung einstweilen der Praxis überlassen “.[2] Der Grundsatz der Privatautonomie, der es den Parteien gestattet, ihre Rechtsübeziehungen weitgehend[3] selbst zu gestalten[4], ermöglichte die inhaltliche Anpassung dieses Instrumentes an die jeweiligen Umstände. Dieser Vorteil wird durch die Schwierigkeit der rechtlichen Qualifikation dieses Instrumentes begleitet, die in Fällen von Interesse ist, in denen mangels Regelung durch die Parteien auf dispositives Recht zurückgegriffen werden soll, va in denen Fragen zwingenden Rechtes zur Diskussion stehen[5] und unterschiedliche Rechtsfolgen an ein Instrument anknüpfen. Rechtsunsicherheiten mangels ausdrücklicher gesetzlicher Normierung bewirken auch die Diskussion über die Zulässigkeit bestimmter Ausgestaltungen und fehlende Standardisierung der Genußscheinbedingungen innerhalb der verschiedenen, Genußrechte emit-tierenden Unternehmungen.[6]
Auch wenn Genußrechte, handelsrechtlich betrachtet, unterschiedliche Formen annehmen können und aus verschiedenen Motiven gewährt werden, wäre die Annahme, daß die steuerrechtlichen Folgen unabhängig von ihrer inhaltlichen Ausgestaltung eintreten, verfehlt. Durch geschickte Wahl der Genußrechtsbedingungen kann die handelsrechtliche Einstufung der Genußrechte als Eigen-kapital erreicht werden, ohne daß die steuerrechtliche Berücksichtigung der Bedienung der Genußrechtsberechtigten als Betriebsausgabe beeinträchtigt wird. Ferner ist gerade im Handelsrecht der europarechtliche Rahmen zu beachten. Im Bereich des Gesellschaftsrechts sind bereits mehr als 30 Jahre Harmonisierungsbestrebungen im Gang, um die grenzüberschreitende wirtschaftliche Tätigkeit zu erleichtern und damit den Grundfreiheiten gerecht zu werden. Dazu gehört die Kapital-RL[7], auf die im Kapitel 2.3.2. eingegangen wird.
2. Der Begriff des Genußrechtes aus handelsrechtlicher Sicht
Wie bereits erwähnt, wird das Genußrecht nicht gesetzlich definiert, auch wenn es in verschiedenen Normen Erwähnung findet: § 174 Abs 3 und 4 AktG, § 240 Z 7 HGB, § 78 Abs 1 Z 15 VAG, § 27, Abs 1 Z 1 lit c EStG, § 93 Abs 2 Z 1 lit c EStG, § 8 Abs 3 Z 1 KStG, § 5 Abs 1 Z 2 KVG[8]. Zwar bezeichnet § 5/1/2 KVG die Genußrechte als Gesellschaftsrechte, es handelt sich dabei jedoch nicht um eine gesetzliche Definition, sondern bloß um eine gesetzestechnische Einordnung für das KVG[9]. Trotz Erwähnung im Aktiengesetz läßt sich der Rechtscharakter der Genußrechte nicht bloß anhand dieser Vorschrift erschließen. Der Gestaltungsspielraum wird auch durch andere gesellschafts-rechtliche Normen, allgemeines Zivilrecht und auch öffentlich-rechtliche Bestimmungen über das Aufsichtsrecht (BWG, VAG) abgegrenzt.[10]
In der Literatur wird der Begriff der Genußrechte häufig sowohl für das gesamte Rechtsverhältnis, als auch für die einzelne Berechtigung verwendet. Selbst der Gesetzgeber differenziert nicht und meint in § 8/3/1 KStG oder § 174/3 AktG das gesamte Rechtsverhältnis, in § 78/1/15 VAG hingegen die einzelne Berechtigung[11]. Oettmeier folgend, wird hier von Genußrecht gesprochen, wenn die einzelne Berechtigung, der Genuß, betrachtet wird, während der Begriff Genußrechtsverhältnis den gesamten Genußrechtsvertrag bedeuten soll. Der Genußschein bezeichnet die urkundlich verbriefte Form eines Genußrechtsverhältnisses[12].
2.1. Das Genußrechtsverhältnis iSd § 174 AktG
Aus handelsrechtlicher Sicht gibt es verschiedene Arten von Genußrechtsverhältnissen: jene gem § 174 AktG, solche iSd VAG oder BWG oder Genußrechte nach dem BFG. Auf den Begriff des Genußrechtes nach dem BFG, VAG und BWG soll zwar in dieser Arbeit nicht näher eingegangen werden, eine kurze Beschreibung erfolgt der Vollständigkeit halber später.[13]
Genußrechte werden im AktG, nicht aber im GmbHG genannt. Auch im Recht der Personengesellschaften findet es keine Erwähnung. Daher soll im folgenden die maßgebliche Bestimmung im AktG betrachtet werden. Anschließend wird die Zulässigkeit der Vergabe von Genußrechten durch andere Gesellschaften untersucht.
2.1.1. Das Genußrecht
Welche Genußrechte es gibt, wird gesetzlich nicht festgelegt. Daher empfiehlt es sich, eher ein weites Verständnis von Genußrechten zu entwickeln, wodurch vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten offenstehen[14].
Nach der hA wollte der Gesetzgeber keine neuen Rechte schaffen, als er den Begriff des Genußrechtes in § 174 AktG aufnahm, sondern soll sich auf die in der Praxis vorkommenden Rechte bezogen haben[15]. Ganz anders die Situation in der Schweiz: Im Schweizer Obligationenrecht (Art 657 Abs 4), wo der Genußschein die weiteste Regelung erfahren hat, wird iU zum österreichischen und deutschen Recht der Inhalt von Genußrechten definiert.[16]
Am 33. Deutschen Juristentag 1925 wurde der Genußschein als die verbriefte Form der Genußrechte beschrieben, was von der Literatur übernommen wurde[17]. Da der Genußschein also eine Urkunde mit Wertpapiercharakter ist, die Genußrechte (= Gen-sse) verbrieft[18], muß geklärt werden, welche Rechte als Genußrechte in Frage kommen. Unter Genußrechten versteht man Rechte, die ihrem Inhalt nach typische Vermögensrechte eines Gesellschafters sind, auch wenn sie nicht exakt wie das jeweilige Recht des Gesellschafters gestaltet sind.[19] Jene Rechte, die von der Mitgliedschaft nicht getrennt werden können, können jedenfalls nicht Gegenstand eines Genußrechtsvertrages sein[20]. Dazu gehören gesellschaftliche Herrschaftsrechte.[21] (Auch im Schweizer Obligationenrecht wird ausdrücklich erklärt, daß Herrschaftsrechte nicht als Gen-sse eingeräumt werden können.)
Zu den Vermögensrechten eines Aktionärs, die Gegenstand eines Genußrechtsvertrages sein können, zählen va die Beteiligung am Gewinn, am Liquidationserlös im Falle der Auflösung der AG, aber auch andere Vermögensrechte, wie zB Benutzungsrechte oder Umtauschrechte.[22] Auch das Bezugsrecht auf Aktien oder neue Genußrechte, das sowohl Elemente der Vermögensrechte als auch solche der Herrschaftsrechte enthält und daher auch als gemischtes Recht bezeichnet wird, kann Inhalt eines Genußrechtsvertrages sein. Diese Rechte stehen den Aktionären schon aufgrund ihrer Mitgliedschaft zu[23], während das Genußrecht nach hL nur schuldrechtlicher Natur ist[24]. Daneben gewährt die Mitgliedschaft den Aktionären Mitverwaltungsrechte (= Herrschaftsrechte), zu denen die Teilnahme in der Hauptversammlung, das Stimmrecht, Recht zur Erhebung einer Anfechtungs- und Nichtigkeitsklage oder das Antragsrecht gehören. Diese können nach überwiegender Meinung nicht Gegenstand des Genußrechtsvertrages sein (siehe später).
In einem Genußrechtsvertrag können einzelne dieser Rechte oder mehrere kumulativ oder alternativ gewährt werden.[25] Trotz der vielfältigen Kombinationsmöglichkeiten, die nach dem Handelsrecht offenstehen, sollten jedoch die mit der unterschiedlichen Ausgestaltung verbundenen steuerrecht-lichen Konsequenzen nicht übersehen werden. Den Standardfall eines Genußrechtes stellt wegen des Einsatzes dieses Instrumentes zur Kapitalbeschaffung die Gewinnbeteiligung dar.[26]
2.1.1.1. Die Gewinnbeteiligung
Wegen fehlender gesetzlicher Regelung wird es bei der Frage nach der Rechtsposition, die dem Genußrechtsberechtigten gewährt wird, in besonderem Maße auf die vertragliche Regelung ankommen.[27] Insbesondere muß der zur Berechnung des Anspruchs des Genußrechtsberechtigten maßgebliche Gewinnbegriff bestimmt werden. Dieser kann Bemessungsgrundlage und/oder Bezugs-größe sein: Nach der Bemessungsgrundlage berechnet sich die Höhe des Gewinnanspruchs des Genußrechtsberechtigten. Die Bezugsgröße gibt an, woraus dieser Anteil gezahlt werden soll. Diese beiden Größen können, m-ssen aber nicht zusammenfallen.[28]
Als Bemessungsgrundlage bzw. Bezugsgröße sind denkbar:
- Der Jahresüberschuß als das Ergebnis der Gewinn- und Verlustrechnung (§ 231/1 HGB): Insofern ist der Genußrechtsberechtigte gegenüber dem Aktionär begünstigt, als er von der R-cklagen-bildung als Gewinnverwendungsmaßnahme nicht betroffen ist. Die Berechnung des Jahresüber-schusses wird va in den Vorschriften §§ 198 ff HGB und §§ 125 ff AktG geregelt. Er scheint in der GuV auf.
- Der Bilanzgewinn, der sich aus dem Jahresüberschuß unter der Berücksichtigung der Bildung/Auflösung von R-cklagen ergibt (§ 231/2/28 HGB): Hier wird der Genußrechtsüberechtigte dem Aktionär ähnlicher, jedoch hängt sein Anspruch nun je nachdem , ob diese Größe Bemessungsgrundlage oder Bezugsgröße ist, in bestimmter Weise vom Gewinnverwendungsübeschluß (§ 126/1 AktG) ab.
- Der Aussch-ttungsgewinn: In dieser Größe sind bereits Gewinn-/Verlustvortrag und gesetzliche R-cklagen berücksichtigt.[29] Genußrechtsberechtigte und Gesellschafter sind „gleichgestellt“, der Genußrechtsberechtigte nimmt an den R-cklagen teil und sein Anspruch ist vom Gewinn-verwendungsbeschluß abhängig.[30] Wird er nicht am Liquidationserlös und damit an den R-ck-lagen beteiligt, wird er gegenüber dem Aktionär benachteiligt.[31]
- Es können auch andere Rechengrößen als Bezugsgröße bzw. Bemessungsgrundlage zur Ermittlung der Gewinnansprüche des Genußrechtsberechtigten vorgesehen sein.[32] Denkbar wäre zB der cash-flow in einer seiner Varianten[33] oder Bilanzkennziffern[34].
- Unzulässig wäre es, ein einziges Geschäft oder die Nichtrealisierung einer R-ckstellung als Bezugsgröße ohne Teilhabe an den Ergebnissen der sonstigen vorgenommenen Unternehmens-geschäfte zu wählen. Hier kann mangels Ähnlichkeit zum Vermögensrecht des Aktionärs, der am Ergebnis aller Geschäfte, nicht aber bloß an einem einzigen beteiligt ist, kein Genußrecht vorliegen.[35] Nach § 52 AktG haben Aktionäre nur einen Anspruch auf den Bilanzgewinn, sodaß Zahlungen aus einem einzelnen Geschäft sogar dem Verbot der Einlagenrückgewähr entgegenstehen.[36] Hingegen wäre es zulässig, die Auflösung von R-cklagen als Bezugsgröße zu wählen, da es sich dabei um Gewinne vergangener Jahre handelt.[37]
- Soll der Nennwert der Genußrechte oder ein Gesellschaftsanteil Bemessungsgrundlage sein, ergibt sich eine feste Verzinsung, sofern man nicht einen variablen Anteilssatz wählt (siehe sogleich).
Zur Berechnung der Höhe des Anspruches benötigt man den rechnerischen Beteiligungsschlüssel. Auch hier finden sich verschiedene Gestaltungsmöglichkeiten: Meist wird das Verhältnis des Genußkapitals zum Stammkapital/Grundkapital oder zum gesamten Gesellschaftsvermögen (variabler Anteil) oder ein von vornherein bestimmter Prozentsatz gewählt. Wegen fehlender Mitverwaltungsrechte wird letzterer häufig ein wenig erhöht. Denkbar wäre die Ankn-pfung an die Höhe der Dividende, wodurch ein variabler Gewinnanteilssatz entsteht, jedoch ein Gewinnver-wendungsbeschluß vorliegen muß (§ 126/1 AktG).[38] Diesen Nachteil kann man durch Festlegung einer bestimmten Quote in der Satzung für den Fall, daß keine Dividende ausgezahlt werden soll, umgehen.[39] Auch die Gesamtkapitalrendite, das Verhältnis des Betriebsgewinnes zum arithmetischen Mittel des Gesellschaftsvermögens am Beginn und am Ende des Geschäftsjahres, können als Anteilssatz gewählt werden.[40] Die Wahl des Anteilssatzes wird nicht zuletzt von der Wahl der Bemessungsgrundlage abhängen.
Der Gewinnanteil ergibt sich idR durch Anwenden des Anteilssatzes auf die Bemessungsgrundlage und anschließendem Bezug auf den Nennwert.
Untersucht man nun die vielen Gestaltungs- und Kombinationsmöglichkeiten, stellt sich die Frage, unter welchen Voraussetzungen man von einem Gewinnanteil sprechen kann und wann bereits Zins vorliegt. Die Bedeutung dieser Abgrenzung liegt in § 174 AktG verborgen. Für gewöhnliche Schuldverschreibungen gilt § 174 AktG nicht.[41] [42] Aber auch für die Entscheidung, ob das Genußkapital als Eigenkapital oder Fremdkapital aufzufassen ist, muß diese Frage näher erörtert werden.[43]
Entscheidend für den Charakter eines Gewinnanteils ist die Abhängigkeit vom Gesellschafter-risiko.[44] Der Anspruch darf nicht wie bei einer Obligation nach Maßstäben zu bestimmen sein, die von der Sphäre des Schuldners unabhängig sind.[45] Der Anspruch des Darlehensgebers ist rechtlich nicht vom unternehmerischen Erfolg des Darlehensnehmers abhängig, er steht von vornherein fest, egal, ob Gewinne erzielt werden und wie hoch diese sind. Für den Gewinnbeteiligten entscheidet der Erfolg unternehmerischen Wirkens über die Höhe seines Anspruches. Dies darf jedoch nicht mit der Konstruktion verwechselt werden, wo ein Genußrecht idF einer Gewinnbeteiligung gewährt wird, um eine Forderung, auf die ein Gläubiger verzichtet hat, abzulösen. In diesem Fall ist der Anspruch des Berechtigten von vornherein nach oben begrenzt. Leistungen aus dem Gewinn werden zur Amortisation des Genußrechtes erbracht. Mitunter kann der Gewinnanteil als Teiltilgung vereinbart sein. Diese Form der Genußrechte steht der echten Gewinnbeteiligung gegenüber, weil ihr Anspruch von vornherein quantitativ limitiert ist.[46]
Unter Zins versteht man ein gewinnunabhängiges Entgelt für die Überlassung von Kapital.[47] Sobald die Aussch-ttung des Gewinnanteils variabel gestaltet ist, liegt ein Genußrecht auf Gewinn-beteiligung vor. Es gen-gt also, eine feste Quote auf den Gewinn zu beziehen. Soll diese aber auf den Nennwert als Bemessungsgrundlage angewendet werden, und der so berechnete Betrag unab-hängig von der Entstehung eines Gewinnes/Verlustes ausgeschüttet werden, kann jedenfalls nicht vom Genußrecht der Gewinnbeteiligung gesprochen werden. Es liegt eine feste Verzinsung vor.[48] [49]
Wie reagiert die Literatur auf die Zulässigkeit einer festen Verzinsung in Genußrechtsverträgen ?
Nach Oettmeier steht die Gewährung einer festen Verzinsung (zB Mindestverzinsung) einer Gewinnbeteiligung nicht entgegen, falls diese vom Vorliegen eines Gewinnes abhängig gemacht wird.
Auch für Sethe[50] kann das Genußrecht der Gewinnbeteiligung eine feste Verzinsung vorsehen, die jedoch nur dann zur Auszahlung kommen darf, wenn ein Gewinn erwirtschaftet wird. Solche Genußrechte bezeichnet er als „obligationsähnlich“, iU zu „aktienähnlich“, bei denen die Höhe des Gewinnanspruches unmittelbar aus dem Gewinn abgeleitet wird oder eine feste Mindestverzinsung mit zusätzlich gewinnabhängiger Aussch-ttung vorgesehen ist. Aktienähnliche Genußrechte sind daher doppelt gewinnabhängig.[51]
Busch[52] vertritt ebenso diese Meinung. Er richtet sich damit gegen die Unterscheidung in Gewinnorientierung, bei der die Aussch-ttung auf das Genußkapital unmittelbar vom Jahresüber-schuß bzw. Bilanzgewinn abhängt, und Gewinnabhängigkeit, bei der ein fester Satz vom Kapital udV der Gewinnerzielung zu entrichten ist, die zB von Gehling[53] vertreten wurde, der für den zweiten Fall die Anwendbarkeit des § 221 dAktG (= § 174 öAktG) verneinte.[54]
Auch für Frantzen[55] können Genußrechte auf Gewinnbeteiligung eine feste Verzinsung vorsehen, die jedoch nur im Fall einer Gewinnerzielung zur Auszahlung kommen darf.
Demgegenüber meint Lutter[56], daß ein Genußrecht, das eine feste Verzinsung in Abhängigkeit einer Gewinnerzielung gegenüber einer Obligation, die gewinnunabhängig eine Verzinsung bietet, ein „Minus“ aufweist. In einem Größenschluß leitet er somit ab, daß bei der Gewährung von Rechten dieser Art ein Bezugsrecht iSd § 221 dAktG (= § 174 öAktG) Aktionären nicht zustehen kann und diese daher von § 221 dAktG nicht erfaßt sein sollen. Eine solche Konstruktion stelle daher nicht ein Genußrecht, sondern eine Obligation dar.[57]
Nach -A kann das Genußrecht eine feste Mindestverzinsung aufweisen.[58] Häufig soll den Genuß-rechtsberechtigten damit eine Mindestrendite eingeräumt werden.[59]
Die Bedienung der Genußrechtberechtigten kann in unterschiedlicher Reihenfolge vorgesehen sein: prioritätisch, posterioritätisch oder gleichrangig mit den Aktionären.[60]
- Beim prioritätischen Genußrecht erfolgt die Aussch-ttung auf das Genußkapital vor der Bedienung der Aktionäre. Es verwundert daher nicht, daß solche Genußrechte idR nach oben limitiert sind oder eine feste Verzinsung gewährt wird. Solche Genußrechte haben meist Darlehenscharakter.[61] Mit der Bevorzugung wird ihr Ausschluß von den stillen Reserven verhindert.[62]
- Beim posterioritätisch gestalteten Genußrecht geht der Gewinnanspruch der Genußrechtsüberechtigten dem der Aktionäre nach. Die Gestaltung eines Rangverhältnisses dient häufig zur Berücksichtigung der Gegenleistung des Berechtigten: Wird eine Geldeinlage erbracht, so wird eine prioritätische Gestaltung sinnvoller sein, denn Geld läßt sich nach allen Seiten hin verwenden. Bei Erbringung einer Sachleistung wird hingegen eher eine posterioritätische Ausgestaltung angebracht sein, weil nicht nur die Verwendungsmöglichkeiten eingeschränkt, sondern auch die Gewinnchancen unsicherer sind.[63] Gründerleistungen oder Patente und Konzessionen, deren wirtschaftlicher Wert für die Unternehmung schwer abschätzbar sind, werden idR mit posterioritätischen Genußrechten abgegolten.[64]
- Gleichrangige Bedienung findet sich häufig bei der Abspleißung vom Aktienrecht, dh, Genußrechte werden gewährt, um unverhältnismäßig hohe Gewinne zu verschleiern[65], die durch steigende Aktienkurse zu verminderter Verkehrsfähigkeit führen können.
2.1.1.2. Der Liquidationserlös/-gewinn
Die Beteiligung am Liquidationserlös/-gewinn hat in handels- bzw gesellschaftsrechtlicher Sicht eine andere Bedeutung als im Steuerrecht (§ 8/3 KStG).[66] So wird ertragsteuerrechtlich nicht verlangt, daß die Abschichtung erst anläßlich der Liquidation der begebenden Kapitalgesellschaft erfolgt. Bei einer Abschichtung vor Liquidation kommt es auf eine Beteiligung am fiktiven Liquidationsgewinn an.[67] Handelsrechtlich drückt sich darin die Beteiligung an der Gesellschafts-substanz, also den stillen Reserven und R-cklagen, aus, die der Nennwert der Aktie nicht widerspiegelt.[68] Dies jedoch nur für den Fall der Auflösung. Da der Aktionär Einlagen nicht zurückfordern kann (§ 52 AktG), bleibt ihm nur die Veräußerung der Aktie, um die Vermögens-substanz lukrieren zu können. Der Kurswert orientiert sich idR am inneren Wert der Aktie. Ähnlich können auch Genußrechtsberechtigte für den Fall einer Auflösung am inneren Wert der Gesellschaft beteiligt werden. Andernfalls steht auch ihnen die Veräußerung ihrer Berechtigung zu.[69]
Zu unterscheiden sind ferner die Begriffe Liquidationserlös und Liquidationsgewinn, was in der Literatur[70] häufig übersehen wird. Der Liquidationserlös ist das nach „Versilberung“ des Gesellschaftsvermögens und Abzug aller Verbindlichkeiten den Gesellschaftern zur Verteilung Verbleibende, während der Liquidationsüberschuß die Differenz zwischen Abwicklungsend-Ver-mögen und Abwicklungsanfangs-Vermögen[71], also Liquidationserlös minus Grundkapital und Ein-lagen darstellt[72].
Die Einräumung des Rechtes auf Beteiligung am Liquidationserlös/-gewinn ist als Genußrecht zulässig und ersetzt häufig den Kapitalrückzahlungsanspruch am Ende der Laufzeit für die Über-lassung von Kapital.[73] Dieses Genußrecht kann zB neben dem Genußrecht auf Gewinnbeteiligung aber auch separat gewährt werden[74], was bisher jedoch nicht häufig vorgekommen ist[75].
Die umstrittene Frage, ob eine Gewinnbeteiligung nicht automatisch auch eine Beteiligung am Liquidationsgewinn vorsieht, die mit der Begründung bejaht wurde, daß der Liquidationsüberschuß zurückbehaltener Gewinn sei, der erst mit Liquidation zur Aussch-ttung gelange, hat aus der Sicht der Genußscheinpraxis ihre Bedeutung verloren[76]. Va wegen § 8/3 KStG, der eine Beteiligung sowohl am Gewinn als auch Liquidations gewinn vorsieht, um der Aussch-ttung auf Genußscheine den Charakter einer Betriebsausgabe zu versagen, wird heute zwischen diesen Genußrechten streng differenziert. Meist verzichtet man daher auf die Einräumung des Genußrechtes auf einen Anteil am Liquidationsgewinn.[77]
Dies steht aber aus handelsrechtlicher Sicht dem Eigenkapitalcharakter nicht entgegen, weil dafür im wesentlichen maßgeblich ist, ob das hingegebene Kapital das Risiko mitträgt, also bei negativem wirtschaftlichen Verlauf des Unternehmens das Kapital verloren geht, ohne daß dem Kapitalgeber die Stellung eines Insolvenzgläubigers zukommt.[78] [79] Die Steuerrechtliche Einstufung muß jedoch nicht mit der handelsrechtlichen übereinstimmen, weil zB auch die Vereinbarung, daß das Genuß-kapital nicht zurückgezahlt wird, zur handelsrechtlichen Einstufung als Eigenkapital führt, mangels Beteiligung am Liquidationsgewinn die Bedienung des Genußkapitals als Betriebsausgabe iSd § 8/3 KStG gilt.[80]
Nach Oettmeier kann von einem Genußrecht auf Beteiligung am Liquidationsgewinn/-erlös nur gesprochen werden, wenn folgende drei Merkmale erf-llt sind[81]:
a) Kapitalverweildauer bis zum Ende der Unternehmensperiode
b) Nachrangigkeit
c) Beteiligung an der gesamten Unternehmenssubstanz
Damit soll der Anspruch des Genußrechtsberechtigten auf Befriedigung aus dem Liquidationserlös von der Forderung eines Kreditgläubigers, die mit Liquidation fällig werden soll, den Liquidationserlös mindert und vor dem Genußrecht befriedigt wird, abgegrenzt werden. Aus einem R-ckzahlungsversprechen für den Fall der Liquidation kann nicht auf das eine oder andere Vertragsverhältnis geschlossen werden, weil auch der Genußrechtsberechtigte nur Gläubiger gegenüber der Gesellschaft ist (siehe später).[82]
Ad a) Das Genußrecht der Beteiligung am Liquidationserlös kann nicht vorliegen, wenn ein R-ckzahlungsanspruch nach Auslosung, Ablauf einer festen Laufzeit, Ausspruch einer K-ndigung vereinbart wird. Soll das Genußrecht ein typisches Vermögensrecht, wie es auch einem Aktionär zusteht, sein, muß das Kapital ebenso für die ganze Unternehmensdauer gebunden sein.
Ad b) Erfolgen Auszahlungen an Genußrechtsberechtigte gleichrangig mit anderen Gläubigern der Gesellschaft, kann das Genußrecht der Beteiligung am Liquidationserlös nicht vorliegen, da das Genußkapital zur Tilgung von Fremdschulden zur Verfügung stehen muß.
Ad c) Zur Unterscheidung von einem langfristigen, nachrangigen Kedit muß sich beim Genußrecht außerdem der R-ckzahlungsanspruch auf die stillen Reserven, die Unternehmenssubstanz, beziehen. Dies wird bereits erreicht, wenn auch nur ein Teil der R-ckzahlungssumme davon abhängt. Wie für Gesellschafter (vgl zB § 212/2 AktG, wonach die Verteilung des Liquidationserlöses nach dem Anteil am Grundkapital erfolgt) muß auch für Genußrechtsberechtigte dieser Anteil variabel sein. Zulässig wäre die Festlegung eines bestimmten Betrages als Höchstwert, sodaß die Auszahlung bei niedrigerem Liquidationserlös entsprechend vermindert wird.[83] Ein fester Betrag, unabhängig vom Wert des Vermögens (zB R-ckzahlung des Nennbetrages unabhängig von der Entstehung eines Liquidationserlöses) widerspricht den Wesensmerkmalen des Genußrechtes auf Beteiligung am Liquidationserlös. Wird den Berechtigten ein fester Betrag für den Fall der Liquidation versprochen, der nach der Befriedigung der -brigen Gläubiger zur Auszahlung kommen soll (Nachrangabrede), liegt keine Beteiligung am Liquidationserlös vor, sofern diese Zusage von der Erzielung eines Liquidationserlös unabhängig ist.[84] Nur bei Liquidation nachrangig rückzahlbares Genußkapital kann hingegen nicht als nachrangige Verbindlichkeit betrachtet werden, wenn die R-ckzahlung des Nennbetrages bei Liquidation aus dem Liquidationserlös erfolgen soll, weil Verbindlichkeiten gewöhnlich vor Liquidation fällig werden, während die nachrangige R-ckzahlung des Kapitals nur bei Liquidation erfolgt.[85]
Ist jemand am Liquidationsüberschuß beteiligt, dann automatisch auch am Liquidationserlös (siehe Definition dieser Begriffe). Die Umkehrung muß nicht immer gegeben sein[86], da die R-ckzahlung der Einlage den Liquidationsgewinn schon begrifflich nicht berührt.[87]
Zusammenfassend gilt daher, daß bei der Wahl der Bemessungsgrundlage, der Bezugsgröße und des Anteilssatzes auf eine variable Beteiligung zu achten ist.
Die Ausgestaltung dieses Genußrechtes kann wegen der Vertragsfreiheit sehr unterschiedlich erfolgen. Sowohl eine prioritätische als auch eine posterioritätische oder gleichrangige Bedienung der Genußrechte im Verhältnis zu Aktien ist möglich. Zu beachten ist jedoch, daß auch diese Genußrechte vom Inhalt ein typisches Vermögensrecht eines Aktionärs darstellen, sodaß zwingende Gläubigerschutzbestimmungen einzuhalten sind. Dazu gehört zB § 213/1 AktG, der eine einjährige Sperrfrist ab der dritten Veröffentlichung des Aufrufs der Gläubiger vorschreibt.[88]
2.1.1.3. Benutzungsrechte
Zur Gruppe der Genußrechte gehören auch Ansprüche auf Benutzung von unternehmenseigenen Einrichtungen (Eisenbahnen, Fabriksanlagen, Sozialeinrichtungen, Theater, Sportanlagen uä)[89]. Auch wenn solche Genußrechte heute selten geworden sind - im Rahmen der Kapitalbeschaffung im Massenverkehr wären sie auch schwer vorstellbar[90] - zählen sie zu den „Kernrechten“[91].
2.1.1.4. Umtauschrechte, Bezugsrecht auf Genußrechte oder Aktien
Da ein solches Recht Aktionären aufgrund § 174/4 AktG und § 153 AktG zusteht, bildet das Bezugsrecht auf Genußrechte bzw Aktien ein typisches Vermögensrecht eines Aktionärs und daher ein Genußrecht.
- Bezugsrecht auf Aktien
Das Bezugsrecht gem § 153 AktG dient der Aufrechterhaltung der vermögenswerten Beteiligung (jährliche Dividende) genauso wie des Anteils an Herrschaftsrechten (Stimmrecht, Minderheits-rechte) im Falle einer ordentlichen Kapitalerhöhung (§ 149 AktG) oder einer Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital (§ 169/2 AktG). Einen dadurch erlittenen Nachteil können die Aktionäre auch durch Veräußerung des Bezugsrechtes kompensieren.[92]
Da bei einer nominellen Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln (R-cklagen, § 2/1 KapBG) die Anteile den Aktionären zwingend anwachsen, ist ein Bezugsrecht in diesem Fall ausgeschlossen. Bei einer bedingten Kapitalerhöhung (§ 159 AktG), die nur zum Zwecke der Gewährung von Bezugs- und Umtauschrechten an Gläubiger von Wandelschuldverschreibungen oder zur Vorbereitung des Zusammenschlusses mehrerer Unternehmungen beschlossen werden darf, ist ein Bezugsrecht eben-falls ausgeschlossen.[93] Das Bezugsrecht ist daher eines der wichtigsten Aktionärsrechte zum Schutz ihrer verbandsrechtlichen Position und kann zwar nicht in der Satzung, aber mittels Hauptver-sammlungsbeschluß mit einer Mehrheit von drei Viertel (§ 153/3 AktG) ausgeschlossen werden, falls dies sachlich gerechtfertigt ist.[94] Da in die verbandsrechtliche Stellung des Aktionärs ein-gegriffen wird, muß der Ausschluß als Eingriff in diese Schutzbestimmung durch überwiegende Interessen der Gesellschaft gerechtfertigt sein.[95]
Für die Beschaffung von Aktien, auf die den Genußrechtsberechtigten ein Bezugsrecht eingeräumt wurde, stehen zwei mögliche Wege offen: ordentliche oder bedingte Kapitalerhöhung.[96] Die ordent-liche Kapitalerhöhung zur Schaffung neuer Aktien scheidet idR wegen der Unsicherheit ihrer Durchführung aus.[97] Zu beachten ist aber der Vorrang des mitgliedschaftlichen Bezugsrechts gegen-über dem schuldrechtlichen nach § 154/1 AktG. Sinn des § 154 öAktG (= § 187 dAktG) ist der Schutz des gesetzlichen Bezugsrechtes der Aktionäre vor der Aushöhlung durch rechtsgeschäftliche Aktienerwerbsrechte. Folglich verhindert er die Entstehung von Schadensersatzansprüchen gegen die AG, die aus der notwendigen Verletzung der einen von zwei gleichgerichteten, sich gegenseitig ausschließenden Verpflichtungen erwachsen.[98] Nur einer der beiden inhaltlich übereinstimmenden Verträge kann erf-llt werden (§ 154/1 AktG). Vor einer Kapitalerhöhung kann ein Bezugsrecht als Genußrecht nur unter der Bedingung einer Kapitalerhöhung und vorbehaltlich der Priorität des mitgliedschaftlichen Bezugsrechtes eingeräumt werden, widrigenfalls die Vereinbarung nichtig ist.[99] Nach einem g-ltigen, ordentlichen Kapitalerhöhungsbeschluß kann das Genußrecht nur für den Fall der Nichtausübung des Bezugsrechtes durch den Aktionär gestattet werden, es sei denn im Kapitalerhöhungsbeschluß wurde dieses ausgeschlossen. Nach dem Beschluß über eine bedingte Kapitalerhöhung steht den Aktionären kein Bezugsrecht auf neue Aktien zu, da die bedingte Kapital-erhöhung zu bestimmten Zwecken vorgesehen ist (siehe oben[100] )[101], sodaß § 154 AktG nicht zur Anwendung kommt.[102] Hier stellt sich sofort die Frage, ob eine bedingte Kapitalerhöhung zur Ausgabe von Aktien an Genußrechtsberechtigte überhaupt zulässig ist, wo doch § 159/2 öAktG (= § 192/2 dAktG) die möglichen Zwecke für diese Form der Kapitalerhöhung nennt. Da aber der im Gesetz vorgesehen Zweck, nämlich va die Kapitalbeschaffung, auch durch die Ausgabe von Genuß-rechten statt Wandelschuldverschreibungen verfolgt wird, wird die Zulässigkeit bejaht. § 159/2 AktG wird als Sollbestimmung betrachtet.[103]
- Bezugsrecht auf Genußrechte
Das Bezugsrecht auf Genußrechte kann folgend gestaltet sein[104]:
- als Bezugsrecht auf neue, auszugebende Genußrechte
- als Bezugsrecht auf weitere, bereits ausgegebene Genußrechte
- als Bezugsrecht auf Wandel- und Gewinnschuldverschreibungen
Anders als bei der Ausgabe junger Aktien schmälert die Ausgabe von Genußrechten nicht die mitgliedschafliche Stellung der Aktionäre, jedoch ihre vermögensrechtliche, da den Genußrechts-inhabern typische Vermögensrechte eines Aktionärs eingeräumt werden.[105]
Zwar verweist § 174/4 AktG nur auf § 153 AktG, nicht aber auf § 154 AktG, dennoch findet auch diese Bestimmungen Anwendung, weil sie wie im Falle der Kapitalerhöhung die Umgehung der mitgliedschaftlichen Rechte verhindern soll.[106] Das Recht auf den Bezug neuer Genußrechte kann also nur vorbehaltlich des Bezugsrechtes der Aktionäre eingeräumt werden, weil auch hier der mitgliedschaftliche und schuldrechtliche Anspruch konkurrieren.[107]
Dies gilt jedenfalls für die Einräumung des Bezugsrechtes auf Wandelschuldverschreibungen, weil diese gerade durch das Bezugs- bzw Umtauschrecht auf Aktien gekennzeichnet sind (siehe oben).[108] Nach Oettmeier und ihm folgend Bürger kommt für die anderen Genußrechte § 154 AktG nicht zur Anwendung, weil § 154 AktG den Substanzwert der Mitgliedschaft und die Herrschaftsverhältnisse sch-tzen will.[109]
Schilling[110] und Schiemer/Jabornegg/Strasser[111] differenzieren nicht. Ebenso können nach Lutter[112] Bezugsrechte auf Genußrechte nur unter Vorbehalt des aktionärsrechtlichen Bezugsrechtes einge-räumt werden.
Umtauschrechte
Unter Umtauschrechten versteht man das Recht, das Genußrecht in einen Gesellschaftsanteil umzutauschen. Mit der Ausübung des Umtauschrechtes geht der Anspruch unter, der Genußrechtsberechtigte erhält einen Verschaffungsanspruch.[113] Der Umtausch erfolgt durch Ausgabe neuer Aktien im Rahmen einer Kapitalerhöhung, idR einer bedingten, auch wenn in § 159/2 AktG das Umtauschrecht als Zweck einer bedingten Kapitalerhöhung nicht genannt wird. Wie erwähnt, ist aber diese Vorschrift eine Sollensvorschrift, die Aufzählung also nicht taxativ. Ein gesetzliches Bezugsrecht der Aktionäre scheidet hier aus (siehe oben).[114]
2.1.1.5. Weitere Rechte
IU zum Schweizer Recht (Art 657/4 OR), das als Genußrechte nur eine Gewinnbeteiligung und einen Anteil am Liquidationserlös zuläßt, können nach österreichischer und deutscher Rechtslage alle typischen Vermögensrechte eines Aktionärs Gegenstand eines Genußrechtsvertrages sein.[115] Diese Feststellung hat primär historischen Hintergrund und zeigt die Entwicklung des Genußrechtes aus dem Aktionärsrecht. Daneben können auch atypische Rechte als Genußrechte vereinbart werden, wie zB die Darlegungen über die Zulässigkeit der festen Verzinsung gezeigt hat.[116]
- Wertzuwachsverg-tung: Zu den atypischen Rechten gehört die Wertzuwachsverg-tung[117], weil der Aktionär durch seine Mitgliedschaft automatisch am Gesellschaftsvermögen beteiligt ist. Sie stellt einen Ausgleich für die fehlende Beteiligung des Genußrechtsberechtigten an den R-cklagen und am Liquidationserlös dar und gilt daher als eine Form der Substanzbeteiligung.[118] Frantzen führt als Beispiel einer Wertzuwachsverg-tung den Genußschein der Triumph Inter-national AG an, bei dem diese Vergütung alle fünf Jahre ausgeschüttet wird. Sie orientiert sich am Bilanzwert des Genußscheines. Der Bilanzwert verringert sich, wenn nach Auflösung der R-cklagen noch ein Bilanzverlust verbleibt.[119] Da Wertzuwachsverg-tungen sehr selten vorkom-men, sollen sie hier nicht näher behandelt werden.
- Weitere Genußrechte sind der Anspruch auf den Bezug von Waren, Lieferungen und/oder Dienstleistungen des emittierenden Unternehmens, die aber eine untergeordnete Rolle spielen.[120]
2.1.1.6. Herrschaftsrechte
Herrschaftsrechte[121] setzen sich aus Mitverwaltungsrechten (Stimmrecht § 114/1 AktG, Recht auf Einberufung der Gesellschafterversammlung § 106/2 AktG, Anhörungs- und Teilnahmerechte § 102 AktG, Rederecht[122], besondere Zustimmungsrechte zu bestimmten Gesellschaftsangelegenheiten §§ 147, 221 AktG und bei Selbstorganschaft[123] Recht auf ein Geschäftsführungsamt) und Informations- und Kontrollrechten (Auskunftsrecht § 112 AktG, Einsichtsrechte §§ 125/5, 126/2, 127/2 AktG, Recht auf Anfechtung von Hauptversammlungsbeschlüssen §§ 125 ff AktG und Sondermitteilungen § 109 AktG) zusammen.[124] Diese Rechte ermöglichen den Eingriff in das Innenverhältnis[125], da sie einen Einfluß auf die Verwaltung und Geschäftsführung ermöglichen. Sie ergeben sich aus der Mitgliedschaft.[126]
Die Frage nach der Zulässigkeit der Einräumung von Herrschaftsrechten wird sich idR nicht stellen, weil in Genußrechtsverhältnissen solche nicht gewährt werden. Hintergedanke ist die Kapitaler-weiterung ohne Veränderung der bisherigen Herrschaftsverhältnisse, es sei denn, Aktionäre verlieren ihre bisherige Mitgliedschaft[127] und sollen dennoch in der Gesellschaft eine ihrer bisherigen Stellung vergleichbare Position behalten.[128] Bedeutung erlangt die Frage nach der Zulässigkeit der Ein-räumung von Herrschaftsrechten im Zusammenhang mit Schutzmaßnahmen zugunsten der Genußrechtsinhaber. Maßnahmen und Entscheidungen der Gesellschaft bzw der Gesellschafter können zwar das Genußrecht nicht einseitig aufheben oder abändern[129], aber ihren wirtschaftlichen Wert erheblich beeinträchtigen[130]. Gläubiger werden daher immer an einem Einblick in Vorgänge beim Unternehmen interessiert sein. Insbesondere gilt dies für Banken als Kapitalgeber.[131]
Schwieriger zu beantworten als die Frage, ob Mitverwaltungsrechte zuerkannt werden können, ist jene, ob Mitverwaltungsrechte zuerkannt werden m-ssen.[132] Dem Gesetz ist eine derartige Ver-pflichtung nicht zu entnehmen.[133]
Während einige Autoren die Unzulässigkeit der Vereinbarung von Kontrollrechten in Genußrechtsüverträgen unterstreichen[134], differenzieren andere Autoren:
Der Genußrechtsberechtigte hat kein Recht, in das Innenverhältnis der AG einzugreifen[135], dh, ihm fehlen Stimmrecht, Anfechtungsrecht, Recht auf Teilnahme in der Hauptversammlung oder ein Widerspruchsrecht gegen die Ausgabe weiterer Genußscheine, Wandel- oder Gewinnschuld-verschreibungen oder eine Kapitalerhöhung, Kapitalherabsetzung, Verschmelzung, Umwandlung oder Auflösung.[136] Einzelne Herrschaftsrechte können ihm aber schuldrechtlich[137] eingeräumt werden, weil sie als atypischer Inhalt eines Genußrechtsvertrages nicht automatisch aus einem g-ltigen Genußrechtsverhältnis resultieren. Nach W-nsch können einzelne Herrschaftsrechte zum Zwecke der Wahrnehmung von Vermögensrechten durch Spezialgesetze vorgesehen sein, sofern eine unmittelbare Einflußnahme auf die AG unmöglich ist.[138] So kann ein Teilnahmerecht in der Hauptversammlung gewährt werden, nicht aber ein Stimmrecht. Im folgenden sollen die verschiedenen Mitverwaltungsrechte betrachtet werden:
- Stimmrecht: Das Stimmrecht ermöglicht die Teilnahme an der kollektiven Willensbildung.[139] Wegen der Verbandssouveränität kann es jedenfalls nicht eingeräumt werden.[140] Verbandsüsouveränität heißt, daß das Schicksal der Gesellschaft nicht in die Hände Dritter gelegt werden darf, die nicht die gleichen Interessen verfolgen wie die Gesellschafter selbst und deren Rechtsüausübung daher nicht ausreichend beschränkt und kontrolliert werden kann.[141] Da das Stimmrecht zu innergesellschaftlicher Willensbildung legitimiert[142], unterliegt die Willensbildung anderen-falls einer Fremdbestimmung. Aus dem Prinzip der Fremdorganschaft bei Kapitalgesellschaften folgt, daß sich die Interessen der Mitglieder nicht unbedingt mit denen der Gesellschaft decken, sodaß die Ausübung des Stimmrechtes durch die Mitglieder nicht immer ein sicheres Gegenügewicht zugunsten von Gesellschaftsinteressen gegenüber dem Stimmverhalten außenstehender Dritter gewährleistet.[143] In einer Entscheidung[144] hat der BGH dargelegt, daß ein Stimmrecht nicht eingeräumt werden kann. Anders ist es bei Personengesellschaften, wo das Prinzip der Selbstorganschaft herrscht. Hier wird die beschränkte Gewährung von Stimmrechten für zulässig erachtet.[145]
- Teilnahme an der Gesellschafterversammlung: Den Genußrechtsberechtigten kann ein Anwesenheitsrecht eingeräumt werden. Sie nehmen damit die Stellung von Beobachten ein.[146]
- Beratungsrecht: Die Gesellschaft darf aufgrund der Privatautonomie auf schuldrechtlicher Ebene ein Beratungsverhältnis vorsehen.[147] Da mit dem Genußrechtsverhältnis eine dauerhafte vertragliche Bindung geschaffen wird, kann dem Genußrecht unzulässige[148], aber beachtliche Einmischungsmöglichkeit in die inneren Angelegenheiten der Gesellschaft zukommen, auch wenn der Genußrechtsberechtigte keine Entscheidungsbefugnis hat.[149] Sie dürfen daher nur in beschränktem Umfang eingeräumt werden. Wird es im nachhinein von Fall zu Fall gewährt, ist dies zulässig.[150]
- Recht auf Einberufung der Gesellschafterversammlung: Die Einräumung dieses Rechtes ist wegen des untrennbaren Zusammenhangs mit der mitgliedschaftlichen Stellung abzulehnen.[151]
- Anfechtungsrecht: Genußrechtsberechtigte, die Risikokapital zur Verfügung stellen, sind weit-gehend interessen- und verantwortungsgemäß mit der Gesellschaft verbunden, sodaß Vollmer die Einräumung eines Anfechtungsrechtes entgegen der hM als gerechtfertig ansieht.[152] Kritisch dazu Rid-Niebler, weil das Anfechtungsrecht eine unmittelbare Gestaltung der Rechtslage bewirkt. Eingriffe in die organschaftliche Willensäußerung können nur auf der Grundlage einer organschaftlichen Kompetenz und nicht auf schuldvertraglicher Basis erfolgen, sodaß die Ein-räumung eines Anfechtungsrechtes unzulässig sei.[153] In einer richtungsweisenden Entscheidung vom 5.10.1992 zum Fall Klöckner[154] hält der BGH die Einräumung von Anfechtungsrechten für „bedenklich“. Genußrechtsinhaber seien haftungsmäßig Aktionären nur beschränkt gleichgestellt, was die Gefahr aufwirft, daß dieses Instrument „ nicht zur Wahrung berechtigter eigener Belange und zur Kontrolle des Handelns der gesellschaftlichen Organe, sondern in erhöhtem Maße funktionswidrigen Eigeninteressen dienstbar gemacht wird “.
- Auskunfts- und Einsichtsrechte: Sie dienen Gesellschaftern zur Überwachung der Geschäftsführung. Damit ist noch keine Einmischung in die innere Organisation verbunden, sodaß Genußrechtsberechtigten diese Rechte zugestanden werden können, sofern ein Informationsbedürfnis solche Rechte legitimiert.[155] Problematisch kann die Gewährung von Einsichtsrechten sein, wenn Genußrechte massenweise eingeräumt werden.[156]
Auch wenn der Genußrechtsinhaber kein Anfechtungsrecht hat, kann er sich mit dem Schadenersatz-recht zur Wehr setzen. Dies gilt insbesondere für treu- und sittenwidrige Verk-rzung ihrer Ansprüche.[157] Der Reichsgerichtshof setzte das „absichtliche“ Handeln zum Nachteil des Genuß-rechtsberechtigten zur Geltendmachung der Haftung voraus.[158] Der BGH kn-pft eine Schadenersatzpflicht an die Schutz- und Sorgfaltspflichten als Nebenpflichten des Genuß-rechtsvertrages und folgt hier Habersack.[159]
2.1.1.7. Kern- und Nebenrechte
Manchmal findet sich in der Literatur die Unterscheidung in Kern- und Nebenrechte, die für die Beurteilung, ob ein Genußrecht vorliegt, maßgeblich sein soll. Danach kann eine Vereinbarung, die ein typisches Nebenrecht iS dieser Unterteilung beinhaltet, bei Fehlens eines Kernrechtes nicht als Genußrechtsvertrag eingestuft werden. Zu den Kernrechten zählen[160]: Anspruch auf Gewinn-beteiligung, Beteiligung am Liquidationserlös und/oder –überschuß, Wandlungsrecht, Benutzungs-recht. Nebenrechte sind zB eine Fixzinsvereinbarung, Pflichten der Genußrechtsberechtigten oder Laufzeitregelungen.
2.1.2. Motive der Einräumung von Genußrechten
Da die Beweggr-nde der Ausgabe von Genußrechten für die konkrete Ausgestaltung der Genußrechte und damit für die rechtliche Qualifikation Bedeutung erlangt haben, soll ein Überblick darüber gegeben werden.[161]
a) Kapitalrückzahlung, bei der Genußrechte an die Stelle von Aktien treten: Dies ist der älteste Entstehungsgrund und hängt mit der Beschränkung der Konzession für Eisenbahngesellschaften auf 90 Jahre zusammen. Nach Ablauf dieser Frist fiel die Anlage unentgeltlich an den Staat, sodaß die AG die Einlagen nicht an die Aktionäre zurückzahlen konnte. Deshalb wurden sie während der Dauer der Konzession „amortisiert“[162] und auf die amortisierten Aktien der Einlagebetrag zurückgezahlt. Den betroffenen Aktionären wurden aber gleichzeitig Genußscheine ausgehändigt, um sie am Gewinn und eventuell am Liquidationserlös zu beteiligen, denn der ausgeloste Aktionär mußte seine Aktien auch abliefern, wenn sie über pari standen, wodurch er anderenfalls einen Verlust erlitten hätte.
[...]
[1] Bürger Albrecht, Genußrechte als Mittel zur Verbesserung der Eigenkapitalausstattung von Unternehmungen, insbesondere von Kreditinstituten (1987) 14
[2] veröffentlicht durch Reichsjustizministerium Berlin 1930, 124; vgl Bürger, Genußrechte 14; W-nsch Horst, Der Genußschein iSd § 174 AktG als Instrument der Verbriefung privatrechtlicher Ansprüche in FS Strasser, Möglichkeiten und Grenzen der Rechtsordnung 1983 871 (872); Oettmeier Michael, Ausgestaltung von Genußrechten und Genußscheinen (1989) 18; Schilling Wolfgang, Aktiengesetz Großkommentar3 III (1973) § 221 Anm 11
[3] dh., in den Grenzen der Rechtsordnung die durch § 879 ABGB und zwingendes Recht abgesteckt werden. W-nsch, Der Genußschein, 871; Jusits Stephan, Genußscheine im österreichischen Zivilrecht, WBl 1987, 81 (82); Braumann Winfried, Gewinnscheine und Anlegerschutz, ÖBA 1984, 397 (398)
[4] Koziol Helmut/Welser Rudolf, Grundriß des bürgerlichen Rechts10 I (1995) 37
[5] Krejci Heinz/van Husen Rainer, Über Genußrechte, Gesellschafterähnlichkeit, stille Gesellschaft und partiarisches Darlehen, GesRZ 2000, 54 (54)
[6] Sethe Rolf, Rechtliche Rahmenbedingungen und Anlegerschutz (I), Die AG 1993, 293 (297)
[7] RL 77/91/EWG, Abl 31. 1. 1977, 1
[8] Schummer Gerhard, Genußrechtsemission durch Personenhandelsgesellschaften ?, GesRZ 1991, 198 (199); Oettmeier Michael, Genußrechte 22; Gassner Wolfgang, Die steuerliche Behandlung der Kapitalaufbringung durch Ausgabe von Genußrechten iSd § 174 AktG, in Wirtschaftsrecht in Theorie und Praxis, Gedenkschrift für Fritz Schönherr (1986) 403 (403 f)
[9] Oettmeier, Genußrechte 23
[10] Van Husen Rainer, Genußrechte, Genußscheine, Partizipationskapital (1998) 84, 124
[11] Oettmeier, Genußrechte 12
[12] Oettmeier vergleicht diese Trias mit einem Darlehen: Der einzelne Darlehensanspruch entspricht dem Genußrecht, das Darlehen(sverhältnis) dem Genußrecht(sverhältnis). Das Gegenst-ck des Genußscheins stellt die Obligation dar.
[13] Zum Genußrechtsbegriffs iSd Beteiligungsfondgesetzes vgl. zB Jusits, Genußscheine, 82 ff; Jud Waldemar, Gr-nwald Alfons, Aktuelle Fragen zum Beteiligungsgeschäft, GesRZ 1990, 72
[14] Krejci/van Husen, Genußrechte, 54
[15] W-nsch, Der Genußschein, 877; Ernst Tassilo, Der Genußschein als Kapitalbeschaffungsmittel, Die AG 1967, 75 (77)
[16] Art 657 OR: Die Generalversammlung kann nach Maßgabe der Statuten oder auf dem Weg der Statutenänderung die Schaffung von Genußscheinen zugunsten solcher Personen beschließen, die mit dem Unternehmen durch frühere Kapitalbeteiligung, Aktienbesitz, Gläubigeranspruch oder ähnliche Gründe verbunden sind. Zugunsten der Gründer der Gesellschaft dürfen Genußscheine nur aufgrund der urspr-nglichen Statuten geschaffen werden. Durch die Genußscheine können dem Berechtigten keine Mitgliedschaftsrechte, sondern nur Ansprüche auf einen Anteil am Reingewinn oder am Liquidationsergebnis oder auf den Bezug neuer Aktien verliehen werden. ... ; Bürger, Genußrechte 16
[17] Vgl Oettmeier, Genußrechte 23, insbesondere Fn 59 und 60
[18] Oettmeier, Genußrechte 19; Schilling, Großkommentar3 III § 221 Anm 14; Jusits, Genußscheine, 81; Schiemer Karl/Jabornegg Peter/Strasser Rudolf, Kommentar zum Aktiengesetz3 (1993) §174 Rz 9; W-nsch, Der Genußschein, 886; Rid-Niebler Eva, Genußrechte als Instrument zur Eigenkapitalbeschaffung über den organisierten Kapitalmarkt für die GmbH (1989) 8; Bürger, Genußrechte 67; Claussen Carsten, Der Genußschein und seine Einsatzmöglichkeiten, in FS für Winfied Werner (1984), 81 (81)
[19] Schilling, Großkommentar3 III § 221 Anm 11; Rid-Niebler, Genußrechte 4; W-nsch, Der Genußschein, 879
[20] Oettmeier, Genußrechte 24; Bürger, Genußrechte 36
[21] Zur Zulässigkeit der Vereinbarung von Herrschaftsrechten siehe Kapitel 2.1.1.6.
[22] Schiemer/Jabornegg/Strasser, AktG3 § 174 Rz 8
[23] Kastner Walter/Doralt Peter/Nowotny Christian, Grundriß des österreichischen Gesellschftsrechts5 (1990) 194
[24] zB Schiemer/Jabornegg/Strasser, AktG3 § 174 Rz 8; Klang Heinrich/Gschnitzer Franz, Kommentar zum ABGB2 V (1952) § 1175 (546); Kalss Susanne/Wessely Karin, Die Rechte des Aktionärs (1994) 55
[25] Rid-Niebler, Genußrechte 3
[26] Oettmeier, Genußrechte 46; Rid-Niebler, Genußrechte 36; Bürger, Genußrechte 37
[27] Rid-Niebler, Genußrechte 36; Frantzen Christopher, Genußscheine (1993) 100; Frotz Stephan, Rechtsfragen der Kapitalbeschaffung gegen schuldrechtliche Gewinnbeteiligung, in Wirtschaftsrecht in Theorie und Praxis, Gedenkschrift für Fritz Schönherr (1986) 167 (178 f)
[28] Frantzen, Genußscheine 100 f
[29] van Husen, Genußrechte 153
[30] Rid-Niebler, Genußrechte 38 f
[31] Busch Torsten, Aktienrechtliche Probleme der Begebung von Genußrechten zwecks Eigenkapitalverbreiterung, Die AG 1994, 93 (96)
[32] vgl dazu Frantzen, Genußscheine 104 f und 107 ff
[33] Schummer, Genußrechtsemission, 200; Krejci/van Husen, Genußrechte, 55
[34] van Husen, Genußrechte 153
[35] Oettmeier, Genußrechte 48
[36] Oettmeier, Genußrechte 248; Göhrum Angelika, Einsatzmöglichkeiten von Genußrechten bei einer notleidenden GmbH oder AG (1992) 17
[37] Oettmeier, Genußrechte 249
[38] Frantzen, Genußscheine 108 f; Bürger, Genußrechte 43; Rid-Niebler, Genußrechte 39 f
[39] Bürger, Genußrechte 43
[40] Frantzen, Genußscheine 109 f; Bürger, Genußrechte 43 (mit Beispielen);
[41] Lutter Markus, Genußrechtsfragen - Besprechung der Entscheidungen BGH ZIP 1992, 1542 (Klöckner) und BGH ZIP 1992, 1728 (Bremer Bankverein), ZGR 1993, 291 (304)
[42] Rechtsfolgen des § 174 AktG: Hauptversammlungsbeschluß, Bezugsrechte; ohne Beschluß der HV: Haftung!
[43] Claussen, Genußschein, 93
[44] Schummer, Genußrechtsemission, 200
[45] Krejci/van Husen, Genußrechte, 55
[46] W-nsch, Der Genußschein, 877
[47] Oettmeier, Genußrechte 50; Busch, Begebung von Genußrechten, 95
[48] Oettmeier, Genußrechte 51; Frantzen, Genußscheine 113; Busch, Begebung von Genußrechten, 95; Sethe Rolf, Die Berichtserfordernisse beim Bezugsrechtsausschluß und ihre mögliche Heilung, Die AG 1994, 342 (345)
[49] Werden neben der festen gewinnunabhängigen Verzinsung zB noch andere Gen-sse gewährt (zB R-ckzahlung zum Nennbetrag nach Befriedigung der Gläubiger aus dem Liquidationserlös (= Beteiligung am Liquidationserlös iS einer Nachrangabrede) - vgl Bürger, Genußrechte 115) - kann durchaus ein Genußrechtsverhältnis vorliegen, das „obligationsähnlich“ gestaltet ist (Bürger, Genußrechte 41, 118; Claussen, Genußschein, 88; Vollmer Lothar, Der Genußschein - ein Instrument für mittelständische Unternehmungen zur Eigenkapitalbeschaffung an der Börse, ZGR 1983, 445 (452)), es geht aber der Eigenkapitalcharakter verloren, das Genußkapital kann aber als besonders Haftungskapital betrachtet werden. Sieht der Vertrag jedoch nur eine feste Verzinsung im Zusammenhang mit einer planmäßigen Tilgung vor, ist eine Obligation gegeben. (Zur Unterscheidung zwischen Obligation und Genußrechten und Genußrechten mit Eigen- bzw Fremdkapitalcharakter siehe später. Vorweggenommen sei hier, daß es auf das Überwiegen der Merkmale ankommt.)
[50] Sethe, Berichtserfordernisse, Die AG 1994, 344 f
[51] Zu den Begriffen „aktienähnlich“, „aktiengleich“ und „obligationsähnlich“ siehe später.
[52] Busch, Genußrechtsbegebung, 95 f
[53] Gehling Christian, „Obligationsähnliche Genußrechte“: Genußrechte oder Obligation ?, WM 1992, 1093 f
[54] Vgl auch van Husen, Genußrechte 151 f mwN
[55] Frantzen, Genußscheine 102 f, 113
[56] Lutter, Genußrechtsfragen, 302 ff
[57] Seine Darstellung steht im Zusammenhang mit dem Urteil des BGH im Fall Bremer Bankverein 9. 11. 1992 II ZR 230/91 ZIP 1992, 1728 = WM 1992, 2098 = DB 1993, 31 = NJW 1993, 400
[58] W-nsch, Der Genußschein, 877; Bürger, Genußrechte 42; Oettmeier, Genußrechte 55; Vollmer, Genußschein, 452; Claussen, Genußschein, 88; Busch, Genußrechtsbegebung, 95 f; anders Lutter, Genußrechtsfagen, 304
[59] Bürger, Genußrechte 42; Frantzen, Genußscheine 112
[60] stellvertretend W-nsch, Der Genußschein, 877 f
[61] W-nsch, Der Genußschein, 877; Schmalenbach Eugen, Die Aktiengesellschaft7 (1950) 76
[62] W-nsch, Der Genußschein, 877; Bürger, Genußrechte 38 f
[63] Schmalenbach, Aktiengesellschaft 75
[64] Bürger, Genußrechte 39
[65] stellvertretend W-nsch, Der Genußschein, 878
[66] Frantzen, Genußscheine 131; Kirchmayr Sabine, Die steuerrechtliche Behandlung von Genußrechten an Kapitalgesellschaften, in Nowotny Christian/Mayer Leopold/Hassler Paul, Rechnungslegung, Prüfung, Beratung FS aus Anlaß des 50-Jahr-Jubiläums der KPMG Alpen-Treuhand (1996) 125 (132);
[67] siehe auch SWK 1991, Heft 14, A1 175
[68] van Husen, Genußrechte 140
[69] van Husen, Genußrechte 139
[70] vgl zB W-nsch, Der Genußschein, 878
[71] Kirchmayr, Behandlung von Genußrechten, 132
[72] Frantzen, Genußscheine 131
[73] Oettmeier, Genußrechte 38
[74] Schummer, Genußrechtsemission, 200; Krejci/van Husen, Genußrechte, 55; Ernst, Genußschein, 77
[75] Frantzen, Genußscheine 60 f mit Beispielen
[76] Frantzen, Genußscheine 135; Bürger, Genußrechte 46 f
[77] zB Frantzen, Genußscheine 135; Bürger, Genußrechte 44; Oettmeier, Genußrechte 38
[78] Schummer, Genußrechtsemission 201
[79] Näheres zum Eigenkapitalcharakter und den maßgeblichen Merkmalen siehe später.
[80] Sontheimer J-rgen, Steuerliche Behandlung von Genußrechten, Der Betriebsberater 1984, Beilage 19/1984 zu Heft 30/1984, 1
[81] Oettmeier, Genußrechte 39 ff
[82] Oettmeier, Genußrechte 39 f
[83] zB Frantzen, Genußscheine 132
[84] Frantzen, Genußscheine 133; Rid-Niebler, Genußrechte 26
[85] Rid-Niebler, Genußrechte 26
[86] Frantzen, Genußscheine 133
[87] Zur möglichen Ausgestaltung siehe zB Frantzen, Genußscheine 132 f; Rid-Niebler, Genußrechte 40 ff
[88] Bürger, Genußrechte 47 f
[89] Frantzen, Genußscheine 160; W-nsch, Der Genußschein, 878; Oettmeier, Genußrechte 32
[90] Oettmeier, Genußrechte 32
[91] Frantzen, Genußscheine 3 f
[92] Sethe, Berichtserfordernisse, 346; Busch, Begebung von Genußrechten, Die AG 1994, 98
[93] Kalss/Wessely, Aktionärsrechte 22, 36
[94] Kastner/Doralt/Nowotny, Gesellschaftsrecht 306 f; Kalss/Wessely, Aktionärsrechte 37 f; Schiemer/Jabornegg/Strasser, AktG § 153 Rz 10
[95] W-nsch, Der Genußschein, 885 f; Schiemer/Jabornegg/Stasser, AktG § 153 Rz 10
[96] Auf die Probleme der Vorratsaktien (§ 51/3 AktG) und eigener Aktien (§§ 65 ff AktG) soll hier nicht eingegangen werden. Unberücksichtigt bleibt auch das genehmigte Kapital, für das im wesentlichen die gleichen Prinzipien gelten wie im Falle der ordentlichen Kapitalerhöhung.
[97] Oettmeier, Genußrechte 34
[98] Fuchs Andreas, Selbständige Optionsscheine als Finanzierungsinstument der Aktiengesellschaft, Die AG 1995, 433 (443)
[99] Schiemer/Jabornegg/Strasser, AktG § 154 Rz 3; Bürger, Genußrechte 49; Fuchs, Optionsscheine, 442 f, Frantzen, Genußscheine 264 ff
[100] auch Bürger, Genußrechte 50, 52; Fuchs, Optionsscheine, 443
[101] Nicht verwechselt werden darf diese Bestimmung mit § 174/4 AktG, wonach den Aktionären ein Bezugsrecht für Genußrechte bei deren Ausgabe zusteht. Dies wird bei der Begründung von Genußrechtsverhältnissen noch eine Rolle spielen. Hier geht es aber um das Verhältnis des Anspruches des Genußrechtsberechtigten und des Aktionärs, wenn es zu einer (bedingten) Kapitalerhöhung kommt bzw gekommen ist. Es liegt also bereits ein g-ltig zustande gekommener Genußrechtsvertrag vor, dessen Inhalt – unabhängig vom Inhaber des Forderungsrechtes (Gesellschafter, Dritter)– so gestaltet sein soll, daß kein Schadensersatzanspruch entsteht .
[102] Der Schutz der Aktionäre ist in diesem Fall früher anzusetzen, nämlich bei der Gewährung des Genußrechtes (§ 174/4 AktG). Der Bezugsrechtsausschluß ist nur unter denselben Voraussetzungen wie in § 153 AktG möglich. Vgl W-nsch, Der Genußschein, 885; Fuchs, Optionsscheine, 444
[103] Oettmeier, Genußrechte 34
[104] Oettmeier, Genußrechte 37
[105] Sethe, Berichtserfordernisse, 346
[106] Schiemer/Jabornegg/Stasser, AktG § 174 Rz 11; W-nsch, Der Genußschein, 885
[107] W-nsch, Der Genußschein, 885; Frantzen, Genußscheine 272 f
[108] Oettmeier, Genußrechte 37
[109] Bürger, Genußrechte 50; Oettmeier, Genußrechte 119 37 Fn 126; Schilling, Großkommentar § 221 Anm 11
[110] Schilling, Großkommentar § 221 Anm 19
[111] Schiemer/Jabornegg/Stasser, AktG § 174 Rz 11
[112] Lutter, Genußrechtsfragen, 305 Fn 41
[113] Oettmeier, Genußrechte 33, 76
[114] Bürger, Genußrechte 52
[115] Vgl Bürger, Genußrechte 52 f
[116] Vgl § 52 AktG Verbot der Einlagenrückgewähr
[117] Oettmeier, Genußrechte 57
[118] Frantzen, Genußrechte 120
[119] Frantzen, Genußscheine 120
[120] Frantzen, Genußscheine 165
[121] auch (Mit-)Verwaltungsrechte, Teilhaberechte oder Organschaftsrechte bezeichnet
[122] ergibt sich aus dem Recht auf Teilnahme an der Hauptversammlung, ohne gesetzlich geregelt zu sein. Es ist vom Auskunftsrecht zu unterscheiden und dient der Darlegung der eigenen Meinung. (Kalss/Wessely, Aktionärsrechte 8)
[123] Personengesellschaften
[124] Oettmeier, Genußrechte 131 f; Kalss/Wessely, Aktionärsrechte 7 ff
[125] Bürger, Genußrechte 55
[126] Oettmeier, Genußrechte 132
[127] Krejci/van Husen, Genußrechte, 57
[128] wie dies bei der Auslosung der Aktien im Fall der Amortisation von Aktien der Eisenbahn AGs, deren Konzessionen auf 90 Jahre beschränkt war, vorkam: W-nsch, Der Genußschein, 872 f; Bürger, Genußrechte 7, der erwähnt, daß die Genußscheininhaber mitunter auch ein Stimmrecht eingeräumt erhielten (Genußaktien), siehe auch Fn 17
[129] W-nsch, Der Genußschein, 880; Vollmer, Genußschein, 461; BGH 5. 10. 1992, ZIP 1992, 1542 (1545); Schilling, Großkommentar3 III § 221 Rz 12
[130] Vollmer, Genußschein, 461;
[131] Oettmeier, Genußrechte 132; Schummer, Genußrechtsemission, 37
[132] Vollmer, Genußschein, 464; Frotz, Kapitalbeschaffung, 179: Er sieht es als ein Gebot der Fairness, Anlegern Kontrollrechte vertraglich einzuräumen. Vgl BGH 5. 10. 1992, ZIP 1992, 1545
[133] Schummer, Genußrechtsemission, 37
[134] Klang Heinrich/Gschnitzer Franz, Kommentar zum Allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuch2 (1952) V 546
[135] Schummer, Genußrechtsemission, 37; W-nsch, Der Genußschein, 879 f, Oettmeier, Genußrechte 62; Bürger, Genußrechte 55 f
[136] W-nsch, Der Genußschein, 880
[137] Rid-Niebler, Genußrechte 50; Vollmer, Genußschein, 462; Krejci/van Husen, Genußrechte, 57; Ernst, Genußschein, 80
[138] W-nsch, Der Genußschein, 880; Vollmer, Genußschein, 463
[139] Oettmeier, Genußrechte 133
[140] Rid-Niebler, Genußrechte 51; Vollmer, Genußschein, 462 mwN; Pougin Erwin, Genußrechte in Festschrift für Walter Oppenhoff (1985) 275 (276); Lutter, Genußrechtsfragen, 494; Ernst, Genußschein, 80
[141] Oettmeier, Genußrechte 135
[142] Oettmeier, Genußrechte 134
[143] Oettmeier, Genußrechte 136
[144] BGH 5. 10. 1992, ZIP 1992, 1542 (1542, 1545)
[145] Oettmeier, Genußrechte 135 mwN (zur näheren Ausgestaltung eines solchen siehe auch 136 ff)
[146] Rid-Niebler, Genußrechte 51; Oettmeier, Genußrechte 140; Kalss/Wessely, Aktionärsrechte 56; BGH 5. 10. 1992; ZIP 1992, 1546; Lutter, Genußrechtsfragen, 295
[147] Kalss/Wessely, Aktionärsrechte 56
[148] W-nsch, Der Genußschein, 879 f
[149] Rid-Niebler, Genußrechte 52; Oettmeier, Genußrechte 138
[150] Oettmeier, Genußrechte 138; Pougin, Genußrechte, 277; Ernst, Genußschein, 80
[151] Rid-Niebler, Genußrechte 52
[152] Vollmer, Genußschein, 463
[153] Rid-Niebler, Genußrechte 56; Oettmeier, Genußrechte 145
[154] BGH 5. 10. 1992, II ZR 172/91, ZIP 1992, 1545
[155] Oettmeier, Genußrechte 141; Pougin, Genußrechte, 270; Kalss/Wessely, Aktionärsrechte 56; BGH 5. 10. 1992, ZIP, 1992 1546; Lutter, Genußschein, 295
[156] Frotz, Kapitalbeschaffung, 179
[157] W-nsch, Der Genußschein 881; Vollmer, Genußschein, 467; Oettmeier, Genußrechte 145
[158] Habersack Mathias, Genußrechte und sorgfaltswidrige Geschäftsführung, ZHR 155 (1991), 378 (391); BGH 5. 10. 1992, ZIP 1992, 1550
[159] Habersack, Genußrechte, 392; BGH 5. 10. 1992, ZIP 1992, 1550
[160] zB van Husen, Genußrechte 137
[161] dazu zB: W-nsch, Der Genußschein, 874 ff; Frantzen, Genußscheine 44 ff; Bürger, Genußrechte 9 ff; Schmalenbach, Aktiengesellschaft 65 ff; Pougin, Genußrechte, 285 ff
[162] zum Begriff der Amortisation zB W-nsch, Der Genußschein, 873; Bürger, Genußrechte 7 f
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Originalausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2001
- ISBN (eBook)
- 9783832452070
- ISBN (Paperback)
- 9783838652078
- DOI
- 10.3239/9783832452070
- Dateigröße
- 846 KB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- Karl-Franzens-Universität Graz – Rechtswissenschaften
- Erscheinungsdatum
- 2002 (März)
- Note
- 1,0
- Schlagworte
- richtlinienkonformität kapitalansammlungsrichtlinie genußrecht besserungsvereinbarung gesellschaftsteuer
- Produktsicherheit
- Diplom.de