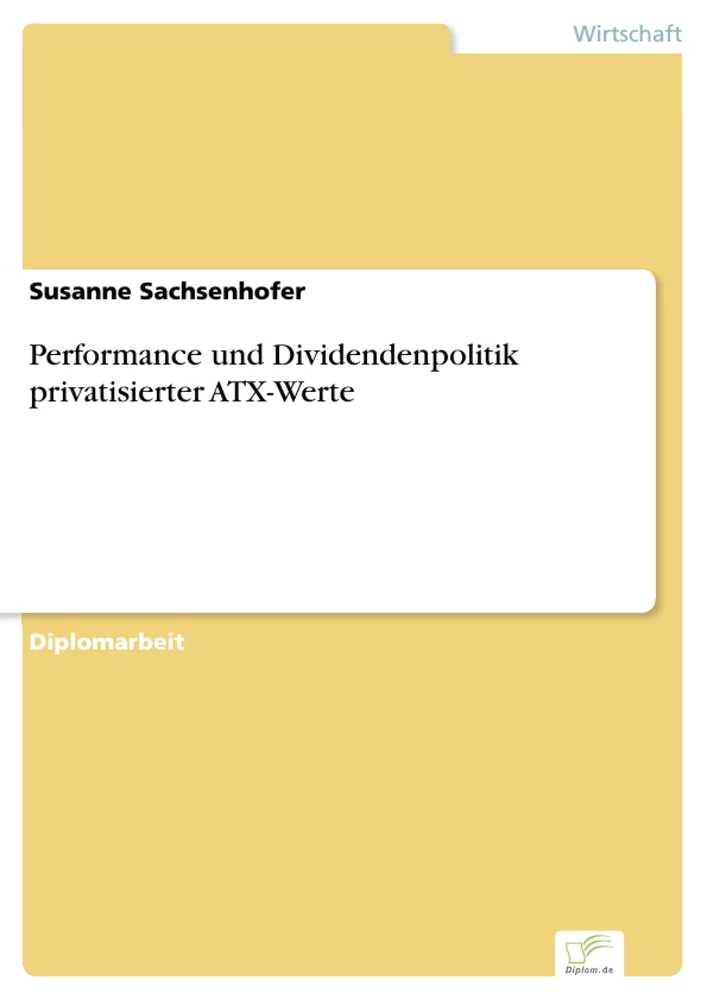Performance und Dividendenpolitik privatisierter ATX-Werte
Zusammenfassung
In meiner Diplomarbeit, bei der eine fundierte, praxisbezogene Untersuchung der Performance und Dividendenpolitik privatisierter ATX-Werte im Mittelpunkt steht, beschäftige ich mich zunächst kurz mit der Geschichte der Verstaatlichung und Privatisierung in Österreich. Hierbei werden die Gründe der nach 1945 beginnenden Verstaatlichung, die beiden Verstaatlichungsgesetze von 1946 und 1947, die Gründung und Neuordnung der Österreichischen Industrieholding Aktiengesellschaft (ÖIAG), die Krisen der verstaatlichten Industrie und die daraus resultierenden Privatisierungswellen zwischen 1957 und 2000 behandelt. Einen nicht unwesentlichen Teilaspekt dieser Arbeit stellt auch die Einstellung der österreichischen Bevölkerung zum Aktienbesitz im Vergleich zur Situation in anderen Ländern dar.
Gang der Untersuchung:
Das Kernstück meiner Diplomarbeit bildet eine eingehende empirische Untersuchung, in der ich zwölf österreichische Unternehmen, die zum Zeitpunkt der Diplomarbeitsvergabe Bestandteil des ATX waren bzw. während meiner Beschäftigung mit dieser Arbeit in den ATX aufgenommen wurden - es handelt sich dabei um Austria Mikro Systeme International AG, Austrian Airlines Österreichische Luftverkehrs AG, Austria Tabak AG, Bank Austria AG, Böhler-Uddeholm AG, Energie-Versorgung Niederösterreich (EVN) AG, Flughafen Wien AG, OMV AG, Telekom Austria AG, Voest-Alpine Stahl AG, Voest-Alpine Technologie AG und Österreichische Elektrizitätswirtschafts AG (Verbundgesellschaft) - und die früher vollständig in staatlichem bzw. in Landesbesitz waren und nun (teil-)privatisiert sind, ausländischen Mitbewerbern jeweils derselben Branche gegenüberstelle. Zweck dieser empirischen Untersuchung ist es, die zwölf österreichischen Unternehmen und ihre ausländischen Konkurrenten bezüglich ihrer Kursentwicklung und Dividendenpolitik branchenweise miteinander zu vergleichen.
Bei der Analyse eines jeden österreichischen ATX-Wertes erfolgt zunächst eine Beschreibung des Tätigkeitsbereiches des Unternehmens, der Gesamtkonzernstruktur, der vergangenen Privatisierungsschritte und der derzeitigen Aktionärsstruktur. Im Anschluss daran wird für jedes Unternehmen eine Analyse der Aktienperformance ab dem Zeitpunkt des Börseganges, sowohl mittels deskriptiver Performancebeschreibung, als auch mittels Verwendung von Reuters-Charts, durchgeführt. Zum Zwecke des Branchen weisen Performancevergleichs der österreichischen Unternehmen mit der Kursentwicklung […]
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
1. EINLEITUNG
„Performance und Dividendenpolitik privatisierter ATX-Werte“ - das ist ein Thema, welches aufgrund der derzeitigen Privatisierungswelle in Österreich äußerst aktuell ist und nicht nur in den Medien, sondern auch in den politischen Parteien heftig diskutiert wird.
Von der „Verteufelung“ der Aktie als Besitztum der „Reichen“ bis zur „Volksaktie“ als Anlagemedium für jedermann war es ein langer Weg. Heutzutage konzentrieren sich die Diskussionen der politischen Parteien nicht mehr so sehr auf die Frage, ob sich bestimmte Industriezweige weiterhin in Staatsbesitz befinden sollen oder nicht; diskutiert wird vielmehr über den richtigen Zeitpunkt der Privatisierung der in diesen Industriezweigen tätigen Unternehmungen.
Neben dem Hauptziel der vorliegenden Arbeit, die Performance und Dividendenpolitik der (teil-)privatisierten ATX-Werte zu schildern, werde ich auch auf die Geschichte der Verstaatlichung und Privatisierung in Österreich eingehen.
Der erste Teil der Arbeit beschäftigt sich, wie bereits erwähnt, mit der Geschichte der Verstaatlichung in Österreich. Zum besseren Verständnis werde ich zunächst den Begriff „Verstaatlichung“ erläutern und anschließend die Gründe, die in Österreich nach 1945 zur Verstaatlichung geführt haben, erklären. Im Anschluß daran werde ich auf die beiden Verstaatlichungsgesetze von 1946 und 1947 eingehen, wobei auch die Bedeutung dieser beiden Gesetze auf die österreichische Volkswirtschaft dargelegt werden soll. Den Abschluß dieses ersten Teiles meiner Arbeit wird die Entstehungsgeschichte der Österreichischen Industrieholding Aktiengesellschaft (ÖIAG) bis zu ihrer Gründung bilden.
Der zweite Teil der vorliegenden Arbeit behandelt den Weg Österreichs von der Verstaatlichung zur Privatisierung. Zunächst werde ich den Begriff „Privatisierung“ erläutern und auf die Formen der Privatisierung genauer eingehen. Nach der Beschreibung der Krisen der verstaatlichten Industrie und der sich daraus ergebenden Neuordnung der ÖIAG bis 1993 möchte ich kurz die Gründe und Ziele der Privatisierung behandeln. Das anschließende Kapitel wird sich den Privatisierungswellen zwischen 1957 und 2000 widmen. Das Thema der „Volksaktienidee“ soll hier ebenso aufgegriffen werden wie auch die Neuordnung der ÖIAG bis zum heutigen Tag. Als nicht unwesentlicher Abschluß dieses Kapitels soll auch die Einstellung der österreichischen Bevölkerung zum Aktienbesitz im Vergleich zur Situation in anderen Ländern genauer unter die Lupe genommen werden.
Den Mittelpunkt meiner Diplomarbeit bildet eine eingehende empirische Untersuchung. Ich werde dabei diejenigen elf österreichischen Unternehmen, die zum Zeitpunkt der Diplomarbeitszuteilung Bestandteil des Austrian Traded Index (ATX) waren - es handelt sich dabei um Austria Mikro Systeme International AG, Austrian Airlines Österreichische Luftverkehrs AG, Austria Tabak AG, Bank Austria AG, Böhler-Uddeholm AG, Energie-Versorgung Niederösterreich (EVN) AG, Flughafen Wien AG, OMV AG, Voest-Alpine Stahl AG, Voest-Alpine Technologie AG und Österreichische Elektrizitätswirtschafts AG (Verbundgesellschaft) - und die früher vollständig in staatlichem bzw. in Landesbesitz waren und nun (teil-)privatisiert sind, ausländischen Unternehmen jeweils derselben Branche gegenüberstellen und sie bezüglich ihrer Kursentwicklung und Dividendenpolitik branchenweise miteinander vergleichen. Aus aktuellem Anlaß habe ich auch die Telekom Austria AG in meine Untersuchung einbezogen.
Im letzten Teil der vorliegenden Arbeit werde ich die in meiner Untersuchung gewonnenen Erkenntnisse über Ähnlichkeiten bzw. Unterschiede zwischen den oben genannten österreichischen und ausländischen Unternehmen hinsichtlich ihrer Kursentwicklung und Dividendenpolitik nochmals zusammenfassen, Schlußfolgerungen aus den gewonnenen Ergebnissen ziehen und versuchen, eventuell notwendige Anpassungs- bzw. Verbesserungsmaßnahmen aufzuzeigen.
2. DIE GESCHICHTE DER VERSTAATLICHUNG IN ÖSTERREICH
2.1. DER BEGRIFF „VERSTAATLICHUNG“
Laut Rauscher versteht man unter „Verstaatlichung“ „die Übernahme von Wirtschaftsunternehmungen und -einrichtungen aus den Händen von privaten Besitzern in die Hände des Staates“ [1]. Langer (1966) beschreibt den Begriff der „Verstaatlichung“ als „die Übergabe des Eigentums einer Unternehmung an den Staat, der die Führung dieser Unternehmung von den Entscheidungen eines oder mehrerer Minister abhängig macht“.[2] Aus dieser Definition geht hervor, daß man von „Verstaatlichung“ sprechen kann, wenn sich die öffentliche Hand die Entscheidung auf allen wesentlichen Gebieten der Geschäftsführung, Finanzen, Produktion und Verwaltung des Unternehmens vorbehält, sich die Gewinne (d. h. in der Regel das Eigenkapital[3] ) zueignet und die wichtigsten Entscheidungsträger ernennt. Langer faßt die Merkmale der Verstaatlichung darüber hinaus folgendermaßen zusammen:[4]
- Die Gestaltung der Verstaatlichung variiert je nach der politischen Situation. In Österreich beispielsweise veränderte sich die zentrale Organisation der verstaatlichten Unternehmen nach jeder Wahl.
- Die Motive, die zur Verstaatlichung führen, sind oft opportunistisch und zielen darauf ab, die Schwächen des Privatsektors zu kompensieren. Aufgrund des Mangels an Privatkapital nach dem Zweiten Weltkrieg konnten z.B. die deutschen Unternehmen nicht auf die österreichische Privatwirtschaft übertragen werden. So wurde die Verstaatlichung als das geeignete Mittel zur Kompensation der Schwäche des Privaten Sektors herangezogen.
- Das Ausmaß der Verstaatlichung ist begrenzt, sie erstreckt sich entweder auf einzelne Unternehmen oder auf einen oder mehrere Wirtschaftszweige. Es ergeben sich daraus häufig Situationen großer Konkurrenz mit privaten Unternehmen.
- Die verstaatlichten Unternehmen werden durch Organe des Staates kontrolliert (z.B. in Österreich durch den Rechnungshof) und stehen im Dienste des Staates. Sie m-ssen oft kurzfristige, von Opportunismus diktierte Aufgaben erf-llen. Häufig streben die Leiter eines verstaatlichten Unternehmens auf kapitalistische Art nach Profit und versuchen, sich - ohne R-cksicht auf die Interessen der Bevölkerung - für ihre Unternehmen ein Maximum an Vorteilen zu verschaffen. Dies führt oft dazu, daß die Menschen das Interesse am öffentlichen Sektor verlieren, da dieser keine unabhängige Politik verfolgt, an der die Staatsbürger Anteil nehmen könnten.
- Der Definition nach ist eine echte Wirtschaftsdemokratie ausgeschlossen, da die Vertreter des Staates im Vorstand und Aufsichtsrat die Mehrheit besitzen. Durch die Einbeziehung von Gewerkschaftern kann höchstens eine indirekte politische Demokratie erreicht werden.
- Gewöhnlich werden bei der Verstaatlichung Unternehmensformen von hohem Konzentrationsgrad bevorzugt, beispielsweise Holdinggesellschaften, Konzerne.
2.2. DIE GRÜNDE DER VERSTAATLICHUNG NACH 1945
Eingangs muß erwähnt werden, daß die Verstaatlichung in Österreich nicht erst nach dem Zweiten Weltkrieg begann, sondern ihre Wurzeln bis ins 15. Jahrhundert, als das Salzmonopol entstand, zurückreichen. Im Zeitalter des Absolutismus setzte sich die Verstaatlichung fort (Schaffung des Tabakmonopols) und erreichte im Zuge der Wirtschaftskrise von 1873 mit der Verstaatlichung der österreichischen Eisenbahnen einen Höhepunkt. In Folge der Wirtschaftskrise von 1929/30 kam es zu einer Ausdehnung des Staatseinflusses vorwiegend im österreichischen Kreditwesen.[5]
Die Gründe, warum es in Österreich nach 1945 zu „einer der höchsten Verstaatlichungsquoten der westlichen Welt“[6] kam, lassen sich folgendermaßen zusammenfassen: Da der Zweite Weltkrieg eine zerr-ttete Wirtschaft zurückließ, die von schweren materiellen Verlusten gekennzeichnet war (Demontagen durch die Sowjets, Verluste der Auslandsbetriebe etc.), erforderte ein rascher Wiederaufbau der Betriebe große Investitionen, die nicht von privater Seite aufzubringen waren (= wirtschaftspolitische Gründe). Darüber hinaus versuchte man, durch „Austrifizierung“[7] der Unternehmen den ausländischen Kapitaleinfluß und eine dementsprechende Einmischung des Auslandes zu verringern, um einen wirtschaftlich selbständigen und unabhängigen Staat zu ermöglichen (= staatspolitische Gründe).[8] Ebenso spielten sozialpolitische Gründe eine Rolle, da die Verstaatlichung in Zeiten hoher Arbeitslosigkeit als bester Garant für Vollbeschäftigung galt.[9] Weiters konnte Österreich über einen internationalen Trend der Verstaatlichung (Osteuropa, Italien, Frankreich, Großbritannien) nicht hinwegsehen.[10]
Der wichtigste Grund für die zunehmenden Verstaatlichungen war allerdings, den Konsequenzen des Potsdamer Abkommens vom 2. August 1945 zu entgehen.[11] Dieses sollte den Alliierten das „Deutsche Eigentum“ (Firmen, die bereits vor dem Anschluß an Deutschland 1938 im Besitz deutscher Konzerne gewesen waren, weiters Betriebe, die nach der Annexion vom deutschen Staat neu errichtet worden waren, und schließlich eine Reihe von Unternehmen, die nach 1938 aus dem Eigentum österreichischer Staatsbürger oder Institutionen in deutsche Hände übergegangen waren[12] ) als Ersatz für Verzicht auf Reparationszahlungen und als Siegesbeute sichern (Grund der Sicherung des Deutschen Eigentums für Österreich). Während Amerikaner, Briten und Franzosen bereits im Jahre 1946 auf jegliche Ansprüche (darunter die VOEST) verzichteten, bestanden die Sowjets auf ihrem Recht. Als Reaktion auf diese Haltung versuchte die österreichische Regierung, durch eine Verstaatlichung den Zugriff der Sowjets auf die betroffenen Unternehmen zu verhindern.[13] Dennoch überführten die Sowjets 252 österreichische Industriebetriebe in die Verwaltung einer von ihr beherrschten Gesellschaft, genannt USIA.[14] Die gesamte Erdölindustrie unterstand hingegen einem einzigen zentralen Unternehmen, namens „Sowjetische Mineralöl-Verwaltung (SMV).[15] Der österreichischen Volkswirtschaft gingen aufgrund der quasi „exterritorialen“ Stellung der USIA-Betriebe G-ter und Leistungen im Ausmaß von ca. zwei Prozent des Bruttoinlandsproduktes verloren.
Erst im Zuge des österreichischen Staatsvertrages (1955) wurden die von den Russen verwalteten Unternehmungen den österreichischen Behörden gegen entsprechende Entschädigungsleistungen zurückgegeben.[16]
2.3. DIE VERSTAATLICHUNGSGESETZE VON 1946 UND 1947
Nachdem für die nach dem Zweiten Weltkrieg „herrenlosen“ Unternehmen (viele Unternehmensleiter waren geflohen) im Jahre 1945 „öffentliche Verwalter“ eingesetzt worden waren und im gleichen Jahr ein beabsichtigtes Verstaatlichungsgesetz aufgrund des Einspruchs der Sowjets gescheitert war[17], wurde am 26. Juli 1946 trotz wiederholten Einspruchs der sowjetischen Besatzungsmacht mittels des Ersten Verstaatlichungsgesetzes (Vgl. Anhang 1: BGBl. Nr. 168/1946) die Verstaatlichung von insgesamt 70 Unternehmungen von allen drei im Nationalrat vertretenen Parteien beschlossen.[18] Dadurch gingen „etwa 90 % der Grundstoffindustrie, darunter die wichtigsten Unternehmen der Eisen- und Stahlindustrie und weite Bereiche des Bergbaus, die gesamte Erdölproduktion- und Verarbeitung, die D-ngemittelindustrie, sowie wichtige Betriebe der Maschinen-, Fahrzeug- und Elektroindustrie in staatliches Eigentum über. Betroffen waren außerdem drei Großbanken“ (Creditanstalt-Bankverein, Österreichische Länderbank AG und Österreichisches Creditinstitut, und die mit diesen Banken verbundenen Industriekonzerne).[19]
Zusätzlich zum Ersten Verstaatlichungsgesetz wurde vom Nationalrat auch das Werksgenossenschaftsgesetz (Vgl. Anhang 2: BGBl. Nr. 169/1946) beschlossen, das zumindest „potentielle Möglichkeiten für die teilweise Reprivatisierung verstaatlichter Unternehmungen eröffnete“[20]. Dieses Gesetz galt als Bedingung für die Zustimmung der ÖVP zum Verstaatlichungsgesetz. Andererseits handelte sich die SPÖ für ihre Zustimmung zum Werksgenossenschaftsgesetz die Verstaatlichung der oben genannten drei Großbanken ein.[21]
Das Zweite Verstaatlichungsgesetz (Vgl. Anhang 3: BGBl. Nr. 81/1947) wurde am 26. März 1947 vom Nationalrat einstimmig verabschiedet. Es unterscheidet sich vom Ersten Verstaatlichungsgesetz insofern, als hier die Übertragung nicht nur auf den Bund, sondern auf die öffentliche Hand (Bund, Länder und fünf Stadtgemeinden) stattfand.[22] Darüber hinaus betraf das Zweite Verstaatlichungsgesetz nur einen einzigen Wirtschaftszweig, die Elektrizitätswirtschaft, die jedoch sehr detailliert geregelt wurde.[23]
Mit Ausnahme einiger Unternehmen (siehe §1, Abs. 2), wurden die Unternehmungen, Betriebe und Anlagen zur Erzeugung und Verteilung elektrischer Energie auf die öffentliche Hand übertragen (verstaatlicht). Mit Inkrafttreten des Gesetzes gingen die Anteilsrechte an den bestehenden acht Landesgesellschaften zur Gänze in das Eigentum der betreffenden Bundesländer über (§3, Abs. 3, auch Ausnahmen); auf die Landesgesellschaften wiederum waren alle zu verstaatlichenden Unternehmungen und Anlagen mit Verstaatlichungsbescheid zu übertragen (§§7 und 8, auch Ausnahmen). Eine Eigentumsübertragung sowohl an den Bund als auch an die Länder sah das Verstaatlichungsgesetz in Form von Sondergesellschaften vor, welche für Großkraftwerke zu errichten waren (§4, Abs. 1). Im §5 wurde die Errichtung einer bundeseigenen Holding
(Verbundgesellschaft) bestimmt, die als Treuhänderin die Beteiligungen des Bundes an Sonder- und Landesgesellschaften zu verwalten hatte.[24] Ebenso wie das Erste Verstaatlichungsgesetz sprach auch das Zweite den Grundsatz einer angemessenen Entschädigung aus.[25]
2.4. DIE BEDEUTUNG DER BEIDEN VERSTAATLICHUNGSGESETZE FÜR
DIE ÖSTERREICHISCHE VOLKSWIRTSCHAFT
Die verstaatlichte Industrie leistete hinsichtlich ihrer wirtschaftlichen Entwicklung trotz massiver Probleme in den Nachkriegsjahren einen großen Beitrag zum Wiederaufbau der gesamtösterreichischen Wirtschaft.[26] Trotz pessimistischer Zukunftsaussichten vieler Politiker und Wirtschaftsexperten nach dem Krieg vollzog sich ein stürmischer Wiederaufbau, durch den die als Orientierungshilfe herangezogenen Wirtschaftsdaten der besten Konjunkturjahre von 1927 und 1937 bereits zu Beginn der fünfziger Jahre übertroffen wurden.[27] Das reale Bruttonationalprodukt Österreichs vermehrte sich von 1946 bis 1950 um 88 Prozent[28] und war 1963 bereits doppelt so hoch wie im Jahre 1929.[29]
„Obwohl auch die Privatindustrie rasch expandierte, wurde sie von der verstaatlichten Industrie beträchtlich übertroffen“[30]. Weber (1964) fügt hinzu, daß vor allem die verstaatlichte Eisen- und Stahlindustrie - aufgrund ihres Produktionszuwachses um 270 % zwischen 1949 und 1960 - der Schrittmacher der Produktionsexpansion der verstaatlichten Industrie war. Weiters beschreibt er, daß die Produktivität der verstaatlichten Industrie zwischen 1949 und 1961 im Verhältnis zu jener der Gesamtindustrie immer, teilweise bis zu 10 %, größer war als die der Industrie insgesamt. Auch die Zahl der Beschäftigten stieg in der Verstaatlichten Industrie zwischen 1949 und 1954 im Vergleich zur Gesamtindustrie um ein Vielfaches mehr an. (Vgl. Anhang 4: Entwicklung der Produktivität von 1949-1954 und von 1956-1962[31] ).
Interessant ist auch die Tatsache, daß die Auftriebskräfte der Produktion der verstaatlichten Industrie zu einem noch größeren Teil als in der gesamten Industrie aus dem Export flossen.[32] Die Exportquote der verstaatlichten Industrie erreichte beispielsweise 1952 fast 35 % gegenüber knapp 20 % der gesamten Industrie.[33] (Vgl. Anhang 5: Exportquoten der Verstaatlichten Industrie und der Industrie insgesamt von 1952 bis 1962[34] ).
Den Anteil der verstaatlichten Industrie am Umsatz der gesamten österreichischen Industrie zwischen 1956 und 1960 beziffert Langer (1966) in Höhe von rund 24 - 25 %. Er stellte überdies den Anteil der verstaatlichten Unternehmen am österreichischen Bruttosozialprodukt, allerdings nur für das Jahr 1959, fest. Nach Schätzungen der Wertschöpfung der verstaatlichten Industrie, der verstaatlichten Elektrizitätswirtschaft, der verstaatlichten Banken, der Landesgesellschaften und deren Beteiligungen bezifferte er den Anteil der verstaatlichten Unternehmen am Bruttosozialprodukt mit 13,8 %.[35]
Gründe für die wirtschaftliche Dynamik der Verstaatlichten Unternehmen waren einerseits die günstige Außenhandelskonjunktur aufgrund außergewöhnlich hoher Nachfrage sowie temporäre Verkäufermarktlagen, andererseits die koordinierte Wiederingangsetzung der Produktion im Grundstoffsektor. Als besonders wichtiger weiterer Grund dafür wird jedoch auch das angeregte Investitionsklima in Österreich angeführt. Dieses ist vor allem auf den vom amerikanischen Außenminister entwickelten „Marshallplan“ (European Recovery Program, ERP) zurückzuführen, der durch die Vergabe von ERP-Krediten zu günstigen Konditionen an die verstaatlichte Industrie - im besonderen an die Eisen- und Stahlindustrie - den Wiederaufbau der österreichischen Wirtschaft entscheidend förderte.[36] Die Kohlenkrise von 1958/59 und das Ende des internationalen Verkäufermarktes für Eisen und Stahl[37] bildeten einen Wendepunkt in der Entwicklung der verstaatlichten Industrie Österreichs, welcher erstmals deren Strukturschwächen aufzeigte und mit dem die überdurchschnittlich expansive Phase der „Verstaatlichten“ zu Ende ging.[38]
2.5. DIE ENTSTEHUNGSGESCHICHTE DER ÖSTERREICHISCHEN
INDUSTRIEHOLDING AG (ÖIAG)
Die Organisation der verstaatlichten Industrie hat im Laufe der Jahrzehnte im Einklang mit der Verschiebung der politischen Machtverhältnisse in Österreich ein recht wechselvolles Schicksal erfahren. Von 1946 bis 1949 war die Verstaatlichte Industrie dem Bundesministerium für Vermögenssicherung und Wirtschaftsplanung unterstellt, das sich vor allem mit der Bildung eines Eisen- und Stahlplanes, eines Elektrizitäts- und Wirtschaftsplanes, sowie eines Kohlen- und Metallindustrieplanes beschäftigte. Von 1950 bis 1956 übernahm diese Aufgabe das Ministerium für Verkehr und Verstaatlichte Betriebe, im Volksmund - nach dem damaligen Minister - „Königreich Waldbrunner“[39] genannt. Für die verstaatlichten Banken jedoch war das Finanzministerium zuständig.[40] Jene Betriebe, die seit dem Ersten Verstaatlichungsgesetz de jure verstaatlicht, aber von den Russen nicht freigegeben waren, wurden durch den Staatsvertrag von 1955 ebenso der Kompetenz des Ministeriums für Verkehr und Verstaatlichte Betriebe unterstellt.[41]
Von 1956 bis 1959 nahm die Österreichische Industrie- und Bergbauverwaltungsgesellschaft mbH. (IBV) als Treuhänderin für die Republik Österreich die Anteilsrechte - mit Ausnahme der Elektrizitätswirtschaft - wahr. In dieser Funktion beschleunigte die IBV vor allem die Reorganisation und Integration der ehemaligen USIA-Betriebe in die verstaatlichte Industrie Österreichs.[42] Jedoch gelang es der IBV nicht, sogenannte „Volksaktien“ zur dringend benötigten Kapitalaufstockung zu emittieren. Unter der Leitung der IBV verringerte sich die Zahl der verstaatlichten Unternehmen aufgrund von Fusionen und Liquidationen, und anstelle der „öffentlichen Verwalter“ traten mit der Zeit „normale“ Gesellschaftsorgane, was die Selbständigkeit der einzelnen Unternehmen gegenüber der IBV erhöhte.[43]
Aufgrund eines zu großen politischen Einflusses der Parteien auf die Bestellung der Geschäftsführung der IBV wurde diese jedoch im Jahre 1959 aufgelöst und die Zuständigkeit für die verstaatlichte Industrie daraufhin dem Bundeskanzleramt (Sektion IV), danach für ein weiteres Jahr wiederum dem Bundesministerium für Verkehr und Verstaatlichte Betriebe übertragen.[44] Nach dem Zusammenbruch der Großen Koalition 1966 entschloß sich die ÖVP-Alleinregierung zur Gründung einer Treuhandgesellschaft, die die Verwaltung der verstaatlichten Betriebe übernehmen sollte. Ihr Name lautete „Österreichische Industrieverwaltungs Ges. m. b. H. (ÖIG).[45] Diese wurde durch die Verabschiedung des ÖIG-Gesetzes (BGBl. Nr. 23/1967) im Jahre 1966 verwirklicht. Da die ÖIG die Verwaltung der Betriebe nur treuhändisch ausüben konnte, wurde durch die Erweiterungen zum ÖIG-Gesetz von 1967 in den Jahren 1969 und 1970 (Vgl. Anhang 6: BGBl. Nr. 47/1970) ihre Tätigkeit „politisiert“[46] und schließlich 1970 die Österreichische Industrieverwaltungs-Aktiengesellschaft (ÖIAG) gegründet, die im folgenden in Form einer echten Holdinggesellschaft ihre Eigentumsrechte unter Anerkennung der weitgehend dezentralen Organisation der Verstaatlichten Industrie ausübte.[47] Die ÖIAG unterlag somit dem österreichischen Aktiengesetz, das eine weitgehende Autonomie der Organe der Unternehmensführung gegenüber den Aktionären vorsieht.“[48]
3. DIE GESCHICHTE DER PRIVATISIERUNG IN ÖSTERREICH
3.1. DER BEGRIFF „PRIVATISIERUNG“
Der Begriff der Privatisierung wird sowohl in der Literatur als auch in der Praxis nicht einheitlich verwendet. Von Lösch (1983) beschreibt „Privatisierung“ als die „vollständige oder teilweise Übertragung bzw. Veräußerung von staatlichem Vermögen (Grundst-cke, Betriebe oder Unternehmensbeteiligungen) an private Personen oder Unternehmen“.[49] Hirche (1959) definiert noch genauer: „Privatisierung ist die Überführung von Erwerbsvermögen der öffentlichen Hand in private Hand, um die öffentliche Wirtschaftstätigkeit einzuschränken oder eine breite Eigentumsstreuung zu erreichen oder um beide Ziele gleichzeitig zu verfolgen.“[50]
3.2. DIE FORMEN DER PRIVATISIERUNG
Gurlit (1995) unterscheidet darüber hinaus zwischen formeller und materieller Privatisierung. Durch die formelle Privatisierung wird die öffentliche Unternehmung in eine private Rechtsform, typischerweise in eine AG, umgewandelt. Hierbei kommt es laut Wieser (1997) noch zu keiner Veränderung der staatlichen Leitung.[51] Die formelle Privatisierung wird bereits als Vorbereitung einer materiellen Privatisierung bezeichnet. Darunter versteht man nun die tatsächliche, teilweise (Teilprivatisierung) oder vollständige (Vollprivatisierung) Übertragung von öffentlichem Eigentum an Unternehmen, wie sie in Österreichs Verstaatlichter Industrie in großem Stil seit Ende 1993 verfolgt wird.[52] Materielle Privatisierungen übertragen also nicht nur die Form, sondern auch den Inhalt von Vermögensherrschaftsrechten in die Privatsphäre.[53]
Gurlit zufolge sind die vier wichtigsten Formen der materieller Privatisierung folgende:[54]
- Die Anteile des Unternehmens können in Form einer Börsenemission (Going Public, Initial Public Offering, IPO) einem breiten Investorenkreis angeboten werden. Diese Methode ist die häufigste Art der materiellen Privatisierung in den OECD-Ländern, wobei wiederum mehrere Fälle zu unterscheiden sind. Eine Möglichkeit ist die Emission von 100 % der Aktien an einem Tage, was jedoch bei den von mir analysierten Unternehmen nicht vorkam. Eine andere Methode ist die vollständige Privatisierung in mehreren Tranchen, wie sie zwar nicht in Österreich, jedoch beispielsweise bei der British Telecom zwischen 1984 und 1993 erfolgreich durchgeführt wurde. Ein eher gradueller Ansatz, der in Österreich häufig angewendet wurde, ist die Teilprivatisierung mittels vom Staat beschlossenen Kapitalerhöhungen, wobei sich der Staat als Hauptaktionär an diesen jedoch nicht beteiligt, wodurch sich sein Anteil an den betreffenden Unternehmen automatisch verringert. Eine weitere graduelle Möglichkeit ist der Verkauf einer Minderheitsbeteiligung eines verstaatlichten Unternehmens über die Börse, ohne daß eine vollständige Privatisierung geplant ist (z.B. AUA-Teilprivatisierung 1988).
- Die Regierung kann bisher öffentliche Unternehmen nach direkten Verhandlungen an ein privates Unternehmen, das meist in der gleichen oder einer verwandten Branche tätig ist, (= strategischer Investor) oder an ein Investorenkonsortium (besteht sowohl aus strategischen als auch aus finanziell motivierten institutionellen Investoren) verkaufen. Dies wird als Privatverkauf (Private Sale, Trade Sale) bzw. als M & A-Transaktion bezeichnet. Privatverkäufe ermöglichen üblicherweise höhere Privatisierungserlöse.
- Manchmal wird im Rahmen eines Management Buy-Out den Führungskräften das gesamte Unternehmen oder eine wesentliche Beteiligung verkauft, wodurch die staatlichen Eigent-mer durch private ersetzt werden. Ein Management Buy-Out eignet sich aufgrund der begrenzten Finanzierungsmöglichkeiten des Führungskreises vor allem als Verkaufsmethode für kleine und mittlere Unternehmen.
- Wenn die Übertragung von Unternehmensgewinnen und -risiken ohne Eigentumstransfer im Mittelpunkt steht, wird häufig Franchising bzw. langfristige Verpachtung eines öffentlichen Unternehmens an Private angewendet.
Hawlik und Sch-ssel schlugen bereits im Jahre 1985 eine weitere Privatisierungsform, die Mitarbeiterbeteiligung, vor. Das Ziel sei es, der Belegschaft der verstaatlichten Industrie nur einen Teil ihres Nettobezuges bar auszubezahlen, und den Restbetrag in Form von „stillen Beteiligungen“ der Mitarbeiter am Unternehmen einzubehalten. Während das Unternehmen seine Eigenkapitalausstattung und Liquidität verbessern könnte, würden die Mitarbeiter zu mehr unternehmerischem Denken und Verhalten und mehr Sparsamkeit angeregt.[55] Teilweise konnte die Idee der Beteiligung der Mitarbeiter an „ihren“ Unternehmen in Form eines Aktienbesitzes bereits in die Praxis umgesetzt werden.
Von den angeführten materiellen Privatisierungsformen spielten, wie später in meiner empirischen Untersuchung ersichtlich sein wird, vor allem Teilprivatisierungen mittels Börsenemission, Kapitalerhöhungen ohne Ausn-tzung des Bezugsrechtes durch den Staat und Privatverkäufe an strategische bzw. institutionelle Investoren eine Rolle.
3.3. DIE KRISEN DER VERSTAATLICHTEN INDUSTRIE UND DIE
NEUORDNUNG DER ÖIAG
Obwohl die Verstaatlichte Industrie Österreichs einige Jahre lang als „Flaggschiff“ der Österreichischen Wirtschaft bezeichnet wurde[56], stellten sich bald die ersten Probleme der Verstaatlichung ein. Nach einer ersten Rezession von 1958/59 hatte auch die Stahlkrise von 1975 negative Auswirkungen auf die verstaatlichten Unternehmen. Vor allem die im Vergleich zur unmittelbaren Nachkriegszeit langsamer wachsende Wirtschaft, der zunehmende Wettbewerb auf den Märkten und die Tatsache, daß die verstaatlichten Unternehmen ohne Zielvorgaben oder strategische Planung, in bürokratischer und politisch gelenkter Manier geführt und von „durch politischen Proporz besetzten Aufsichtsratsorganen“[57] „kontrolliert“ wurden, waren ungünstige Voraussetzungen für zuk-nftigen wirtschaftlichen Erfolg. Auch waren die Meinungen der beiden österreichischen Parteien, was die Zukunft der „Verstaatlichten“ anging, geteilt. Während die SPÖ versuchte, „ihre“ Verstaatlichung zu verteidigen, wollte die ÖVP mit Hilfe der Ausgabe von „Volksaktien“ eine Reprivatisierung der Verstaatlichten Industrie einleiten, was allerdings bis zu Beginn der 80er Jahre nicht gelang.
Das VOEST-Debakel von 1985, das einerseits durch die Fehlspekulationen der VOEST-Tochter Intertrading bei verschiedenen Ölgeschäften, andererseits durch die Verluste bei der Errichtung des Stahlwerkes Bayou verursacht wurde[58], war der Auslöser für eine tiefe Krise der gesamten Verstaatlichten Industrie. Das ÖIAG-Gesetz 1986, das unter anderem den Firmenwortlaut der ÖIAG in „Österreichische Industrieholding Aktiengesellschaft“ änderte[59], sowie das ÖIAG-Finanzierungsgesetz 1987 waren erste Schritte zur Sanierung der „Verstaatlichten“. Weiters einigte man sich auf eine Reform, mit der ab 1986 tiefe Umstrukturierungen geplant waren, die aus der Verstaatlichten Industrie mittels einer branchenweisen Zusammenfassung der Unternehmen nach dem Holdingprinzip einen effizienten Konzern[60] machen sollte. (Vgl. Anhang 7: Organigramm der ÖIAG-Konzernstruktur vor der Reform 1987 mit Stand 31. 12. 1986 bzw. Anhang 8: Organigramm der ÖIAG-Konzernstruktur nach der Reform 1987 mit Stand 30. 6. 1988[61] ).
Zwischen 1989 und 1991 wirkte sich das ÖIAG-Konzept erstmals positiv auf das Betriebsergebnis aus, was zu der Überlegung führte, die Verstaatlichte Industrie als Gesamtkonzern, den „Austrian Industries“, die 1990 gegründet wurden, schrittweise an die Börse zu bringen. Aufgrund der Verschlechterung der Lage des Konzerns in den Jahren 1992 und 1993, großteils begr-ndet durch das Finanzdebakel des Aluminiumunternehmens AMAG[62], war ein ganzheitlicher Börsengang nicht mehr realisierbar. R-ckwirkend mit 31. 12. 1993 wurden die „Austrian Industries“ im April 1994 aufgelöst und die „ÖIAG-neu“ als Beteiligungsverwaltungsgesellschaft für die Privatisierung der Unternehmen von Austrian Industries und ÖIAG errichtet.[63] (Vgl. Anhang 9: Organigramm der ÖIAG-Konzernstruktur nach Aufgabe des Austrian-Industries-Konzeptes mit Stand 31. 12. 1993[64] ). Mit der ÖIAG-Gesetzesnovelle 1993 (Vgl. Anhang 10: BGBl. Nr. 973/1993) hat sich die ÖVP politisch gegenüber der SPÖ durchgesetzt und so wurde der erste Schritt zur Durchführung der Privatisierungen der einzelnen Unternehmen der Verstaatlichten Industrie getan.[65] Aufgrund der vergangenen, -brigens erfolgreich über die B-hne gegangenen, Privatisierungswellen, die ich in einem der nächsten Kapitel kurz beschreiben möchte, kann man schließen, daß die Umstrukturierungen der Verstaatlichten Industrie nicht umsonst gewesen sind.
3.4. DIE GRÜNDE UND ZIELE DER PRIVATISIERUNG
Bevor die vergangenen Privatisierungswellen in Österreich näher erläutert werden sollen, möchte ich noch kurz auf die Nachteile der Verstaatlichung eingehen, die zu einem „Umdenken“ im Zuge der Verstaatlichungsdiskussion geführt und Argumente für eine Privatisierung geliefert haben.
Wie bereits im vorhergehenden Kapitel beschrieben, waren die verstaatlichten Unternehmen im Laufe der Zeit immer mehr durch Ineffizienzen verschiedenster Art gekennzeichnet. Wieser (1997) und Butschek (1985) führen beispielsweise das eigenn-tzige Verhalten von Entscheidungsträgern in verstaatlichten Betrieben, die anstelle auf Gewinnmaximierung auf Beschäftigungssicherung ausgerichtete Politik, die Weiterführung unrentabler Betriebe aus den Erträgen der florierenden Unternehmen, überdurchschnittlich hohe Bürokratie oder die fehlende Trennung zwischen Unternehmensführung und politisch-gewerkschaftlicher Macht an.[66] Für Hirche (1959) gibt allein die Tatsache, daß der Staat im Zuge einer Verstaatlichung zugleich politische und wirtschaftliche Macht in Händen hält, Anlaß zur Privatisierung.[67] Gurlit (1995) und Cointreau (1987) nennen überdies eine geringe Personalproduktivität und -motivation[68], geringe Innovationskraft und fehlende Kunden- und Marktorientierung, die meist zu enormen Defiziten der verstaatlichten Unternehmen führen, und die dann „mit einschneidenden Sanierungsmaßnahmen wieder verringert werden m-ssen“[69]. Als zusätzliches, gravierendes Problem von verstaatlichten Unternehmen sieht Gurlit die Tatsache, daß diese häufig unterkapitalisiert sind, also über zu wenig Eigen- und Fremdkapital verfügen.[70]
Um die genannten Ineffizienzen zu verringern bzw. gänzlich auszuschalten, wurde bereits in den 50er Jahren der Privatisierungsgedanke „geboren“. Später wurde die Privatisierungsdiskussion in Österreich auch vom Privatisierungsgeschehen im Ausland, vor allem dem in den USA („Reagonomics“) und jenem in Großbritannien („Thatcherism“) geprägt, die beide vom Glauben an die liberalen Marktkräfte und der Skepsis gegenüber staatlichen Eingriffen gekennzeichnet waren.[71] Vielfach wurde festgestellt, daß mithilfe von Privatisierungen ein Anstieg der Produktivität und Innovationskraft aufgrund höherer Leistungskonkurrenz und eine Verbesserung der Markttransparenz erreicht werden können. Eine aktuelle Untersuchung hat ergeben, daß als Folge von Privatisierungen zu 80 % deutliche Verbesserungen der Nettogewinne bzw. der Umsätze der betreffenden Unternehmen festgestellt werden konnten.[72]
Das wichtigste Ziel der Privatisierung war jedoch die Sanierung der Staatsfinanzen aufgrund der enormen Defizite, die eine Reihe von verstaatlichten Unternehmen aufwiesen. Darüber hinaus wurde als Ziel die Förderung des „Volkskapitalismus“, also die Förderung des Aktienbesitzes der Bevölkerung durch eine breite Streuung von Unternehmensbesitz[73], betrachtet. Wie wir später noch sehen werden, steckt diese Entwicklung in Österreich, ganz im Gegensatz zu einigen anderen europäischen Ländern, noch „ in den Kinderschuhen“.
3.5. DIE PRIVATISIERUNGEN SEIT 1957
3.5.1. Die Idee des „Volkskapitalismus“: Die „Volksaktie“
In Österreich begannen die ersten Privatisierungsdiskussionen bereits Mitte der 50er Jahre. Die durch den Abschluß des Staatsvertrages zu leistenden Reparationszahlungen an Rußland und das Versiegen der Marshallhilfe lösten eine Suche nach Finanzierungsmitteln für die österreichische Wirtschaft aus. Bei den folgenden Diskussionen wurde die Idee der „Volksaktie“ geboren. Diese Idee machte sich im Jahre 1957 die ÖVP zunutze, um mithilfe der Ausgabe von „Volksaktien“ eine Reprivatisierung der Verstaatlichten Industrie einzuleiten.[74]
Unter der „Volksaktie“ verstand man damals wie heute „klein gest-ckelte Aktien, also Aktien mit einem niedrigen Nennwert, die aus wirtschafts- und gesellschaftspolitischen Gründen breit gestreut bevorzugt Personen mit kleinerem Einkommen sowie den Belegschaften zu einem sozialen Einführungskurs angeboten werden“.[75] Die Charakteristika der „Volksaktie“ waren folgende: das Ziel der Volksaktie war vorderhand nicht die Kapitalbeschaffung, sondern eine kapitalmäßige Beteiligung breiter Bevölkerungsschichten am Eigentum von an sich in öffentlicher Hand befindlichen Produktionsmitteln. Weiters wurden die Volksaktien unter ihrem wirklichen Wert ausgegeben, teils, um mehr Aktionären den Erwerb zu ermöglichen, teils, da der niedrige Emissionskurs ständig eine relativ hohe Dividende erlaubte, ohne daß dadurch die Reservenbildung der verstaatlichten Unternehmungen unmöglich gemacht wurde. Auch konnten Volksaktien nur von österreichischen Staatsbürgern erworben werden, um jeglichen ausländischen Einfluß zu verhindern. Das vierte Kennzeichen besagte, daß die Mehrheit des Aktienkapitals der verstaatlichten Unternehmungen in den Händen des Staates bleiben sollte, damit „das positive Ziel der Verstaatlichung dadurch nicht gefährdet werden kann“.[76]
Durch ihren Wahlsieg 1956 konnte die ÖVP ihre „Reprivatisierungspolitik“ bis zum Jahre 1959 in die Tat umsetzen. Bereits 1957 wurden durch das Bundesgesetz vom 18. Dezember 1956 „über den Verkauf von Aktien verstaatlichter Banken“ (BGBl. Nr. 274/1956) je 40 % des Kapitals der Creditanstalt-Bankverein (CA) und der Österreichischen Länderbank in Form von Volksaktien ausgegeben[77] - davon je 10 % als Stammaktien und 30 % als Vorzugsaktien mit sechsprozentigem Dividendenanspruch - , es erfolgte also eine Teilprivatisierung.[78] Tatsächlich wurde jedoch bei diesen Volksaktien das Stimmrecht explizit ausgeschlossen und nur sehr wenige Aktien wurden unter ihrem Nominale von ATS 1.000,- gest-ckelt, was ein wesentliches Kennzeichen der „Volksaktien“ gewesen wäre. Man kann daher davon ausgehen, daß der urspr-ngliche Wunsch einer breiten Aktienstreuung nicht verwirklicht wurde.[79]
Bis 1963 gaben weitere elf Gesellschaften des verstaatlichten Bereiches Volksaktien aus, vorwiegend Unternehmen, die nach dem Staatsvertrag aus dem früheren deutschen Eigentum der Republik Österreich zugefallen waren. Als jedoch die ÖVP 1963 25 % der VÖEST und Alpine Montangesellschaft in Form von Volksaktien ausgeben wollte, brachten die Unstimmigkeiten zwischen den beiden Koalitionspartnern ÖVP und SPÖ bezüglich des Zwecks der Volksaktien (Absicherung der Verstaatlichung versus Reprivatisierung) die Idee des „Volkskapitalismus“ endgültig zum Scheitern. Doch auch das fehlende Stimmrecht, unerwartete Spekulationen auf „schnelle Kursgewinne“[80] und die Tatsache, daß viele der Unternehmen viel zu klein waren, um sich als Dauerpublikumsgesellschaften durchzusetzen[81], trugen zum Mißerfolg bei. Letztendlich wurden die Volksaktien von einigen wenigen Großaktionären aufgekauft, anstelle von vielen „einfachen Bürgern“ gehalten zu werden.[82] Es ist offensichtlich, daß bereits hier die im nächsten Hauptkapitel angesprochene Einstellung der österreichischen Bevölkerung zum Aktienbesitz eine nicht unbedeutende Rolle gespielt hat. „Bis zum Jahre 1985 kam es somit von den von den Verstaatlichungsgesetzen betroffenen Unternehmen der Verstaatlichten Industrie nur bei der Siemens AG Österreich zu einer Privatisierung“.[83]
3.5.2. Phase I: Die Privatisierungen bis 31. 12. 1993
Die ÖIAG teilt die zwischen Ende der 80er und Ende der 90er Jahre stattgefundenen Privatisierungen in drei große Blöcke ein, die auch als „Privatisierungswellen“ bezeichnet werden können. Aufgrund einer im Kapitel 4 dargelegten detaillierten Schilderung der Privatisierungsschritte der einzelnen Unternehmen soll an dieser Stelle nur ein kurzer Überblick über die wichtigsten Privatisierungsaktivitäten gegeben werden. Da die Privatisierungsschritte der drei nicht von der ÖIAG privatisierten, in meiner Studie jedoch inkludierten Unternehmen (Bank Austria AG, EVN AG, Verbundgesellschaft) in den jeweiligen Kapiteln ebenfalls genauestens beschrieben sind, wird hier auf eine Darstellung verzichtet. Ebenso verzichtet wird auf die Beschreibung der ÖIAG-Privatisierungen jener teilverstaatlichten Unternehmen, die nicht Gegenstand meiner Untersuchung sind.
In die erste Phase fallen die Privatisierungen im ÖIAG-Konzern bis 31. 12. 1993. Zwischen 1987 und 1989 erfolgte die in zwei Tranchen durchgeführte Börseneinführung der OMV, bei der insgesamt 27,7 % des Aktienkapitals des Unternehmens erfolgreich teilprivatisiert wurden. 1993 folgte ein 74 %iges Initial Public Offering (IPO) der Austria Mikro Systeme International AG (AMS).[84]
3.5.3. Phase II: Das Erste Privatisierungskonzept 1994 - 1996
Anschließend an die erste Phase begann eine neue Privatisierungswelle, ausgelöst durch die ÖIAG-Gesetz- und ÖIAG-Finanzierungsgesetz-Novelle 1993 (BGBl. Nr. 973/1993). Die ÖIAG verpflichtete sich darin, „die ihr unmittelbar gehörenden Beteiligungen an industriellen Unternehmungen in angemessener Frist mehrheitlich abzugeben.“ Dabei war darauf „Bedacht zu nehmen, daß österreichische Industriebetriebe und industrielle Wertschöpfung, soweit wirtschaftlich vertretbar, erhalten bleiben“.[85] Es ist erwähnenswert, daß die bilanzielle Situation der ÖIAG Ende 1993 äußerst angespannt war. Zielsetzung des Ersten Privatisierungskonzeptes der ÖIAG in finanzieller Hinsicht war es daher, die Schulden durch Erlöse aus Privatisierungsmaßnahmen konsequent abzubauen[86], sodaß das verbleibende Beteiligungsvermögen der ÖIAG möglichst durch Eigenmittel finanziert werden konnte.
Für den Zeitraum zwischen 1994 und 1996 wurden folgende Ziele avisiert[87]: die OMV sollte mehrheitlich (zu 75 %) privatisiert, die aus den Austrian Industries Technologies entstandene VA-Technologies (VA Tech) sollte mit der VA Stahl AG zu je 25 % verschränkt und Mitte 1994 zu 51 % über die Börse privatisiert werden. Auch strebte man die Ausstattung der Böhler-Uddeholm AG, die 1996 zu 75 % über die Börse privatisiert werden sollte, mit ATS 2,5 Mrd. Eigenkapital an. Die VA Stahl AG sollte 1996 zu 26 % verkauft werden. Weiters wurde die 100 %ige Privatisierung der AMS beschlossen.
Tatsächlich wurden zwischen 1994 und 1996 sowohl Börsetransaktionen (VA Tech, Böhler-Uddeholm, VA Stahl, OMV), M & A-Transaktionen (OMV, AMS, VA Stahl), als auch Kapitalerhöhungen ohne Ausn-tzung der Bezugsrechte durch den Staat (OMV) durchgeführt. Trotz der erfolgreichen Privatisierungsmaßnahmen, von denen die Transaktion der VA Tech bis zum Börsegang der Telekom Austria als „die größte Transaktion der österreichischen Kapitalmarktgeschichte“[88] galt, gab es in der Praxis einige Abweichungen vom Ersten Privatisierungskonzept. Die Restbeteiligung der ÖIAG an der OMV betrug 1996 statt der geplanten 25 % doch noch 35 % und die Privatisierung der VA Stahl AG, an der die ÖIAG nur noch zu 38,8 % (statt 49,0 %) beteiligt war, erfolgte bereits 1995 (statt 1996).[89]
Das in dieser zweiten Privatisierungsphase erreichte Gesamtvolumen der Privatisierungstransaktionen für direkte ÖIAG-Beteiligungen belief sich auf rund ATS 27,4 Mrd. In diesem Zeitraum gelang der ÖIAG ein Eigenkapitalaufbau von rund ATS 9,95 Mrd. und eine Verringerung der Bruttoverbindlichkeiten um ca. ATS 36,2 Mrd.[90] Dennoch waren Ende 1996 die Restbeteiligungen der ÖIAG höher und die tatsächlichen Erlöse geringer als im Ersten Privatisierungskonzept angenommen.[91]
3.5.4. Phase III: Das Zweite Privatisierungskonzept 1997 - 1999
Mit dem Bundesgesetz vom 12. Juli 1996 betreffend die Übertragung von Kapitalbeteiligungen des Bundes an die ÖIAG und der Novelle zum ÖIAG-Gesetz (Vgl. Anhang 11: BGBl. Nr. 426/1996) wurden der ÖIAG neue Privatisierungsaufgaben anvertraut. Die Anteilsrechte des Bundes an der Austria Tabakwerke AG (ATW) wurden zum Zwecke der Umstrukturierung und Privatisierung in das Eigentum der ÖIAG übertragen.[92] Geplant waren bei den ATW ein erster Privatisierungsschritt Ende 1997, eine Veräußerung von 25 % 1998 und ein Verkauf von weiteren 50 % im Jahre 1999. Auch bei der Privatisierung dieses Unternehmens waren die Bestimmungen des BGBl. Nr. 973/1993, daß österreichische Industriebetriebe und industrielle Wertschöpfung, soweit wirtschaftlich vertretbar, erhalten bleiben sollen, anzuwenden. Auch wurde festgelegt, daß die ÖIAG die durch die Privatisierung erzielten Erlöse und Dividendenaussch-ttungen zur Begleichung ihrer Verbindlichkeiten verwenden sollte.[93] Tatsächlich fand im November 1997 der Börsegang der Austria Tabak AG statt, jedoch befinden sich nach Abgabe von weiteren 9,4 % des Aktienkapitals
an institutionelle Investoren im Jahre 1999 noch 41,1 % in Staatsbesitz.
Nachdem in den Jahren 1994 bis 1996 die Nettoverschuldung der ÖIAG stark verringert und zwischen 1996 und 1999 sogar ein Überschuß der Aktivposten über R-ckstellungen und Verbindlichkeiten in Höhe von ATS 795 Mio. erwirtschaftet werden konnte[94], wurde im Zweiten Privatisierungskonzept geplant, aus Dividendeneinnahmen von den urspr-nglichen Beteiligungsgesellschaften der ÖIAG einen Betrag von insgesamt ATS 2.300 Mio. an das Bundesbudget abzuführen, was auch geschehen ist. Zwischen 1996 und 1999 gelang der ÖIAG außerdem eine Aufstockung der Eigenmittel um mehr als ATS 1 Mrd.[95]
Eine weitere gesetzliche Bestimmung des Zweiten Privatisierungskonzeptes 1997 - 1999, das Bundesgesetz über die Übertragung von Bundesbeteiligungen in das Eigentum der ÖIAG (BGBl. Nr. 87/1998), regelte die Übertragung der Anteilsrechte des Bundes an der AUA (51,94 %) und der Flughafen Wien AG (17,38 %) an die ÖIAG. Bis zum ÖIAG-Gesetz 2000, das diese Regelung wieder aufhob, hatte die ÖIAG keine aktiven Privatisierungsschritte an diesen beiden Unternehmungen vorzunehmen, sondern nur die Anteilsrechte anstelle des Bundes zu verwalten.[96] Mit der in den Jahren 1997 und 1998 erfolgten Übertragung der Anteilsrechte umfaßt das Aufgabengebiet der ÖIAG nun drei Bereiche: Beteiligungsmanagement, Durchführung von Privatisierungen und Dienstleistungen für den Bund.[97]
In Summe läßt sich feststellen, daß die ÖIAG durch die beiden Privatisierungskonzepte 1994 - 1996 und 1997 - Mitte 1999 insgesamt Privatisierungserlöse in Höhe von ATS 32,28 Mrd. erzielt hat. Werden zusätzlich noch die Erlöse der Post und Telekombeteiligungsverwaltungsgesellschaft (PTBG) miteinbezogen, ergibt sich ein Gesamtprivatisierungserlös von ATS 75,83 Mrd.[98]
Abschließend noch ein paar Worte zu erwähnenswerten Kennziffern: Ende 1999 beschäftigten die Unternehmungen und 100 %igen Beteiligungen der ÖIAG in Summe 66.428 Mitarbeiter, die einen Umsatz von rund ATS 251 Mrd. erwirtschafteten. Zusammen mit den Unternehmungen des Bereiches der PTBG ergibt sich ein Mitarbeiterstand von 122.571 und ein Umsatz von rund ATS 326 Mrd. (ohne PSK). Im selben Jahr erzielte die gesamte Gruppe ein EGT von ca. ATS 16,8 Mrd., der Marktwert der von der ÖIAG gehaltenen Aktien betrug Ende 1999 ATS 35,5 Mrd. Der Erfolg dieser Privatisierungsmaßnahmen kann jedoch auch anhand des ÖIAG-Index, des Aktienkurses der privatisierten Firmen, festgestellt werden. Dieser hat sich seit Beginn des Ersten Privatisierungskonzeptes 1994 im Vergleich zum Austrian Traded Index (ATX) kontinuierlich besser entwickelt. (Vgl. Anhang 12: ÖIAG-Index versus ATX[99] ). Sowohl die oben erwähnten Kennziffern als auch die ÖIAG-Indexentwicklung zeigen die große Bedeutung des Beteiligungsportfolios ÖIAG/PTBG für die österreichische Volkswirtschaft.
3.5.5. Der Privatisierungsauftrag 2000
Mit dem im Februar vom Parlament verabschiedeten neuen ÖIAG-Gesetz 2000 (BGBl. Nr. 24/2000) wurden für die zuk-nftige Entwicklung der ÖIAG neue Weichen gestellt. Das Regierungsprogramm der Bundesregierung sieht vor, daß die bestehenden Verbindlichkeiten der ÖIAG (der Netto-Schuldenstand der ÖIAG belief sich Anfang 2000 auf über ATS 80 Mrd.[100] ) in der kommenden Legislaturperiode durch Privatisierungserlöse zu tilgen und darüber hinausgehende Erlöse dem Bund zuzuführen sind. Das Management der ÖIAG erhielt deshalb den Auftrag, ein mehrjähriges Privatisierungskonzept zu entwickeln, um die Bundesanteile der Flughafen Wien AG, der Telekom Austria AG (ÖIAG-Anteil vor dem Börsegang: 75 % -1 Aktie) und der Austria Tabak AG (ÖIAG-Anteil: 41,1 %) zu 100 % neuen Eigent-mern, strategischen Partnern oder dem Publikum zuzuführen.[101] Den Schwerpunkt der derzeitigen Privatisierungswelle stellte zweifellos bereits die Emission der Telekom Austria AG-Aktien am 21. November 2000 dar. Diese hat die bisher größte Börsentransaktion, jene der VA Tech AG, dem Volumen nach um ein Mehrfaches übertroffen.
Ebenfalls im ÖIAG-Gesetz 2000 wurde die Post und Telekombeteiligungsverwaltungsgesellschaft (PTBG) durch Übertragung ihres Vermögens auf die ÖIAG in die ÖIAG verschmolzen, „womit der Beteiligungsbereich der ÖIAG einen beachtlichen Zuwachs“[102] erfuhr. (Vgl. Anhang 13: Derzeitige Beteiligungsstruktur der ÖIAG[103] ).
3.6. DIE AKTIE ALS GELDANLAGEMEDIUM IN ÖSTERREICH IM VERGLEICH
ZUM AUSLAND
Wenn man die vergangenen Privatisierungswellen in verschiedenen Ländern betrachtet, kann man einen Zusammenhang zwischen dem Beginn und dem Tempo der Privatisierung und der Verbreitung der Aktie als Anlagemedium erkennen. Während vor allem in Großbritannien, Frankreich und Deutschland der Übergang von der Verstaatlichung zur Privatisierung bereits vor
einigen Jahrzehnten eingeleitet wurde, begannen in Österreich die großen „Privatisierungswellen“ erst 1993. Mehrere Studien haben gezeigt, daß es in Ländern, in denen der Übergang von Staatseigentum an Private früher stattfand, heute einen höheren Prozentsatz von Aktienbesitzern in der Bevölkerung gibt.
Beispielsweise hielten im Jahre 1985 in den USA bereits 19 % der Bevölkerung Aktien, in Japan 17 %, und in Frankreich 8 %.[104] Nachdem 1979 etwa zehn Prozent der Bevölkerung Großbritanniens bereit waren, grundsätzlich einmal in Aktien zu investieren, zog Umfragen der Unternehmensberatungsgesellschaft Dewe Rogerson zufolge 1984 bereits etwa ein Viertel der Bevölkerung diese Anlageform in Betracht. Tatsächlich hat sich in Großbritannien die Zahl der Aktionäre innerhalb von dreizehn Jahren ungefähr verdreifacht: besaßen 1979 ca. 7 % aller Briten Aktien, so lag diese Zahl 1992 bereits bei ca. 23 % (= ca. 10 Millionen Aktionäre).[105] Diese Entwicklung ist einerseits auf eine in der Bevölkerung wachsende Bereitschaft, Vermögen in Aktien zu erwerben, und andererseits auf erhebliche Anstrengungen der Regierung, die Bevölkerung und Mitarbeiter der betreffenden Unternehmen zum Kauf von Aktien zu bewegen, zurückzuführen.[106] Auch eine andere Relation beweist den vergleichsweise wenig verbreiteten Aktienbesitz in Österreich: im Jahre 1985 waren 5,7 % der Einwohner der Bundesrepublik Deutschland Aktionäre, während in Österreich nur 1 % der Bevölkerung Aktien besaß.[107]
Einer Studie des Linzer Meinungsforschungsinstitutes Spectra aus dem Jahre 1999 zufolge steht es um den Aktienbesitz in Österreich heutzutage zwar etwas besser als noch vor ein paar Jahren, jedoch ist die eher zögerliche Haltung der Bevölkerung, was den Erwerb von Aktien betrifft, noch immer deutlich erkennbar. Aufgrund der Umfrageergebnisse besaßen im Jahre 1999 nur etwa 6-7 % der Österreicher ab 15 Jahren Aktien und 11 % hielten Investmentfonds. Weiters fällt auf, daß bei 24 % der Bevölkerung zum Stichwort „Aktien“ an erster Stelle die Spontanassoziationen „hohes Risiko, unsichere Geldanlage, Spekulation“ aufgetreten sind. Als Gründe, warum es in Österreich so viele „Aktien-Muffel“ gibt, wurden vor allem eine geringe Risikobereitschaft, zu wenig vorhandenes Insiderwissen und Unflexibilität genannt.[108] Eine im März 2000 durchgeführte Studie ergab, daß für 45 % der Österreicher in Zukunft Bausparen, für 35 % Lebensversicherungen und für 33 % Immobilien/Grundst-cke die günstigsten Geldanlagen für die nächste Zeit sein werden. Aktien sind für 18 % der Bevölkerung die optimale Geldanlage.[109]
Die aktuellsten Ergebnisse liefert die neueste Studie des Meinungsforschungsinstitutes Market vom Sommer 2000. Obwohl mehr als zwei Drittel der Österreicher der Meinung sind, daß Aktien in Zukunft die ertragreichste Anlageform darstellen werden, legen nur zehn Prozent der Bevölkerung in Aktien an, was jedoch im Vergleich zur Spectra-Studie eine bedeutende Steigerung des Aktienbesitzes bedeutet. Als Grund dafür wird das „schwindende Vertrauen in die staatliche Altersversorgung“ genannt.[110]
Gründe für die bisher eher bescheidene Nutzung der Aktie als Geldanlagemedium in Österreich gibt es einige. Nach den beiden Weltkriegen, aus denen Österreich als Verlierer hervorgegangen war, besaß die Bevölkerung aufgrund der inflationsbedingten Abwertungen der Währung einerseits nicht die nötigen finanziellen Mittel, um Aktien zu erwerben, noch hatte sie übermäßiges Interesse daran, da es zuallererst galt, die Grundbedürfnisse zu befriedigen.
Eine weitere Erklärung gibt die Tatsache, daß sich das österreichische Sparaufkommen aufgrund der gemachten bitteren Erfahrungen in der Nachkriegszeit auf hochliquide Formen, wie etwa das Sparbuch, beschränkte, und sich, wie in den oben geschilderten Umfragen beschrieben, noch einige Jahrzehnte lang sehr stark auf diese Anlageform konzentrierte.[111] Gleichzeitig hat laut Hawlik und Sch-ssel (1985) der begünstigte Erwerb von Anleihen und Pfandbriefen für Privatpersonen in Österreich einerseits „zu einem breiten und funktionst-chtigen Markt für festverzinsliche Papiere geführt, andererseits aber den österreichischen Aktienmarkt zu einem Mauerbl-mchendasein („Flüsterbörse“) verurteilt“.[112]
Als weiterer gewichtiger Grund für die geringe „Aktionärsdichte“ gilt auch die vergleichsweise „Kleinheit“ der Wiener Börse und die damit einhergehende Schwäche des österreichischen Kapitalmarktes. Diese hätte laut Wieser (1997) zwar vielfach durch die Hereinnahme von Investoren entschärft werden können, was jedoch aufgrund der im internationalen Vergleich mangelnden Entwicklung von institutionellen Investoren, wie beispielsweise Versicherungsgesellschaften oder Pensionsfonds, in Österreich auch wieder problematisch war.[113] Bis vor einigen Jahren war der Pensionssicherungsgedanke in Form einer Vermögensanlage in Investmentfonds in Österreich tatsächlich kaum ausgeprägt. Erst als vorwiegend ausländische Experten auf die aufgrund der demografischen Entwicklung sich ergebenden Schwierigkeiten der Finanzierung der zuk-nftigen Pensionen aufmerksam machten, wurde der Aktie als Anlagemedium in Form von Investmentfonds größerer Zuspruch zuteil.
Last, but not least, soll noch auf einen weiteren Grund für den geringen Aktienbesitz in Österreich hingewiesen werden: es ist dies die öffentliche „Verteufelung“ des Aktienbesitzes durch manche Parteien, für die eine Aktienemission einen „Verkauf von Familiensilber“ darstellt.
Um die Wiener Börse aus ihrem „Dornröschenschlaf“ herauszuholen und den heimischen Kapitalmarkt zu beleben, soll in Zukunft unter anderem eine stärkere Beteiligung der Mitarbeiter an „ihren“ Unternehmen, die Zulassung von Börseprospekten auch in englischer Sprache sowie die Veröffentlichung von Publizitätsvorschriften im - in der Zukunft von der Wiener Börse und von Anlegern intensiver zu nutzenden - Internet beschlossen werden.[114] Am 26. September 2000 wurde vom Ministerrat ein Kapitalmarktförderungsprogramm verabschiedet, das sowohl die Abschaffung der Börsenumsatzsteuer ab 1. Oktober 2000 als auch die Abschaffung der Erbschaftssteuer beim Erwerb von Aktien im Erbweg ab 1. Jänner 2001 vorsieht. Natürlich soll die Bevölkerung auch durch die Privatisierungsoffensive der Regierung ihre „Scheu“ vor Aktien verlieren und so der Aktienbesitz in Österreich populärer gemacht werden.
4. PRIVATISIERTE ÖSTERREICHISCHE ATX-WERTE UND VERGLEICH IHRER PERFORMANCE UND DIVIDENDENPOLITIK MIT INTERNATIONALEN KONKURRENZUNTERNEHMEN JEWEILS DERSELBEN BRANCHE
Die vorliegende empirische Untersuchung beschäftigt sich, wie bereits erwähnt, mit einer detaillierten Analyse der Dividendenpolitik und der Kursentwicklung der Aktien jener österreichischen Unternehmen, die sich in der Vergangenheit gänzlich im Besitze des österreichischen Staates bzw. in Landesbesitz befunden hatten und nun (teil-)privatisiert sind und zum Zeitpunkt der Diplomarbeitszuteilung (März 2000) Bestandteil des ATX waren. Neben den sich somit ergebenden 11 Unternehmen AMS AG, AUA, Austria Tabak AG, Bank Austria AG, Böhler-Uddeholm AG, EVN AG, Flughafen Wien AG, OMV AG, VA Stahl AG, VA Technologie AG und Verbundgesellschaft habe ich aus aktuellem Anlaß auch die Telekom Austria AG, die Anfang November 2000 an die Börse ging und bereits in den ATX aufgenommen wurde, in meine Untersuchung einbezogen.
Bei der Analyse eines jeden Unternehmens habe ich zuerst den Tätigkeitsbereich des Unternehmens beschrieben und die Gesamtkonzernstruktur näher beleuchtet. Anschließend daran erfolgt eine detaillierte Schilderung der vergangenen Privatisierungsschritte eines jeden Unternehmens im Zeitablauf und eine Darstellung der derzeitigen Aktionärsstruktur. Darüber hinaus habe ich bei jenen Unternehmen, bei denen in nächster Zukunft mit Änderungen der Aktionärsstruktur aufgrund von weiteren Privatisierungsschritten gerechnet werden kann, auf diese hingewiesen.
Im Anschluß daran erfolgt für jedes Unternehmen eine Analyse der Aktienperformance ab dem Zeitpunkt des Börseganges. Dabei wird einerseits auf die deskriptive Performancebeschreibung, andererseits auf eine grafische Darstellung mittels, zumeist monatlicher, Reuters-Charts Wert gelegt. Die Kurswerte vor dem 1. Januar 1999 wurden zum Zwecke der einheitlichen Darstellung in Euro umgerechnet.
Da bei Reuters aufgrund standardisierter, nicht veränderbarer, Einstellungsparameter eine Darstellung des Kursverlaufes erst ab Anfang 1991 möglich ist, konnte bei jenen Unternehmen, die vor 1991 an die Börse gingen (OMV AG, AUA, Verbundgesellschaft) nicht die gesamte Performance grafisch dargestellt werden.
Um einen aussagekräftigen Vergleich der Kursentwicklung der österreichischen Unternehmen mit internationalen Konkurrenzunternehmen jeweils derselben Branche durchführen zu können, habe ich weitere Reuters-Charts gewählt, die die Performance der ATX-Werte in US-$ darstellen und diese, beginnend mit dem 30. 12. 1994, dem Startzeitpunkt des Morgan Stanley Capital International (MSCI) Vergleichs-Index, mit einem Wert von 100 indexieren. Bei jenen drei Unternehmen, die erst 1995 bzw. 1997 privatisiert wurden (VA Stahl AG, Böhler-Uddeholm AG, Austria Tabak AG), wurde der Beginn des Performancevergleichs auf den jeweiligen Zeitpunkt der Emission verlegt.
Zum Zwecke des Performancevergleichs wurden von mir, je nach Branchenzugehörigkeit der österreichischen Unternehmen, - wie bereits erwähnt - die entsprechenden weltweiten Branchenindizes von Morgan Stanley herangezogen. Jeder Branchenchart beinhaltet weltweit jene Unternehmen der „Old Industries“, die, je nach Höhe ihrer Marktkapitalisierung (Anzahl der Aktien x Börsenkurs), im MSCI-Index unterschiedlich gewichtet sind.[115]
Da die Indizes die jeweilige Branchenperformance aufgrund standardisierter, nicht veränderbarer, Einstellungsparameter erst ab dem 30. 12. 1994 abbilden, wurde diese Einstellung von mir auch bei den Reuters-Charts gewählt, wodurch das obige Datum somit als offizieller Startzeitpunkt des Performancevergleichs gilt.
Es ist wichtig zu erwähnen, daß es sich bei den Morgan Stanley-Branchencharts, genau wie bei den Charts von Reuters, um „Price Indices“ handelt, die zwar Kapitalerhöhungen im Kursverlauf berücksichtigen, Dividendenzahlungen jedoch bei der Kursbildung außer acht lassen. Laut Herrn Mag. Gillhofer von der Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. ist somit ein Vergleich der Performance österreichischer ATX-Werte mittels Reuters-Charts mit den Werten der jeweiligen MSCI-Branchenindizes zulässig.[116]
Im Zuge der Beschreibung der Dividendenpolitik der 11 (teil-)privatisierten Unternehmen wird am Beginn jedes Kapitels auch ein kurzer Überblick über die wichtigsten Unternehmensdaten, die in engem Zusammenhang mit der Dividendenpolitik stehen, gegeben. Dabei habe ich auf die seit dem Beginn der Privatisierung jährlich bzw. quartalsweise veröffentlichten Konzern- bzw. Einzelabschlüsse der untersuchten Unternehmen zurückgegriffen.
Um Ergebnisverzerrungen aufgrund von durchgeführten Kapitalerhöhungen zu vermeiden, basiert die Analyse der Dividendenpolitik auf den Berechnungen der Dividendenrenditen zweier, voneinander unabhängiger, Geschäftsjahre. Als jeweils erstes Vergleichsjahr habe ich das Geschäftsjahr des Börseganges des österreichischen Unternehmens herangezogen, wobei bei einer Emission nach dem 30. Juni die Daten des darauffolgenden Jahres verwendet wurden. Als zweites Geschäftsjahr habe ich jeweils das zum Stichtag 22. November 2000 zuletzt veröffentlichte Geschäftsjahr (1998/99, 1999 bzw. 1999/2000) gewählt.
Bei den österreichischen Unternehmen wurden die Dividendenrenditen, jeweils bezogen auf Ultimo-, Höchst- und Tiefstkurs der beiden Geschäftsjahre, berechnet. Die vor dem 1. 1. 1999 in den Geschäftsberichten in ATS angegebenen Kurse und Dividendenzahlungen wurden von mir zum Zwecke einer einheitlichen Darstellung zum fixen Umtauschverhältnis 1 € = 13,7603 ATS in Euro umgerechnet dargestellt, was auf die sich ergebenden Dividendenrenditen, dem eigentlichen Ziel meiner Analyse, keine Auswirkungen hatte. Darüber hinaus habe ich auch die in den -brigen Geschäftsjahren verfolgte Dividendenpolitik der genannten österreichischen Unternehmen kurz beleuchtet.
Um die österreichischen Dividendenrenditen, in diesem Falle die Dividendenzahlungen lediglich bezogen auf die jeweiligen Ultimokurse, mit jenen ausländischer Unternehmen vergleichen zu können, habe ich bei den 11 ATX-Werten den jeweils bedeutendsten europäischen Mitbewerber derselben Branche in Erfahrung gebracht und dessen, der obigen Vorgehensweise entsprechend berechneten, Dividendenrenditen, als Vergleichswerte herangezogen. Im Falle eines unterschiedlichen Bilanzstichtages der österreichischen und der ausländischen Unternehmen habe ich bei den europäischen Konkurrenten jene Geschäftsjahre gewählt, die mit den Geschäftsjahren der österreichischen Unternehmen am ehesten „deckungsgleich“ waren.
Zuletzt möchte ich darauf hinweisen, daß die vorliegende Arbeit sowohl hinsichtlich der Kursentwicklung der behandelten Aktien, als auch hinsichtlich des laufenden Privatisierungsprozesses mit Stichtag 22. November 2000 abgeschlossen wurde.
4.1. AUSTRIA MIKRO SYSTEME INTERNATIONAL AG
4.1.1. Das Unternehmen - Der Austria Mikro Systeme International Konzern
Austria Mikro Systeme International (AMS) ist seit 20 Jahren als Unternehmen der Halbleitererzeugnisindustrie auf die Entwicklung und Herstellung von integrierten Schaltkreisen - ASICs - und anwendungsspezifischen Standardprodukten - ASSPs - spezialisiert und bietet eine breite Palette an maßgeschneiderten Lösungen für den Automobil-, Kommunikations- und Industrieanwendungsmarkt an. Das Unternehmen gehört zu den europäischen Marktführern auf dem Gebiet der gemischt analog/digitalen ASICs und offeriert Systemlösungen in den Bereichen Forschung & Entwicklung, Design, Prozessentwicklung, Produktion und Montage. Das Unternehmen gliedert sich in die drei Geschäftsfelder „Automobil“, „Kommunikation“ und „Industrie“, die für Verkauf, Marketing und Design der erzeugten Produkte für den jeweiligen spezifischen Kundenkreis zuständig sind.[117]
Im Jahre 1995 entstand durch den Erwerb der beiden Beteiligungsunternehmen South African Micro-Electronic Systems (Pty) Ltd. (SAMES) und THESYS Gesellschaft für Mikroelektronik mbH die THESYS-AMS-SAMES Unternehmensgruppe. Jedoch wurden beide Unternehmen aufgrund der nicht den Erwartungen entsprechenden Ergebnisse in den Jahren 1998 bzw. 1999 wieder veräußert und somit entkonsolidiert.[118] Derzeit hält die AMS AG an neun ausländischen Unternehmen Beteiligungen zwischen 50 und 100 %. Die 100 %igen Tochtergesellschaften „führen für die AMS AG Marktforschung sowie technische Beratung durch, unterst-tzen den Vertrieb der Produkte weltweit und stellen eine Erweiterung der Designkapazität dar“.[119] (Vgl. Anhang 14: Unternehmen, an denen die Austria Mikro Systeme International AG mindestens 20 % der Anteile besitzt[120] ). Da sie jedoch keine Außenumsatzerlöse tätigen und daher „für die Vermittlung eines möglichst getreuen Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Konzerns von untergeordneter Bedeutung“ sind, wurden die neun Tochtergesellschaften im Jahresabschluß 1999 der AMS nicht konsolidiert.[121]
AMS betreibt Designzentren in Unterpremstätten, Dresden und Budapest sowie Verkaufsbüros in Paris, Mailand, Stockholm, London, M-nchen, Hamburg, Budapest, San José/Kalifornien und Yokohama/Japan.[122]
[...]
[1] Vgl. Langer, E., Die Verstaatlichungen in Österreich, Wien 1966, 26.
[2] Vgl. Langer, 1966, 24.
[3] Vgl. Gurlit, W., Auswirkungen und Erfolgsfaktoren der Privatisierung staatlicher Unternehmen - Eine Analyse des Verkehrssektors in OECD-Ländern, Reihe: Internationales Management, Forschungsstelle für Internationales Management, St. Gallen, hrsg. von Brauchlin, E., Bd. 13, Konstanz 1995, 76.
[4] Vgl. Langer, 1966, 24-26.
[5] Vgl. Wieser, O., Unternehmenskultureller Wandel durch Privatisierung in Form von Management-Buy-Outs innerhalb der Verstaatlichten Industrie Österreichs, Reihe: Theorie und Forschung, Bd. 469, Reihe Wirtschaftswissenschaften, Bd. 45, Regensburg 1997, 4-9.
[6] Vgl. Bachinger, K./Hemetsberger-Koller, H./Matis, H., Grundriß der österreichischen Sozial- und Wirtschaftsgeschichte von 1848 bis zur Gegenwart, Wien 1987, 113.
[7] Vgl. Sandgruber, R., Österreichische Wirtschaftsgeschichte vom Mittelalter bis zur Gegenwart, hrsg. von Wolfram, H., Wien 1995, 458.
[8] Vgl. Bachinger/Hemetsberger-Koller/Matis, 1987, 112-113.
[9] Vgl. Langer, 1966, 41-42.
[10] Vgl. ÖIAG-Journal, 1946-1986 - 40 Jahre Verstaatlichte Industrie, Journal 2/1986, Wien 1986, 7.
[11] Vgl. Wieser, 1997, 10.
[12] Vgl. ÖIAG-Journal, 1986, 6.
[13] Vgl. Wieser, 1997, 10.
[14] Vgl. Otruba, G., Österreichs Wirtschaft im 20. Jahrhundert, Wien 1968, 37.
[15] Vgl. Langer, 1966, 81.
[16] Vgl. Eigner, P./Helige, A., Österreichische Wirtschafts- und Sozialgeschichte im 19. und 20. Jahrhundert, 175 Jahre Wiener Städtische Versicherung, 1. Aufl., Wien - M-nchen 1999, 193.
[17] Vgl. Smekal, C., Die verstaatlichte Industrie in der Marktwirtschaft - Das österreichische Beispiel, Forschungsinstitut für Wirtschaftsverfassung und Wettbewerb, Heft 12, Köln 1963, 21-22.
[18] Vgl. Sandgruber, 1995, 459.
[19] Vgl. Wieser, 1997, 10.
[20] Vgl. Weber, W., Die Verstaatlichung in Österreich, Berlin 1964, 80.
[21] Vgl. Hollerer, S., Verstaatlichung und Wirtschaftsplanung in Österreich (1946 - 1949), Dissertationen der Hochschule für Welthandel in Wien, Bd. 15, Wien 1974, 57.
[22] Vgl. Langer, 1966, 68.
[23] Vgl. Hollerer, 1974, 69.
[24] Vgl. BGBl. Nr. 81/1947.
[25] Vgl. Hollerer, 1974, 73.
[26] Vgl. Wieser, 1997, 15.
[27] Vgl. ÖIAG-Journal, 1986, 11.
[28] Vgl. Otruba, 1968, 39-40.
[29] Vgl. ÖIAG-Journal, 1986, 11.
[30] Vgl. Butschek, F., Die österreichische Wirtschaft im 20. Jahrhundert, Österreichisches Institut für Wirtschaftsforschung, Wien 1985, 186.
[31] Vgl. Weber, 1964, 121.
[32] Vgl. Weber, 1964, 116-117.
[33] Vgl. Butschek, 1985, 187.
[34] Vgl. Weber, 1964, 123.
[35] Vgl. Langer, 1966, 238-241.
[36] Vgl. Institut für Österreichkunde, Die Wirtschaftsgeschichte Österreichs, Wien 1971, 198.
[37] Vgl. Weber, 1964, 131.
[38] Vgl. ÖIAG-Journal, 1986, 18.
[39] Vgl. Langer, 1966, 127.
[40] Vgl. Wieser, 1997, 14.
[41] Vgl. Weber, 1964, 95-96.
[42] Vgl. Weber, 1964, 100-101.
[43] Vgl. ÖIAG-Journal, 1986, 10.
[44] Vgl. Butschek, 1985, 186.
[45] Vgl. ÖIAG-Journal, 1986, 10.
[46] Vgl. ÖIAG-Journal, 1986, 10.
[47] Vgl. Wieser, 1997, 14.
[48] Vgl. ÖIAG-Journal, 1986, 10.
[49] Vgl. Von Lösch, A., Privatisierung öffentlicher Unternehmen - Ein Überblick über die Argumente, in: Schriftenreihe der Gesellschaft für öffentliche Wirtschaft und Gemeinwirtschaft, Heft 23, 1. Aufl., Baden-Baden 1983, 28.
[50] Vgl. Hirche, K., Die Komödie der Privatisierung - Der Kampf um die öffentliche Wirtschaft, 2. Aufl., Köln 1959, 70.
[51] Vgl. Wieser, 1997, 91.
[52] Vgl. Wieser, 1997, 91.
[53] Vgl. Hamer, E./Gebhardt, R., Privatisierungspraxis - Hilfe zur Umstellung von Staats- auf Privatwirtschaft,
Schriftenreihe des Mittelstandsinstitutes Niedersachsen, Bd. 26, 2. Aufl., Essen 1992, 78.
[54] Vgl. Gurlit, 1995, 96-112.
[55] Vgl. Hawlik, J./Sch-ssel, W., Staat laß nach - Vorschläge zur Begrenzung und Privatisierung öffentlicher Aufgaben, Wien 1985, 176.
[56] Vgl. Wieser, 1997, 15.
[57] Vgl. Wieser, 1997, 19.
[58] Vgl. Sandgruber, 1995, 491.
[59] Vgl. BGBl. Nr. 204/1986.
[60] Vgl. Wieser, 1997, 37.
[61] Vgl. Wieser, 1997, Anhang XVII.
[62] Vgl. Sandgruber, 1995, 492.
[63] Vgl. Wieser, 1997, 49-52.
[64] Vgl. Wieser, 1997, Anhang XIX.
[65] Vgl. BGBl. Nr. 973/1993.
[66] Vgl. Wieser, 1997, 88-90 bzw. Butschek, 1985, 189.
[67] Vgl. Hirche, 1959, 60.
[68] Vgl. Cointreau, E., Privatisierung - Alternativen zur Staatswirtschaft, D-sseldorf - Wien - New York 1987, 15.
[69] Vgl. Schneider, F., Deregulierung und/oder Privatisierung öffentlicher Unternehmungen in westeuropäischen Ländern: Der Stand der Debatte und erste Ergebnisse, in: Schriftenreihe Volkswirtschaft, Heft 8, Wien 1989, 16. [70] Vgl. Gurlit, 1995, 25.
[71] Vgl. Gurlit, 1995, 3.
[72] Vgl. Wieser, 1997, 89-90.
[73] Vgl. Gurlit, 1995, 32.
[74] Vgl. Wieser, 1997, 16.
[75] Vgl. Lösch von, A., Privatisierung und die Zukunft der öffentlichen Wirtschaft, in: Schriftenreihe der
Gesellschaft für öffentliche Wirtschaft und Gemeinwirtschaft, hrsg. von Brede, H., Heft 29, 1. Aufl., Baden-
Baden 1988, 132.
[76] Vgl. Langer, 1966, 176-178.
[77] Vgl. Otruba, 1985, 49.
[78] Vgl. Lösch von, 1988, 136.
[79] Vgl. Langer, 1966, 180-181.
[80] Vgl. Gurlit, 1995, 32.
[81] Vgl. Lösch von, 1988, 136.
[82] Vgl. Lösch von, 1983, 20.
[83] Vgl. Wieser, 1997, 17.
[84] Vgl. ÖIAG-Bericht 1994-1999, Privatisierung - Beteiligungsmanagement - Neue Aufgaben, Wien 1999, 16- 18.
[85] Vgl. ÖIAG-Bericht 1994-1999, 1999, 8.
[86] Vgl. ÖIAG-Bericht 1994-1999, 1999, 8-10.
[87] Vgl. ÖIAG-Bericht 1994-1999, 1999, 18-19.
[88] Vgl. Wieser, 1997, 101-102.
[89] Vgl. ÖIAG-Bericht 1994-1999, 1999, 26.
[90] Vgl. ÖIAG-Bericht 1994-1999, 1999, 31.
[91] Vgl. ÖIAG-Bericht 1994-1999, 1999, 27.
[92] Vgl. ÖIAG-Geschäftsbericht 1998, Wien 1998, 13.
[93] Vgl. ÖIAG-Bericht 1994-1999, 1999, 40.
[94] Vgl. ÖIAG-Bericht 1994-1999, 1999, 51.
[95] Vgl. ÖIAG-Bericht 1994-1999, 1999, 47.
[96] Vgl. ÖIAG-Geschäftsbericht 1998, 1998, 14.
[97] Vgl. ÖIAG-Geschäftsbericht 1998, 1998, 5.
[98] Vgl. ÖIAG-Bericht 1994-1999, 1999, 84.
[99] Vgl. ÖIAG 2000 - Neue Aufgaben, Geschäftsbericht der Österreichischen Industrieholding
Aktiengesellschaft für das Jahr 2000, Wien 2000, 5.
[100] Vgl. ÖIAG 2000, 2000, 6.
[101] Vgl. ÖIAG 2000, 2000, 2, 6.
[102] Vgl. ÖIAG 2000, 2000, 5.
[103] Vgl. Beteiligungsstruktur der ÖIAG Österreichische Industrieholding Aktiengesellschaft, Wien 2000, 4.
[104] Vgl. Cointreau, 1987, 38.
[105] Vgl. Höller, K., Die Auswirkungen der britischen Privatisierungspolitik auf betroffene Organisationen unter
besonderer Berücksichtigung der Entwicklung von British Airways, British Rail und des nationalen
Bussystems, Diplomarbeit an der Universität Linz, Winklarn 1992, 43.
[106] Vgl. Guski, H-G., Privatisierung in Großbritannien, Frankreich und den USA, Institut der deutschen
Wirtschaft, Beiträge zur Wirtschafts und Sozialpolitik, Köln 1988, 22.
[107] Vgl. Hawlik/Sch-ssel, 1985, 121.
[108] Vgl. „Die wahre Verbreitung der Aktie“, Studie des Linzer Meinungsforschungsinstitutes Spectra über die
Verbreitung der Aktie in Österreich, Linz 1999, 1, 8-9.
[109] „Bausparvertrag führt vor Lebensversicherung“, Die Presse, 22. 4. 2000, 20.
[110] Vgl. „Platonische Liebe der Österreicher zu Aktien“, Die Presse, 29. 9. 2000, 28.
[111] Vgl. Drennig, M., Privatisierungsbestrebungen in Österreich, in: Privatisierung und Vermögensbildung in Arbeitnehmerhand, Berichte - Analysen - Dokumente, Politische Akademie, Forschungsbericht 28/1985, hrsg. von Popp, G., Wien 1985, 30. [112] Vgl. Hawlik/Sch-ssel, 1985, 149.
[113] Vgl. Wieser, 1997, 99.
[114] Vgl. Domforth, C., „Grasser will Wiener Börse aus Dornröschenschlaf herausholen“, Die Presse, 15. 6. 2000, 17.
[115] Vgl. Index Coverage, 2000-04-10, http://www.msci.com/cover/index.html.
[116] Vgl. Gespräch mit Herrn Mag. Gillhofer über die Vergleichbarkeit von Reuters-Charts mit MSCI- Branchenindizes, Linz, 17. 11. 2000.
[117] Vgl. Unternehmensprofil der AMS, 2000-10-30, http://www.amsint.com/corporate/German/profile.html.
[118] Vgl. Unternehmensgeschichte der AMS, 2000-10-30, http://www.amsint.com/corporate/German/ history.html.
[119] Vgl. Austria Mikro Systeme International AG - Geschäftsbericht 1999, Unterpremstätten 2000, 59.
[120] Vgl. Austria Mikro Systeme International AG - Geschäftsbericht 1999, 2000, 58.
[121] Vgl. Austria Mikro Systeme International AG - Geschäftsbericht 1999, 2000, 38.
[122] Vgl. Austria Mikro Systeme International AG - Geschäftsbericht 1999, 2000, 2-3.
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Originalausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2000
- ISBN (eBook)
- 9783832451875
- ISBN (Paperback)
- 9783838651873
- DOI
- 10.3239/9783832451875
- Dateigröße
- 1 MB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- Johannes Kepler Universität Linz – Sozial- und Wirtschaftswissenschaften
- Erscheinungsdatum
- 2002 (März)
- Schlagworte
- verstaatlichung öiag privatisierung
- Produktsicherheit
- Diplom.de