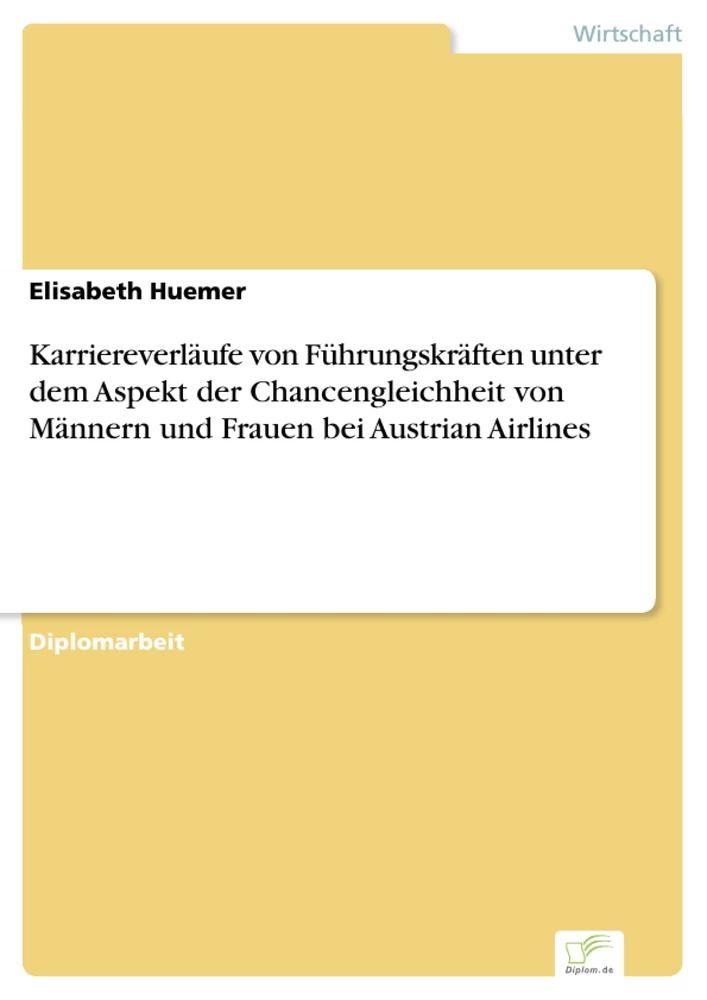Karriereverläufe von Führungskräften unter dem Aspekt der Chancengleichheit von Männern und Frauen bei Austrian Airlines
Zusammenfassung
Chancengleichheit für Männer und Frauen ist ein Thema, welches schon immer meine Aufmerksamkeit erregt hat. Im Rahmen meines Organisationsstudiums wurde ich durch das Seminar Geschlecht und Organisation auf die Möglichkeit aufmerksam, in diesem Bereich eine Diplomarbeit zu schreiben.
Ebenso gilt mein persönliches Interesse der Luftfahrt. Bei Austrian Airlines wurde mir übrigens ohne Zögern die Chance gegeben, diese beiden Themen zu kombinieren. So kam es zur Diplomarbeit mit dem Titel Karriereverläufe von Führungskräften unter dem Aspekt der Chancengleichheit von Männern und Frauen bei Austrian Airlines.
Im ersten Teil der Arbeit soll die theoretische Grundlage zum Verständnis für dieses Thema gelegt werden. Zu Beginn beschäftige ich mich daher mit Chancengleichheit im allgemeinen und im speziellen mit Begründungen für diese für Betriebe. Im zweiten Kapitel wird auf die numerische Verteilung von Männern und Frauen in Führungspositionen eingegangen. Dazu wird besonders das Konzept der Numbers des strukturellen Ansatzes von R. M. Kanter erläutert. Kapitel drei beschäftigt sich sowohl mit positiven Einflussfaktoren auf die Karriere, als auch mit Karrierebarrieren. Das nächste Kapitel versucht dann, typische Karriereverläufe zu identifizieren, und im darauffolgenden werden die möglicherweise dahinterstehenden Lebensbilder beschrieben.
Im empirischen Teil versuche ich dann, diese erläuterten theoretischen Aspekte mit den bei der AUA gewonnenen praktischen Erkenntnissen in Verbindung zu bringen. Der Aufbau des zweiten Teiles entspricht daher im Grunde jenem des ersten. So wird jedem theoretischen Kapitel ein praktisches zugeordnet, in dem die dazu gewonnenen Einsichten und auch Statistiken dargestellt werden. Des weiteren versuche ich, Zusammenhänge zwischen Theorie und Praxis sofort in diesen Kapiteln zu erläutern. Das letzte Kapitel beschäftigt sich mit Schlussfolgerungen aus dieser Arbeit.
Inhaltsverzeichnis:Inhaltsverzeichnis:
Theoretischer Teil
1.Einleitung5
2.Chancengleichheit6
2.1Begriffsklärung6
2.2Begründungen für Chancengleichheit8
2.2.1Moralische Argumente9
2.2.2Rechtliche Argumente10
2.2.3Ökonomische Argumente11
2.3Chancengleichheit als Wertprinzip15
3.Numerische Verteilung von Männern und Frauen17
3.1Die Situation in Österreich17
3.2Numbers18
3.2.1Zusammensetzung von Gruppen18
3.2.2Die Token-Situation20
3.2.3Typische Verhaltensweisen in Organisationen23
3.3Die Quotenregelung als […]
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
1 Einleitung
‚Chancengleichheit für Männer und Frauen’ ist ein Thema, welches schon immer meine Aufmerksamkeit erregt hat. Im Rahmen meines Organisationsstudiums wurde ich durch das Seminar ‚Geschlecht und Organisation’ auf die Möglichkeit aufmerksam, in diesem Bereich eine Diplomarbeit zu schreiben.
Ebenso gilt mein persönliches Interesse der Luftfahrt. Bei Austrian Airlines wurde mir – übrigens ohne Zögern – die Chance gegeben, diese beiden Themen zu kombinieren. So kam es zur Diplomarbeit mit dem Titel ‚ Karriereverläufe von Führungskräften unter dem Aspekt der Chancengleichheit von Männern und Frauen bei Austrian Airlines’.
Im ersten Teil der Arbeit soll die theoretische Grundlage zum Verständnis für dieses Thema gelegt werden. Zu Beginn beschäftige ich mich somit mit Chancengleichheit im allgemeinen und im speziellen mit Begründungen für diese für Betriebe. Im zweiten Kapitel wird auf die numerische Verteilung von Männern und Frauen in Führungspositionen eingegangen. Dazu wird besonders das Konzept der ‚Numbers’ des strukturellen Ansatzes von R. M. Kanter erläutert. Kapitel drei beschäftigt sich sowohl mit positiven Einflußfaktoren auf die Karriere, als auch mit Karrierebarrieren. Das nächste Kapitel versucht dann, typische Karriereverläufe zu identifizieren, und im darauffolgenden werden die möglicherweise dahinterstehenden Lebensbilder beschrieben.
Im empirischen Teil versuche ich dann, diese erläuterten theoretischen Aspekte mit den bei der AUA gewonnenen praktischen Erkenntnissen in Verbindung zu bringen. Der Aufbau des zweiten Teiles entspricht daher im Grunde jenem des ersten. So wird jedem theoretischen Kapitel ein praktisches zugeordnet, in dem die dazu gewonnenen Einsichten und auch Statistiken dargestellt werden. Des weiteren versuche ich, Zusammenhänge zwischen Theorie und Praxis sofort in diesen Kapiteln zu erläutern. Das letzte Kapitel beschäftigt sich mit Schlußfolgerungen aus dieser Arbeit.
Theoretischer Teil
2 Chancengleichheit
2.1 Begriffsklärung
„Chancengleichheit durch Personalpolitik“ (Krell 1997), „ (...) Implementierung von Chancengleichheitsprogrammen“ (Scheinecker 1998, S. 199), „ (...) Förderung der Chancengleichheit im Betrieb“ (Frauenberger 1998, S.177), „ (...) Verbesserung der Chancengleichheit von Frauen (...)“ (Steibl 1998, S. 189), „Wege zur Chancengleichheit“ (Der Standard 3./4. Juli 1999) – Schlagwörter, welche sich in dieser oder ähnlicher Form durch nahezu die gesamte themenspezifische Literatur ziehen.Die Bedeutung des Begriffes Chancengleichheit wird dabei allerdings oft als selbstverständlich angenommen.
Vorausschicken möchte ich, daß im Zusammenhang mit dieser Arbeit, der Begriff Chancengleichheit fast ausschließlich auf Frauen und Männer im Betrieb bezogen wird. Selbstverständlich soll in Unternehmungen auch die Chancengleichheit von anderen MitarbeiterInnen, die nicht der dominanten Gruppe angehören, verwirklicht werden. Erwähnt werden soll, daß Maßnahmen, die die Chancengleichheit von Frauen fördern, auch anderen ‚Minderheiten’ nutzen und so zu einer multikulturellen Organisation führen können (Krell 1999, S.27ff).
Der Begriff Chancengleichheit wird also in diesem Kontext meist mit Frauenförderung synonym verwendet, wobei Frauenförderung allerdings eher den Weg und Chancengleichheit das Ziel meint.
So ist für Arioli (in: Bendl 1997, S.10) Chancengleichheit eine wünschenswerte Zielvorstellung, die im Zusammenhang mit den Geschlechterverhältnissen in Organisationen wohl am öftesten gebraucht wird. Für sie verlangt Chancengleichheit einerseits, „ (...) daß niemanden der Zugang zu einem bestimmtem Gut aufgrund von nicht angemessenen oder nicht vernünftigen Kriterien verweigert wird“, andererseits sollen diese Kriterien aber auch so sein, „ (...) daß Personen aus allen gesellschaftlichen Bereichen eine gleiche Chance zur Erfüllung dieser Kriterien haben.“ Konkretisiert auf die Arbeitsbedingungen für Frauen bedeutet dies, daß Chancengleichheit dann gegeben ist, wenn der Arbeitsmarkt nicht mehr so stark männerdominiert ist und auch weibliche Lebenslagen verstärkt berücksichtigt werden. Betrachtet man die meisten Unternehmungen, so stellt sich heraus, daß sie von Männern konstruiert wurden und daher auch vorwiegend männliche Bedürfnisse befriedigen (Fischer 1993, S.104).
„Verwirklichte Chancengleichheit würde bedeuten, daß den Angehörigen beider Geschlechter die Wahl zusteht, ihren Teil in der Familienbetreuung und im Erwerbsleben zu übernehmen. Frauen und Männer hätten die gleichen affektiven Möglichkeiten, sich nach ihren eigenen Zielvorstellungen und frei von geschlechtsspezifischen Hindernissen zu entfalten. Es würde keine Rollenverteilung nach Geschlecht, keine geschlechtsspezifische Arbeitsteilung mehr geben“ (Arioli in: Bendl 1997, S. 10). Daß diese Vorstellung wohl großteils noch lange ein Wunsch bleiben wird, wird in der Realität täglich bewiesen. Chancengleichheit ist in Betrieben oftmals noch ein ‚Luxusthema’ (Beispielsweise nahmen 1995 an einem Wettbewerb für besonders frauen- und familienfreundliche Betriebe in Wien nur 17 von 1300 dazu eingeladenen Betrieben teil; Rossmann 1996, S.100). Mit Chancengleichheit beschäftigen sich Betriebe – vielleicht etwas überspitzt formuliert – in finanziell sehr erfolgreichen Jahren oder bei einem Mangel an männlichen Arbeitskräften. Ein weiteres Motiv für ‚Frauenfreundlichkeit’ ist der Kampf um weibliche Kunden (Rossmann 1996, S.100).
Aus welchen Gründen auch immer, sind Chancengleichheitsprogramme zu begrüßen, denn bereits der Versuch zur Chancengleichheit führt zu personaler und auch gesellschaftlicher Vielfalt (Laurien 1988, Sp.132).
Wie bereits angedeutet, werden die Verwirklichungsversuche von Chancengleichheit in der Regel durch den Begriff Frauenförderung subsumiert. Leider ist der Begriff Frauenförderung etwas unglücklich gewählt, und oftmals wird mit ihm eine Bevorzugung der Frauen in Verbindung gebracht, oder - von Krell (1999, S. 36) noch krasser formuliert - ‚Entwicklungshilfe für minderbemittelte weibliche Wesen’. Frauenförderung bedeutet jedoch vielmehr, daß bestehende Barrieren für Frauen abgebaut werden, damit auch deren Potentiale angemessen berücksichtigt werden und zu ihrer Entfaltung kommen können (Innreiter-Moser 1999, S. 51).
Ähnlich argumentieren Krebsbach-Gnath und Schmid-Jörg (in: Bendl 1997, S.14), wenn sie Frauenförderung als Maßnahmen und Aktionsprogramme bezeichnen,
- „die helfen, die vorherrschenden personalpolitischen Entscheidungsmuster ‚bei gleicher Qualifikation im Zweifel für den männlichen Bewerber’ aufzubrechen und möglicherweise für eine befristete Zeit umzukehren,
- die der Tatsache Rechnung tragen, daß es viele qualifizierte und motivierte Frauen gibt, deren berufliche Chancen an sozialen Vorurteilen – die vielfach die betriebliche Personalpolitik leiten – scheitern,
- die den Zugang zu einem größeren Spektrum an qualifizierten Personal eröffnen,
- die den Entscheidungsträgern in Unternehmen helfen, bewußte oder unbewußte, willkürliche oder unwillkürliche Benachteiligungen von Frauen im Arbeitsleben abzubauen.“
In diesem Sinn versteht auch Krell (1999, S36f) Frauenförderung, wenn sie anstelle dieses Begriffes jenen der ‚Männerförderung’ verwendet. Sie meint damit, daß vor allem männliche Führungskräfte im Rahmen von Weiterbildungsveranstaltungen auch mit dem Thema der Geschlechtergleichstellung konfrontiert werden sollen. So hofft sie, daß sich nicht nur die Frauen weiterentwickeln (wenn sie durch Rhetorikkurse oder Karriereseminare ‚gefördert’ werden), sondern die Organisation als Ganzes sich mit diesem Thema beschäftigt und entsprechende Maßnahmen ganz selbstverständlich implementiert sind.
Chancengleichheitsprogramme sind ein Signal der Unternehmensspitze dafür, daß ein Klima in dem Frauen benachteiligt werden, nicht erwünscht ist (Assig 1993, S. 135).
2.2 Begründungen für Chancengleichheit
Warum sollen UnternehmerInnen nun aber konkret versuchen, Chancengleichheit für Männer und Frauen in ihren Betrieben zu erreichen?
Krell (1999, S.41) gibt dafür im wesentlichen drei Begründungen an:
- moralische
- rechtliche
- ökonomische
2.2.1 Moralische Argumente
Eigentlich sollte dieses Kapitel ja überflüssig sein! Leider gibt es aber (nicht nur unter EntscheidungsträgerInnen in Unternehmungen) noch immer Einstellungen, die von Chancengleichheit für Männer und Frauen weit entfernt sind: die Frau ist für den Haushalt zuständig, der Mann hat seinen Beruf, seine Karriere, er bringt das Geld nach Hause. Und wenn die Frau schon arbeiten geht, dann um zusätzlich etwas Geld zu verdienen oder um ein Hobby auszuüben. Außerdem gilt, so lange sich Männer für bestimmte Positionen interessieren, werden keine Frauen eingestellt. Doch nun genug der Polemik und übertriebenen (?) und verallgemeinernden Aussagen. Vielleicht ist ja dies doch nur die Meinung einer Minderheit, die nur den für dieses Thema sensibilisierten Personen gar nicht so klein erscheint.
Fest steht jedenfalls, daß es noch immer sogenannte ‚traditionelle Vorurteile’ Frauen gegenüber gibt. Frauen können bestimmte Tätigkeiten nicht machen, weil sie ‚dafür nicht geeignet sind’ oder weil sie aufgrund einer möglichen Schwangerschaft äußerst ‚unsichere Arbeitskräfte’ oder ‚Fehlinvestitionen’ darstellen. Manchen Frauen wird auch weniger bezahlt mit den Argumenten, daß ‚sie keine Familie ernähren müssen’ oder ‚weniger schwere Arbeit machen’ (oder überhaupt ohne Begründung). Solche Vorurteile wirken – oft unausgesprochen und damit auch unangreifbar – in der betrieblichen Realität. Diese erwähnten ‚sachlichen Rechtfertigungen’ für Ungleichbehandlung resultieren meist aus einer traditionellen Einschätzung von weiblicher und männlicher Rolle in der Gesellschaft (Nikolay-Leitner 1998, S.164f).
Aus diesen Aussagen ist erkennbar, daß moralische Einwände gegen Ungleichbehandlung auch oft aufgrund von traditionellen, ‚üblichen’ Denkweisen nicht erkannt werden! Oft ist nicht eine diskriminierende Denkweise Ursache von solchen Aussagen und Behandlungen sondern schlicht und einfach mangelndes Problembewußtsein.
So möchte ich in diesem Zusammenhang in Anlehnung an Laurien (1988, Sp.129f) Chancengleichheit für Männer und Frauen wie folgt beschreiben:
Chancengleichheit geht von der gleichen Personenwürde aller Menschen aus, wie sie auch der christlichen Position und der der Aufklärung entspricht. Gesellschaftlich, sozial oder geschlechtsspezifisch verursachte Hindernisse sollen dafür beseitigt werden.
2.2.2 Rechtliche Argumente
In Österreich ist die Gleichstellung und Gleichwertigkeit von Mann und Frau auch gesetzlich geregelt.
So heißt es beispielsweise in Artikel 7 des Bundes-Verfassunggesetzes: „Alle Bundesbürger sind vor dem Gesetz gleich. Vorrechte (...) des Geschlechtes (...) sind ausgeschlossen (...)“ (B-VG § 7 Abs.1).
Eine wesentliche rechtliche Grundlage ist auch das österreichische Gleichbehandlungsgesetz. Es ist am 1. 7. 1979 in Kraft getreten und heißt seit der ersten Novelle im Jahr 1985 offiziell ‚BG über die Gleichbehandlung von Frau und Mann im Arbeitsleben’. Das GleichbG gilt für Arbeitsverhältnisse aller Art, die auf privatrechtlichem Vertrag beruhen (Bei/Novak 1995, S. 86ff).
§ 2 Abs. 1 der momentan aktuellen Fassung des Gleichbehandlungsgesetzes (ArbBGxx §2 Abs.1) lautet wie folgt:
,,(1) Auf Grund des Geschlechtes darf im Zusammenhang mit einem
Arbeitsverhältnis niemand unmittelbar oder mittelbar diskriminiert
werden, insbesondere nicht
1. bei der Begründung des Arbeitsverhältnisses,
2. bei der Festsetzung des Entgelts,
3. bei der Gewährung freiwilliger Sozialleistungen, die kein Entgelt darstellen,
4. bei Maßnahmen der Aus- und Weiterbildung auf betrieblicher Ebene,
5. beim beruflichen Aufstieg, insbesondere bei Beförderungen,
6. bei den sonstigen Arbeitsbedingungen und
7. bei der Beendigung des Arbeitsverhältnisses.
Diskriminierung ist jede benachteiligende Differenzierung, die ohne
sachliche Rechtfertigung vorgenommen wird.''
Leider gibt es in Österreich immer wieder Vorfälle, in denen Frauen ihre durch das Gleichbehandlungsgesetz gewährleisteten Rechte verletzt sehen (siehe z.B. Nikolay-Leitner 1998, S.168ff). Es stehen dann den Betroffenen grundsätzlich mehrere Rechtsschutzmöglichkeiten offen, nämlich die gerichtliche Geltendmachung, die Antragstellung bei der Gleichbehandlungskommission oder auch eine Verbindung beider Mittel (Bei 1998, S.155). Grundsätzlich ist jedoch, wenn immer möglich, eine Aufmerksammachung der EntscheidungsträgerInnen und eine Einigung innerhalb des Betriebes zu empfehlen.
2.2.3 Ökonomische Argumente
Die beste Möglichkeit, für Chancengleichheitsprogramme zu argumentieren, bieten wohl ökonomische Begründungen. Unbedacht der Einstellung der Personalverantwortlichen zur Chancengleichheit von Männern und Frauen können hier Argumente angeführt werden, die das oberste Ziel der (wohl meisten) Unternehmen unterstützt – Gewinn zu erwirtschaften. Leider stellt Engelbrech (1998, S.6) fest, „ (...) that cost-benefit analysis is rarely carried out.” Produktivitätsgewinne, welche durch Chancengleichheit(sprogramme) begründet werden können, müssen in ihrer Ursache nicht für alle EntscheidungsträgerInnen transparent sein. Dennoch soll im folgenden versucht werden, die ökonomische Notwendigkeit von Chancengleichheit zu verdeutlichen und die möglichen Wirkungsweisen der Maßnahmen transparenter zu machen.
Jedenfalls sieht Bendl (1998, S.63f) durch ihre Untersuchungen die Hypothese, daß Frauenförder- bzw. Chancengleichheitsprogramme einen positiven Einfluß auf die Effektivität von Unternehmen haben, als bestätigt an. Dies läßt durchaus auch den Schluß zu, daß betriebswirtschaftliche Effizienz ohne Gleichberechtigung nicht erfüllbar ist.
2.2.3.1 Die Erhaltung qualifizierter MitarbeiterInnen
Es ist wohl allen klar, daß MitarbeiterInnen den Unternehmen auch Kosten verursachen (neben Lohnkosten u.a. ev. Ausbildungskosten, Weiterbildungskosten). Schon alleine aus diesem Wissen heraus, müssen Firmen versuchen, ihre qualifizierten MitarbeiterInnen zu halten und nicht an die Konkurrenz zu verlieren. Daß Chancengleichheitsprogramme qualifizierte Frauen und Männer motivieren können, bei einem bestimmten Unternehmen zu bleiben, ist bereits Argument genug, diese zu implementieren (Bendl 1998, S.57ff). Nicht vergessen werden darf dabei, daß den MitarbeiterInnen genügend Entwicklungsmöglichkeiten geboten werden müssen, denn das Fehlen dieser ist eine wichtiger Grund für das Verlassen eines Unternehmens. Wen würde es da wundern, wenn Frauen, die oft kaum Aufstiegsperspektiven vor sich haben und die im Vergleich zu ihren männlichen Kollegen in der selben Position auch noch weniger verdienen, das Unternehmen verlassen. Andererseits bewahrheitet sich die Vermutung nicht, daß Frauen ein größeres Investitionsrisiko für Unternehmen darstellen als Männer (aufgrund potentieller Schwangerschaften?). Frauen zeigen oft größere Loyalität zu Firmen als Männer, insbesondere wenn sie eigenverantwortlich Aufgaben übernehmen dürfen (Preuss 1987, S.460ff). So bleiben Männer im Aufsteigeralter der Firma im Schnitt 3,3 Jahre erhalten, Frauen hingegen 4,5 (vgl. Fischer 1993, S.103).
Gezielte Maßnahmen zur Chancengleichheit können zur Reduzierung von Fluktuationen beitragen. Beispielsweise wirken Weiterbildungsmaßnahmen während der Karenz dem ‚process of skill loss’ entgegen und helfen so ‚hire and fire costs’ zu vermeiden (Engelbrech 1998, S.7).
2.2.3.2 Die Öffentlichkeitswirksamkeit von Chancengleichheitsprogrammen
Bendl (1998, S.59f) vertritt die These, daß Chancengleichheitsprogramme in bezug auf betriebliche Marketingziele effektivitätsfördernd seien. Sie stützt sich dabei unter anderem auf Untersuchungen von Casper, der überzeugt ist, daß diese für ein positives Image von Unternehmungen fördernd sein können und daß dieser Imagevorteil nach innen und außen genutzt werden kann. Außerdem meint er: „Für das Image des Unternehmens wäre es nützlich, wenn viele Frauen in höheren Positionen wären“ (Casper, in: Bendl 1998, S.60).
Bendl folgert aufgrund ihrer Untersuchungen, daß die Steigerung des Bekanntheitsgrades von chancenpolitischen Maßnahmen von Unternehmen dazu führen können, daß (Bendl 1997, S. 231)
- es zu einer Verbesserung des Gesamtimages des Unternehmens kommt, weil männerdominierte Unternehmen als altmodisch gelten,
- sich mehr Frauen in männerdominierten Betrieben bewerben,
- der Bekanntheitsgrad des Unternehmens im allgemeinen gesteigert wird,
- die Einstellungen von Frauen dem Unternehmen gegenüber positiv beeinflußt werden.
Aus dieser Darstellung geht auch hervor, daß weibliche Nachwuchskräfte durch entsprechende frauenpolitische Maßnahmen verstärkt angesprochen und motiviert werden können, sich bei diesen Unternehmen zu bewerben. Dadurch vergrößert sich der Rekrutierungspool der Unternehmen enorm, es kann aus einer größeren Gruppe von qualifizierten Personen ausgewählt werden. Dies ist angesichts der erwarteten rückläufigen Zahl von männlichen Erwerbstätigen und der damit verbundenen möglichen Nichtbesetzung bzw. Besetzung mit weniger qualifizierten Personen von wichtigen Positionen (falls nur männliche Bewerber rekrutiert werden würden) ein wesentlicher Vorteil (Krell 1999, S.30f und Preuss 1987, S.463). Unternehmen, welche konkurrenzfähig bleiben wollen, können es sich langfristig einfach nicht leisten, auf ein großes Mitarbeiterpotential zu verzichten, vor allem dann, wenn die Konkurrenz aus dem vollen Reservoir an gut qualifizierten männlichen und weiblichen MitarbeiterInnen schöpft.
Ein positives Image von Firmen gerade bei der Zielgruppe der Frauen als Kundinnen ist aber auch aus absatzpolitischen Überlegungen interessant. Frauen sind eine starke Konsumentengruppe, ihr Einfluß auf Verkaufszahlen sollte nicht unterschätzt werden. Auch kann festgestellt werden, daß Unternehmen mit einem großen (und natürlich öffentlich bekanntem) Frauenanteil in gehobeneren Positionen von Frauen als Konsumentinnen bevorzugt werden (Engelbrech 1998, S.8). Jedenfalls ist klar, daß die Bewußtseinsbildung unter Frauen und Männern in bezug auf Chancengleichheit (auch aufgrund des steigenden Bildungsniveaus) immer größer wird und zumindest ein Teil der Bevölkerung den Worten wohl auch Taten folgen lassen wird. Dieser Trend sollte meiner Ansicht nach von zukunftsorientierten Unternehmen nicht ignoriert werden.
2.2.3.3 Erhöhung von Potential und Motivation
Aus Büchern und Artikeln der Management Literatur (z.B. Irle 1975) geht hervor, daß heterogene Gruppen bei Problemlösungsprozessen zu kreativeren und qualitativ hochwertigern Lösungen – wenn auch unter größerem Zeitaufwand als homogene Gruppen – gelangen können. Sind solche Lösungen in Unternehmen erwünscht, so können sie beispielsweise durch die Perspektivenvielfalt, welche in der Regel in gemischtgeschlechtlichen Gruppen größer ist, gefördert werden. Eine solche Perspektivenvielfalt kann u.a. durch unterschiedliche Interessen und Erfahrungen der beteiligten Personen argumentiert werden. Dies mit Eigenschaften von Personen zu begründen, ist in diesem Zusammenhang problematisch, da sie v.a. Frauen wieder in stereotype Vorstellungen hineindrängt, die zu großen Belastungen für diese führen können und bei Problemlösungsprozessen noch dazu hinderlich sind (Krell 1999, S.30ff).
Ähnlich wird in einem Bericht des Standard (27./28. Mai 2000) argumentiert: „Ein ausgewogenes Geschlechterverhältnis und unterschiedliche kulturelle Zugehörigkeit der Mitarbeiter erhöhen die Lösungskompetenz eines Teams und sind dadurch ein klarer Wettbewerbsvorteil.“
In der Literatur wird auch das Argument angeführt, daß Organisationen mit heterogenen Gruppen auch bei der Internationalisierung ihre Betriebe Vorteile haben. Wenn bereits Menschen im innerbetrieblichen Raum eine Vielfalt an unterschiedlichen Personen als selbstverständlich akzeptieren, dann erleichtert das ja schlußendlich auch das Agieren in anderen, fremden Kulturen (Krell 1999, S.32f). Gerade dieses Agieren in anderen Kulturen ist bei großen Firmen oft ein nicht unwesentlicher Teilaspekt einer Führungsaufgabe.
Ebenso ist allen (oder vielen) klar, daß motivierte Mitarbeiter wesentlich zum Firmenerfolg beitragen (z.B. Der Standard, 18.Mai 2000). Daß gute Aufstiegschancen, Vereinbarkeit von Familie bzw. Privatleben und Beruf, interessante Weiterbildungsmaßnahmen, usw. oder schlichtweg eine offene Unternehmenskultur eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein sollten, aber trotzdem starke Motivatoren für Männer und Frauen in diesem Betrieb sind, ist evident.
2.2.3.4 Flexibilitätsvorteile
Gerade im Zusammenhang mit verschiedenen Arbeitszeitmodellen, können sich für Unternehmungen Vorteile ergeben. Diese liegen darin, daß bei sich ändernden Umweltbedingungen die Unternehmen entsprechend rasch reagieren können. „ The possibility of more flexible management of working time for men and women which match their interests also contributes therefore to being better able to cope with economic requirements when the enterprise’s capacity is over or under-utilized” (Engelbrech 1998, S.8). Daß dies auch wirtschaftliche Vorteile mit sich bringt, liegt auf der Hand.
Problematisch in Bezug auf Chancengleichheit können Arbeitszeitflexibilisierungen aber dann werden, wenn sie nur Frauen betreffen und hier insbesondere Teilzeitbeschäftigungen. Natürlich wollen viele Frauen die Möglichkeit der Teilzeitbeschäftigung, wenn sie auch mit ihren Bedürfnissen übereinstimmen. Andererseits sind aber Karrierechancen in Teilzeitbeschäftigungen leider noch bei sehr wenigen Firmen gegeben. Arbeitszeitflexibilisierungsmaßnahmen sind daher unbedingt für beide Geschlechter anzubieten und auch zu fördern!
Im Wesentlichen kann gesagt werden, daß die Ergebnisse gelebter Chancengleichheit wesentliche Faktoren für den wirtschaftlichen Erfolg von zukunftsweisenden Unternehmen sind. „Organisationen sind gut beraten, wenn sie alles tun, Frauen den Weg für ihr Veränderungspotential zu ebnen. Eine Arbeitswelt, in der Frauen aufstehen und sich entfalten können, ist von Bewegung gekennzeichnet, von Innovation, von Respekt, von der Bereitschaft aller, sich auf Neues, auf Prozesse und auf Veränderungen einzulassen“ (Assig 1998, S.166).
2.3 Chancengleichheit als Wertprinzip
Es liegt wohl auf der Hand, daß erfolgreiche Maßnahmen zur Förderung von Chancengleichheit nur dann etwas nutzen, wenn auch die entsprechenden positiven Einstellungen dazu in der Belegschaft und vor allem der Unternehmensführung vorhanden sind. Chancengleichheit sollte im Bewußtsein der MitarbeiterInnen verankert und in der Unternehmenskultur gelebt werden. Dazu kann zum Beispiel Überzeugungsarbeit bei EntscheidungsträgerInnen geleistet werden. Ebenso kann es Workshops oder Vorträge zum Thema geben, aber das gelebte Vorbild ist sicherlich die beste Möglichkeit.
Generell wird in der Forschung festgestellt, daß die positive Einstellung zur Gleichberechtigung im Arbeits- und Familienleben bei Männern stark zunimmt, daß jedoch dieser Einstellung nur relativ wenig Taten folgen (z.B. Jurczyk 1998, S.307f).
Wirksame Chancengleichheitsprogramme haben aber nicht nur Auswirkungen auf die Arbeitssituation von Frauen, sondern auch auf jene der Männer. Es geht darum, z. B. die Arbeitszeitmodelle beider Geschlechter zu diskutieren, oder „ (...) Strukturen zu verändern oder gar Spitzenpositionen und damit Macht und Einfluß zu teilen“ (Steckmeister in: Fischer 1993, S.102). Dies wird jedoch von vielen (nicht nur jungen) Männern durchaus auch als Chance gesehen. Sie sind durch die Emanzipation gesellschaftlich nicht mehr so eng in ein Rollenkorsett gepreßt und haben mehr Entfaltungsmöglichkeiten (Der Standard, 27. 12. 1999).
Chancengleichheit sollte im Bewußtsein aller im Unternehmen Beschäftigten verankert sein. Dies kann durch Broschüren oder Unternehmensgrundsätze und das Leitbild unterstützt werden (Innreiter-Moser 1999, S.61). Vorraussetzung dafür ist allerdings, daß im Unternehmen auch versucht wird, daß Leitbild zu leben - nicht nur von jenen, die es entwickelt haben.
Weitere Aktivitäten um eine ernsthafte Umsetzung einer Chancengleichheitspolitik zu gewährleisten, ist eine Institutionalisierung der selbigen. Dies kann zum Beispiel durch eine Stabstelle für Chancengleichheitspolitik, durch Arbeitskreise oder Gesprächskreise erfolgen. Ebenso können in Unternehmen Konzepte zur speziellen Förderung von Mitarbeiterinnen ausgearbeitet werden. Solche stellen in der österreichischen Privatwirtschaft aber derzeit noch ein Novum dar (Innreiter-Moser 1999, S.60 und S.51).
3 Numerische Verteilung von Männern und Frauen
3.1 Die Situation in Österreich
In Österreich wurden im Jahr 1991 7,8 Millionen Einwohner gezählt, davon waren 52 % Frauen. Der Anteil der erwerbstätigen Bevölkerung insgesamt betrug 47 %. Die durchschnittliche Frauenerwerbsquote (Frauen zwischen 15 und 60) lag 1991 bei 62,7 %, jene der Männer bei 81,8 %. Die Zahl der berufstätigen Männer nahm gegenüber dem Jahr 1981 um 6,1 % zu, jene der Frauen um 10,8 %. Insgesamt waren 41,4 % der Erwerbstätigen Frauen (Schramm in: Frauenbericht 1995, S.228).
Die Zunahme der Frauenerwerbstätigkeit veränderte jedoch kaum die geschlechtstypische Dominanz in den einzelnen Berufen oder Branchen (=horizontale Segregation). Frauen wurden vor allem dort eingestellt, wo schon vorher Frauen beschäftigt waren, an der Struktur der Frauenbeschäftigung änderte sich somit wenig. Der Großteil der Männer und Frauen arbeitet in Berufen, die von ihrem Geschlecht dominiert werden. Es ist allerdings auffallend, daß männliche Kollegen für Frauen eine deutlich üblichere Erfahrung sind als umgekehrt. Dies belegen folgende Zahlen (Kapeller 1999, S72):
- Über 40 % der Männer sind in Berufen tätig, in denen sie mit einem Verhältnis von 1:9 völlig dominieren.
- Mehr als 50 % der Männer finden das eigene Geschlecht immerhin noch im Verhältnis 8:2 vor.
- Umgekehrt gibt es keine entsprechend hoch segregierten Frauenberufe.
- Allerdings finden 20 % der Frauen das eigene Geschlecht noch im Verhältnis 8:2 vor.
Daß diese prozentuell höchst ungleichmäßigen Verteilungen Auswirkungen auf das Verhalten der Männer und Frauen in den jeweiligen Gruppen haben, soll anhand der im folgenden Abschnitt beschriebenen Forschungen von Rosabeth Moss Kanter (1977) aufgezeigt werden. Ich möchte hier auch schon auf die Anwendbarkeit dieser Ausführungen für Organisationen betreffend der Führungsebenen hinweisen, da meist ein ebensolches typisches Verhältnis von Männern und Frauen in Führungspositionen herrscht.
3.2 ‚Numbers’
Die numerische Verteilung von Männern und Frauen in Organisationen beeinflußt zweifelsfrei auch ihre sozialen Interaktionen in der Gruppe, schlicht und einfach den Umgang miteinander, die Verhaltensmöglichkeiten der betroffenen Personen.
Unter ‚numbers’ ist laut Kanter (1977, S. 206ff) die numerische Verteilung von Personen einer bestimmten Kategorie bzw. Gruppe auf eine Gesamtgruppe gemeint. Solche Kategorien können z. B. durch das Geschlecht, aber auch durch die Hautfarbe oder die Zugehörigkeit zu einer bestimmten ethnischen oder religiösen Gruppe bestimmt werden. Kanter führte ihre Untersuchungen in Bezug auf Frauen in Unternehmungen durch. Sie identifizierte dabei drei wesentliche strukturelle Merkmale, die entscheidenden Einfluß auf die Situation der Frauen (und Männer) in Unternehmungen haben.
- Opportunities (Möglichkeiten, Chancen)
- Power (Macht)
- Numbers (numerische Verteilungen)
In diesem Abschnitt möchte ich besonders auf die möglichen zahlenmäßigen Verteilungen von Männern und Frauen in Organisationen eingehen und ihre Auswirkungen auf die Betroffenen darstellen. So können dann „the dramas of the many and the few in the organization“ besser verstanden werden (Kanter 1977, S.208).
3.2.1 Zusammensetzung von Gruppen
Kanter (1977, S. 208) unterscheidet im wesentlichen 4 Typen von Gruppen. Ihre Unterscheidung erfolgt aufgrund der verschiedenen proportionalen Aufteilungen von beispielsweise Männern und Frauen.
3.2.1.1 Uniform Group
Diese Gruppe weist nur eine bestimmte Art von Mitgliedern aus. Alle verfügen dabei über das gleiche spezifische Merkmal, z.B. männliches Geschlecht.
3.2.1.2 Skewed Group
Diese Gruppe zeichnet sich durch eine sehr starke Untergruppe und eine eher schwach vertretene Untergruppe aus. Die Mitglieder der ersteren werden in diesem Fall als ‚dominants’ bezeichnet, da sie die Gruppe und deren Kultur fast ausschließlich prägen. Für Mitglieder der kleinen Gruppe hat Kanter den Begriff der ‚token’ geprägt. Sie stechen aus dieser Gruppe stark hervor. ‚Token’ werden in der Regel als RepräsentantInnen ihrer Kategorie betrachtet, eher als ‚Symbole’ denn als Individuen. (Weitere Ausführungen bezüglich der Verhaltensweisen in diesen Gruppen werden in den folgenden Abschnitten gemacht.)
Von einer ‚skewed group’ spricht man bei einer Aufteilung von bis zu 85:15 % (Richtwert).
3.2.1.3 Titeled Group
In der ‚titeled group’ entwickeln sich ‚dominants’ langsam zur ‚majority’ und ‚tokens’ zur ‚minority’. Minderheiten-Mitglieder können hier Allianzen und Koalitionen bilden, außerdem können sie auch Einfluß auf die Verhaltensweisen innerhalb der Gruppe ausüben und die Kultur mitprägen. Sie werden als Individuen betrachtet, die sich innerhalb ihrer Gruppe differenzieren, aber als ganze Gruppe von der Mehrheit unterscheiden. Das numerische Verhältnis in solchen Gruppen ist zwischen ca. 15 und 40 % für die Minderheit und zwischen 85 und 60 % für die Mehrheit.
3.2.1.4 Balanced Group
In ausgeglichenen Gruppen – das Verhältnis beträgt 60:40 bis 50:50 – spielt die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gruppe keine Rolle mehr. Das Verhalten und die Kultur wird stärker von anderen persönlichen und strukturellen Merkmalen beeinflußt, beispielsweise von entstandenen anderwärtigen Untergruppen oder Rollenzuweisungen.
Group Types as Defined by Proportional Representation of
Two Social Categories in the Membership
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
3.2.2 Die Token-Situation
Frauen befinden sich in Unternehmungen, speziell in Führungspositionen, oft in einer sogenannten Token-Situation. Wie diese aussehen kann, soll anhand der folgenden Abbildungen gezeigt werden.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Diese Situationen sind grundsätzlich, wie von Kanter (1977, S. 206ff) ausführlich beschrieben wird, von drei wahrnehmbaren Tendenzen geprägt: Sichtbarkeit, Kontrast und Assimilation.
3.2.2.1 Sichtbarkeit
Üblicherweise sticht das O aus diesen Bildern hervor. Es kann auch übersehen werden, aber wenn es gesehen wird, wird ihm mehr Aufmerksamkeit geschenkt als jedem X. Die Situation des O ist in vielen Fällen mit Frauen in Führungspositionen vergleichbar. „Aufsteigerinnen sitzen immer auf dem Präsentierteller, haben auf gleicher Ebene selten Frauen als Gesprächspartnerinnen und müssen zudem die Reibungsverluste kompensieren, die durch ihre bloße Anwesenheit in Männergruppen entsehen“ (Fischer 1993, S.113). Diese ständige Sichtbarkeit führt zu einem hohen Leistungsdruck und auch Konfliktpotential für Personen in Token-Situationen. Eine daher von ‚token’ angewandte Strategie ist, im Hintergrund zu agieren, sich unsichtbar zu machen. Dies führt allerdings auch dazu, daß die trotzdem erbrachten Leistungen keine Aufmerksamkeit und Anerkennung finden, was dann - aufgrund der Stereotypisierung (siehe: Assimilation) - wiederum dazu führt, daß weniger ‚token’ eingestellt oder befördert werden. Dies verstärkt dann den Token-Mechanismus.
Andererseits kann die erhöhte Aufmerksamkeit für Frauen in Token-Situationen auch von Vorteil sein (Riehle 1996). Während Männer größere Anstrengungen unternehmen müssen, können Frauen den Publicityeffekt leichter auch zum eigenen Vorteil nutzen. Es erfordert von diesen Frauen aber auch viel soziale Kompetenz, dadurch die Beziehungen zu ihren KollegInnen nicht zu belasten. Leider kann aber auch beobachtet werden, daß Frauen die Vorteile aufgrund ihres Solo-Status nicht gefährdet sehen wollen und daher anderen Frauen den Eintritt ins Management erschweren. In der Literatur wird dies als ‚Bienenkönigin-Syndrom’ bezeichnet (Wiegand 1995, S. 201).
3.2.2.2 Kontrast
Der Kontrast der Os zu den X ist auffällig. Man kann hier auch von Polarisierung oder Hervorheben der Unterschiede sprechen. Die Dominanten werden sich in dieser Situation – anders als in ‚uniform groups’ – ihrer Gemeinsamkeiten stärker bewußt (X–Awarness). Als Folge können diese dann auch stärker betont werden, um die Gruppe gewissermaßen vor den ‚tokens’ zu schützen. Die Dominanten werden als ähnlicher empfunden als sie es tatsächlich sind. Außerdem schenken sie den ‚token’ erhöhte Aufmerksamkeit. In der Regel müssen diese erst ihre Kompetenz beweisen, bevor sie in die Gruppe integriert werden. Weiters ist die Tendenz von Mitgliedern der dominanten Gruppe hoch, in Unterhaltungen zwischen ‚token’ eine Verschwörung zu vermuten, hingegen ist es ganz normal, wenn ‚dominants’ sich unterhalten. Kontrast führt sowohl zu einer Betonung der dominanten Kultur als auch zu einer Isolation der ‚token’. In ‚titeled groups’ verschwimmen diese Tendenzen zusehends. Ich würde es so ausdrücken: ‚Token’ sind keine Ausnahmen mehr.
3.2.2.3 Assimilation
In Token-Situationen ist es leichter, über Os Generalisierungen anzustreben als über X. X sind in ihrer Anzahl überlegen und weisen daher ein größeres Sample an Individuen und Variationen auf. Os sind alleine und werden daher oft als RepräsentantInnen, als Symbole für ihre Kategorie gesehen. Auch wenn sie eine kleine Anzahl bilden, können sie sich nicht so stark individualisieren wie X, daher können sie auch die Versuche zur Generalisierung ihres Verhaltens nur schwer widerlegen. Grundlagen für Assimilation sind oftmals Verallgemeinerungen, Vorurteile und Stereotype. Kanter (1977, S. 211) stellt dazu fest, daß ‚token’ ironischerweise sehr stark als anders identifiziert werden, ihnen aber gleichzeitig ihre Individualität nicht zugestanden wird, sondern daß sie eben mit Stereotypen belegt werden. Die charakteristischen persönlichen Eigenschaften eines ‚token’ werden zugunsten von Verallgemeinerungen übersehen. Gegen Stereotype anzukämpfen, erfordert allerdings viel Kraft. Schließlich wollen ‚token’ ja auch von der Gruppe akzeptiert und in sie integriert werden. Oft ist es für die Betroffenen daher akzeptabel, mit diesen Vorurteilen bis zu einem gewissen Grad zu leben, dadurch werden diese allerdings auch wieder bestätigt. Kanter (1977, S. 233ff) beobachtet für Frauen in Token-Situationen beispielsweise folgende Stereotype am häufigsten:
- Mutter – man kann mit allen Problemen zu ihr kommen
- Verführerin (bis zur Hure)
- ‚Pet’ oder Maskottchen, kleine Schwester – braucht vor allem Hilfe
- ‚Iron Maiden’ – sie versucht erfolgreich, sich den drei obigen Typen zu widersetzen und gerät dadurch meist in diese Rolle.
Gleichzeitig ist auch festzustellen, daß aufgrund der Generalisierung nicht erfolgreiche ‚token’ dazu beitragen, daß eben Personen ihrer Kategorie nicht mehr in diesen Gruppen akzeptiert werden.
Dies konnte auch die Astronautin Eileen Collins, die erste weibliche amerikanische Kopilotin (vor 21 Jahren!), feststellen, nachdem eine der wenigen Kolleginnen einem Testflug nicht bestanden hatte und diese Tatsache sich in Windeseile auf dem Stützpunkt verbreitete. „Plötzlich merkte ich, was für ein ungeheurer Druck auf mir lastet. Ich kann es mir nicht leisten zu versagen, denn sonst würde ich allen anderen jungen Frauen ihre Chance hier versauen“ (in: Assig 1996, S. 168f).
3.2.3 Typische Verhaltensweisen in Organisationen
Kanter stellt fest, daß es aufgrund der ungleichen numerischen Verteilung (!) von zwei Gruppen in ‚skewed groups’ zu charakteristischen Verhaltensweisen kommen kann. Es gibt allerdings auch Ausführungen, die diese Behauptungen dahingehend einschränken, daß sie nur für jene Gruppen gelten, in denen typischerweise Männer arbeiten und Frauen nur Minderheitenstatus haben (Riehle 1996) . Jedoch auch unter dieser Einschränkung finden sich in der Realität noch genug Beispiele, und es erscheint mir relevant diese typischen Verhaltensweisen aufzuzeigen.
So treffen auf Mitglieder der dominanten Gruppe in der Regel folgende Aussagen zu (Kanter 1977, S. 249).
- Sie werden leichter als Teil einer Gruppe gesehen und akzeptiert.
- Sie werden für hoch-kommunikative Managementjobs bevorzugt.
- Es fällt ihnen leichter, Vertrauen auch für Aufgaben mit hoher Unsicherheit zu erlangen, beispielsweise für Management Jobs.
- Sie haben leichteren Zugang zu informellen Netzwerken (die meist wiederum aus Mitgliedern der dominanten Gruppe bestehen), sie bilden leichter ‚peer-groups’ und lernen so auch leichter von- und miteinander.
- Es ist wahrscheinlicher, daß sie von Organisationsmitgliedern mit höherem Status gefördert werden. (Mentoren sponsern oft ihnen ähnliche Personen.)
- Sie werden ohne Stereotypisierungen – als Individuen – wahrgenommen.
- Sie sind weniger mit persönlichem Streß konfrontiert.
Im Gegensatz dazu sind ‚token’ folgenden Umständen ausgesetzt (Kanter 1977, S. 248f).
- Sie sind sichtbar, am Präsentierteller.
- Sie fühlen sich höherem Druck zur Konformität ausgesetzt und verspüren höheren Druck, weniger Fehler machen zu dürfen.
- Sie versuchen oft, unsichtbar zu werden und nicht zu sehr aus der Menge herauszustechen.
- Sie finden es härter, Glaubwürdigkeit und Vertrauen für Positionen mit hohem Unsicherheitsfaktor (z.B. Managementjobs) zu erlangen.
- Sie agieren oft an der Peripherie der Organisationen, sind isolierter.
- Außerdem nehmen ‚token’ nicht so oft an informellen Netzwerken teil und haben so auch keinen Zugang zur ‚power-through-alliances’.
- Aufgrund der Ermangelung von ihnen ähnlichen Personen in Führungspositionen werden sie weniger oft gefördert.
- Sie sind oft mit Stereotypisierungen konfrontiert und geraten somit meist in für sie unpassende Rollenerwartungen, die ihre Effektivität hemmen.
- Sie sind höherem persönlichem Streß ausgesetzt.
3.3 Die Quotenregelung als Konsequenz?
Angesichts dieser Darstellungen ist es nur verständlich, wenn Frauen in Tokensituationen einen höheren Anteil ihres Geschlechts in den jeweiligen Gruppen fordern, um so auch den in den jeweiligen Organisationen und Ebenen schon vertretenen Frauen ihre Arbeit zu erleichtern.
Ein heftig und kontrovers diskutiertes Instrument dazu ist die Quotenregelung. Allerdings sind oft genug (emotionale) Vorbehalte gegen sogenannte ‚Quotenfrauen’, auch wenn sie fachlich qualifiziert sind, festzustellen. Die Akzeptanz dieser in den jeweiligen Gruppen wird meines Erachtens dadurch erschwert, es kommt für die Betroffenen zu keinem positiveren Klima als in Token-Situationen. Andererseits kann der schnell herbeigeführte erhöhte Frauenanteil in den jeweiligen Organisationen dazu führen, daß Erfahrungen mit Frauen gesammelt und eventuelle Vorbehalte gegenüber ihrem Einsatz abgebaut werden können (Regnet 1994, S. 323f). Durch Quotenregelungen sollen Frauen nur bei gleicher Qualifikation den Männern bevorzugt werden und dies auch nur, solange ihr Anteil unter einem bestimmten Prozentsatz ist. Am zielführendsten ist aber, wenn sich Unternehmen selber konkrete Zielsetzungen für die Einstellung von qualifizierten Frauen vorgeben, beispielsweise eine Erhöhung des Frauenanteils in der ersten und zweiten Managementebene auf mindestens 25 % innerhalb von ca. 10 Jahren. Wenn Quotenregelung in diesem Sinne verstanden wird, ist sie, auf anderen Maßnahmen aufbauend, sicherlich ein sinnvolles Instrument. Eine ablehnende Haltung gegenüber (verpflichtenden) Quotenregelungen darf kein Vorwand sein, um auf eine ‚balanced group’ im Management zu verzichten. Entscheidend ist hier allerdings wieder die grundsätzliche Einstellung und daraus resultierende Verhaltensweisen der EntscheidungsträgerInnen zu Chancengleichheit in Betrieben.
4 Karriere
Bevor nun das Thema Karriere näher beleuchtet werden soll, möchte ich noch zwei grundsätzliche Begriffsklärungen vornehmen. Erstens was ist unter Karriere an sich und im speziellen in dieser Arbeit zu verstehen, und zweitens welche Inhalte werden mit dem Begriff Führungskraft assoziiert.
4.1 Begriffsklärungen
4.1.1 Karriere
„Was Karriere sei und was sie wert sei, ist umstritten“ (Stengel 1997, S.65)
Um eine Definition, was nun unter Karriere tatsächlich zu verstehen ist, haben sich in der Literatur schon viele AutorInnen bemüht. Im Prinzip kann bei den Definitionsversuchen auf zwei Sichtweisen zurückgegriffen werden, die aus der französischen Wurzel des Begriffes (carrière) hervorgehen (Goebel 1997, S.23):
- die Karriere als ‚Laufbahn’: etwas weitergefaßtes Verständnis von Karriere
- die Karriere als ‚Rennbahn’: spezifischeres Karriereverständnis
Dem ‚Laufbahnverständnis’ wird in der Literatur beispielsweise durch folgende Begriffsbestimmung rechtgegeben:
„Unter Karriere wird jede beliebige Stellen – oder Positionsfolge einer Person im betriebliche Positionsgefüge verstanden. Diese Begriffsfassung schließt neben ranghierarchischem Aufstieg auch Stellenwechsel im Sinne von Seitwärts – und Abwärtsbewegungen ein. Es kann sich als sinnvoll erweisen, die Sicht nicht auf einen einzelnen Betrieb zu beschränken, sondern auch Unternehmenswechsel (ggfs. in Zusammenhang mit Branchen- und regionalem Wechsel) mit einzubeziehen“ (Berthel 1987, Sp. 1183).
In diesem Sinne hat Schein (in: Woodd 1999, S.3) recht, wenn sie meint, daß Karriere etwas ist, „that we all have but often fail to recognise.“
Andererseits wird im allgemeinen Sprachgebrauch der Begriff Karriere mit ‚Rennbahn’ assoziiert, er wird fast immer als rasche Folge von Aufwärtsbewegungen in der Hierarchie einer Organisation verstanden (Weitbrecht 1992, Sp. 1114).
Hierarchischer Aufstieg wird im allgemeinen gleichgesetzt oder zumindest begründet mit beruflichem Erfolg (Autenrieth 1993, S.158). Es wird auch oftmals der Begriff der vertikalen Karriere dafür verwendet. Im Gegensatz dazu steht die horizontale Karriere, welche durch Seitwärtsbewegungen innerhalb des Positionsgefüges einer Unternehmung erklärt wird.
Zielführend für diese Arbeit – sie handelt schließlich vom Weg der Frauen in Führungspositionen – ist es, sich auf den Karrierebegriff im Sinne der ‚Rennbahn’, des hierarchischen Aufstieges zu konzentrieren.
4.1.2 Führungskraft
Genauso wie für den Karrierebegriff gibt es für den Begriff der Führungskraft verschiedenste Interpretationsmöglichkeiten. In der Literatur finden sich dazu unterschiedliche Definitionen und Abgrenzungen. Diese berücksichtigen sowohl gesetzliche, als auch verhaltenswissenschaftliche Überlegungen, z.B. Führung als Machtbeziehung, Führung als Motivationsbeziehung (Jopp 1994, S. 5ff). Gemeinsam ist allen unterschiedlichen Definitionen, daß Führungskräfte Personalverantwortung zu tragen haben und eine hierarchisch herausgehobene Leitungsfunktion wahrnehmen (Büdenbender 1996, S.148). In der Praxis können diese sowohl MeisterInnen und GruppenleiterInnen als auch lediglich Mitglieder der Leitungsgremien wahrnehmen (Wiegand 1995, S.123). Für Statistiken werden oft auch die Gehaltsstufe und außertarifliche Bezahlungen als Indiz für Führungskräfte herangezogen (Dienel 1996, S. 19). In der Praxis wird oftmals nach oberer, mittlerer und unterer Führungsebene differenziert. Die jeweils genauen Abgrenzungen können die Betriebe wohl nur für sich festlegen.
4.2 Die Situation in Österreich
Wegen der unterschiedlichen bzw. eher unklaren Abgrenzungen des Begriffs Führungskraft weisen auch verschiedene Untersuchungen etwas abweichende Daten auf. Das statistische Zentralamt gibt für 1999 insgesamt 42 400 Personen als Führungskräfte in Österreich an, davon sind ca. 85 % Männer und 15 % Frauen (Statistisches Jahrbuch 1999, S. 201). Dies wäre doch ein starker Anstieg gegenüber dem Jahr 1991 in dem von 5 % Frauen im mittleren Management und von 0 bzw. bis zu 3 % in Toppositionen die Rede war. Frauen sind vor allem in frauentypischen Bereichen wie Dienstleistung, Verwaltung und Gesundheitswesen in leitenden Positionen (Felderer-Edobor, 1991, S.96). Die Angaben zur Präsenz von weiblichen Führungskräften sind sehr stark branchenspezifisch und differieren natürlich in den unterschiedlichen Bereichen (Autenrieth 1993, S.104ff). Nichts desto Trotz ist immer noch eine starke Unterrepräsentanz von Frauen in Führungspositionen feststellbar, der Trend geht allerdings in Richtung höherer Frauenanteil in Managementpositionen. „Die Bestellung von Frauen in Spitzenpositionen löst nicht mehr die große Sensation aus“ (Standard, 14. 6. 2000).
4.3 Einflußfaktoren und Voraussetzungen für eine Karriere
Zu den wichtigsten Parametern für eine Karriere gehören die generellen Einflußfaktoren im Unternehmen, die Persönlichkeitsfaktoren und auch die in der jeweiligen Situation vorliegenden Karrierebarrieren. In den folgenden Abschnitten möchte ich diese näher erörtern, gleichzeitig aber darauf hinweisen, daß die Einflußfaktoren nicht vollständig abgedeckt sein müssen, da sich in den jeweiligen individuellen Situationen natürlich auch noch andere ergeben können. Weiters werde ich erläutern, wie sich diese jeweiligen Einflußfaktoren speziell auf Frauen, die eine Führungsposition anstreben, auswirken können. In mir besonders relevant erscheinenden Fällen werde ich auch Maßnahmen zur Chancengleichheit anführen, diese aber (großteils) nicht näher erklären, da dies den Rahmen dieser Arbeit sprengen würde.
4.3.1 Karrierefördernde Einflußfaktoren im Unternehmen
4.3.1.1 Leistung und Qualifikation
Zentral für den beruflichen Aufstieg geben sowohl Männer als auch Frauen immer wieder Leistung, Qualifikation und beruflichen Erfolg an. Auch Unternehmen begründen Entscheidungen über den Aufstieg ihrer MitarbeiterInnen oftmals aufgrund des Leistungsprinzip. Dabei sollen jene befördert werden, die den größten Beitrag zur Erreichung der Betriebsziele leisten (Wiegand 1995, S.128). Es ist jedoch für Betriebe schwierig, die individuelle Leistungsfähigkeit der BewerberInnen objektiv zu messen. So spielen bei Beförderungen immer wieder auch andere Kriterien eine Rolle.
Dies ist anscheinend gerade jungen karrierebewußten Frauen klar. In einer durchgeführten Untersuchung (Autenrieth 1993, S. 159ff) geben sie zwar – genauso wie die befragten Männer – der Leistung und Qualifikation die höchste Priorität in Bezug auf Beförderungen, sie schätzen allerdings die Relevanz der eigenen Leistung für die tatsächliche Karriere signifikant niedriger ein als Männer. Trotzdem behaupten erfolgreiche Karrierefrauen, daß ihnen der Trend zu einer exakteren und damit faireren Leistungsbeurteilung bei ihrem Aufstieg geholfen hat (Gronwald 2000, S290ff). Dadurch könnte dann auch die vielbehauptete Aussage, daß Frauen mindestens so gut arbeiten müssen (mußten) wie Männer, um aufstiegen zu können, endlich relativiert werden (Friedel-Howe 1993, S. 458).
Unternehmen sind sich der Unzulänglichkeit des Leistungsprinzips durchaus bewußt. Es wird daher in der Praxis auch oftmals durch das Senioritätsprinzip ergänzt. Dieses kann für Frauen und auch Männer dann eine Verzögerung ihrer Karriere bedeuten, wenn die Seniorität aufgrund der Betriebszugehörigkeit bestimmt wird, und ein eventueller späterer beruflicher Einstieg in dieses Unternehmen oder berufliche Pausen (z.B. durch Karenz) nicht berücksichtigt werden (Wiegand 1995, S.131ff). Eine (zumindest teilweise) Anrechnung dieser würde den Betroffenen sicher helfen. Bei ergänzenden Maßnahmen wie z.B. Weiterbildung oder geringfügiger Mitarbeit im Betrieb während der Karenzzeit, wäre dies auch durchaus gerechtfertigt.
4.3.1.2 Bekanntheitsgrad im Unternehmen
Den Bekanntheitsgrad der eigenen Person bei höheren Führungskräften bzw. der Geschäftsleitung und dem Vorstand erachten Frauen und Männer als entscheidende Komponente für ihre Karriereverläufe. Interessant ist, daß aber weibliche Führungsnachwuchskräfte diesem Umstand eine größere Bedeutung beimessen als ihre männlichen Kollegen. Dies stimmt auch durchaus mit der oben erwähnten Beimessung von geringerer Bedeutung der Leistung für den tatsächlichen Aufstieg in der Unternehmenshierarchie durch die befragten Frauen überein. Daraus schließt Autenrieth (1993, S. 159ff), daß Frauen die informellen Netze und deren Bedeutung innerhalb der Unternehmen sehr wohl kennen und sogar höher bewerten als ihre männlichen Kollegen.
Interessant ist auch, daß die im Sinne der Aufstiegsgeschwindigkeit erfolgreichen ManagerInnen einen im Vergleich weit überdurchschnittlichen Anteil ihrer Arbeitszeit in die Beziehungspflege investieren (Rosenstiel 1997, S. 18).
Daß der Bekanntheitsgrad einer Person und eine damit einhergehende Wertschätzung ihrer Persönlichkeit und Leistungen für eventuelle Bewerbungen eine Rolle spielt, kann auch durch die folgende beispielhafte Aussage verdeutlicht werden: „Frauen wurden (in diesem Betrieb) nicht einmal bewußt ignoriert, sondern nur einfach nicht als denkbare Konkurrenz gesehen“ (Nikolay-Leitner 1998, S. 170).
Haben allerdings Frauen erst einmal eine bestimmte Position erreicht, in welcher sie eine ‚Token-Stellung’ einnehmen, so wird ihnen auch erhöhte Aufmerksamkeit geschenkt, der Bekanntheitsgrad steigt zwangsläufig. Dies kann der Karriere dieser einzelnen Frauen auch dienlich sein.
Der Bekanntheitsfaktor ist aber (meist nur dann) für einen Karriereverlauf entscheidend, wenn er durch (auch informelle) Netzwerke und MentorInnen begründet wird. Daher erscheint es mir sinnvoll, auf die Bedeutung dieser für den Aufstieg in der Unternehmenshierarchie noch näher einzugehen.
4.3.1.3 Netzwerke und MentorInnen
„Karriere = Können + Kontakte“ (Lintschinger 1999, S.16).
Netzwerke sind im privaten wie auch im beruflichen Umfeld wichtig. Sie dienen dazu, Informationen und Erfahrungen auszutauschen, Kontakte herzustellen, Synergien zu nutzen, aber auch andere Mitglieder zu fördern und zu unterstützen (Lintschinger 1999, S. 18ff). Dies trifft auch auf einen wesentlichen Teilaspekt von Netzwerken – Mentoring – zu. Das heißt hier, daß sich eine erfahrene Führungskraft gezielt für eine jüngere einsetzt, sie unter Umständen in den Betrieb einführt, auf etwaige Eigenheiten aufmerksam macht, ihr Selbstvertrauen stärkt, Vorbild ist,... und natürlich auch für einen entsprechenden Bekanntheitsgrad sorgt. Ein Großteil von erfolgreichen ManagerInnen „feel that their success could in part be attributed to another person“ (White 1995, S.8).
Es zeigt sich aber, daß Frauen im Führungsnachwuchs schwerer Zugang zum ‚informalen Förderungsnetz’ finden (Friedel-Howe 1993, S. 458). Ein einfacher Grund dafür ist, daß MentorInnen meist ihnen ähnliche Personen fördern, daß heißt auch Männer meist Männer und Frauen Frauen. Da jedoch weniger Frauen in Führungspositionen sind, können auch weniger die Funktion einer Mentorin übernehmen, und weniger Frauen haben wieder Zugang zu informellen Netzwerken, deren Informationen und Beziehungen. So kann die daraus folgende Isolation von Frauen auch zu einer Hürde für ihren beruflichen Aufstieg werden.
4.3.1.4 Glück
Glück wird allgemein von Frauen und Männern als nicht unwesentlicher Erfolgsfaktor einer Karriere gesehen. Sie messen ihm generell gleich hohe Bedeutung bei (Autenrieth 1993, S. 162). Den Frauen wird allerdings unterstellt, eine erfolgreiche eigene Karriere eher auf Glück zurückzuführen, Männer hingegen eher auf eigenes Können (Autenrieth 1993, S. 35f). Frauen leiden angeblich unter einem Selbstunterschätzungssyndrom und beurteilen ihre eigenen Leistungen kritischer als Männer (Friedel-Howe 1993, S. 457).
4.3.1.5 Bestimmte Abteilung
Ob die Zugehörigkeit zu bestimmten Abteilungen tatsächlich einen Erfolgsfaktor für Karrieren darstellt, ist in der Literatur umstritten. In Interviews zeigte sich die Tendenz, daß Personalverantwortliche der Erfolgsrelevanz von Abteilungen eher widersprechen, Führungsnachwuchskräfte (männliche und weibliche) dies jedoch sehr wohl glauben (Autenrieth 1993, S.163).
4.3.2 Karrierefördernde Persönlichkeitsfaktoren
4.3.2.1 Besonders wichtige Führungseigenschaften
In der Führungstheorie wird viel über bedeutende Eigenschaften von Führungskräften und daraus resultierende unterschiedliche Führungsstile von Männern und Frauen gesprochen.
So gibt folgende Darstellung Einblicke in das den Frauen und Männern unterstellte Führungsverhalten (Buber 1991, S.91):
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Hadler (1995, S.190ff) berichtet von einer Untersuchung unter Führungsnachwuchskräften in Großunternehmen. Die Frage, ob sie an einen typisch weiblichen Führungsstil tatsächlich glauben, verneinen ein Großteil der Befragten. Bemerkenswert ist allerdings, daß Frauen, die diese Frage mit ‚Ja’ beantworten, den ‚weiblichen Führungsstil’ positiv bewerten, Männer hingegen negativ. In einer anderen Untersuchung wurde festegestellt, daß Frauen und Männer in Nachwuchspositionen tendenziell die gleichen Eigenschaften als wichtig für Führungspositionen erachten. Zu den wichtigsten zählen dabei Engagement, Einsatzbereitschaft, Selbstvertrauen, Kommunikationsfähigkeit, geistige Flexibilität, Teamfähigkeit, Kreativität, Führungskompetenz, Entscheidungsfreudigkeit,... Ebenso zählen Durchsetzungsvermögen und Streßfähigkeit dazu, es wird diesen jedoch von Frauen eine größere Bedeutung beigemessen, was aus einer höheren Bewußtseinsbildung durch persönliche Betroffenheit (Token-Situation und ihre Auswirkungen) resultieren kann (Autenrieth 1993, S.164ff). Prinzipiell stellt allerdings Wunderer (1997, S.75) in einer von ihm durchgeführten Untersuchung fest, „daß die Ähnlichkeiten im Führungsverhalten der Geschlechter weitaus größer sind als die Unterschiede.“
Allerdings ist es auch wesentlich, darauf hinzuweisen, daß es in der geschlechtervergleichenden Führungsforschung – und auch der öffentlichen Meinung – prinzipiell drei unterschiedliche Meinungen dazu gibt (Krell 1997, S. 299ff).
- Frauen führen schlechter als Männer
- Frauen führen nicht anders als Männer
- Frauen führen besser als Männer
Laut Krell (1997, S. 303) ist die derzeit in der Forschung dominierende These: ‚Frauen führen besser’. Dies erweist sich ihrer Ansicht nach allerdings als Danaergeschenk für weibliche Führungs(nachwuchs)kräfte. „Wenn die Forderung nach der Rekrutierung von mehr Frauen in Führungspositionen mit dem Verweis auf deren anderen Führungsstil begründet wird, dann folgen auf dem Fuß spezifische Erwartungen an diejenigen Frauen, die tatsächlich Führungspositionen inne haben. Daß sie die üblichen Managementaufgaben – mindestens – genauso gut zu erfüllen haben wie Männer, steht außer Frage. Aber damit nicht genug. Darüber hinaus werden weibliche Führungskräfte aufgrund ihrer Geschlechtszugehörigkeit für das Humane und das Soziale zuständig gemacht. Sie sollen das Betriebsklima verbessern – die Unternehmen und Verwaltungen ‚veredeln’“ (Krell, S. 304). Krell sieht auch gerade dadurch eine neue Form der Mehrfachbelastung, wenn den Frauen in der Minderheitenrolle in Führungspositionen auch noch die Verantwortung für die Veränderung der herrschenden Zustände aufgebürdet wird. Außerdem stellt sich ja auch noch aus der Perspektive der aufstiegswilligen Frauen die Frage, warum denn ihr Anspruch auf Chancengleichheit bei der Besetzung von Führungspositionen unbedingt damit begründet werden muß, daß sie besser führen als ihre männlichen Kollegen (Krell 1997, S. 304).
In der betrieblichen Praxis führt der Glaube an typische männliche bzw. weibliche Führungseigenschaften aufgrund des Geschlechts zur Diskriminierung von Bewerbern oder Bewerberinnen, je nachdem welcher ‚Führungstyp’ gewünscht wird. Laut einer Befragung der Wirtschaftswoche (in: Krell 1997, S. 301) – und entgegen dem Wunschdenken der Führungsforschung nach dem neuen weiblichen Stil – sind die gefragten Eigenschaften noch immer Durchsetzungsvermögen, Entscheidungskraft und Leistungsorientierung und nicht so sehr Teamfähigkeit und Einfühlungsvermögen. Also, der ‚typisch männliche Stil’ wird dem ‚typisch weiblichen Stil’ vorgezogen. Entsprechend läßt sich gemeinsam mit Rosenstiel (1997, S.19) folgern, „daß derjenige, der eine gute Führungskraft sucht, zunächst einmal an einen Mann und nicht an eine Frau denken wird.“ Er bezeichnet dies als Nachteil, der den Frauen aufgrund der ‚Geschlechtsstereotypisierung’ entsteht.
Ob nun Frauen tatsächlich typischerweise andere Eigenschaften und Merkmale aufweisen als Männer – wie in manchen empirischen Forschungen zweifelsfrei (?) belegt wird (Rosenstiel 1997, S. 21) – sei dahingestellt. Es erscheint hier auch insofern irrelevant, da es zwar um die Aufstiegsmöglichkeiten und Chancen von Frauen geht, jeder Mensch – und damit auch seine Karriere – aber seine individuellen Züge aufweist. Frauen (und Männer) sollen nicht ständig der Gefahr der Generalisierung und Stereotypisierung unterliegen und dem damit verbundenen entsprechen bzw. sich zur Wehr setzen müssen. Die Verabschiedung von Denkweisen in typisch männlichen und weiblichen Führungseigenschaften und deren Berücksichtigung bei der Rekrutierung bzw. Beförderung ist somit eine (leichte?) Maßnahme, um Chancengleichheit zu fördern.
[...]
[1] Ich möchte hier persönlich feststellen, daß es sich bei den oben dargestellten Ausführungen um eine von Kanter entwickelte Theorie handelt, die sie auch praktisch überprüft hat, und eben diese typischen Verhaltensweisen bestätigt gefunden hat.
Es ist allerdings fast jeder Theorie inhärent, daß es auch Ausnahmen gibt, daß anderes Verhalten ebenfalls (zum Glück für die Unvorherberechenbarkeit des Lebens) feststellbar ist, die oben genannten Situationen jedoch die „typischen“ sind.
[2] In der Literatur wird zwischen Führung und Management (und auch Leitung) unterschieden. Dies ist jedoch für diese Arbeit nicht zielführend, diese Begriffe werden hier synonym verwendet.
[3] Für mich schlüssig kann dieses Ergebnis aber durchaus mit der ‚Volksweisheit’: ‚Man merkt erst dann was man gehabt hat, wenn man es nicht mehr hat’ begründet werden.
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Originalausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2000
- ISBN (eBook)
- 9783832451868
- ISBN (Paperback)
- 9783838651866
- DOI
- 10.3239/9783832451868
- Dateigröße
- 1.7 MB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- Johannes Kepler Universität Linz – Sozial- und Wirtschaftswissenschaften
- Erscheinungsdatum
- 2002 (März)
- Schlagworte
- führungskräfte chancengleichheit austrian airlines karriere frauen
- Produktsicherheit
- Diplom.de