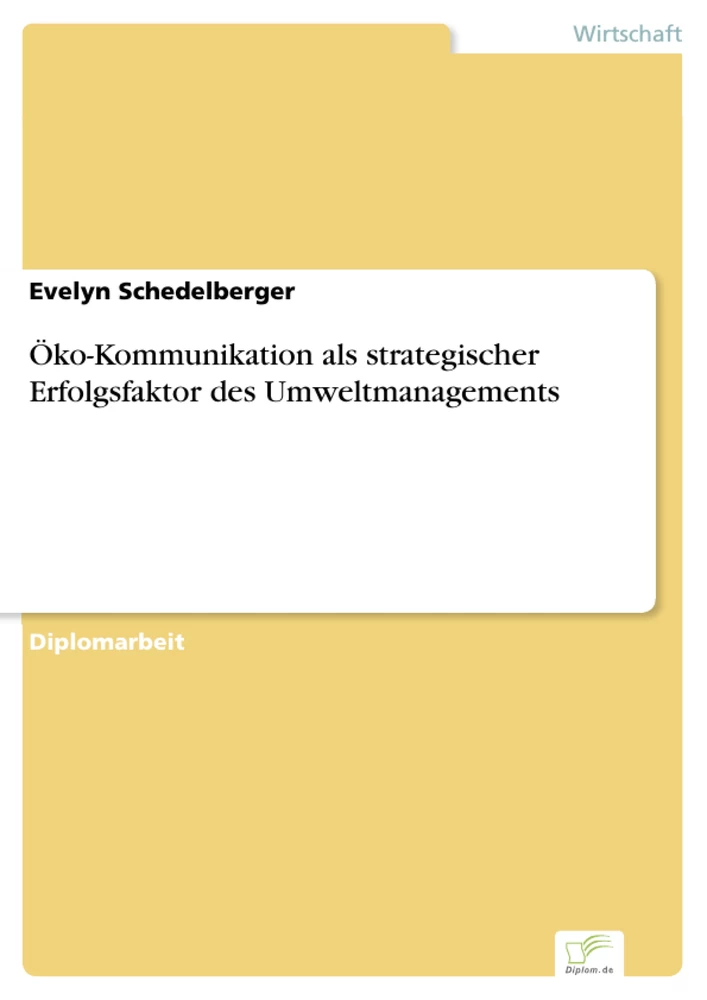Öko-Kommunikation als strategischer Erfolgsfaktor des Umweltmanagements
Zusammenfassung
Ökologie ist heute kein Fremdwort mehr für die Unternehmen. Zumindest verbal bekunden immer mehr Unternehmen, dass Umweltschutz einen wichtigen Stellenwert in der Geschäftspolitik einnimmt. Das bedeutet große Chancen, aber auch Risiken, die die Unternehmen in wirtschaftlich schwierigen Zeiten nur zögernd in Kauf nehmen wollen. Ein grünes Mäntelchen wird nicht mehr genügen... die ökologische Lösungskompetenz und -bereitschaft muss glaubwürdig dargestellt werden.
Ausgehend von einer Untersuchung gesellschaftlicher Veränderungen und Entwicklungen in der Unternehmensführung wird in meiner Arbeit auf Kommunikation in ökologischen Belangen eingegangen, da dieser in der Literatur nur selten als eigenständiges Gebiet behandelt wird.
Mit Beginn der 90er Jahre geht der Trend der Umweltkommunikation in Richtung eines ganzheitlichen Ansatzes in einem erweiterten strategischen Kontext, zunächst über die Bewusstseinsbildung der Mitarbeiter und dann mit Hilfe von Umweltmanagementsystemen, wie z.B. EMAS oder ISO14000. Zwei Untersuchungen der Univ. Münster (1988, 1994) bestätigen daneben eine höhere ökologische Betroffenheit der Unternehmen durch Umweltgesetzgebung und Forderungen der Marktteilnehmer.
Die Zielgruppen der Öko-Kommunikation umfassen nun neben den traditionellen Anspruchsgruppen des Unternehmens, wie Kunden, Lieferanten, Mitarbeitern und Anteilseignern auch neue Gruppen, wie z.B. Nachbarn, Anrainer, Behörden, Umwelt- und Verbraucherverbände, Medien, Schulen und Universitäten. Diese Kommunikation muss umfassend, ehrlich und auf die Zielgruppe abgestimmt sein. Mögliche Gestaltungsformen reichen von der Umweltberichterstattung (-bericht, -erklärung) über das Öko-Marketing, Öko-PR bis zur Risikokommunikation und Öko-Sponsoring.
Erfolgreiche Öko-Kommunikation muss im Unternehmen selbst mit einer Öffnung nach innen beginnen. Ausgehend von der Grundsatzentscheidung des Management muss der ökologische Wandel auf allen Unternehmensebenen verankert werden und eine ökologische Unternehmenskultur aufgebaut und gefördert werden. Damit die Mitarbeiter ökologiebewusst handeln, müssen sie entsprechend informiert, motiviert, sensibilisiert und ausgebildet werden und die strukturellen und prozessbezogenen Rahmenbedingungen geschaffen werden.
Im Rahmen einer Öffnung nach außen muss eine offensive Kommunikationspolitik betrieben werden, um in der Öffentlichkeit Akzeptanz und Verständnis für das eigene Handeln zu erreichen, glaubwürdig […]
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Einleitung
1. Ökologieorientiertes Management im gesellschaftlichen Kontext - Entwicklung und Einflußfaktoren
1.1. Gesellschaftlicher Wandel der letzten Jahrzehnte
1.1.1. Kurzbeschreibung des Wertewandels der letzten Jahrzehnte
1.1.2. Auswirkungen der Wertepluralisierung auf das Konsumentenverhalten
1.1.3. Wertepluralisierung als Herausforderung an die Unternehmensführung
1.2. Die ökologische Öffnung der Betriebswirtschaftslehre
1.2.1. Von der verhaltenswissenschaftlichen zur ökologischen Öffnung
1.2.2. Konzeption eines gesellschaftsbewußten Management
1.2.3. Das Anspruchsgruppenkonzept
1.2.4. Vernetztes und ganzheitliches Denken und Handeln im Unternehmen
1.3. Die Veränderung der Rahmenbedingungen in den Handlungsfeldern der Unternehmung
1.3.1. Externe Veränderungen
1.3.2. Interne Veränderungen
1.4. Gesetzliche Rahmenbedingungen im Wandel
1.4.1. Die EU-Richtlinie über den freien Zugang zu Informationen über die Umwelt - Umweltinformationsgesetz (UIG)
1.4.2. EU-Richtlinie über die Umweltverträglichkeitspr-fung (UVP) bei bestimmten öffentlichen und privaten Projekten – UVP-Gesetz
1.4.3. Umweltzeichenverordnung der Europäischen Union
1.4.4. „Environmental Management Auditing Scheme“ der Europäischen Union (EMAS-Verordnung/Öko-Audit)
1.4.5. ISO 14000-Normen
1.5. Gegenwärtige Veränderungen im gesellschaftlichen Kontext erfordern ökologieorientiertes Management
1.5.1. Die normative Ebene
1.5.2. Die strategische Ebene
1.5.3. Die operative Ebene
1.5.4. Aktivitäten, Strukturen und Verhalten
1.5.5. Der Kommunikationsaspekt im Management
2. Grundlagen ökologieorientierter Kommunikation
2.1. Definitionen von Kommunikation, Unternehmenskommunikation und Umweltkommunikation
2.2. Geschichte der Unternehmenskommunikation und Notwendigkeit ökologieorientierter Kommunikation
2.3. Öko-Kommunikation als Kernelement ökologisch bewußter Strategien
2.4. Ökologieorientierte Kommunikation im Organisationskonzept
2.5. Grundsätze, Ziele und Zielgruppen ökologischer Information und Kommunikation
2.6. Gestaltungsformen der Öko-Kommunikation
2.6.1. Umweltberichterstattung
2.6.2. Öko-Marketing
2.6.3. Öko-Werbung
2.6.4. Verkaufsförderung/Persönlicher Verkauf
2.6.5. Öffentlichkeitsarbeit
2.6.6. Risikokommunikation/Risiko-PR
2.6.7. Öko-Sponsoring
2.6.8. Zusammenarbeit mit verschiedenen Institutionen
2.6.9. Umweltorientierte Mitarbeiterkommunikation
2.6.10. Neuere Formen (Umweltberichte, Testimonials, etc.)
2.6.11. Der derzeitige Stand der Berichterstattung über Umweltaspekte
3. Ökologieorientierte Unternehmenspolitik erfolgreich kommunizieren
3.1. Anforderungen und Voraussetzungen für eine glaubwürdige Kommunikation
3.1.1. Anforderung an die Unternehmen: Öko-Glaubwürdigkeit
3.1.2. Voraussetzungen für glaubwürdige Öko-Kommunikation im Unternehmen
3.1.3. Kriterien für glaubwürdige Öko-Kommunikation
3.1.4. Argumente für Öko-Kommunikation – Kapitalfehler in der Öko-Kommunikation
3.2. Öffnung und Kommunikation nach innen
3.2.1. Vorbildfunktion des Managements
3.2.2. Mitarbeiterkommunikation – Umweltmanagement als kooperativer Prozeß
3.2.3. Aus- und Weiterbildung/Betriebliche Umweltbildung
3.2.4. Ökologieorientiertes Personalwesen und Organisationsentwicklung
3.3. Öffnung und Kommunikation nach außen
3.3.1. Die zentrale Rolle der Public Relations
3.3.2. Die Rolle der Medien
3.4. Dialogfähigkeit als Schl-sselqualifikation des Management bzw. der Mitarbeiter
3.4.1. Partizipation als Basis des Dialogs
3.4.2. Struktur und Instrumente der Umweltdialogkommunikation
3.4.3. Mediationskonzepte zur Konfliktlösung
3.4.4. Risiko-Dialog
3.5. Implikationen für eine ganzheitliche ökologiebezogene Kommunikation
3.6. Der Beitrag der EMAS-Audit-Verordnung zur ökologischen Kommunikation
3.6.1. Integration von interner und externer Kommunikation
3.6.2. Die Umwelterklärung
3.6.3. Umwelterklärung als Instrument symmetrischer Kommunikation
3.6.4. Umwelterklärung als Informations- und/oder Kommunikationsinstrument
4. Zusammenfassung und Ausblick
4.1. Ein gr-nes Mäntelchen wird nicht mehr gen-gen
4.2. Von der Umwelt- zur Nachhaltigkeitsberichterstattung
Anhänge zu den einzelnen Kapiteln
Die Leistungen der Anspruchsgruppen für das Unternehmen und die dafür erwarteten Gegenleistungen
Branchenbezogene Betroffenheitspositionierung im Längsschnittvergleich
Checkliste für die Ermittlung von Ansatzpunkten für ökologische Maßnahmen in der Unternehmung
Beispiel für eine institutionalisierte Einbindung der Mitarbeiter im Umweltbericht 1994/95 der Bosch-Siemens-Hausgeräte GmbH
Tutzinger Erklärung, Valdez Principles:
Liste der eingetragenen EMAS-Standorte in den EU-Mitgliedstaaten und Norwegen:
Beispiel NEFF-Umweltbericht 1991:
Beispiel HENKEL-Gruppe. Grundsätze zum Umweltmanagement.
Beispiel zur Kommunikation nach außen: BP Chemicals / UK – 1992
Übersicht über die Handlungs- und Verhaltensmaximen/Anforderungen an die Führungskräfte der Zukunft
Beispiel Wandel der Unternehmenskultur: CIBA-GEIGY-Konzern
Beispiel Öffnung nach innen: HOECHST-Umweltbericht
Beispiel für interne Kommunikation: RANK XEROX-Umweltbericht
Beispielkatalog für eine Mischung aus in die Berufsaus-bung integrierte Umweltbildung und Sonderformen der Umweltbildung
Kurzzusammenfassung über die Lernmethoden in der Umweltbildung
Beispiele aus der Umwelterklärung vom Jahr 1997 der BMW Motoren GmbH, Standort Steyr
Beispiel für umfassende Umweltorientierung: Wilkhahn, Bad M-nder
Beispiel KODAK, 1991
Beispiel für Umweltbildung BRITISH TELECOM-Umweltbericht 1992
Checkliste: Wie gestaltet man betriebliche Umweltschulungen?
Fragen eines umweltorientierten Personalmanagement
Beispiel Risiko-Kommunikation im Krisenfall – AMOCO Corp., USA
Literaturliste
Abbildungsverzeichnis
Abbildung 1: Persönliche Betroffenheit durch Umweltverschmutzung (1980 - 1987)
Abbildung 2: Strategischer Stern als Herausforderung für die Unternehmensführung
Abbildung 3: Das Unternehmen als Teil der Gesellschaft
Abbildung 4: Die Beziehungen des Unternehmens mit den Anspruchsgruppen
Abbildung 5: Die Vernetzung der Bestimmungskriterien der Ganzheitlichkeit
Abbildung 6: Ökologierelevante Einfl-sse auf das Unternehmen.
Abbildung 7: Ökologische Handlungsfelder
Abbildung 8: Die Funktionen des UIG
Abbildung 9: Dreistufiges Steuerungs- und Kontrollkonzept des umweltbezogenen Unternehmenshandelns
Abbildung 10: Ablauf und Zusammenhang gemäß EMAS-Verordnung
Abbildung 11: Ablauffolge ISO-UmweltManagementystem als dynamischer Prozeß der kontinuierlichen Verbesserung
Abbildung 12: Spannungsfelder der ökologieorientierten Unternehmensführung
Abbildung 13: Handlungsebenen eines ökologisch bewußten Management
Abbildung 14: Zusammenhang von normativem, strategischem und operativem Management in horizontaler und vertikaler Sicht
Abbildung 15: Die Normative Dimension des Umweltmanagement
Abbildung 16: Beispiele ökologischer Führungssysteme
Abbildung 17: Der Kommunikationsaspekt im Gesamtzusammenhang
Abbildung 18: Kommunikationsmodell
Abbildung 19: Arten und Möglichkeiten der Kommunikation
Abbildung 20: Kommunikationsentwicklung bis zu den 90er Jahren
Abbildung 21: Betroffenheitsprofil im Längsschnittvergleich.
Abbildung 22: Das erweiterte Spannungsfeld unternehmerischen Wirkens
Abbildung 23: Erweiterte Managementpyramide
Abbildung 24: Kernelemente ökologisch bewußter Strategien
Abbildung 25: Ökologische Wertekette
Abbildung 26: Beispiel für die Darstellung der Organisation des Umweltschutzes
Abbildung 27: Musterbeispiel für Umweltaufbauorganisation.
Abbildung 28: Beispiel für umweltbezogene Kommunikationsstrukturen
Abbildung 29: Ziele und Grundsätze der Umweltberichterstattung
Abbildung 30: Zielgruppen und Beispiele für Nutzen von Umweltinformation
Abbildung 31: Die drei Arten der Umweltberichterstattung
Abbildung 32: Ansatzpunkte und Instrumente für ein ökologisches Marketing-Mix
Abbildung 33: Kommunikationsmittel in Abhängigkeit vom vorhandenen Wissen und dem Differenzierungsvermögen von Konsumenten
Abbildung 34: Stufen der Umweltberichterstattung von Unternehmen
Abbildung 35: Modell Umwelt-Controlling.
Abbildung 36: Öko-Glaubwürdigkeit im unternehmerischen Kontext
Abbildung 37: Das "Erscheinungsbild" des Unternehmens
Abbildung 38: Widerstände bei ökologischen Verbesserungen.
Abbildung 39: Der Weg zur ökologiebewußten Verhaltensänderung.
Abbildung 40: Merkmale ökologischer Entwicklungsfähigkeit.
Abbildung 41: Die Rolle der Medien im Wertesystem.
Abbildung 42: Risiko-Dialog in der Entwicklung des Risiko-Management
Abbildung 43: Konzeptpapier zur integrierten Unternehmenskommunikation.
Abbildung 44: Chancen und Perspektiven durch Umwelt-Auditing
Abbildung 45: Rahmenbedingungen für die Erstellung der Umwelterklärung.
Abbildung 46: Unterschiede EMAS und SMAS.
Einleitung
Ökologie ist heute kein Fremdwort mehr für die Unternehmen. Zumindest verbal bekunden immer mehr Unternehmen, daß Umweltschutz einen wichtigen Stellenwert in der Geschäftspolitik einnimmt. Trotzdem reißen die Berichte über sterbende Bäume, umkippende Gewässer, Klimakollaps, Tankerunfälle und andere Umweltkatastrophen nicht ab.
Die ökologische Herausforderung anzunehmen bedeutet große Chancen, aber auch Risiken, die die Unternehmen in wirtschaftlich schwierigen Zeiten nur zögernd in Kauf nehmen wollen. Außerdem werden die Unternehmen mit Forderungen konfrontiert, die von den traditionellen unternehmenspolitischen Konzepten eine Ausweitung oder eine Neuorientierung verlangen. Dazu zählen beispielsweise:[1]
- Wertepluralisierung und der Trend zu einer aktiven, kritischen Gesellschaft berühren die Unternehmen im Außen- und Innenbereich, sie m-ssen sensibler auf Veränderungen reagieren und sich ihrer gesellschaftlichen Rolle bewußt werden.
- Trotz Rezession und Sparpaketen wächst das Umweltbewußtsein der Bevölkerung und Bezugsgruppen des Unternehmens. Das belegt auch eine IFES-Studie vom Jahr 1996.[2]
- Die bekannten marktlichen Anspruchsgruppen stellen neben ihren traditionellen Anspr-chen verstärkt ökologische und soziale Anspr-che und
- neue unternehmenspolitische Akteure (z.B. B-rgerinitiativen, Umweltgruppen) melden sich mit ihren ökologischen Forderungen zu Wort.
- Der Staat setzt verstärkt indirekte Instrumente und Anreizsysteme (z.B. EMAS-Verordnung der Europäischen Union) ein, die den Unternehmen mehr Eigenverantwortung im Umweltschutz geben und kreative Lösungen erfordern.
- Wachsende Komplexität und Dynamik des Umfeldes erfordern eine ganzheitliche Sichtweise. Innerbetriebliche Lern- und Organisationsentwicklungsprozesse werden angestoßen und Arbeitsbeziehungen bekommen eine neue Qualität.
Früher konnten die Unternehmen darauf vertrauen, sich allein durch ihre wirtschaftliche Kompetenz auf dem Markt zu behaupten. Heute sind die Unternehmen in zunehmendem Maße auf die Akzeptanz und Unterstützung der gesellschaftlichen Gruppen angewiesen. Nicht nur die Verbraucher, auch andere, neue Anspruchsgruppen erwarten sich Informationen über und Kommunikation mit dem Unternehmen. Im Jahr 1993 wurde dazu z.B. durch das Umweltinformationsgesetz und die EMAS-Norm ein wichtiger Schritt gesetzt und der Weg zu einer „Öffnung“ der Unternehmen vorgezeichnet.
Entscheidend für die Wettbewerbsposition wird, ob für die Anspruchsgruppen der Eindruck von ökologischer Lösungskompetenz und –bereitschaft im Erscheinungsbild der Unternehmen entsteht. Aufgrund der besonderen Merkmale ökologischer Probleme ist dies aber kein leichtes Unterfangen: [3]
- hohe Komplexität,
- funktionsübergreifender Querschnittscharakter,
- Neuartigkeit (und damit der Mangel an bewährten Lösungsmustern),
- hoher Konfliktgehalt (Informationsasymmetrien, Wertewandel, Rollenkonflikte, ...),
- hohe zeitliche Reichweite ökologischer Probleme.
Um den Anforderungen von Glaubwürdigkeit, Transparenz und Offenheit gerecht werden zu können, ist eine ganzheitliche, vernetzte Denkweise notwendig. Deshalb muß der Umweltschutz auf allen Ebenen des Unternehmens Einzug halten. Der Querschnittscharakter des Umweltschutzes erfordert aktive Kommunikation und Dialog im Unternehmen und auch mit den externen Anspruchsgruppen. Dabei kann der Aufbau eines Umweltmanagementsystems, z.B. nach EMAS (Environmental Management Auditing Scheme) durch die Einbindung aller Geschäftsbereiche und die Veröffentlichungspflicht eine Basis bieten.
In der vorliegenden Arbeit möchte ich nun, ausgehend von den gesellschaftlichen Veränderungen und Entwicklungen in der Unternehmensführung der letzten Jahrzehnte speziell auf den ökologischen Kommunikationsbereich eingehen, da dieser in der Literatur nur selten als eigenständiges Gebiet behandelt wird.
Dabei wird aufgrund der Bandbreite dieses Themas keineswegs eine vollständige und erschöpfende Betrachtung aller Auswirkungen auf das betriebliche Management angestrebt. Vielmehr soll ein Überblick über Notwendigkeiten und Tendenzen in diesem Bereich gegeben werden.
Im 1. Teil der Arbeit wird der gesellschaftliche Wandel hin zu einem Wertepluralismus und die Entwicklung der Ökologie im betriebswirtschaftlichen Bereich beschrieben. Durch die Veränderungen in den Handlungsfeldern und im Umfeld des Unternehmens wird eine ganzheitliche, vernetzte Sichtweise unumgänglich. Daraus wiederum ergibt sich die Notwendigkeit eines verstärkten Blickes auf den Kommunikationsaspekt im Unternehmenskonzept.
Auf Geschichte, Notwendigkeit und Grundlagen einer ökologieorientierten Kommunikation gehe ich im 2. Kapitel ein. Durch die gestiegene ökologische Betroffenheit der Unternehmen wird die Kommunikation neben Innovation und Kooperation als ein Kernelement ökologisch orientierter Strategien gesehen und muß sich auch im Organisationskonzept niederschlagen. Außerdem werde ich hier auf die besonderen Ziele, Grundsätze, Zielgruppen und möglichen Gestaltungsformen der Öko-Kommunikation eingehen.
Das dritte Kapitel ist den Voraussetzungen, Anforderungen und Kriterien einer glaubwürdigen Öko-Kommunikation gewidmet. Ein gelebtes ökologisches Bewußtsein in allen Unternehmensbereichen ist die Voraussetzung für eine erfolgreiche Positionierung als umweltorientiertes Unternehmen. Kommunikation bedeutet dabei wechselseitiges Lernen und Dialog mit allen Anspruchsgruppen, wobei diese „neuen“ Schl-sselqualifikationen im Management- und Mitarbeiterbereich aufgebaut und trainiert werden m-ssen. Weiters wird untersucht, wie Kommunikation im Konzept der EMAS-Verordnung verankert ist.
Den Abschluß bildet ein Ausblick darüber, welche Tendenzen und Bestrebungen sich in der Entwicklung der Berichterstattung über Umweltaspekte abzeichnen.
An dieser Stelle möchte ich noch all jenen danken, die in irgendeiner Weise zum Zustandekommen dieser Arbeit beigetragen haben, besonders meiner Betreuerin Frau Dr. Stanek und Herrn Ing. Kurt E. Simperl, durch dessen Arbeiten ich erst auf die Idee kam, speziell über Öko-Kommunikation zu schreiben und der mir auch später durch sein Fachwissen in diesem Bereich immer wieder sehr geholfen hat. Sonja gilt noch ein spezieller Dank für ihre konstruktive und aufbauende Kritik und meinem Bruder für seine Unterstützung in der Endphase.
1. ÖKOLOGIEORIENTIERTES MANAGEMENT IM GESELLSCHAFTLICHEN KONTEXT - ENTWICKLUNG UND EINFLUßFAKTOREN
1.1. Gesellschaftlicher Wandel der letzten Jahrzehnte
Veränderungen innerhalb der menschlichen Gesellschaft sind keine neuartigen Erscheinungen. So haben sich die gesellschaftlichen Strukturen im letzten Jahrhundert von einer Agrar- zu einer Industrie- und schließlich zu einer Dienstleistungsgesellschaft, von der kapitalistischen zur sozialen und voraussichtlich ökologischen Marktwirtschaft verändert.[4]
Früher gaben geschlossene gesamtgesellschaftliche Wertesysteme einen Rahmen für die im Laufe der Sozialisation vermittelten Werte. Wertveränderungen vollzogen sich meist über Generationen hinweg, sie stellen somit eine Größe von gewisser Konstanz dar. Heute existiert eine Vielzahl nebeneinander oder kurzfristig nacheinander entstehende Wertveränderungen, sprich ein Wertepluralismus. Diese von verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen getragenen Werte können natürlich auch von anderen Gruppen angenommen werden und sich so auf die allgemeine Wertedynamik auswirken. Als Beispiel dafür gilt das zunehmende Naturbewußtsein, das sich von einer Alternativbewegung auf große Teile der Bevölkerung ausdehnte.[5]
1.1.1. Kurzbeschreibung des Wertewandels der letzten Jahrzehnte
„Werte sind die wesentliche Voraussetzung jeder sozialen Ordnung. Sie bestimmen das Verhalten der Gesellschaft gegenüber generellen Zielen durch eine besondere Auffassung von Mensch, Natur und Gesellschaft.“[6]
Ronald Inglehart stellte in den 70er Jahren einen grundlegenden Wandel von Wertorientierungen in den westlichen Industrieländern fest, nämlich der Entwicklung von materiellen zu post- und nichtmateriellen Werten.
Unter postmateriellen Werten werden hier z.B. soziale Anerkennung, Selbstverwirklichung, Mitsprache am Arbeitsplatz, politische Partizipation, Frieden und Umweltschutz verstanden. [7]
Nach einer 30jährigen extremen Wachstumsphase nach dem 2. Weltkrieg traf die Weltwirtschaft 1974 überraschend eine Krise, wobei sich die Wirtschaft relativ rasch wieder erholte, aber ein Wandel in den gesellschaftspolitischen Einstellungen stattfand. Traditionelle Wertkomplexe wie z.B. „materieller Wohlstand“ und „soziale Fragen“ traten in den Hintergrund, während der Wertebereich „Umwelt und Gesundheit“ wichtiger wurde.[8]
Empirische Untersuchungen, die sich circa seit Mitte der 70iger Jahre verstärkt diesem Problemkreis widmen, ergaben, daß umweltorientierte Werthaltungen bei verschiedenen Bevölkerungsgruppen der westlichen Industriestaaten immer wichtiger werden.
In der öffentlichen Meinung gehört die Sorge um eine Verschlechterung der Umweltqualität, neben der Bekämpfung der Arbeitslosigkeit, zu den drängendsten politischen, wirtschaftlichen und wissenschaftlichen Problemen.
In den 80er Jahren fand eine weitere starke Aufwertung dieser beiden Werte Umwelt und Gesundheit statt, besonders die Umweltfrage fand wie kaum ein anderes Thema in den Medien große Beachtung. Das schlug sich auch in einem verstärkten „gr-nen“ Marketing nieder (Bio-, „gr-ne“ Produkte).
Der Trend-Monitor von BASIS RESEARCH zeigt die Steigerung der persönlichen Betroffenheit und Sichtbarkeit im Bereich Umweltbelastung, der B-rger f-hlt sich zunehmend für Umweltbelastung und Umweltschutz mitverantwortlich und bedroht.
Abbildung 1: Persönliche Betroffenheit durch Umweltverschmutzung (1980 - 1987)
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Quelle: Silberer, G.: Wertewandel und Wertorientierung in der Unternehmensführung.
In: Marketing, Heft 2, 1991, S. 79
Helmut Klages stellte auf Basis einer Untersuchung des Wertewandels seit den 60er Jahren die Prognose eines „Wandels von Pflicht- und Akzeptanz- zu Selbstentfaltungswerten“ in den 90er Jahren auf.[9]
Silberer hat für die 90er Jahre aufgrund „einer weiteren drastischen Verknappung intakter Umwelt und „naturreiner“ Nahrungsmittel einen weiteren Anstieg der Werte Umwelt, Gesundheit und Lebensf-lle (Lebensfreude, Lebenssinn) prognostiziert. Andere elementare Werte, wie Freiheit, Wohlstand und individuelle Selbstentfaltung d-rften, seiner Meinung nach, ihren Stellenwert beibehalten.[10]
Die bisher genannten Thesen haben sich zwar nicht als falsch herausgestellt, jedoch wird neuerdings die Ansicht vertreten, daß der stattfindende Wertewandel facettenreicher ist, als die bisherige eindimensionale Betrachtungsweise. Es wird von einem mehrdimensionalen Wertewandel gesprochen, wobei die Veränderungen auf zwei oder mehreren getrennten Dimensionen gesehen werden.[11]
Raffeé/Wiedmann geben einen Überblick über zentrale Tendenzen des allgemeinen Wertewandels:[12]
1. Anhaltend hoher Stellenwert gesellschaftsbezogener Werte, der Werte Umwelterhaltung, Umweltschutz und Gesundheit, Schaffung und Sicherung von Arbeitsplätzen, Verwirklichung sozialer und humanitärer Ziele, Integration von Ausländern, Recht und Ordnung.
2. Trend zu Selbstentfaltung und Erleben, in Verbindung mit einer Relativierung von Pflicht- und Akzeptanzwerten; Aufwertung von Werten wie Kreativität, Spontanität, Eigenständigkeit, Genuß, Freizeit, Abenteuer, Spannung, „Arbeit muß Spaß machen“.
3. Wunsch nach verbesserter Information, „Politik, Wirtschaft und Technik zum Anfassen“, Überschaubarkeit, Sicherheit, sozialer Kontakt, Aufwertung von Traditionswerten.
4. Trend zur aktiven und kritischen Gesellschaft: Interesse an Informationen über gesellschaftliche Entwicklungen, an Hintergrundinformationen sowie an neutralen Informationen über unternehmerische Produkte und Prozesse, Kritikfähigkeit und Kritikbereitschaft, passive oder aktive Unterstützung von kritischen Institutionen, politisches Engagement.
5. Zunehmende Pluralisierung individueller und gesellschaftlicher Wertsysteme, Polarisierungsütendenzen, Wertekonflikte im Individuum selbst, hybrides Verhalten, pluralistische Lebensstile (z.B. zwischen Luxus und „neuer Bescheidenheit“), Werteschwankungen, -verlust und -zerfall.
Daß der Umweltschutz auch heute, in Zeiten der Sparpakete, seine Bedeutung nicht verliert, zeigt eine IFES-SYNERGA-Umfrage, der Öko-Monitor 1996: Nur 19 % der Befragten glauben, daß der Umweltschutz an Bedeutung verlieren wird, 65 % sprechen sich entschieden dagegen aus.[13]
Eine aktuelle Umfrage von Fessel&GfK (4.500 Befragte) zeigt, daß die österreichische Bevölkerung für Umweltfragen überdurchschnittlich offen ist. Demnach können 54 % der Befragten als umweltbewußt eingestuft werden und Österreich wird europaweit an die dritte Stelle nach der deutschsprachigen Schweiz und Westdeutschland gereiht. Allerdings setzen bis jetzt nur 24 % der Befragten die guten Vorsätze auch in die Tat um.[14]
Als sichtbare Beispiele für einen Bewußtseinswandel nennt Hopfenbeck unter anderem:[15]
Ökowelle in den Regalen; steigende Zahl von Umweltpreisen und Umweltausstellungen;
erste Ökobank in Frankfurt bereits 1974;
Öko-Nachrichtenagenturen; nationale Umweltpläne;
ab 1994/95 mehr eigenständige Umweltberichte als Kommunikationsinstrumente;
„Charta for Sustainable Development“ von Rio de Janeiro;
Medienvereinigung für Umweltthemen;
steigendes Bildungsangebot aus betrieblicher Umweltökonomie; etc.
1.1.2. Auswirkungen der Wertepluralisierung auf das Konsumentenverhalten
Die allgemeine Wertedynamik verändert natürlich auch das Konsumentenverhalten, besonders in Richtung einer eher naturwertorientierten Konsum- und Lebenshaltung und eines steigenden Umwelt- und Energiebewußtseins.[16]
Szallis/Wiswede stellten 1990 einige Thesen zur gewandelten Rolle des Konsumenten in unserer Gesellschaft auf, die sich stark auf sein Verhältnis zu Umwelt und Natur auswirken:[17]
1. Vom puritanischen Ethos zur Genußmoralität: Hier wird eine verstärkte Hinwendung zu einem gegenwartsorientierten, genußfreudigen Konsumstil festgestellt.
2. Vom passiven Konsumenten zum „Prosumenten“: damit ist ein aktiver, schöpferischer, kreativer Konsum gemeint. Als Beispiel für einen Konsumenten, der gestaltend und produktiv im wirtschaftlichen Prozeß mitwirkt, gilt der aktive Urlaub oder die Do-it-yourself-Bewegung.
3. Vom Besitzdenken zum Transmaterialismus: Transmaterialismus soll die Rolle der Konsumg-ter als Vehikel für besondere Formen des Erlebens und Genießens herausstreichen. Der Zweck, den sie erf-llen, ist wichtig, nicht ihre materielle Präsenz. Es entsteht also keine Konsumverweigerung, sondern eine andere Art, mit G-tern umzugehen.
4. Vom Lebensstandard zum Lebensstil: Lebensstandard stellt eine quantitative Größe, z.B. die Höhe des Einkommens dar. Lebensstil hingegen bezeichnet das Wie der G-terverwendung.
5. Vom demonstrativen Konsum zur selektiven Bescheidenheit: Durch die universelle Verf-gbarkeit nahezu aller G-ter, wird der prestigevermittelnde Grenznutzen der Konsumg-ter geringer. Eine R-ckkehr zur „neuen Natürlichkeit“ wird gesehen, wobei hier auch häufig bewußt gegensätzlich gehandelt wird (hybrider Konsument).
6. Vom genormten Verbrauch zum individualisierten Konsumenten: Letzterer gilt als Endpunkt aller bisher genannten Tendenzen und besagt, daß die Konsumenten immer unterschiedlicher und Segmentierungen immer schwieriger werden.
7. Vom unkritischen zum m-ndigen Verbraucher: Indizien dafür sind z.B. steigende Nutzung von Informationsquellen, Skepsis gegenüber Werbeaussagen, wachsendes Bewußtsein für die Umweltschädigungen und wachsendes Gesundheitsbewußtsein. Viele der Tendenzen sind durch allgemein gestiegenes Bildungsniveau und gesteigerten Umgang mit Konsumg-tern erklärbar.
Besonders die letzte These ist für die Unternehmen interessant, da sie aufzeigt, daß sich der Konsument immer mehr auch für das Unternehmen als Ganzes und seine „Umwelt-Performance“, seine Leistung im Bereich Umwelt, zu der nicht nur die Produkte gehören, interessiert.
1.1.3. Wertepluralisierung als Herausforderung an die Unternehmensführung
„Wandel – das einzig Bleibende in der heutigen Unternehmensführung“[18]
Neben dem gesellschaftlichen Wandel setzen auch andere Entwicklungen das Unternehmen zunehmend unter Druck.
Dies bezieht sich z.B. auf die zunehmende Internationalisierung der Wirtschaft, Beschleunigung des technischen Fortschritts, Verk-rzung der Produktlebenszyklen, zunehmende oder zumindest zunehmend erkannte Umweltbelastungen und verstärkte Anforderungen an das Verantwortungsbewußtsein des Management.[19]
Die Wertepluralisierung in der Gesellschaft berührt das Unternehmen sowohl im Außen- wie auch im Innenbereich, und zwar über das aktuelle und zu erwartende Verhalten der Abnehmer, Lieferanten, der Öffentlichkeit, des Gesetzgebers, der Eigner, Mitarbeiter und Manager. Diese Wertedynamik der heutigen Zeit muß als Herausforderung in bezug auf die Grundhaltung gegenüber erwünschten und unerwünschten Trends und auf die Herleitung eines konkreten Werteprofils im Unternehmen gesehen werden und erfordert eine verstärkte Sensibilisierung für Veränderungen im Markt und in der Marktumwelt (z.B. auf ökologische Effekte wirtschaftlichen Handelns). Können diese Werte nicht im Bewußtsein der Manager und Mitarbeiter im Sinne einer „Corporate Value Identity“ (gemeinsames Wertesystem) verankert werden, wird das Unternehmen unglaubwürdig.[20] (siehe dazu auch Kap. 3)
1.2. Die ökologische Öffnung der Betriebswirtschaftslehre
Die im ersten Punkt kurz angeführten gesellschaftlichen Veränderungen und Wertentwick-lungen führen zwangsläufig auch zu Wissensspr-ngen in der Betriebswirtschaftslehre. Seit Ende der 80iger Jahre erscheinen vermehrt betriebswirtschaftliche Beiträge, die die Ökologie in bestehende Ansätze integrieren wollen oder die das betriebswirtschaftliche Paradigma bei ökologischen Fragen in Frage stellen. Hier wird der Schwerpunkt auf das strategische Management gelegt, von der operativen Anpassung auf eine aktive Zukunftsgestaltung verlagert (z.B. bei Meffert/Kirchgeorg 1992, Hopfenbeck 1990)[21]
Auch Bleicher spricht in diesem Zusammenhang von einem notwendigen Paradigmenwechsel in der Betriebswirtschaftslehre und der Managementtheorie.
Dabei versteht er Paradigma als „... ein System von Normen, welche ein bestimmtes Wirtschaftsbild prägen; die Normen beziehen sich sowohl auf die Ziele, wie auch auf die Methodik des Vorgehens und die Charakteristik der anzustrebenden Erkenntnisse einer Wissenschaft“.[22]
Vereinfacht gesagt kann man die Entwicklung der Betriebswirtschaftslehre in der Zeit nach dem 2. Weltkrieg in vier Phasen einteilen:
In den 50iger Jahren stand die kostengünstige Produktion (Fließband) von Masseng-tern im Vordergrund, die 60iger Jahre brachten die Umorientierung von der Produktions- zur Absatzorientierung und der Entwicklung komplexer Marketingstrategien. Die turbulenten 70iger waren nicht nur gekennzeichnet durch Ölpreis- und Weltwährungskrisen, sondern auch durch gesättigte Märkte. Die Betriebswirtschaftslehre reagierte darauf mit dem Instrumentarium der Strategischen Unternehmensplanung. Seit Mitte der 80iger Jahre dominieren Stichwörter wie „Globalisierung“, „Technologie“ und „Umweltschutz“ in einer komplexen und dynamischen Umwelt.[23]
Die heutige Herausforderung der Unternehmensführung wird durch das folgende Sechseck definiert.
Abbildung 2: Strategischer Stern als Herausforderung für die Unternehmensführung
Quelle: Steger, U.: Umweltmanagement. Erfahrungen und Instrumente einer umweltorientierten
Unternehmensstrategie. Gabler Verlag, 2. Auflage, Wiesbaden 1993, S. 59
1.2.1. Von der verhaltenswissenschaftlichen zur ökologischen Öffnung
In den 50iger und 60iger Jahren stand die Betriebswirtschaftslehre eher im Zeichen einer verhaltenswissenschaftlichen Öffnung, bei der es um eine Öffnung nach innen, gegenüber dem Menschen in seiner sozialen und psychischen Dimension, ging.
Heute, in den 90er Jahren geht es im Zuge der ökologischen Öffnung um eine Öffnung nach außen, gegenüber der Natur und den natürlichen Lebensbedingungen des Menschen. Umwelt bedeutet nun nicht mehr nur „marktliche“ Umwelt, sondern auch „nicht-marktliche, gesellschaftliche“ Umwelt.[24]
Die verhaltenswissenschaftliche Öffnung erscheint quasi als methodische Vorbereitung für den Einbezug ökologischer Gesichtspunkte in die Unternehmenspolitik.[25]
- In beiden Fällen handelt es sich um Restriktionen, bei denen einerseits auf Mitarbeiter und andererseits auf die Umwelt R-cksicht genommen werden muß.
- Beide Dimensionen sind eher qualitativer Natur, also nur schwer zu quantifizieren.
- Das betriebliche Sozialziel bedeutete die erste markante Erweiterung der betrieblichen Zielkonzeption, die Einführung des Umweltziels wird als weitere bedeutende Ausweitung gesehen.
- Sowohl der Sozialaspekt, wie auch der Umweltaspekt sind aufwandsträchtig, d.h. sie können Kosten und Mindererlöse bedeuten. Aber beide können letztlich auch die Erfolgspotentiale der Unternehmung erhöhen.
1.2.2. Konzeption eines gesellschaftsbewußten Management
Seit Mitte der 70iger Jahre entwickelte sich das Konzept eines gesellschaftsbewußten Management, in dem die Unternehmung über ihre wirtschaftliche Verantwortung hinaus die Verantwortung für die gesellschaftlichen Auswirkungen ihrer Tätigkeit hat. (z.B. bei Ulrich 1977, Dyllick 1982).
Der rein ökonomisch ausgerichtete „Shareholder-Approach“ wird hier zu einem mehrdimensionalen, sozioökonomischen „Stakeholder-Approach“ erweitert. (z.B. Dyllick 1984, Bleicher 1991)
Das Unternehmen ist Teil der Gesellschaft und deshalb werden auch andere Anspruchsgruppen bedeutsam, wie z.B. Behörden und Verwaltung, Öffentlichkeit, Medien, Anwohner, B-rgerinitiativen, Umweltorganisationen, Konsumentenorganisationen, Gewerkschaften, Dritte-Welt-Organisationen oder auch die Wissenschaft. Das erfordert natürlich auch eine neue Kommunikationskonzeption mit allen Bezugsgruppen.
Abbildung 3: Das Unternehmen als Teil der Gesellschaft
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Quelle: Dyllick, Th.: Ökologisch bewußtes Mangement. In: Die Orientierung 96, Bern 1990, o. S.
Aber auch andere Anliegen als nur die wirtschaftlich orientierten, wie zufriedenstellende Produkte, gesicherte Abnahme, befriedigende Arbeit oder angemessene Rendite werden wichtig. Das sind Anliegen der Gesellschaft, deren Lösung als politisch vordringlich gesehen wird, wie Arbeitslosigkeit, Umweltbelastung, Ressourcenverbrauch oder Gesundheitsgefährdung. Die Unternehmen werden also nicht nur nach ihrer wirtschaftlichen, sondern auch nach ihrer „ gesellschaftlichen Leistung“ bewertet, d.h. inwieweit das Unternehmen und seine Aktivitäten soziale Akzeptanz finden.[26]
Parallel dazu entstand das Konzept eines „ethikbewußten Management“, bei dem es um ethische Begründungen für unternehmerische Entscheidungen geht.[27]
1.2.3. Das Anspruchsgruppenkonzept
Das Unternehmen wird hier selbst als „produktives, soziales System“ gesehen, das mit anderen Subsystemen in Austauschbeziehung steht. Mit deren Erwartungen bzw. Forderungen muß sich das Unternehmen auseinandersetzen und bei Entscheidungen R-cksicht nehmen. [28]
Dyllick sieht das Unternehmen als eine Koalition von Anspruchsgruppen, die in wechselseitiger Abhängigkeit stehen. Die Theorie des Anspruchsgruppen-Konzepts versucht die Beziehungen zwischen Unternehmen und Umwelt „ durch die Augen der wichtigsten Anspruchsgruppen zu sehen“. Die Aufgabe der Unternehmensführung ist es nun, die teilweise widerspr-chlichen Anspr-che miteinander zu vereinbaren.[29]
(Beispiele für Leistungen und Gegenleistungen im Sinne des Konzeptes siehe Anhang 1)
Der Begriff „Stakeholder“ wurde erstmals 1963 vom Stanford Research Institute (SRI) benutzt, um deutlich zu machen, daß Aktionäre nicht die einzige Gruppe sind, die das Management beachten muß, sondern alle Gruppen, „ohne deren Unterstützung die Unternehmung nicht existieren kann“. Freemans Definition aus dem Jahr 1983 geht weiter und umfaßt alle Gruppen und Individuen, die die Zielerreichung einer Organisation beeinflussen oder von dieser betroffen sind. Dabei werden explizit auch gegnerische Gruppen als Stakeholder betrachtet.[30]
Im Rahmen dieses Konzeptes werden interne und externe Anspruchsgruppen unterschieden:
1. Mitglieder von Aufsichts- und Verwaltungsräten, leitende Angestellte, -brige Mitarbeiter und Betriebsräte.
2. Lieferanten, Konkurrenten, Abnehmer, Banken, Eigent-mer, Versicherungen. In j-ngerer Zeit im Rahmen der ökologischen Herausforderung auch Anwohner/Nachbarn, Behörden, Staat, Medien, Verbände, Gewerkschaften, Hochschulen, B-rgerinitiativen, Umweltschutzverbände.
Die Unternehmen wandeln sich zu „quasiöffentlichen Institutionen“, die zumindest teilweise einer externen Lenkung unterworfen sind. Ihr Verhalten muß von der Gesellschaft akzeptiert werden. W-thrich bringt das wie folgt auf den Punkt:
„In einer Welt voller Externalitäten gibt es heute kein interessenneutrales, wertfreies, ‚rein‘ betriebswirtschaftliches ‚Formalziel‘ des Unternehmens, das die verschiedenen ‚Wertanspr-che‘ der unternehmerischen Bezugsgruppen auf eine einzige Wertdimension (z.B. Gewinn) harmonisieren könnte.“[31]
Abbildung 4: Die Beziehungen des Unternehmens mit den Anspruchsgruppen
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Quelle: Hallay, H./Pfriem, R.: Umweltaudits, Öko-Controlling und externe Unternehmenskommunikation.
In: UmweltWirtschaftsForum, September 1993, S. 49
Für die Kommunikation des Unternehmens bedeutet dies besonders im ökologischen Bereich eine neue Herausforderung. Das Unternehmen muß in seiner Informations- und Kommunikationspolitik auf alle internen und externen Anspruchsgruppen eingehen und einen offenen, ehrlichen Dialog schaffen, damit die angesprochene gesellschaftliche Akzeptanz erreicht wird. (siehe dazu auch Kapitel 3)
1.2.4. Vernetztes und ganzheitliches Denken und Handeln im Unternehmen
Unternehmen werden vermehrt Gegenstand öffentlicher Auseinandersetzung, weil sie nicht nur G-ter und Wohlstand, sondern auch Risiken für Umwelt und Gesundheit verursachen, denn unternehmerische Tätigkeiten sind unausweichlich mit Belastungen für die Umwelt verbunden.
Andererseits ist unsere Welt allgmein komplexer geworden, d.h. sie ist hochgradig vernetzt und dynamischer geworden. Damit ist die Zukunft nicht eindeutig vorhersagbar oder erwartbar, viele Ziele stehen gleichzeitig im Mittelpunkt.[32]
Im Zusammenhang mit einer ganzheitlichen Betrachtungsweise fordern nun Systemtheoretiker (z.B. Vester, Ulrich) eine Änderung des Unternehmensbildes, von einem geschlossenen zu einem offenen System, um dieser erhöhten Komplexität gerecht zu werden.
Dabei wird das gesamte Unternehmen mit einem organischen System verglichen, das einer evolutionären Dynamik unterliegt.[33] Systemtheorie und Ökologie sind aufeinander angewiesen, da z.B. die Ökologie als Wissenschaft auf die in der Systemtheorie entwickelten Vorstellungen und Denkformen zurückgreift und die Ökologie mit der Biokybernetik zur Weiterentwicklung der Systemtheorie beiträgt.[34]
Ein ökonomisches System als offenes System erfordert ein Denken in Systemzusammenhängen, das
- seiner Natur nach mehrdimensional, multidisziplinär geöffnet und integrativ ist;
- einen viel größeren Zeithorizont erfordert;
- ökonomisches Handeln in einem Netzwerk von Beziehungen und dynamischen Strukturen sieht, die in ständiger Wechselwirkung stehen.[35]
Ganzheitliches Denken und Handeln als Konzept wird als Integration von Unternehmen, Mensch und Umwelt in ihren gegensätzlichen und komplementären Beziehungen zueinander gefordert. Im Zentrum des Interesses stehen Fragen der Flexibilität, Evolution, Anpassungsfähigkeit, Lernfähigkeit, Selbstregelung und Selbstorganisation.
Rudolf Mann spricht von folgenden Aspekten der Ganzheitlichkeit im Unternehmen:[36]
1. Vernetzte Systeme: Die zunehmende Komplexität der Zusammenhänge macht eine Abkehr vom linearen Denken notwendig. Das Unternehmen ist keine Insel, sondern in der Innen- und mit der Außenwelt vernetzt.
2. Unternehmen als lebende Organismen: Verbundenheit und Abhängigkeit des Unternehmens mit der Natur fordert aus sich heraus schon den Schutz der Natur.
3. Evolutionäre Individuen: Jeder Mensch ist einzigartig und befindet sich in ständigem Wandel. Aus den Fähigkeiten der Mitarbeiter ergibt sich dann auch die Chance der Einzigartigkeit des Unternehmens.
4. Holographische Bilder: Das Unternehmen wird wie Mensch und Wirtschafts- und Gesellschaftssystem als holographisches Bild gesehen, d.h. jeder Teil trägt das Bild des Ganzen in sich.
5. Leib/Seele/Geist-Einheit: Menschen und auch Unternehmen sind Leib/Seele/Geist-Einheiten. Meist werden im Tagesgeschäft im Unternehmen nur die ersten zwei der folgenden Gestaltungsebenen wahrgenommen: Materie (z.B. Gebäude, Rohstoffe) und Bewegung (z.B. Material, Geld). Die Ebenen der Energie (z.B. Beziehungen) und des Geistes (z.B. Visionen) werden nur aus der Distanz wahrgenommen.
Diese fünf Aspekte sind untrennbar miteinander verzahnt:
Abbildung 5: Die Vernetzung der Bestimmungskriterien der Ganzheitlichkeit
Quelle: Mann, R.: Das ganzheitliche Unternehmen. Scherz Verlag, Bern/M-nchen/Wien 1990, S. 124
Ulrich/Probst unterscheiden sieben Komponenten oder Bausteine, auf denen ein solches systemisches Denken aufbaut:[37]
1. Das Ganze und die Teile: Der Begriff System steht als dynamische Ganzheit an der Basis. Es besteht aus mehreren unterschiedlichen Teilen, die in einem bestimmten Aufbau miteinander vernetzt sind. Das System ist mehr als die Summe seiner Teile.
2. Vernetztheit: Zwischen den Teilen bestehen Verbindungen, aber nicht nur in Form linearer Kausalketten, sondern durch Netzwerke. Die Wechselwirkungen zwischen den Elementen verändern sich im Zeitablauf. (z.B. das Beziehungsgef-ge von Unternehmen)
3. Das System und seine Umwelt (Offenheit): Grundvorstellung des ganzheitlichen Denkens ist das offene System, es gibt also für das System eine Außenwelt, mit der es in
Wechselwirkung steht. Das System ist selbst eine aus Teilen bestehende Ganzheit, die in diese größere Ganzheit eingebettet ist. (z.B. das Unternehmen in die Gesellschaft)
4. Komplexität: bedeutet, daß etwas nicht nur kompliziert ist, sondern auch seinen Zustand ständig ändert.
Man kann nicht vorhersagen, welchen konkreten Zustand es als nächstes annehmen wird (z.B. ökologische, soziale Systeme). Die Komplexität des Unternehmens beruht darauf, daß es aus Menschen besteht und starke Vernetzungen aufweist. Durch Maßnahmen oder Regeln kann die Komplexität des System beeinflußt werden.
5. Ordnung: In einem System bilden sich aus Struktur und Verhalten Regeln heraus, die eine gewisse Ordnung erkennen lassen. Die potentielle Komplexität wird eingeschränkt und das Zurechtfinden innerhalb des Systems wird erleichtert. Im Unternehmen entstehen alleine durch das Zusammenwirken der Menschen von selbst Strukturen und Verhaltensmuster. Autonome Arbeitsgruppen, Projektorganisation und Konzepte der Organisationsentwicklung spielen für die Selbstorganisationsfähigkeit der Subsysteme der Unternehmung eine große Rolle.
6. Lenkung: Die Fähigkeit, sich selbst unter Kontrolle zu halten, wird als Lenkung bezeichnet, d.h. Systeme und -einheiten können durch Informationsaufnahme, ‑verarbeitung und ‑übermittlung bestimmte Vorzugszustände anstreben.
7. Entwicklung: Systeme bleiben nicht immer gleich, d.h. sie sind entwicklungs- und lernfähig. Entwicklung umfaßt ein bewußtes oder unbewußtes Erweitern des Verhaltenspotentials und eine Neugestaltung von Zweck und Zielen. Unternehmungen können nicht nur größer oder kleiner werden, sie m-ssen sich auch aus sich selbst heraus qualitativ verbessern und innovationsfähig sein.
Auch Steger spricht von einem sich anbahnenden Paradigmen-Wechsel, der von einer „technokratischen“ Unternehmensführung zu einer „evolutionären“ übergehen soll.[38]
Seidel/Menn weisen darauf hin, daß eine evolutionäre Betrachtungsweise durch ihr ganzheitliches, vernetztes Denken eine besondere Ähnlichkeit zur Ökologie hat. Die ganzheitliche, vernetzte Denkweise unterstreicht die Abhängigkeit jeder Population, also auch von Unternehmungen, von der sie umgebenden natürlichen Umwelt.[39]
Der evolutionäre Ansatz geht im Gegensatz zu technokratischen Ansätzen (von Taylor bis Ansoff) davon aus, daß zwischen dem Unternehmen und seiner Umwelt ein „Fließgleichgewicht“ bestehen muß, damit die Unternehmung auf Dauer überleben kann.
In diesem systemorientierten Sinne behandeln auch die St. Gallener Managementansätze das Unternehmen nicht als „Aktionszentrum“, sondern als ein „Interaktionszentrum“, das seine Ressourcen nicht nur zur Funktionserf-llung, sondern auch zur Weiterentwicklung, einsetzt.[40]
W-thrich zieht aus den Einfl-ssen, deren Spektrum von einer zunehmenden Ökologisierung über globalisierende bzw. völlig im Umbruch liegende Märkte und neue technologische Möglichkeiten bis hin zur Wertepluralisierung unserer Gesellschaft und einer Wissensexplosion, die das menschliche Gehirn an seine Grenzen stoßen läßt, reicht, die folgenden Schlußfolgerungen für die Betriebswirtschaftslehre:[41]
- „Durch die erkennbaren Veränderungen und Herausforderungen muß von einer andauernden Instabilität ausgegangen werden.
- Die Vorhersehbarkeit und Beherrschbarkeit gehen auf ein Minimum zurück.
- Ein ständiges Hinterfragen paradigmatischer Prämissen ist für die Theoriebildung und für Handlungsanweisungen notwendig. Die Herausforderung gilt dabei weniger den Methoden als dem Bewußtsein selbst.
- Neue Denkmuster verlangen ein fließendes Wissenschaftsverständnis und die Bereitschaft zum lebenslangen Lernen.“
Das Unternehmen ist keine Insel, sondern eingebettet in und untrennbar mit der Umwelt verbunden. Es besteht aus einzelnen Individuen und einer Umwelt, deren Forderungen in die unternehmerischen Entscheidungen Eingang finden m-ssen.
Besonders im Bezug auf den Umweltschutz ist daher dem Netzwerk von Beziehungen, der Dynamik der Strukturen und der verstärkten Komplexität unserer Umwelt durch offene, ganzheitlich gesehene und ehrliche Kommunikation zu begegnen.
Durch eine ganzheitliche Denk- und Handlungsweise kann die angesprochene gesellschaftliche Akzeptanz erreicht werden und das Unternehmen wird als kompetent und glaubwürdig gesehen. Dies wird im 2. und 3. Teil der Arbeit noch genauer ausgeführt.
1.3. Die Veränderung der Rahmenbedingungen in den Handlungsfeldern der Unternehmung
1.3.1. Externe Veränderungen
Unternehmen werden meist nicht mit den eigentlichen ökologischen Problemen z.B. in Form von Luft- oder Bodenbelastung konfrontiert, sondern sie werden erst durch gesellschaftliche Anspr-che, politische Regulierungen oder marktliche Veränderungen für sie relevant.
Dyllick sieht das Unternehmen einer Primärumwelt gegenüber, die aus den Lenkungssystemen Markt, Gesellschaft und Politik (also den Stakeholdern) besteht. Diese Primärumwelt ist in eine Sekundärumwelt eingebettet, die ökologische Umwelt. Anhand dieser Dimensionen werden nun die externen Veränderungen systematisiert.[42]
Abbildung 6: Ökologierelevante Einfl-sse auf das Unternehmen.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Quelle: Dyllick, Th.: Ökologisch bewußte Unternehmensführung. Bausteine einer Konzeption ..., o. S.
Die ökologische Dimension behandelt die Forderung einer Minimierung des Verbrauchs natürlicher Ressourcen sowie der Umweltbelastung.
Bei der gesellschaftlichen Dimension geht es um die Akzeptanz und Legitimität der relevanten gesellschaftlichen Anspruchsgruppen. Hier sollte auch der zunehmende Wettbewerbsdruck erwähnt werden, der eine systematische und ganzheitliche Herangehensweise gerade im Umweltbereich erfordert. Die Verbraucher und anderen Anspruchsgruppen reagieren sensibel auf die Verschlechterung der Umweltbedingungen und Veränderungen in ihrem Umfeld. Nicht nur Produkte und Leistungen sind interessant, sondern man erwartet sich auch offene und ehrliche Information und Kommunikation von Problemen.[43]
In politischer Dimension steht die Erf-llung gesetzlicher Umweltschutzvorschriften und behördlicher Auflagen im Mittelpunkt. In diesem Bereich hat sich die Entwicklung von einzelnen Gesetzeskomplexen in verschiedenen Umweltmedienbereichen (z.B. Wasser, Luft, etc.), die Grenzwerte und explizite Handlungsweisen festlegen, zu einer offeneren Gesetzgebung entwickelt.
Diese beruht mehr und mehr auf einer Rahmengesetzgebung, die den Unternehmen mehr Spielraum und Kreativität läßt. Dadurch wird Ökologie auch als Profilierungsmöglichkeit freigegeben und z.B. aufwendige Grenzwertkontrollen fallen zum Großteil weg. Außerdem gleichen sich die Umweltstandards auf internationaler Ebene – besonders im EU-Bereich – an. Damit fällt die Benachteiligung von Unternehmen mit Sitz in Ländern mit hohen Umweltstandards weg. Es ergibt sich dabei eher ein Standortvorteil, da diese Unternehmen durch die Profilierung auf dem Umweltsektor Wettbewerbsvorteile erreichen können.[44]
In marktlicher Dimension geht es um die kosteneffiziente Anpassung an ökologische Anforderungen und Auflagen. Daß Ökonomie und Ökologie durchaus vereinbar sind, beweisen zahlreiche Vorreiterbetriebe (z.B. Teilnehmer der Öko-Profit-Initiative in Österreich). Dabei kommt es allerdings darauf an, eine langfristige Sichtweise und alle relevanten Faktoren mit einzubeziehen.[45]
1.3.2. Interne Veränderungen
Dyllick unterscheidet zwischen vier ökologischen Handlungsfeldern im Unternehmen, die jeweils einen eigenständigen Handlungszusammenhang beschreiben. In jedem Handlungsfeld sind andere Ziele relevant, steht ein anderer Objekt- und Funktionsbereich im Mittelpunkt.[46]
Abbildung 7: Ökologische Handlungsfelder
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Quelle: Dyllick, Th.: Ökologisch bewußte Unternehmensführung. Bausteine einer Konzeption ..., o. S.
Im Mittelpunkt des Handlungsfeldes Betrieb steht die Leistungserstellung, also die Funktionsbereiche Produktion, Beschaffung, Energie- und Abfallmanagement. Das Ziel ist hier, Belastungen im Bereich des eigenen Betriebes zu erfassen und zu reduzieren, um ökologische Risiken zu vermeiden und Kosteneinsparungen zu realisieren.
Dabei ist zu bedenken, daß Umweltschutzmaßnahmen durch hohe Kosten kurzfristig die Rentabilität senken können, aber langfristig betrachtet – bedingt durch sich verschärfende Rahmenbedingungen – existenzsichernd und gewinnbringend sind.
Handlungsfeld Produkt: Hier steht der ökologische Produktlebenszyklus im Zentrum, der neben den unternehmensbezogenen Stufen auch alle vor- und nachgelagerten Stufen umfaßt. Angesprochene Funktionsbereiche sind dabei die Produktentwicklung, das Marketing und die Logistik. Ökologische Belastungen während des gesamten Produktlebenszyklusses (also auch beim Kunden) m-ssen erfaßt und reduziert werden, um sich als umweltbewußter Anbieter profilieren zu können. Ansatzpunkte sind hier die Bereiche Produktdesign, Inhaltsstoffe, Produktionsprozesse, Verpackungsgestaltung, Kooperation mit Recycling- und Entsorgungspartnern.
Handlungsfeld Management und Mitarbeiter: Im Zentrum stehen aktuelle und potentielle Mitarbeiter, also die Funktionsbereiche Führung, Personal und Organisation.
Die Mitarbeiter sollen als Hauptträger ökologisch relevanter Handlungen sensibilisiert, motiviert und ausgebildet werden. So wird innerhalb und außerhalb des Unternehmens an Attraktivität gewonnen.
Ansatzpunkte bilden Führungsstil, Führungsvorgaben, Unternehmenskultur, Information und Kommunikation, Aus- und Weiterbildung sowie die Organisationsentwicklung. Denn, ein aktives Umweltmanagement beginnt in den Köpfen des Management und der Mitarbeiter und nicht durch aufgesetzte Konzepte.
Handlungsfeld Kommunikation: Ökologische Probleme gehören zu den wichtigsten gesellschaftlichen Anliegen. Externe Öffentlichkeit (Behörden, Medien, Politiker, Wissenschafter, Verbandsvertreter und Anrainer) sowie interne Öffentlichkeit (Mitarbeiter, Gesellschafter) stehen im Mittelpunkt dieses Handlungsfeldes.
Als Funktionsbereiche sind interne und externe Kommunikation angesprochen. Das Ziel besteht darin, nach innen und außen kompetent und glaubwürdig über Probleme und Aktivitäten im Ökologiebereich zu kommunizieren. Ansatzpunkte finden sich in der Vorbildfunktion der Leitung, der Informationspolitik und der Fähigkeit zum aktiven Dialog und zur Zusammenarbeit mit anderen Anspruchsgruppen. (siehe dazu auch Kap. 3)
1.4. Gesetzliche Rahmenbedingungen im Wandel
Das generelle Interesse der Politik ist es, möglichst viele gesellschaftliche Interessensströmungen zu treffen. Daher motiviert sich das Interesse der Politik am Umweltschutz aus den Erwartungen, die die Politik durch die Gesellschaft an sich gestellt sieht. Mit einiger Zeitverzögerung spiegelt die Politik so das Bild wider, das in etwa dem aktuellen Stellenwert des Umweltschutzes in Öffentlichkeit und Gesellschaft entspricht.[47]
Nach mittlerweile zwei Jahrzehnten Umweltpolitik hat sich gezeigt, daß eine staatliche Umweltpolitik alleine zwar politische Rahmenbedingungen setzen kann, reagieren und sanieren kann, wenn es um Umweltschädigungen geht, aber kaum eine nachhaltige Entwicklung und Engagement erzwingen kann. Neben den Konsumenten sind es vor allem die Unternehmen, die mit ihren Entscheidungen die zuk-nftige Umweltqualität beeinflussen.
Laut einer SYNERGA/IFES-Umfrage aus dem Jahr 1995 wird für ungefähr 65 % der Befragten von Politik und Wirtschaft zuwenig für die Umwelt getan. Nur ca. 20 % behaupten, Politik und Wirtschaft tun genug für den Umweltschutz, dagegen meinen ca. 31 %, die Verbraucher tun genug.[48]
Besonders im Rahmen der europäischen Umweltpolitik sind in letzter Zeit zunehmend ökonomische Instrumente zum Einsatz gekommen, die in diesem Abschnitt der Arbeit behandelt werden. Die Richtlinien über den freien Zugang zu Umweltinformationen, über die Umweltverträglichkeitspr-fung, EMAS-Verordnung und ISO-14000-Normen sollen hier als Beispiel für eine zunehmende Ökonomisierung und Standardisierung (zumeist auf EU-Ebene, aber auch international) von umweltbezogenen Regelungen aufgezeigt werden.
Die Grundidee dieser „indirekten“ (ökonomischen) Instrumente ist,
- daß Unternehmen in Eigenverantwortung und Selbststeuerung den betrieblichen Umweltschutz kontinuierlich verbessern sollen,
- die Abkehr von der Fremdkontrolle technischer Auflagen- und Gesetzeserf-llung hin zur Pr-fung der „Funktionserf-llung“ von Managementystemen,
- der Wandel von einem reaktiven zu einem proaktiven Umwelthandeln.
Es werden daher bei der EU-Richtlinie zum Umweltmanagement, Öko-Audit und Öko-Label weder Preise, Mengen, Handlungen oder Technologien reguliert, noch Verhandlungs- oder Haftungslösungen anvisiert. Es wird ein Anreiz für Unternehmen geschaffen, sich freiwillig einem Paket offizieller Richtlinien ökologiegerechten Managements zu unterwerfen. [49]
1.4.1. Die EU-Richtlinie über den freien Zugang zu Informationen über die Umwelt - Umweltinformationsgesetz (UIG)
Die Bedeutung der Information der Öffentlichkeit im Bereich des Umweltschutzes wurde bereits in früheren Aktionsprogrammen der EU betont. Im 4. Aktionsprogramm 1990 wurde es als notwendig erachtet, den Zugang aller B-rger zu Informationen über die Umwelt durch eine spezifische Gemeinschaftsaktion zu ermöglichen.
Die Behörden der Mitgliedstaaten sind grundsätzlich verpflichtet, allen natürlichen oder juristischen Personen auf Antrag Informationen über die Umwelt zur Verfügung zu stellen. Ausnahmen bestehen etwa bei Geschäfts- oder Betriebsgeheimnissen, sowie bei vertraulichen Daten. Die Mitgliedstaaten sind außerdem verpflichtet, die erforderlichen Maßnahmen zu einer allgemeinen Information der Öffentlichkeit über den Zustand der Umwelt zu ergreifen.
Diese Richtlinie mußte von den Mitgliedstaaten der EU bis 31. Dezember 1992 in nationales Recht umgesetzt werden.[50] In Österreich ist das Umweltinformationsgesetz im Bundesgesetzblatt Nr. 495/1993 geregelt.
Als „Umweltdaten“ werden exemplarisch angeführt: Vorhaben oder Tätigkeiten, die Gefahren für den Menschen oder die Umwelt, umweltbeeinträchtigende Eigenschaften, Mengen und Auswirkungen von Chemikalien, Abfällen, usw. erzeugen können.
Zwei Bestimmungen des UIG richten sich direkt an Anlagenbetreiber als die Verpflichteten: die Bekanntmachung von Emissionsdaten (§ 13) und die Information über die Gefahr von Störfällen (§ 14). § 13 Abs. 1 fordert auch, die Daten „an einer allgemein leicht zugänglichen Stelle bekanntzumachen“.[51]
Eine Studie des BMU hat ergeben, daß entgegen den urspr-nglichen Erwartungen nicht B-rgerinitiativen, Pressure Groups (Umweltschutzorganisationen) und Medien die wichtigsten Informationsnachfragegruppen darstellten, sondern überwiegend betroffene Einzelpersonen. Während sich 1993 nur etwa 7 % der Befragten vorstellen konnten, vom UIG Gebrauch zu machen, waren dies ein Jahr später 24 %. Dies läßt sich auf das gestiegene Umweltinformationsinteresse zurückführen.[52]
Hier ist auch die 1994 aufgrund des § 14 Abs. 5 UIG erlassene Störfallinformations-verordnung (StIV), Bundesgesetzblatt Nr. 391/1994, zu erwähnen. Sie enthält nähere Bestimmungen über die Anlagentypen, die unter Informationspflicht fallen.
Insbesondere sind folgende Angaben zu machen: über die am Standort ausgeführten Tätigkeiten, die möglichen Gefahrenquellen und die Auswirkungen der Gefahren von Störfällen auf Leben und Gesundheit von Menschen und Umwelt. Weiters muß die Bevölkerung über das richtige Verhalten bei Eintritt eines Störfalles und die am Standort der Anlage getroffenen Sicherheitsvorkehrungen unterrichtet werden.[53]
Die grundlegenden Funktionen und Ziele des Umweltinformationsgesetzes werden in folgender Grafik zusammengefaßt:
Abbildung 8: Die Funktionen des UIG
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Quelle: Clausen, J./Lehmann, S.: Handbuch Umwelt-Controlling. Hrsg. Bundesumweltministerium/
Umweltbundesamt, M-nchen 1995, S. 82
1.4.2. EU-Richtlinie über die Umweltverträglichkeitspr-fung (UVP) bei bestimmten öffentlichen und privaten Projekten – UVP-Gesetz
Die Umweltfolgen eines geplanten Vorhaben sollen im vorhinein und unter Beteiligung der B-rgerInnen abgeschätzt werden.
Der Projektwerber muß mit einem Genehmigungsantrag das Verfahren einleiten. Durch Anschlag in der Standortgemeinde und den angrenzenden Gemeinden ist das Vorhaben kundzumachen. Innerhalb einer Frist von sechs Wochen kann jedermann eine schriftliche Stellungnahme abgeben. Danach läßt die Behörde durch die Sachverständigen das Umweltverträglichkeitsgutachten erstellen. Nach einer öffentlichen Erörterung mit der Möglichkeit einer Stellungnahme für alle erfolgt die m-ndliche Verhandlung.
Durch das UVP-Gesetz (4. Abschnitt) wird auch ein sogenannter Umweltrat eingerichtet, der unter anderem Ausk-nfte über anhängige Genehmigungsverfahren verlangen kann, die Auswirkungen der Gesetzesvollziehung auf den Umweltschutz beobachten und die Ergebnisse an den Bundesminister für Umwelt, Jugend und Familie weiterleitet oder Anregungen zur Verbesserung des Umweltschutzes aussprechen kann.
Der B-rgerbeteiligung ist ein eigener Abschnitt gewidmet, wo unter anderem festgelegt wird, daß die Eintragung in eine Unterschriftenliste (B-rgerinitiative) eine Stellungnahme unterst-tzen kann oder daß Standortgemeinde und angrenzende Gemeinden Stellung nehmen können und am Verfahren als Beteiligte mit dem Recht auf Akteneinsicht teilnehmen können.
Wer Parteienstellung hat (diejenigen, die durch Betrieb, Bestand oder Errichtung gefährdet oder belästigt werden), wird im § 19 festgelegt. Außerdem muß eine öffentliche Erörterung des Vorhabens durchgeführt werden. Die Ergebnisse der B-rgerbeteiligung sind von den Behörden bei der Entscheidung soweit wie möglich zu ber-cksichtigen.[54]
1.4.3. Umweltzeichenverordnung der Europäischen Union
Die Verordnung (EWG Nr. 880/92) zu einem gemeinschaftlichen System der Vergabe des Umweltzeichens wurde im März 1992 erlassen. Ziel der Verordnung ist:
- Förderung von Entwicklung, Herstellung, Vertrieb und Verwendung von Erzeugnissen, die während ihrer gesamten Lebensdauer geringere Umweltauswirkungen haben und
- bessere Unterrichtung der Verbraucher über Umweltbelastungen von Erzeugnissen
Der Antrag erfolgt im Erzeugerland und es werden folgende Aspekte beurteilt:
- Abfallaufkommen - Bodenverschmutzung und -schädigung
- Wasserverschmutzung - Luftverschmutzung
- Lärm - Energieverbrauch
- Auswirkungen auf Ökosysteme - Verbrauch natürlicher Ressourcen.[55]
1.4.4. „Environmental Management Auditing Scheme“ der Europäischen Union (EMAS-Verordnung/Öko-Audit)
Die Verordnung verlangt zunächst ein umfassendes, nach innen gerichtetes Umweltmanagementsystem und ordnet dieses zusätzlich einer externen Kontrolle unter, verlangt also ein dreistufiges Kontrollkonzept. Die Ziele, die damit verfolgt werden, sind:[56]
- Schaffung und Einsatz eines Umweltmanagementsystems.
- Systematische, objektive und periodische Bewertung der Erfolge, die durch den Einsatz des UmweltManagementystems erreicht werden.
- Unterrichtung der Öffentlichkeit über die umweltbezogene Leistung der Unternehmung am Standort.
Abbildung 9: Dreistufiges Steuerungs- und Kontrollkonzept des umweltbezogenen Unternehmenshandelns
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Quelle: Dyllick, Th.: Die EU-Verordnung zum Umweltmanagement und zur Umweltbetriebspr-fung (EMAS) im
Vergleich zur geplanten ISO-Norm-14001. In: Zeitschrift für Unternehmensführung (ZfU), 3/95, S. 315
Das System soll einen Anreiz für die eigenständige Wahrnehmung der unternehmerischen Umweltverantwortung geben, indem die wahrgenommene Umweltverantwortung transparent gemacht wird und damit die Basis für Kommunikation und Wettbewerb dieser „Umweltleistung“ gegeben werden.
Abschließend wird ein kurzer Überblick über den Weg zur Erlangung des Zertifikates gegeben, auf den möglichen Beitrag der EMAS-Verordnung für den Bereich der Öko-Kommunikation wird im 3. Kapitel genauer eingegangen.
Abbildung 10: Ablauf und Zusammenhang gemäß EMAS-Verordnung
Quelle: Dyllick, Th.: Die EU-Verordnung zum Umweltmanagement ..., S. 305 und Clausen, J./Fichter,K.:
Umweltbericht – Umwelterklärung ..., S. 46
1.4.5. ISO 14000-Normen
Parallel zur EMAS-Verordnung hat die International Organization for Standardization (ISO) eine weltweit g-ltige Norm für Umweltmanagementysteme erarbeitet. Im Unterschied zu EMAS weist das ISO-Umweltmanagementystem eine straffere Struktur auf und durch ihre Ähnlichkeit zum herkömmlichen Planungs- und Controllingkreislauf ist sie leichter in die Managementterminologie einbeziehbar.
Grundidee ist dieselbe wie bei EMAS: Durch Umweltmanagementysteme soll von einem reaktiven zu einem proaktiven Umweltverhalten übergegangen werden, Probleme werden selber erkannt und planvoll behandelt, bevor sie zu öffentlichen/politischen Anliegen werden.
Die Unterschiede zur EMAS-Verordnung sind folgende:
1. ISO gilt weltweit und ist nicht standortbezogen.
2. EMAS ist begrenzt auf gewerbliche Tätigkeiten, ISO ist völlig offen.
3. Die beim EMAS-System kritisierte Ausklammerung der Produkte wird hier vermieden.
4. Es besteht keine Veröffentlichungspflicht einer Umwelterklärung.
5. Privatwirtschaftliche Lösung, d.h. keine öffentliche Stelle pr-ft.
6. Es findet sich kein Erfordernis zur Einhaltung der „Guten Managementpraktiken“ oder zu EVABAT (economically viable application of best available technology).
7. Geht es bei EMAS um die kontinuierliche Verbesserung der „Umweltleistung/environmental performance“, verlangt ISO die kontinuierliche Verbesserung des „Umweltmanagementsystems“[57]
Abbildung 11: Ablauffolge ISO-UmweltManagementystem als dynamischer Prozeß der kontinuierlichen Verbesserung
Quelle: Dyllick, Th.: Die EU-Verordnung zum Umweltmanagement ..., S. 332
® Die geschilderten Ausz-ge aus dem Umweltrecht sollen einen Vorgeschmack auf eine F-lle von Gesetzen, Verordnungen usw. liefern. Denn, ein Irrtum des Täters sch-tzt grundsätzlich vor Strafe nicht. Eine Überprüfung der Gesetzeskonformität – wie im Öko-Audit gefordert – gewährt Rechtssicherheit und dient der Erkennung von Schwachstellen. Rechtzeitiges und systematisches Handeln kann daher viel Ärger und Geld sparen.
[...]
[1] Vgl. auch Freimann, J./Hildebrandt, E. (Hrsg.): Praxis der betrieblichen Umweltpolitik. Forschungsergebnisse und Perspektiven. Gabler Verlag, Wiesbaden 1995, S. 7f
[2] Vgl. Öko-Monitor 1996. In : Simperl, K.E.: Wettbewerbsvorteile durch Öko-Kommunikation. Baden 1996, S. 19f
[3] Vgl. Kr-ssel, P.: Ökologieorientierte Entscheidungsfindung in Unternehmen als politischer Prozeß. Rainer Hampp Verlag, M-nchen/Mering 1995, S. 27ff
[4] Vgl. Baumberger, H. U.: Unternehmensführung in einer sich wandelnden Gesellschaft. In: io Management Zeitschrift Nr. 59 (1990) Nr. 10, S. 27
[5] Vgl. Hopfenbeck, W.: Allgemeine Betriebswirtschaftslehre. Verlag moderne Industrie, 10. Auflage, Landsberg/Lech 1996, S. 220
[6] Vgl. Eschenbach, R./Müller, Ch. (Hrsg.): Umweltmanagement in Österreich. MANZsche Verlags- und Universitätsbuchhandlung, Wien 1992, S. 26
[7] Vgl. Helfert, M.: Wertewandel, Arbeit, technischer Fortschritt, Wachstum. Hrsg. vom Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Institut des Deutschen Geschäftsbundes, Bund-Verlag, Köln 1986, S. 9ff
[8] Vgl. Baumberger, H. U.: Unternehmensführung in einer sich wandelnden Gesellschaft ..., S. 28ff
[9] Vgl . Klages, H.: Wertewandel in Deutschland in den 90er Jahren. In: von Rosenstiel, L./Djarrahzadezeh M./Einsiedler H./Streich R. (Hrsg.): Herausforderungen für die Unternehmenspolitik in den 90er Jahren. 2. Auflage, Schaeffer-Poeschel Verlag, Stuttgart 1993, S. 3ff
[10] Vgl. Silberer, G.: Wertewandel und Wertorientierung in der Unternehmensführung. In: Marketing, Heft 2, 1991, S. 80
[11] Vgl. Szallis, R. /Wiswede, G.: Wertewandel und Konsum. Fakten, Perspektiven und Szenarien für Markt und Marketing; Verlag moderne Industrie, Landsberg/Lech 1990, S. 21f
[12] Vgl. Hopfenbeck, W.: Allgemeine Betriebswirtschaftslehre ..., S. 220
[13] Vgl. Simperl, K. E.: Wettbewerbsvorteile durch Öko-Kommunikation. SYNERGA-Unterlagen, Baden 1996, S. 19f
[14] Vgl. Pressetext Austria 17.2.1997, Aussendung BmUJF,
http://www.pressetext.at/cgi-bin/cgiwrap/prestext/.cgi/display.pl.cgi?pta=970217001
[15] Vgl. Hopfenbeck, W.: Allgemeine Betriebswirtschaftslehre ..., S. 735f
[16] Vgl. ebenda, S. 220
[17] Vgl. Szallies, R. /Wiswede, G.: Wertewandel und Konsum ..., S. 25ff
[18] Vgl. Gomez, P.: Ganzheitlich führen in Zeiten rasanten Technologiewandels. In: io Management Zeitschrift 65 (1996) Nr. 1, S. 22
[19] Vgl. Baumberger, H.U.: Unternehmensführung in einer sich wandelnden Gesellschaft ..., S. 27
[20] Vgl. Silberer, G.: Wertewandel und Wertorientierung in der Unternehmensführung ..., S. 77ff
[21] Vgl. ebenda, S. 79
[22] Bleicher, 1992. Zit. in: W-thrich, H. A.: Die Vergänglichkeit paradigmatischer Prämissen in der BWL. In: Die Unternehmung, 45. Jg. 1991, Nr. 5, S. 320
[23] Vgl. S teger, U.: Umweltmanagement. Erfahrungen und Instrumente einer umweltorientierten Unternehmensstrategie. Gabler Verlag, 2. Auflage, Wiesbaden 1993, S. 57ff
[24] Vgl. Dyllick, Th.: Ökologisch bewußte Unternehmensführung. Bausteine einer Konzeption. In: Die Unternehmung 6/92, o. S.
[25] Vgl. Seidel, E./Menn, H.: Ökologisch orientierte Betriebswirtschaft. Verlag Kohlhammer, Stuttgart 1988, S. 41
[26] Vgl. ebenda, S. 42
[27] Vgl. Dyllick, Th.: Ökologisch bewußte Unternehmensführung. Bausteine einer Konzeption ..., o. S.
[28] Vgl. Hopfenbeck, W.: Allgemeine Betriebswirtschaftslehre ..., S. 83f
[29] Vgl. Dyllick, Th.: Das Anspruchsgruppenkonzept: Eine Methodik zum Erfassen der Umweltbeziehungen der Unternehmung. In: io Management Zeitschrift, Nr. 2, 53 (1984), S. 74f
[30] Vgl. Clausen, J./Fichter, K.: Umweltbericht – Umwelterklärung. Carl Hanser Verlag, M-nchen/Wien 1996, S. 20f
[31] Vgl. Hopfenbeck, W.: Allgemeine Betriebswirtschaftslehre ..., S. 83
[32] Vgl. Probst, G./Gomez, P. (Hrsg.): Vernetztes Denken. Unternehmen ganzheitlich führen. Gabler Verlag, Wiesbaden 1989, S. 3
[33] Vgl. Hopfenbeck, W.: Allgemeine Betriebswirtschaftslehre ..., S. 512
[34] Vgl. Ulrich, H./Probst,G.: Anleitung zum ganzheitlichen Denken und Handeln. 3. Auflage, Verlag Haupt, Stuttgart/Bern 1991, S. 20
[35] Vgl. Hopfenbeck, W.: Umweltorientiertes Management und Marketing. Verlag moderne Industrie, 3. Auflage, Landsberg/Lech 1994, S. 47 und Ulrich, H.: Management. Verlag Haupt, Bern 1984, S. 24
[36] Vgl. Mann, R.: Das ganzheitliche Unternehmen. Scherz Verlag, Bern/M-nchen/Wien 1990, S. 79ff
[37] Vgl. Ulrich, H./Probst, G.: Anleitung zum ganzheitlichen Denken und Handeln ..., S. 27ff und S. 239ff
[38] Vgl. Steger, U.: Umweltmanagement. Erfahrungen und Instrumente ..., S. 59
[39] Vgl. Steinle, C./Lawa, D./Schollenberg, A.: Ökologieorientiertes Management – Stand und Ausgestaltungsformen zentraler Managementteilprozesse. In: UmweltWirtschaftsForum, September 1993, S. 9f
[40] Vgl. Steger, U.: Umweltmanagement. Erfahrungen und Instrumente einer umweltorientierten Unternehmensstrategie ..., S. 57ff
[41] Vgl. W-thrich, H. A.: Die Vergänglichkeit paradigmatischer Prämissen in der Betriebswirtschaftslehre ..., S. 332
[42] Vgl. Dyllick, Th.: Ökologisch bewußte Unternehmensführung. Bausteine einer Konzeption ..., o. S.
[43] Vgl. Kunczik, M./Heintzel, A./Zipfel, A.: Krisen-PR. Unternehmensstrategien im umweltsensiblen Bereich. Böhlau Verlag, Köln 1995, S. 15 und Simperl, K.E.: Umweltbewußtsein glaubhaft gemacht. Synerga-Unterlagen, Baden 1995, S. 4ff
[44] Vgl. Fromm, St.: So richten Sie Ihr Unternehmen auf Umweltschutz aus. In: io Management Zeitschrift 61 (1992), Nr. 1, S. 67f
[45] Vgl. ebenda, S. 67f
[46] Vgl. Dyllick, Th.: Ökologisch bewußte Unternehmensführung. Bausteine einer Konzeption ..., o. S.
[47] Vgl. Schlömer, R. H.: Interaktionen von Umweltbewußtsein, Umweltpolitik und emittierenden Industrien. Bochumer Wirtschaftswissenschaftliche Studien Bd. 132, Universitätsverlag Dr. N. Brockmeyer, Bochum 1993, S. 33ff
[48] Vgl. Simperl, K.E.: Umweltbewußtsein glaubhaft gemacht. SYNERGA-Unterlagen, Baden 1995, Grafik 3 im Anhang
[49] Vgl. Fichter, K.: EU-Öko-Audit-Verordnung. Carl Hanser Verlag, M-nchen/Wien 1995, Vorwort
[50] Vgl. Kramer, R.: Umweltinformationsgesetz, Öko-Audit-Verordnung, Umweltzeichenverordnung. Verlag Kohlhammer GmbH, Köln 1994, S. 60
[51] Vgl. Stangl, M./Fink, K. (Hrsg.): Leitfaden über das Umweltrecht, Kurzübersicht Stand Februar 1997. WEKA-Verlag, Wien 1997, Band 2, Register 6
[52] Vgl. Bundesministerium für Umwelt, Jugend und Familie: Bericht über die Erfahrungen mit der Vollziehung des UIG. Wien 1995, S. 10ff
[53] Vgl. Stangl, M./Fink, K. (Hrsg.): Leitfaden über das Umweltrecht, Kurzübersicht ..., Kapitel 3, S. 1ff
[54] Vgl. Stangl, M./Fink, K. (Hrsg.): Leitfaden über das Umweltrecht, Kurzübersicht ..., Register 5
[55] Vgl. Kramer, R.: Umweltinformationsgesetz, Öko-Audit-Verordnung, Umweltzeichenverordnung ..., S. 69ff
[56] Vgl. Dyllick, Th.: Die EU-Verordnung zum Umweltmanagement und zur Umweltbetriebspr-fung (EMAS) im Vergleich zur geplanten ISO-Norm-14001. In: Zeitschrift für Unternehmensführung (ZfU), 3/95, S. 300ff
[57] Vgl. Dyllick, Th.: Die EU-Verordnung zum Umweltmanagement ..., S. 331ff
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Originalausgabe
- Erscheinungsjahr
- 1997
- ISBN (eBook)
- 9783832451219
- ISBN (Paperback)
- 9783838651217
- DOI
- 10.3239/9783832451219
- Dateigröße
- 1.3 MB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- Johannes Kepler Universität Linz – Sozial- und Wirtschaftswissenschaften
- Erscheinungsdatum
- 2002 (März)
- Schlagworte
- emas öko-glaubwürdigkeit öko-kommuniaktion strategische erfolgsfaktoren umwelterklärung
- Produktsicherheit
- Diplom.de