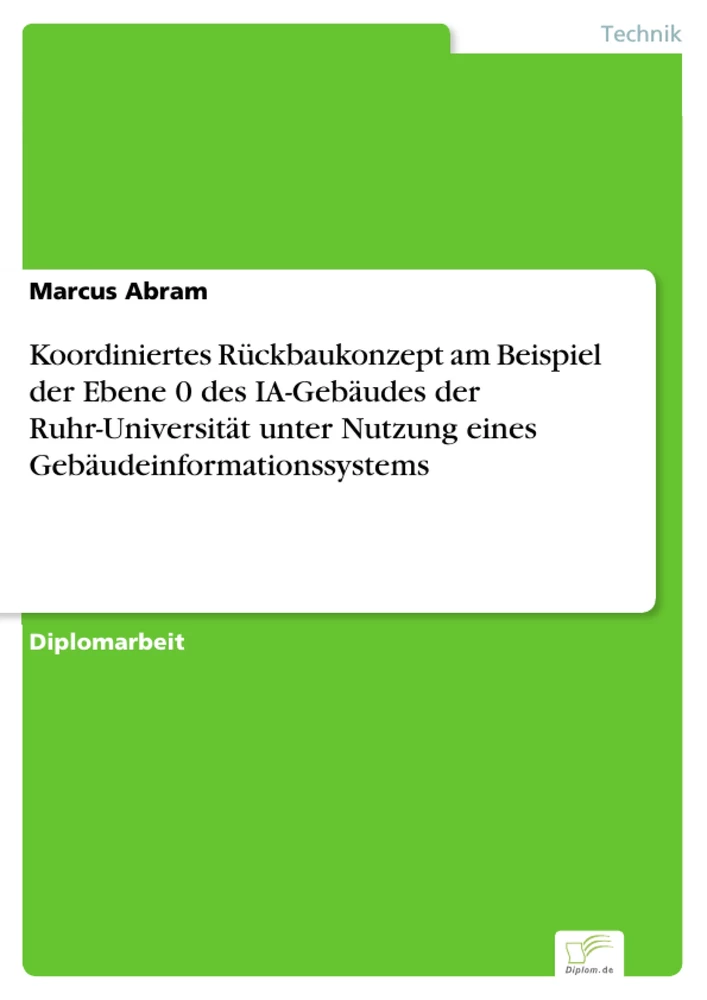Koordiniertes Rückbaukonzept am Beispiel der Ebene 0 des IA-Gebäudes der Ruhr-Universität unter Nutzung eines Gebäudeinformationssystems
Zusammenfassung
Das Kreislaufwirtschaft- und Abfallgesetzes verlangt eine Verwertung von Abfällen und verbietet eine Vermischung verschiedener Materialien. Vor diesem Hintergrund wird ein Rückbaukonzept erstellt, das es ermöglicht die verschiedenen voneinander separierten Baureststoffe einer möglichst hochwertigen Verwertung zuzuführen.
Die aus Bauwerksunterlagen und Gebäudebegehungen gewonnenen Daten werden in ein Gebäudeinformationssystem integriert. Dieses System dient zur Erstellung des Rückbaukonzeptes und der den einzelnen Rückbaustufen zugeordneten Plänen. Die den einzelnen Stufen zugehörigen Bauteile werden in einer Stückliste dargestellt.
Es wird eine Internet-Baureststoffbörse erstellt, die eine Verbindung zwischen Anbietern und Abnehmern von Baureststoffen herstellt. Auf diese Weise soll einerseits die Verwertungsquote erhöht werden, und andererseits sollen die Entsorgungskosten für den Anbieter gesenkt werden. Die Ergebnisse werden dargestellt und bewertet. Abschließend werden Schlussfolgerungen gezogen, Empfehlungen für die Zukunft gegeben und die Arbeit zusammengefasst.
Inhaltsverzeichnis:Inhaltsverzeichnis:
1.Einleitung
1.1Ausgangslage
1.2Zielsetzung
2.Vorgehensweise
3.Randbedingungen
3.1Rechtlicher Rahmen
3.1.1Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz (KrW-/AbfG, 1994)
3.1.2Abfallwirtschaftskonzept- und -bilanzverordnung (AbfKoBiV, 1996)
3.1.3Verordnung zur Einführung des Europäischen Abfallkatalogs (EAK - Verordnung, 1996)
3.1.4Landesabfallgesetz für NRW (LabfG, 1998)
3.1.5Landesbauordnung für NRW (BauONW, 1995)
3.1.6Satzung über die Abfallentsorgung in der Stadt Bochum (AbfS, 1999)
3.1.7VOB & TV-Abbruch
3.1.8Schlussfolgerungen
3.2Verwertungsmöglichkeiten und Baustoffrecycling
3.2.1Allgemeines / Formen der Entledigung
3.2.2Mineralische Materialien
3.2.3Andere Baureststoffe, mit denen im Zuge des Rückbaus zu rechnen ist
3.2.4Derzeitige Situation
3.3ArcView als Gebäudeinformationssystem
3.3.1Allgemeines zu Gebäudeinformationssystemen
3.3.2Die Möglichkeiten von ArcView
4.Bauwerk
4.1Baugeschichte und Nutzungsänderungen
4.2Gebäudeaufbau
4.3Zu erwartende Schadstoffe
5.Detaillierte Erfassung der Bauwerksdaten
5.1Bauwerksinformationen
5.1.1Überblick
5.1.2Decken und Galerien
5.1.3Stützen
5.1.4Treppen
5.1.5Wände
5.1.6Türen und Türelemente
5.1.7Fenster
5.1.8Deckenverkleidung
5.1.9Boden und Bodenbelag
5.1.10Sanitäre Einrichtungen
5.1.11Leitungen
5.1.12Sonstige […]
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Inhalt
1 Einleitung
1.1 Ausgangslage
1.2 Zielsetzung
2 Vorgehensweise
3 Randbedingungen
3.1 Rechtlicher Rahmen
3.1.1 Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz (KrW-/AbfG, 1994)
3.1.2 Abfallwirtschaftskonzept- und –bilanzverordnung (AbfKoBiV, 1996)
3.1.3 Verordnung zur Einführung des Europäischen Abfallkatalogs (EAK – Verordnung, 1996)
3.1.4 Landesabfallgesetz für NRW (LabfG, 1998)
3.1.5 Landesbauordnung für NRW (BauONW, 1995)
3.1.6 Satzung über die Abfallentsorgung in der Stadt Bochum (AbfS, 1999)
3.1.7 VOB & TV-Abbruch
3.1.8 Schlußfolgerungen
3.2 Verwertungsmöglichkeiten und Baustoffrecycling
3.2.1 Allgemeines / Formen der Entledigung
3.2.2 Mineralische Materialien
3.2.3 Andere Baureststoffe, mit denen im Zuge des R-ckbaus zu rechnen ist
3.2.4 Derzeitige Situation
3.3 ArcView als Gebäudeinformationssystem
3.3.1 Allgemeines zu Gebäudeinformationssystemen
3.3.2 Die Möglichkeiten von ArcView
4 Bauwerk
4.1 Baugeschichte und Nutzungsänderungen
4.2 Gebäudeaufbau
4.3 Zu erwartende Schadstoffe
5 Detaillierte Erfassung der Bauwerksdaten
5.1 Bauwerksinformationen
5.1.1 Überblick
5.1.2 Decken und Galerien
5.1.3 St-tzen
5.1.4 Treppen
5.1.5 Wände
5.1.6 T-ren und T-relemente
5.1.7 Fenster
5.1.8 Deckenverkleidung
5.1.9 Boden und Bodenbelag
5.1.10 Sanitäre Einrichtungen
5.1.11 Leitungen
5.1.12 Sonstige Einrichtungen
5.2 Widerspr-chliche Informationen und Unsicherheiten
5.3 GebIS – Schema, Aufnahme der Daten
5.3.1 Überblick
5.3.2 Datenerfassung
5.3.3 Datenverwaltung
5.3.4 Datenabfrage
5.3.5 Datenexport
5.3.6 Weitere Nutzungsmöglichkeiten
6 Grundkonzept einer Internet – Baureststoffbörse
6.1 Motivation und Ziel der Baureststoffbörse
6.2 Startseite und Titel der Baureststoffbörse
6.3 Funktionsweise
6.4 Beispiel zur Preisbildung durch schrittweise Steigerung der Gebote
6.5 Programmierung und Schwächen des Systems
7 R-ckbaukonzept unter Nutzung des GebIS
7.1 Grobe Festlegung der R-ckbaustufen
7.2 Genaue Festlegung der R-ckbaustufen und Bezeichnungsvergabe
8 Verwertungskonzept unter Einbeziehung der Baureststoffbörse
8.1 Materialbezogene Auswertung
8.2 Verwertungsplanung unter Nutzung der Baureststoffbörse
8.3 Verwertungsbezogene Auswertung
9 Bewertung der Ergebnisse
10 Empfehlungen und Ausblick
11 Zusammenfassung
12 Literatur
13 Anhang
Tabellen
Tabelle 3.1: Verzeichnis von Abfällen gemäß EAK-Verordnung
Tabelle 3.2: Formen der Entledigung
Tabelle 5.1: Themenzuordnung der einzelnen Bauteile
Tabelle 6.1: Ausz-ge von Entsorgungskosten für Baurestmassen
Tabelle 7.1: Massenverteilung der einzelnen R-ckbaustufen
Tabelle 8.1: Massenverteilung der Materialien der Ebene 0
Tabelle 8.2: Massenanteile der einzelnen Entledigungsformen
Abbildungen
Abbildung 1.1: Von der Bundesregierung für 1995 vorgegebene Verwertungsquote
Abbildung 3.1: Drei Typen von Informationssystemen
Abbildung 4.1: Konstruktives System in Draufsicht und Schnitt
Abbildung 4.2: Aufbau eines Kerns
Abbildung 4.3: Details zu den St-tzen
Abbildung 4.4: schematische Deckenuntersicht
Abbildung 5.1: Legende der im GebIS verwendeten Themen
Abbildung 5.2: Oberfläche des Systems, nur der Grundriß ist aktiviert
Abbildung 5.3: Attributtabelle der Bodenbeläge
Abbildung 5.4: Abfrageergebnis einer St-tzenverkleidung mit dem Werkzeug Identifizierung und Aufruf eines Detailfotos mittels eines Hot-Links
Abbildung 5.5: Ermittlung von Daten mittels Abfrageausdrucks
Abbildung 6.1: Startseite der Baureststoffbörse reUsus
Abbildung 6.2: Anmeldeseite der Baureststoffbörse reUsu s
Abbildung 6.3: R-ckmeldung auf die erfolgreiche Anmeldung
Abbildung 6.4: Daten ändern oder löschen
Abbildung 6.5: Angebot aufgeben
Abbildung 6.6: Eingabe der Suchkriterien
Abbildung 6.7: Ausgabe der zur Suche passenden Datensätze und Wahl eines Datensatzes
Abbildung 6.8: Maximalgebot abgeben
Abbildung 6.9: Grafik zur Verdeutlichung der CGI-Situation
Abbildung 7.1: Montagekran mit Deckenelement
1 Einleitung
1.1 Ausgangslage
Das Bauwesen ist mit seinem jährlichen Verbrauch von 660 Mio. Tonnen Rohstoffen der materialintensivste Wirtschaftszweig Deutschlands. Diese Rohstoffe werden in der Regel auf Jahrzehnte bis zum Abbruch der jeweiligen Bauwerke gebunden.
Das dem Bausektor zuzurechnende Abfallaufkommen beträgt rund 285 Mio. Tonnen. Das entspricht etwa 80 M.-% (Massenprozent) bzw. 60 Vol.-% (Volumenprozent) des gesamten Abfallaufkommens. Bis zum Jahr 2020 wird mit einem Anstieg des Abfallaufkommens auf über 330 Mio. Tonnen gerechnet. Im Gegensatz zum Bereich des Straßenbaus ist der Bereich des Hochbaus noch überwiegend durch nicht r-ckführende Prozesse gekennzeichnet (HOLZKAMP, 1999; KLOFT, 1997).
Die Brisanz der Thematik wird anhand der Verknappung der Rohstoffressourcen und der Deponieräume deutlich (KLEMT, 1997).
Vor diesem Hintergrund wird die Notwendigkeit nach einer Weiter- bzw. Wiederverwertung der verwendeten Materialien ersichtlich. Aber auch die steigenden Kosten für die Abfallbeseitigung zwingen zur Wiederverwertung.
Den gesetzlichen Rahmen hierzu bildet das Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, nach dessen Maßgabe Abfälle zu vermeiden, falls nicht zu vermeiden zu verwerten und falls nicht verwertbar schadlos zu entsorgen sind.
Für 1995 hat die Bundesregierung eine Verwertung von 60% des Bauschutts, 70% des Erdaushubs, 90% des Straßenaufbruchs und 40% der Baustellenabfälle vorgegeben. Diese sind allerdings nicht eingehalten worden. Hochwertige Verwertungsmöglichkeiten werden bisher kaum genutzt. Häufig kommt es zum sogenannten Downcycling, d.h. die Baustoffe werden nicht auf gleichem Qualitätsniveau verwertet, sondern auf einem niedrigerem Niveau.
Abb. 1.1: Von der Bundesregierung für 1995 vorgegebene Verwertungsquote (nach BREITENBÜCHER et al., 1996)
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Im Vergleich zu konventionellen Abbruchmethoden ist es durch einen koordinierten R-ckbau leichter und kostengünstiger möglich die verschiedenen Baustoffe voneinander zu trennen, Schad- und Störstoffe abzutrennen. So wird eine Qualitativ höherwertige Wiederverwertung der Baustoffe ermöglicht.
Im Unterschied zum herkömmlichen Abbruch erfordert der R-ckbau eine intensivere Vorplanung im Hinblick auf eine spätere Verwertung der zu erwartenden Baureststoffe.
Gebäudeinformationssysteme können bei der Planung und Durchführung eines R-ckbaus helfen, da sie im Idealfall sämtliche Informationen eines Bauwerkes enthalten und so Überraschungen, bedingt zum Beispiel durch die Verwendung veralteter oder unvollständiger Baupläne, vermeiden können.
1.2 Ziel der Bearbeitung
Die wesentlichen Bauwerksdaten der Ebene 0 des IA-Gebäudes der Ruhr-Universität sind zu ermitteln.
Die Daten werden in ein Gebäudeinformationssystem (GebIS) integriert. Dieses GebIS ermöglicht es die Gebäudegeometrie mit Sachdaten zu kombinieren.
Besonders sinnvoll ist eine Aufnahme der Daten mittels eines Gebäudeinformationssystems, da der R-ckbau nicht unmittelbar bevorsteht, sondern voraussichtlich erst in ferner Zukunft erfolgt. Bis zu diesem Zeitpunkt bietet das GebIS die Möglichkeit, sich durch Umbauten ergebende, neue Informationen aufzunehmen und so stets eine kostengünstige Anpassung des R-ckbaukonzeptes zuzulassen.
Unter Nutzung dieses Informationssystems werden ein koordiniertes R-ckbaukonzept für die Ebene 0 und zugehörige R-ckbaupläne erstellt.
Es wird nach Verwertungsmöglichkeiten der einzelnen voneinander separierten Baustoffe gesucht. Um eine Schnittstelle zwischen dem Anbieter, das heißt dem Abfallbesitzer und dem Abnehmer, in der Regel Recycling- und Entsorgungsfirmen, zu schaffen, wird eine Internet-Plattform für den Handel mit Baureststoffen programmiert.
2 Vorgehensweise
Im erster Schritt der Bearbeitung werden in Kapitel 3 die gesetzlichen Rahmenbedingungen, die Verwertungsmöglichkeiten der Baureststoffe, mit denen im Zuge eines R-ckbaus zu rechnen ist, und die Grundlagen von Gebäudeinformationssystemen dargestellt.
In Kapitel 4 wird der bau- und nutzungsgeschichtliche Hintergrund des Gebäudes beschrieben. Aufgrund dessen läßt sich eine erste Annahme über die zu erwartenden Schadstoffe treffen.
Im folgenden Schritt wird in Kapitel 5 beschrieben, welche Daten des Gebäudes im einzelnen erfaßt werden, welchen Unsicherheiten sie unterliegen, und wie sie in ein Gebäudeinformationssystem eingebunden werden.
Im sechsten Kapitel wird die Baureststoffbörse ausf-hrlich vorgestellt und ihre Funktionsweise erläutert.
In Kapitel 7 werden die im Gebäudeinformationssystem verwalteten Daten hinsichtlich eines R-ckbaus ausgewertet. Mit Hilfe des GebIS werden für die einzelnen R-ckbaustufen R-ckbaupläne erstellt.
Es folgt in Kapitel 8 die Auswertung hinsichtlich Verwertung und Entsorgung. Hierzu werden die im GebIS erfaßten Daten hinsichtlich der stofflichen Bauteilzusammensetzung bilanziert, sowie eine möglichst sinnvolle Entledigungsform der einzelnen Bauteile bzw. Baustoffe ermittelt. Hierzu dient die in Kapitel 6 vorgestellte Baureststoffbörse.
Zum Abschluß werden die Ergebnisse bewertet und Schlußfolgerungen gezogen. Die Arbeit wird nochmals kurz zusammengefaßt.
3. Rahmenbedingungen
3.1 Rechtlicher Rahmen
Der rechtliche Rahmen wird gebildet durch das Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz auf Bundesebene, durch die Landesbauordnung und das Landesabfallgesetz auf Länderebene, kommunalen Satzungen, sowie diverser Verordnungen und Verwaltungsvorschriften.
Im folgenden werden die relevanten Gesetze und Verordnungen kurz erläutert.
3.1.1 Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz (KrW-/AbfG, 1994)
Am 7. Oktober 1996 ist das Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz (KrW-/AbfG) vom 27. September 1994 in Kraft getreten. Anders als im Abfallbeseitigungsgesetz von 1977 steht nun nicht mehr die Beseitigung im Vordergrund, sondern die Vermeidung und Verwertung der anfallenden Stoffe.
Zweck des Gesetzes ist laut § 1 die Förderung der Kreislaufwirtschaft zur Schonung der natürlichen Ressourcen und die Sicherung der umweltverträglichen Beseitigung von Abfällen.
§ 2 legt den Geltungsbereich der Vorschriften dieses Gesetzes auf die Vermeidung, die Verwertung und die Beseitigung von Abfällen fest. Bauabfälle unterliegen in vollem Umfang den Vorschriften dieses Gesetzes, für sie gelten keine Ausnahmen.
§ 3 umfaßt die Begriffsbestimmungen. So sind im Sinne des Gesetzes Abfälle alle beweglichen Sachen, deren sich ihr Besitzer entledigt, entledigen will oder entledigen muß.
Sowohl eine Beseitigung nach Anhang II A als auch eine Verwertung nach Anhang II B stellt eine Entledigung im Sinne dieses Gesetzes dar. Also wird auch Bauschutt zur Verwertung als Abfall definiert. Die Bezeichnung des Abfalls richtet sich nach der gewählten Entsorgungsart. Man spricht somit von Abfall zur Verwertung bzw. von Abfall zur Beseitigung.
Durch § 4 wird die Rangfolge der Behandlung der Abfälle festgelegt. In erster Linie sind sie zu vermeiden und in zweiter Linie stofflich zu verwerten oder zur Energiegewinnung zu nutzen.
In § 5 Abs. 2 heißt es: „Die Erzeuger oder Besitzer von Abfällen sind verpflichtet, diese nach Maßgabe von § 6 zu verwerten. Soweit sich aus diesem Gesetz nichts anderes ergibt, hat die Verwertung von Abfällen Vorrang vor deren Beseitigung. Eine der Art und Beschaffenheit des Abfalls entsprechende hochwertige Verwertung ist anzustreben. Soweit dies zur Erf-llung der Anforderungen nach §§ 4 und 5 erforderlich ist, sind Abfälle zur Verwertung getrennt zu halten und zu behandeln.“
Nach Abs. 4 ist die Pflicht zur Verwertung von Abfällen einzuhalten, soweit dies technisch möglich und wirtschaftlich zumutbar ist.
Abs. 5 stellt eine Einschränkung der oben genannten Pflichten dar. Somit entfällt der Vorrang der Verwertung von Abfällen, wenn deren Beseitigung die umweltverträglichere Lösung darstellt. Dabei sind insbesondere zu ber-cksichtigen:
1. die zu erwartenden Emissionen,
2. das Ziel der Schonung der natürlichen Ressourcen,
3. die einzusetzende oder zu gewinnende Energie und
4. die Anreicherung von Schadstoffen in Erzeugnissen, Abfällen zur Verwertung oder daraus gewonnenen Erzeugnissen.
Abfälle können sowohl stofflich als auch energetisch verwertet werden. § 6 legt fest, daß die umweltverträglichere Verwertungsart Vorrang hat.
§§ 19 bis 21 verpflichten zur Erstellung von Abfallwirtschaftskonzepten und Abfallbilanzen, wenn bei einem Erzeuger größere Abfallmengen anfallen.
3.1.2 Abfallwirtschaftskonzept und –bilanzverordnung (AbfKoBiV, 1996)
Diese Verordnung regelt Form und Inhalt der nach §§ 19 und 20 KrW-AbfG erforderlichen Unterlagen sowie Ausnahmen für bestimmte Abfallarten für das Abfallwirtschaftskonzept und die Abfallbilanz.
Nach § 2 sind besonders überwachungsbed-rftige Abfälle und überwachungsbed-rftige Abfälle in ihrer Art darzustellen und ihre jeweilige Menge zu ermitteln. Die Abfallbezeichnung nach, der in Kapitel 3.1.3 erläuterten, EAK-Verordnung ist anzugeben.
Desweiteren wird Darstellungsform insbesondere von Verbleib und Entsorgungsweg der genannten Abfallarten geregelt.
3.1.3 Verordnung zur Einführung des Europäischen Abfallkatalogs (EAKV, 1996)
Die EAK-Verordnung vom 13. September 1996 ist am 7. Oktober 1996 in Kraft getreten. Seit dem 1. Januar 1999 gibt es keine Übergangsregelungen mehr, so daß der Europäische Abfallkatalog die Abfallbezeichnungen der Länderarbeitsgemeinschaft abgelöst hat.
Der Europäische Abfallkatalog vereinheitlicht die Bezeichnung anfallender Abfälle europaweit, indem einzelnen branchen- und prozesspezifischen Stoffgruppen Abfallschl-ssel zugeordnet werden, die aus einer sechsstelligen Ziffernkombination bestehen. Diese Abfallschl-ssel m-ssen bei behördlichen Entscheidungen, Planfeststellungen, Genehmigungen, Zulassungen, Erlaubnissen und Bewilligungen sowie Entsorgungsnachweisen angegeben werden.
Bau- und Abbruchabfälle sind in der Branchenkategorie 17 zusammengefaßt. Kategorie 17 05 (Erde und Hafenaushub) fällt im Rahmen dieser Arbeit nicht an. Materialien, denen keine Abfallbezeichnung der Kategorie 17 zugeordnet werden kann, werden Bezeichnungen anderer Branchenkategorien zugeordnet.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Tab. 3.1: Verzeichnis von Abfällen gemäß EAKV (1996)
3.1.4 Landesabfallgesetz für NRW (LabfG, 1998)
Das Ziel des Landesabfallgesetzes NRW vom 24. November 1998 ist die Förderung einer möglichst abfallarmen Kreislaufwirtschaft zur Schonung der natürlichen Ressourcen und die Sicherung der umweltverträglichen Beseitigung von Abfällen im Einklang mit den Bestimmungen des Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes.
Unter anderem in Bezug auf Baureststoffe legt § 1 des Gesetzes fest, daß Abfälle ordnungsgemäß, schadlos und möglichst hochwertig verwertet werden sollen. Nicht verwertbare Abfälle sollen zur Verringerung ihrer Menge und Schädlichkeit entsprechend behandelt werden. Nicht verwertbare Abfälle sollen im Inland möglichst in der Nähe ihres Entstehungsortes beseitigt werden.
§ 2 fordert bei Bauvorhaben den Vorrang von rohstoffschonenden Verfahren, den Einsatz von Recycling - Erzeugnissen, sowie den Einsatz von Erzeugnissen, die sich zur Verwertung und zur verträglichen Beseitigung eignen.
Nach § 5 sind Bauabfälle vom Zeitpunkt ihrer Entstehung an voneinander getrennt zu halten, soweit dies für ihre ordnungsgemäße, schadlose und möglichst hochwertige Beseitigung erforderlich ist.
3.1.5 Landesbauordnung für NRW (BauONW, 1995)
Die Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen vom 7.3.1995 fordert nach § 69 die Einreichung eines Bauantrags, auch für Abbrucharbeiten, mit allen erforderlichen Unterlagen.
3.1.6 Satzung über die Abfallentsorgung in der Stadt Bochum (AbfS, 1999)
Ziel und Aufgabe der Abfallsatzung der Stadt Bochum vom 18.12.1996 in der Fassung der zweiten Änderungssatzung vom 1.2.1999 ist die Förderung der Abfallvermeidung, die Gewinnung von Stoffen aus Abfällen (stoffliche Verwertung), die Gewinnung von Energie aus Abfällen (energetische Verwertung) und die Beseitigung von Abfällen auf Grundlage des Landesabfallgesetzes, der Landesbauordnung und des Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes.
Die Aufgaben, die Maßnahmen sowohl zur Bereitstellung, Überlassung, Einsammlung durch Hol- und Bringsysteme, Beförderung, Behandlung, Lagerung und Ablagerung als auch Beratung über Möglichkeiten der Vermeidung, Verwertung und Beseitigung von Abfällen umfassen, werden durch die Umweltservice Bochum GmbH erledigt.
Von der Entsorgung durch die Stadt Bochum ausgeschlossen sind Abfälle aus Industrie und Gewerbe in großen Mengen, Bau- und Abbruchabfälle, sowie schadstoffhaltige Abfälle in nicht haushalts-blichen Mengen und einige andere Abfallarten.
3.1.7 VOB (1992) und TV-Abbruch (1997)
Auch für Abbruchleistungen ist die VOB/A die Grundlage für die Ausschreibung und Vergabe, da jene nach § 1 als Bauleistungen eingestuft werden. Die Anforderungen an die Sicherheit und den Gesundheitsschutz sind in den Ausschreibungen zu ber-cksichtigen.
Es gibt bislang noch keine eigenen Allgemeinen Technischen Vorschriften (ATV) für Abbrucharbeiten, jedoch greifen auch hier die DIN 18299 (Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten jeder Art) der VOB/C. Daher empfiehlt der Deutsche Abbruchverband e.V. die TV-Abbruch zusammen mit der VOB/A/B/C als Vertragsbestandteil auszuweisen.
Die Regelungen der TV-Abbruch sind, bei ihrer Übernahme als Vertragsgrundlage, für die Vertragspartner verbindlich.
3.1.8 Schlußfolgerungen
Das Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz bildet den Rahmen für den Umgang mit den anfallenden Bauabfällen. Da eine Vermeidung von Abfällen im Rahmen eines R-ckbaus nicht möglich ist, sind sie auf der Baustelle getrennt zu halten und zu verwerten, soweit möglich und wirtschaftlich zumutbar. Die umweltverträglichste Verwertungsart hat Vorrang.
Aufgrund der großen Abfallmengen ist ein Abfallwirtschaftskonzept zu erstellen. Die Abfallwirtschaftkonzept und –bilanzverordnung fordert eine Mengenermittlung und die Angabe der Abfallbezeichnungen nach der EAK-Verordnung.
Das Landesabfallgesetz für NRW fordert eine möglichst hochwertige Verwertung der Abfälle. Die Abfälle sind auf der Baustelle somit voneinander getrennt zu halten.
Nach Landesbauordnung ist ein Bauantrag für den R-ckbau einzureichen.
Die Abfallsatzung der Stadt Bochum schließt eine Entsorgung der Bauabfälle aus.
Wenn es zur Auftragsvergabe zum R-ckbau des Gebäudes kommt, sollten VOB und TV-Abbruch Vertragsgrundlage sein.
3.2 Verwertungsmöglichkeiten und Baustoffrecycling
3.2.1 Allgemeines / Formen der Entledigung
Es gibt verschiedene Entledigungsarten für Baureststoffe:
1. Wiederverwendung
2. Verwertung
2.1 stoffliche Verwertung auf gleichem Niveau
2.2 stoffliche Verwertung auf niedrigerem Niveau
2.3 thermische Verwertung
3. Deponierung/Beseitigung
Unter Wiederverwendung versteht man die direkte Verwendung von Bauteilen ohne Umwandlung der Produkt- bzw. Materialgestalt für Anwendungen, die ihrem urspr-nglichen Zweck entsprechen.
Verwertung stellt den Oberbegriff für stoffliche und thermische Verwertung dar. Das Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz fordert die Verwertung, wobei die umweltverträglichere Verwertungsart der Vorrang gegeben wird.
Werden Stoffe auf niedrigerem Niveau weiterverwertet, so spricht man von Down-cycling. Ein Beispiel hierfür ist die Verwendung von Hochbauabbruch als Verf-llmaterial oder Lärmschutzwänden.
Im Sinne des Stoffkreislaufes ist aber eine Verwertung auf möglichst hohem Niveau anzustreben. So läßt sich zum Beispiel Betonbruch als Zuschlagstoff bei der Betonherstellung verarbeiten, und Asphaltaufbruch zu bituminösen Tragschichten. In diesen Fällen handelt es sich um echtes Recycling.
Eine weitere Form der Entledigung stellt die Deponierung dar. Eine Deponierung der Materialien ist zu vermeiden, da sie somit aus dem Stoffkreislauf ausscheiden.
Da die Qualität des Sekundärrohstoffs von dessen Zusammensetzung abhängt, sollte auf die Sortentrennung der Abbruchmaterialien besonderer Wert gelegt werden.
Tabelle 3.2 stellt die Entledigungsformen in kompakter Form dar.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Tab. 3.2: Formen der Entledigung von Baureststoffen (Die Ziffern entsprechen der Nummern der Entledigungsart auf S.17.)
Ganze Bauteile, wie zum Beispiel Heizkörper und T-ren können nur einer Wiederverwertung zugef-hrt werden, wenn ein geeigneter Abnehmer gefunden wird.
Nachfolgend werden die Materialien, mit denen im Zuge des R-ckbaus zu rechnen ist, möglichst hochwertigen Entledigungsformen zugeordnet. Eine Deponierung ist im Prinzip immer möglich.
3.2.2 Mineralische Materialien
Den größten Umfang der anfallenden Baureststoffe bilden mineralische Stoffe. Der Umfang und die Art der Verwertung mineralischer Baureststoffe wird entscheidend durch die Art der Aufbereitung und der daraus resultierenden Qualität beeinflußt. Derzeit ist die Aufbereitung, unter Ausschluß von Baustoffen auf Gips- und Asbestbasis, auf die Verwendung im Straßen und Wegebau ausgerichtet, also einer stofflichen Verwertung auf niedrigerer Stufe (Tab. 3.2, Entledigungsform 2.3). Prinzipiell eignen sich mineralische Baustoffe aber auch als Sekundärzuschlag bei der Betonherstellung. Die bisherigen Erkenntnisse haben zu der, von GRÜBL (1998) erläuterten, vorläufigen DAfStb-Richtlinie „Beton mit rezykliertem Zuschlag“ über die Verwendung von Betonsplitt und Betonbrechsand gef-hrt.
Wie die mineralischen Baureststoffe einer möglichst hochwertigen Verwertung (Tab. 3.2, Entledigungsform 2.2) zugef-hrt werden können wird nachfolgend erläutert:
Beton
Nach MÜLLER (1998) sind der direkten stofflichen Verwertung des Baustoffs Beton, das heißt Verwertung von 1 m3 altem Beton zur Herstellung von 1 m3 neuem Beton, bei gleichbleibender Qualität auch bei Sortenreinheit sowohl bei heutiger als auch bei zuk-nftiger Aufbereitungstechnik Grenzen gesetzt, da sich die gef-gebildenden Vorgänge (Hydratation) nicht unmittelbar, sondern nur durch zusätzlichen Stoffeinsatz und Energieeinsatz, umkehren lassen.
Bei herkömmlicher mechanischer Zerkleinerung eines Betons B25 zum Beispiel durch eine Prallm-hle, mit dem Ziel Zuschlag im günstigen bis brauchbaren Sieblinienbereich zu erhalten, fallen rund 30 M.-% des Betons als Brechsand der Körnung 2 mm an, die -brigen 70 M.-% als Betonsplitt. Zur Herstellung eines Betons B25 lassen sich jedoch nur 50 Vol.-% Betonsplitt und 20 Vol.-% Brechsand einsetzen. Die direkte Verwertungsquote liegt somit bei rund 30 M.-%.
Der nicht verwertete Brechsand läßt sich grundsätzlich als Zuschlag für Mauermörtel und als Rohstoffkomponente bei der Zementproduktion verwenden.
Faser- und Polymerbetone lassen sich zur Zeit noch nicht aufbereiten.
Gips
Gips (CaSO42H2O) tritt in der Natur auf, doch wird heute in bedeutendem Ausmaß Gips aus Rauchgas-Entschwefelungs-Anlagen verwertet. Bei der Produktion von Gipsplatten wird der Gipsbrei zwischen zwei Kartoneinlagen aufgetragen.
Jährlich fallen ca. 450000 t, also ca. 1% der Baurestmasse, Gipsbaustoffe an, deren Nutzungsdauer abgelaufen ist.
Grundsätzlich lassen sich nach HUMMEL (1997) Gipsplatten vollständig in den Produktionsprozeß zurückführen, sofern keine störenden Verunreinigungen vorhanden sind. Wenn die Platten nicht verunreinigt sind, lassen sich Gips und Karton mechanisch durch zerkleinern und mahlen weitestgehend trennen. Es folgt die direkte stoffliche Verwertung durch die Gipsindustrie. Beschichtete oder angestrichene Platten lassen sich nach dem Müller-K-hne-Verfahren stofflich verwerten. Als Produkte entstehen Schwefelsäure und Zement. Diese Stoffe können von der chemischen Industrie und der Bauindustrie verwendet werden
Ziegel
Mauerziegel lassen sich nach MÜLLER (1998) nur in relativ geringen Mengen bei der Herstellung neuer Ziegel stofflich verwerten. In sortenreinem Zustand, das heißt ohne Mörtelreste, können 10 bis 20 M.-% in Form von gemahlenem Ziegelsplitt als Magerungsmittel bzw. F-llstoff dem Rohstoffgemisch zugegeben werden. Höhere Anteile führen zu Festigkeitsverlusten. Ziegelsplitt läßt sich auch als Zuschlagstoff in der Betonherstellung verwerten, die Zuschlagkörner sind aber bei der Verwertung von Splitt aus Leichthochlochziegeln ungünstig geformt. Außerdem können Mauersteine auf Ziegelsplittbasis mit einem Anteil von 10% Ton, sowie Braunkohlenflugasche und Wasser bei einer Temperatur von ungefähr 1130°C gebrannt werden.
Bims
Bimsbauschutt kann bis zu 5 Vol.-% des Naturbims bei der Leichtbetonherstellung ersetzen (MÜLLER, 1998).
Kalksandstein
Die Wiederverwertung von Kalksandstein-Bruchmaterial als Zugabe zur Roh-mischung der Kalksandstein-Produktion ist nach MÜLLER (1998) sowohl im sortenreinem Zustand als auch mit Mörtelresten problemfrei. Anhaftende Fremdstoffe führen unter Umständen zu erheblichen Qualitätseinbußen der neuen Kalksandsteine.
Porenbeton
Porenbetonbruch mit Putz- und Mörtelresten von bis zu 10 M.-% der Trockenrezeptur kann nach MÜLLER (1998) ohne Qualitätsverlust als Zugabe bei der Porenbetonherstellung verwendet werden.
Jedoch wird zerkleinerter Porenbetonbruch überwiegend als Wärmedämmsch-ttung oder als Substrat für Gr-ndächer auf stofflich niedrigerer Stufe verwertet (Tab. 3.2, Entledigungsform 2.2).
Mauermörtel und Putze
In der Praxis ist nur eine Verwertung von Werktrockenmörtel möglich, da eine Trennung des Mauermörtels vom Stein nicht mit vertretbarem Aufwand möglich ist. Für Putze gilt das gleiche (MÜLLER, 1998).
Mineralisches Dämmaterial
Zu den mineralischen Dämmaterialien zählen Erzeugnisse aus Glas- und Steinwolle. Sowohl eine direkte Wiederverwendung als auch eine stoffliche Verwertung als Sekundärrohstoff bei der Neuproduktion ist möglich.
Asbest
Asbesthaltiges Material ist nach MÜLLER (1998) als Abfall entsprechend zu beseitigen (Tab. 3.2, Entledigungsform 3).
3.2.3 Andere Baureststoffe, mit denen im Zuge des R-ckbaus zu rechnen ist
Im folgenden werden Entledigungsformen und Verwertungsmöglichkeiten nichtmineralischer Baustoffe beschrieben. Die Deponierung (Tab. 3.2, Entledigungsform 3) der Baustoffe ist im Prinzip immer möglich.
Holz
Unbehandeltes Holz läßt sich nach SCHREYER (1999) direkt wiederverwenden (Tab. 3.2, Entledigungsform 1) oder der stofflichen zur Spanplatten- und Papierherstellung verwerten
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
(Tab. 3.2, Entledigungsform 2.2). Auch eine thermische Verwertung ist möglich (Tab. 3.2, Entledigungsform 2.3).
Lackiertes Holz kann bei der Spanplattenherstellung und thermisch verwertet werden (Tab. 3.2, Entledigungsformen 2.2 und 2.3).
Papier und Pappe Papier und Pappe können zur Energieerzeugung (Tab. 3.2, Entledigungsform 2.3) und in der Papierindustrie (Tab. 3.2, Entledigungsform 2.1) genutzt werden (SCHREYER, 1999).
Metalle Metalle lassen sich nach SCHREYER (1999) einschmelzen und stofflich verwerten (Tab. 3.2, Entledigungsform 2.1).
Kunststoffe
PVC kann SCHREYER (1999) zufolge nach entsprechender Behandlung bei der Produktion neuer Fenster, Bodenbelägen und Rohren dem frischen PVC zugemischt werden (Tab. 3.2, Entledigungsform 2.1). Textilbodenbeläge können als Zusatzstoff für Dämmaterialien verwendet werden (Tab. 3.2, Entledigungsform 2.2).
Kabel
Der PVC-Anteil der Elektrokabel kann nach SCHREYER (1999) nach entsprechender Aufarbeitung als Zugabe bei der PVC-Bodenbelagproduktion dienen. Sind verschiedene Kunststoffe verwendet worden, ist lediglich eine Zugabe bei der Produktion von Schallschutzwänden, Parkbänken, usw. möglich (Tab. 3.2, Entledigungsform 2.2).
Polystyroldämmung
Dämmung aus Polystyrol, auch Styropor genannt, kann nach SCHREYER (1999) zur Verpackungsproduktion verwendet oder in den Ausgangsstoff zurückgewandelt werden (Tab. 3.2, Entledigungsform 2.1 und 2.2).
Isoliermaterial
Dachbahnen finden Verwertung in der Neuproduktion (Tab. 3.2, Entledigungsform 2.1) (SCHREYER, 1999).
Glas
Beschichtetes Glas kann nach SCHREYER (1999) nicht verwertet werden (Tab. 3.2, Entledigungsform 3). Unbeschichtetes dagegen läßt sich direkt oder durch einschmelzen stofflich verwerten (Tab. 3.2, Entledigungsform 2.1).
Verbundbaustoffe
Verbundbaustoffe werden je nach Zusammensetzung der thermischen Verwertung oder der Beseitigung zugef-hrt (Tab. 3.2, Entledigungsform 2.3 bzw. 3). Gelegentlich ist es sinnvoll Verbundbaustoffe in ihre Bestandteile zu zerlegen, und diese einer höherwertigen Entledigungsform zuzuführen.
3.3 ArcView als Gebäudeinformationssystem
3.3.1 Allgemeines zu Gebäudeinformationssystemen
Nach ZIPPELT (1999) versteht man unter Gebäudeinformation das strukturierte Wissen über die Geometrie der Gebäude und seiner Einrichtungen, über die Einordnung des Gebäudes in einen Raumbezug und über die Beschreibungen, Nutzungen und Bewertungen des Gebäudes mitsamt seinen Einrichtungen.
Ein Gebäudeinformationssystem, kurz GebIS genannt, ist ein Softwaresystem, daß es ermöglicht, durch Kombination der geometrischen Daten mit den Sachdaten eines Gebäudes, alle relevanten Vorgänge und Dienstleistungen rund um das Gebäude im Zusammenhang zu betrachten.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 3.1: Drei Typen von Informationssystemen (RTG/KOMMUNAL TEAM, 2000)
Ziel eines Gebäudeinformationssystems ist es Daten effizient zu strukturieren, den Informationsfluß und daraus resultierend Arbeitsabläufe zu verbessern und zu beschleunigen, sowie eine stetig aktuelle Basis für Entscheidungen zu schaffen. Außerdem können Kosten durch Optimierung der Arbeitsabläufe, durch die Vermeidung von Mehrfachtätigkeiten und durch Simulation verschiedener Varianten gesenkt werden. Dazu ist es notwendig, einerseits alle alten Datenbestände zu integrieren und andererseits das System permanent zu aktualisieren.
[...]
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Originalausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2001
- ISBN (eBook)
- 9783832450939
- ISBN (Paperback)
- 9783838650937
- DOI
- 10.3239/9783832450939
- Dateigröße
- 1.5 MB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- Ruhr-Universität Bochum – Ingenieurwissenschaften
- Erscheinungsdatum
- 2002 (März)
- Note
- 1,7
- Schlagworte
- baureststoff verwertung baureststoffbörse internet entsorgung
- Produktsicherheit
- Diplom.de