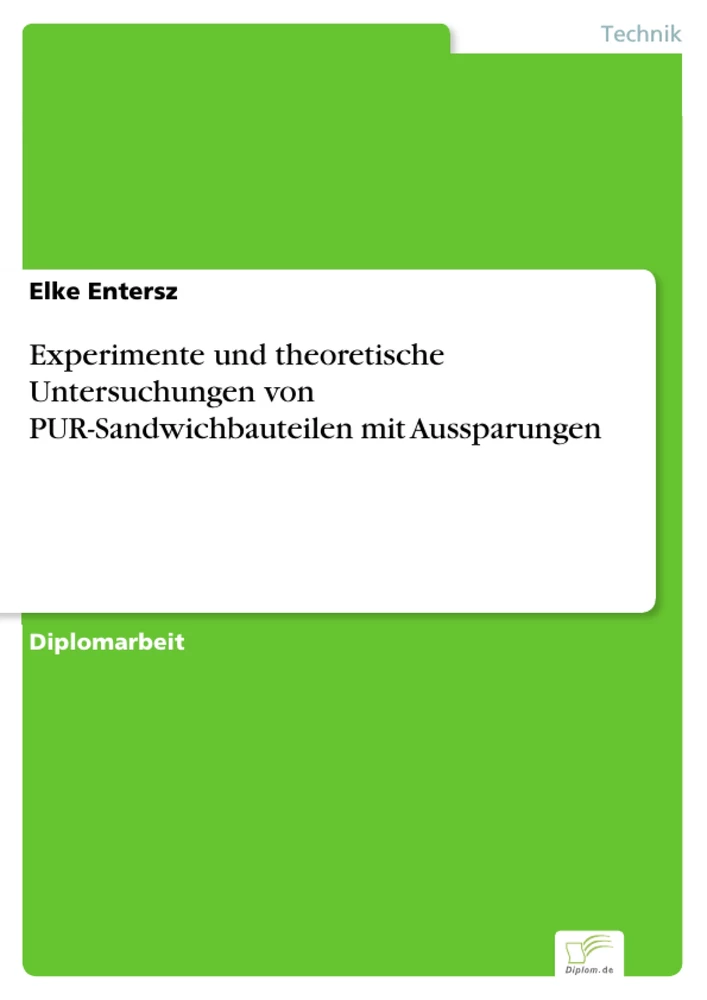Experimente und theoretische Untersuchungen von PUR-Sandwichbauteilen mit Aussparungen
Zusammenfassung
Sandwichbauteile werden mittlerweile immer mehr im Industrie und Hallenbau, zum Beispiel als Dach- oder Wandbauteile eingesetzt und sind somit wesentliche Konstruktionselemente eines Bauwerks.
In den meisten Fällen werden Aussparungen für Fenster und Türen notwendig. Diese schwächen jedoch die Tragfähigkeit und die Steifigkeit der Sandwichbauteile erheblich, so dass bislang eine aufwendige stahlbaumäßige Auswechslung erforderlich war, um das geschwächte Bauteil tragfähiger zu machen.
Ziel dieser Diplomarbeit ist es, festzustellen im welchem Zusammenhang Aussparungsgröße und Tragfähigkeit des Sandwichbauteils stehen, um konstruktive Maßnahmen vorschlagen zu können, die das Tragverhalten von Sandwichelemente mit Aussparungen positiv beeinflussen.
Ein weiterer Punkt ist die Berechnung der Tragfähigkeit von Sandwichbauteilen mit Öffnungen. Um annähern das Tragverhalten erfassen zu können, werden experimentelle sowie numerische Untersuchungen erforderlich. Hierbei ist es wichtig die Schwächung des Bauteils in Abhängigkeit der Öffnungsgröße sowie die Spannungsverteilung in den öffnungsnahen Bereichen zu untersuchen.
Inhaltsverzeichnis:Inhaltsverzeichnis:
Einleitung
1.Sandwichbauteile ohne Aussparung1
1.1Allgemeines1
1.2Vorteile1
1.3Besonderheiten4
1.4Einwirkungen5
1.5Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung7
1.6Nachweise7
1.7Lastfallkombinationen9
1.8Zusammenfassung10
2.Sandwichbauteile mit Aussparungen11
2.1Problematik11
2.1.1Einflussfaktoren12
2.2Überlegungen zu rechnerischen Erfassung von Sandwichbauteilen mit Aussparungen12
2.2.1Einfluss durch Größe und Form der Öffnung13
2.2.2Einfluss durch die Lage der Aussparung14
2.2.3Bewertungskontrolle17
2.2.4Beeinflussung durch die Deckblechart18
2.2.5Ein- und Mehrfeldträger18
2.2.6Dichte des Kernstoffs19
2.3Möglichkeiten für Elemente mit Öffnungen den Bauteilanforderungen stand zu halten20
2.4Vorschläge zur Aussteifung von Öffnungen21
2.5Weiteres Vorgehen23
3.Untersuchungen mit Hilfe der Finite Elemente Methode24
3.1Spannungsverläufe26
4.Experimentelle Untersuchungen von Sandwichbauteilen mit Aussparungen27
4.1Abmessungen27
4.2Ziele der Versuche27
4.3Aufstellung der durchzuführenden Versuche28
4.3.1Versuchsprogramm28
5.Experimenteller Versuchsaufbau30
5.1Anordnung von DMS und WA32
5.1.1Positionen für die Messung der Durchbiegung eines Sandwichbauteils mit Öffnung32
5.1.2Positionen für die Messung der Deckblechdehnungen33
5.2Wirkungsweise der […]
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
1. Sandwichbauteile ohne Aussparung
1.1. Allgemeines
Sandwichbauteile zählen zu den geschichteten Bauteilen, sie bestehen aus zwei dünnen Deckschichten hoher Dichte und einer mittleren dicken Kernschicht geringer Dichte. In den 50er und 60er Jahren wurden diese Bauteile eigentlich für Tragwerke der Luft- und Raumfahrt entwickelt. Mittlerweile werden die Sandwichbauteile meist als Dach oder Wandbauteile ( raumbildende und tragende Bauteile ) meist im Industrie- und Hallenbau eingesetzt. Sie sind somit wesentliche Konstruktionselemente eines Bauwerks.
1.2. Vorteile
Dadurch, dass die Sandwichbauteile baustellenkomplettierte Systeme sind, die in der Fabrik als Wand oder Dachbauteile vorgefertigt werden, können sie auf der Baustelle leicht, schnell und kostengünstig montiert werden. Ein weiter Vorteil der Sandwichtragwerke besteht darin, dass die Kernschicht nicht nur eine wärmedämmende Eigenschaft besitzt, sondern durch den Verbund mit den Deckschichten die Steifigkeit und Tragfähigkeit der Bauteile erhöht.
Die in der Praxis verwendeten Sandwichbauteile bestehen meist aus einer metallischen Deckschicht, die quasi-eben ( gesickt oder liniert ) oder trapezförmig sind, sowie aus einem Kunststoffkern (Polyurethan-Hartschaum).
Durch die Verklebung von einer metallischen Deckschicht mit einer wärmedämmenden Kernschicht (Polyurethan-Hartschaum, EPS, XPS oder Mineralwolle) entsteht eine schubsteife Verbindung. Erst durch die Verbundwirkung kann das Element Lasten aufnehmen. So wird zum Beispiel bei einem Einfeldträger das Biegemoment durch ein Kräftepaar in den dehnsteifen Deckschichten und die Querkraft durch den schubfesten Kern übernommen. Somit ist also sicher, dass die Kernschicht nicht nur eine wärmedämmende Eigenschaft, sondern auch durch die Mitwirkung im Verbund und durch die Stabilisierung der Deckbleche, die Steifigkeit und Tragfähigkeit der Sandwichbauteile erhöht.
Vorraussetzung dafür ist eine ausreichende Verbindung ( Verklebung ) der Deckbleche mit der Kernschicht; ( Hartschaum verfügt über eine Selbstklebewirkung ). Des weiteren muss ein entsprechender Elastizitäts- und Schubmodul vorhanden sein.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Bild 1.1 [ 5 ]
Biegeverhalten zweier Deckbleche übereinander
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Bild 1.2 [ 5 ]
zwei Deckbleche mit einer Kernschicht in der Mitte, die nicht miteinander verbunden sind
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Bild 1.3 [ 5 ]
Tragfähigkeit der einzelnen Baustoffe, wenn sie miteinander verbunden sind, ein Sandwichelement
Auf diesen Bildern ist deutlich zu erkennen, wie groß die Biegesteifigkeit und wie gering die Durchbiegung bei einem Bauteil mit schubfester Verbindung der einzelnen Schichten sein kann.
Nicht nur auf die Durchbiegung nimmt die Kernschicht einen positiven Einfluss, sondern auch auf den Versagensfall Knittern der Deckschicht bei einer Druckbeanspruchung.
Besonders bei dünnen ebenen oder quasi-ebenen Deckblechen, ohne ausreichende Aussteifung durch eine Kernschicht, kommt es bei Druckbeanspruchungen zu einem frühzeitigen Beulen bzw. Knittern, obwohl die Deckbleche eine hohe Festigkeit haben.
Je kraftschlüssiger nun der Verbund zwischen Deckblech und Kernschicht ist, desto stärker wird das Knittern ( Beulen ) der Deckschicht verhindert. Die Kernschicht wirkt im Hinblick auf die Deckschichten als stabilisierende, elastische Bettung.
Erhöht man die Steifigkeit der Kernschicht so werden die Beulen der Deckschiecht beim Erreichen der kritischen Last im druckbeanspruchten Bereich der Deckschichten immer kurzwelliger. Als positive Folge können höhere Versagens bzw. Knitterspannungen erreicht werden, die zwischen [Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten]
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 1.1 [ 6 ] elastische Bettung
Ein weiterer Einfluss auf die Knitterspannungen hat die Oberflächenform der Deckschicht, wie man in Abbildung 4 deutlich erkennen kann. Im Unterschied zu den ebenen Deckschichten weisen die profilierten Deckbleche Profilkanten und Sicken auf, die eine zusätzliche aussteifende Wirkung haben und somit dem Knittern bis zu einem bestimmten Punkt entgegen wirken.
1.3. Besonderheiten
Bei der Beurteilung der Tragfähigkeit und der späteren Bemessung von Sandwichbauteilen ist es wichtig, eine Reihe von Besonderheiten zu beachten. So ist in diesem Zusammenhang die Schubweichheit der Kernschicht, das Verhalten der Deckschichten ( Dehnung, Knittern ) dieser Bauteile zu berücksichtigen. Um eine sichere Bemessung durchzuführen und das Verhalten der Bauteile zu erfassen, wird deshalb die „Theorie des elastischen Verbundes“ bzw. „Sandwichtheorie“ angewendet, die hauptsächlich die Verformungen und die dazugehörigen Spannungsumlagerungen infolge Schubverformung der Kernschicht berücksichtigt. „Der Satz von Bernoulli“ vom Ebenbleiben des Querschnitts „Querschnitte, die vor der Verformung eben waren, sind auch während der Verformung eben“, kann somit nicht angewendet werden.
Mit Hilfe der nachfolgenden Abbildung wird das Prinzip des elastischen Verbundes näher erläutert.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 1.2 [ 6 ] Prinzip des nachgiebigen Verbundes
Hier wird das Prinzip des elastischen bzw. nachgiebigen Verbundes dargestellt (ähnlich wie bei Holzbauteilen). Wie man auf Abb. 1.2 erkennen kann verschieben sich die Deckschichten gegenseitig. Folglich kann Ein Starrer Verbund nicht angenommen werden, da sonst die Bauteile eine rechnerisch höhere Tragfähigkeit besitzen würden, als sie in Realität aufweisen können.
1.4. Einwirkungen
Aufgrund der Kombination verschiedener Materialien ( Metall als Deckschicht, Kunststoff als Kernschicht ) müssen besondere Einwirkungen berücksichtigt werden, die einen erheblichen Einfluss auf das Tragverhalten der Sandwichbauteile haben. Neben den üblichen Einflüssen aus Eigengewicht, Wind und Schnee sind noch zwei weitere Einflüsse von großer Bedeutung.
Ein großer Teil der Beanspruchungen resultiert aus Zwängungen bzw. Temperaturzwängungen infolge unterschiedlicher Deckblechtemperaturen und bei längerer Belastung aus Umlagerung durch Schub-Kriechen der Kernschicht.
Die eben erwähnten Zwängungen infolge Verformungen, entstehen durch unterschiedliche Längenänderungen infolge Temperatur der äußeren und inneren Deckschicht. Bei Temperaturänderung müssen noch zusätzliche Beanspruchungen berücksichtigt werden, die sich aus den Verformungen infolge Dehnung der Deckschicht ergeben.
Durch Sonneneinstrahlung entstehen auf der äußeren Deckschicht Temperaturen von bis zu 80°C ( Mitteleuropa ), an der inneren Deckschicht hingegen herrscht nur eine Temperatur von ca. 25°C. Das selbe Problem entsteht natürlich auch im Winter, wenn außen eine niedrigere Temperatur als innen vorhanden ist.
Durch die gute Isolierung der Kernschicht kommt es bei einer einseitigen Wärmeeinstrahlung durch die Sonne zu Temperaturdifferenzen zwischen äußerer und innerer Deckschicht, die einerseits Krümmungsverformungen des Sandwichbauteils und andererseits auch Spannungen im Sandwichquerschnitt zur Folge haben.
Wichtig ist es sich an die minimal und maximal Temperaturen zu halten, die für verschiedene Landesabschnitte und Deckblechfarben in der Zulassung vorgegeben werden.
Die zweite zu berücksichtigende Einwirkung ergibt sich aus dem Verhalten der Kernschicht. Im Gegensatz zu den metallischen Deckschichten hat die Kernschicht, bestehend aus einem Kunststoff, nämlich die Eigenschaft unter Dauerbelastung ( Eigengewicht und Schnee ) zu kriechen. Als kriechen bezeichnet man hier eine Zunahme der Verformung ohne Erhöhung der Belastung. Durch die relativ großen Verformungen in der Kernschicht durch Schubbeanspruchungen, kommt es vor allem bei profilierten Deckschichten zu Spannungsumlagerungen.
Neben den Spannungsumlagerungen im Verbundsystem hat das Kriechen auch einen Einfluss auf die Bettung der Deckschichten. Durch die in den Beulfeldern infolge Verformung hervorgerufenen Bettungsspannungen in den Kernschichten, erhält man ein zusätzliches Kriechen und somit weitere Verformungen. Bei Versuchen wurde festgestellt, dass die Verformung erst exponentiell und später annähernd linear zunimmt und somit das Kriechen nicht zum Stillstand kommt. Das bedeutet meist für Sandwichelementen mit ebenen Deckblechen eine Zunahme der Durchbiegung bis zum Versagen.
Die Kriechgeschwindigkeit nimmt mit erhöhter Belastung zu, kann aber auch durch eine Erhöhung der Rohdichte des Hartschaums verlangsamt werden. Wobei auch festgestellt hat wurde, dass bei einer Druckbeanspruchung (Eigengewicht und Schnee) die Kriechgeschwindigkeit im Vergleich zu einer Zugbeanspruchung (abgehängte Decke) geringer ist.
Bei einer Be- und Entlastung der Bauteile konnte man ebenso feststellen, dass in der Entlastungsphase die elastische Verformung der Kernschicht wieder zurück ging , jedoch nicht ganz vollständig. Bei einer Widerbelastung ist die Verformungszunahme geringer trotz gleicher Belastungsdauer und Art.
Einen Abfall der Steifigkeiten wurde beim Hartschaum während einer kurzzeitigen oder auch einer langzeitigen Belastung und steigender Temperatur feststelle, folglich ist bei niedrigen Temperaturen zum Beispiel bei –30°C die Verformung des Hartschaums geringer als zum Beispiel bei 0°C.
Aufgrund dieser Tatsachen, sind Temperatur und Kriechen als Lastfälle zu untersuchen.
1.5. Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Für den Einsatz von Sandwichbauteile als Wand oder Dachelemente mit einer schubfesten Verbindung von Deckblech und Kern gibt es bisher keine geregelte Norm, so dass eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung notwendig wird. Mit den Festlegungen, die in der Zulassung für einen bestimmten Bauteiltyp und Hersteller erfasst sind, ist es möglich ausreichend genaue Bemessungen durchzuführen.
Die genauen Nachweise und alle nötigen Widerstandsgrößen und Sicherheitsbeiwerte sind dort nachzulesen.
1.6. Nachweise
Für die Nachweise der Standsicherheit und der Gebrauchssicherheit werden in der Praxis zwei Verfahren angewendet:
- Nachweis mit Hilfe der typengeprüften Stützweitentabellen
- Projektbezogene Einzelnachweise
Bei den gesamten Nachweisen muss die Summe der Beanspruchungen (äußere Lasten:(s + p) und Temperaturzwängungen) kleiner sein, als die Widerstandsgröße. Widerstandsgrößen sind zum Beispiel: Zugfestigkeit, Fließgrenze, Druckfestigkeit oder Beul- bzw. Knitterspannungen. Diese Widerstandswerte werden durch viele Versuche und Auswertungen festgelegt.
Somit ergibt sich folgendes Sicherheitskonzept:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Es muss also nachgewiesen werden, dass die Beanspruchung ([Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten]) multipliziert mit dem Teilsicherheitsbeiwert ([Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten]) und wenn nötig mit einem Kombinationsbeiwert (y), kleiner ist als die zulässige Beanspruchung bzw. Widerstandsgröße ([Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten]) dividiert durch den Materialsicherheitsbeiwert ( [Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten] ).
Der Gebrauchsfähigkeitsnachweis definiert sich neben der Durchbiegungsbeschränkung durch das Erreichen der Streckgrenze im Zugbereich oder das Knittern im Druckbereich.
Die Grenztragfähigkeit beim Tragsicherheitsnachweis wird erreicht, wenn Knitterspannungen im Druckbereich und Fließen im zugbeanspruchten Blech sowie Schubverformungen der Kernschicht auftreten.
So gesehen gibt es drei Versagenszustände:
- Fließen der Deckschicht
- Knittern der Deckschicht
- Schubverformung der Kernschicht
Die Ausbildung einer plastischen Falte, besonders bei ebenen Deckschichten, die sich einer Druckbeanspruchung entziehen wollen, ist nicht unbedingt für die Standsicherheit maßgebend, sondern eher für die Gebrauchsfähigkeit.
Bei den Nachweisen ist es wichtig, besonders auf Hinblick der Knitterspannungen, zwischen Einfeld- und Mehrfeldträgern zu unterscheiden. Durch die äußeren Belastungen entstehen gleichzeitig Momente und Auflagerkräfte, die bei den Mittelstützen durch Interaktion von Biegemoment und Auflagerkraft mit einzubeziehen sind. Somit sind die Knitterspannungen der Mehrfeldträger im Vergleich zu den Einfeldträgern geringer.
Es sind hierbei zwei Lastfälle zu unterscheiden: Auflast (Schnee) und Abhebende Last (Windsog).
Zusätzlich darf bei Durchlaufträgern (mehrfeldrige Dach- oder Wandbauteile), besonders bei quasi-ebenen Deckblechen, nicht vergessen werden, dass die Feldweite wegen der geringen Drucksteifigkeit des unteren Deckblechs begrenzt ist.
1.7. Lastfallkombinationen
Bei der späteren Bemessung ist darauf zu achten, dass die ungünstigste Lastfallkombination ermittelt und angesetzt wird. Abhängig von dem statischen System, von der Nachweisart und den Widerstandsgrößen werden möglichst die Einwirkungen angesetzt, die die maßgebenden Lastfallkombination ergeben. Sinnvolle Ansätze sind Zum Beispiel:
- Eigengewicht, Schnee, Temperatur außen 0°C, Kriechen
- Eigengewicht, Windsog, Temperatur außen 80°C
Neben den Nachweisen der Bauteile sind noch zusätzliche Nachweise zu erbringen:
- Nachweis der Befestigung
- Nachweis der Auflagerpressung
- Nachweis der Schraubenkopfauslenkung infolge unterschiedlicher
Deckblechtemperaturen
Einzelnachweise werden dann nötig, wenn ein System mit unterschiedlicher Stützweite vorliegt. Aber auch bei besonderen Beanspruchungen zum Beispiel bei einem Kühllager. In diesem Zusammenhang sollen möglichst die Beanspruchungen aus Einwirkungen der Spannungen in den Deckschichten infolge äußerer Lasten, unterschiedlicher Deckblechtemperaturen und Kriechen der Kernschicht bei der Berechnung berücksichtigt werden. Wobei das statische System sowie die Querschnittsform eine Rolle spielen.
1.8. Zusammenfassung
Abschließend ist zu sagen, dass mit den Sandwichelementen auf einfachste Weise ein leichtes Bauelement entwickelt wurde, dass neben der erstaunlichen Tragfähigkeit weitere positive Eigenschaften wie:
Wärmedämmung Korrosionsschutz (durch Zusatzbeschichtung oder Lackierung) Feuchteschutz aufweist.
Im Hinblick auf diese Verbundtragwerke gibt es wichtige Beeinflussungsgrößen die nicht vernachlässigt werden können. Gemeint ist hiermit die Einwirkung der Temperatur auf das Sandwichelement sowie das Kriechen der Kernschicht.
In diesem Zusammenhang ist die Belastungsdauer mit einer möglichen Entlastungsperiode zu untersuchen. Da das Bauwerk im laufe der Zeit vielen unterschiedlichen Belastungsarten und Belastungszeiten ausgesetzt wird, muss man versuchen alle zu berücksichtigen.
Folglich sind Kurz- und Langzeitbelastungen sowie Be- und Entlastungen der Bauteile mit ihren Auswirkungen auf das Sandwichelement zu berücksichtigen.
2. Sandwichbauteile mit Aussparungen
2.1. Problematik
Wie schon erwähnt werden Sandwichsysteme Heute immer mehr im Industrie- und Hallenbau eingesetzt und häufig mit Aussparungen zum Beispiel für Fenster. Jedoch gibt es bisher keine konkreten Anhaltspunkte zur Berechnung der Tragfähigkeit und Gebrauchsfähigkeit. Demzufolge werden Untersuchungen im Bereich der Sandwichelemente mit Aussparungen notwendig.
Durch einige Versuche wurde bereits festgestellt, dass die Einwirkungen von Aussparungen Einfluss auf die Lastverteilung und die Tragfähigkeit der Sandwichelemente haben.
Es wird angenommen, dass falls eine Öffnung vorhanden ist, sich die Spannungen nicht mehr gleichförmig entlang der Breite des Bauteils verteilen können. Es treten Kerbspannungen in den Eckbereichen der Öffnung auf, wodurch die Tragfähigkeit der Elemente ebenso stark darunter leidet, wie die Steifigkeit. Dies wirkt sich nachfolgend auf die Spannungsverteilung resultierend aus den Temperaturbeanspruchungen aus.
Diese Erkenntnis reicht bei weitem nicht aus, um das Tragverhalten eines Sandwichbauteils mit Öffnung rechnerisch zu erfassen. Es liegt nämlich nahe, dass es im Zusammenhang von Sandwichtragwerken mit Aussparung eine Vielzahl von Einflussfaktoren gibt, die im Hinblick auf die Steifigkeit und Tragfähigkeit der Bauteile mit ein wirken. Somit ist es sinnvoll mit Hilfe von weiteren Untersuchungen die drei für Sandwichbauteile typischen Versagenszustände:
- Fließen der Deckschicht bei Zugbeanspruchung
- Knittern der Deckschicht bei Druckbeanspruchung
- Schubverformung der Kernschicht durch Querkraft bzw. Schubkraft
im Hinblick auf die folgenden Einflussfaktoren zu betrachten.
2.1.1. Einflussfaktoren
Im Bezug auf die weiteren Untersuchungen, sind verschiedene Einflussfaktoren zu berücksichtigen:
- Größe und Form der Öffnungen
- Lage der Öffnungen
- Art der Deckschicht ( profiliert oder eben bzw. quasi-eben )
- Verschiedene Belastungsmöglichkeiten, Ein- und Mehrfeldträger
- Dichte des Kernstoffs
- Zusammenwirken von benachbarten Bauteilen
- Örtliche Verstärkungen bzw. Aussteifungen
2.2. Überlegungen zur rechnerischen Erfassung von Sandwichbauteilen mit Aussparungen
Basierend auf den Berechnungen von Bauteilen ohne Öffnungen müssen Veränderungen der Berechnungswege vorgenommen bzw. Parameter gefunden werden, welche den Einfluss einer Aussparung erfassen. Neben den Versuchen mit Sandwichpaneelen kann die “Finite Elemente Methode” ( FEM ) Hilfestellung geben.
Wie schon erwähnt, wird davon ausgegangen, dass die Spannungskonzentrationen (Kerbspannungen) in den Eckbereichen dazu führen, dass es zu einem frühzeitigen Erreichen der kritischen Spannungen kommt, was zu einem Knittern bei den Sandwichbauteilen und somit zu einem Versagen des Bauteils führt.
Es liegt also nahe, Abminderungsfaktoren bzw. Parameter zu finden, die einerseits die Spannungskonzentrationen (Kerbspannungen) in den Eckbereichen der Öffnungen und andererseits die Minderung der Tragfähigkeit berücksichtigen. Eine mögliche Lösung, um die Spannungserhöhungen in den Eckbereichen der Öffnung mit einzubeziehen, ist ein Verhältniswert zwischen den maximalen Kennwerten ( multipliziert mit der Deckblech- oder Kernschichtstärke ) und der Gesamtkraft pro Elementbreite zu bilden.
Mit anderen Worten, wird eine Relation zwischen den maximalen Spannungen und der Gesamtspannung im Querschnitt aufgestellt.
2.2.1. Einfluss durch Größe und Form der Aussparung
Im Bezug auf die Minderung der Tragfähigkeit und Steifigkeit von Sandwichelementen mit Aussparungen erscheint es plausibel, dass eine große Öffnung einen weitaus größeren Einfluss auf das Bauteil besitzt als eine kleine Öffnung, da der eigentliche Querschnitt je nach Öffnungsgröße vermindert wird.
Je größer die Öffnung desto kleiner der tragende Querschnitt und somit die aufnehmbare Last. Hinzu kommt noch die Einwirkung der örtlichen Spannungskonzentrationen (Kerbspannungen) in den Eckbereichen der Öffnung.
In diesem Zusammenhang wird angenommen, dass durch Eckausrundungen bei den Aussparungen oder kreisförmigen Öffnungen die Tragfähigkeit der Sandwichbauteile gesteigert werden kann. Die Spannungen können sich somit besser verteilen und es kommt zu keinen solch großen Spannungskonzentrationen (Kerbspannungen) in den Eckbereichen der Öffnung.
Um dies belegen zu können, ist es notwendig die Verteilung der Normalspannung in der Deckschicht und die Verteilung der Schubkraft in der Kernschicht im Hinblick auf die Tragfähigkeit und Steifigkeit der Sandwichelemente in Abhängigkeit der Abmessungen und Form der Aussparungen näher zu untersuchen.
2.2.2. Einfluss durch die Lage der Aussparung
Ein weiterer nennenswerter Einfluss auf Sandwichbauteile mit Aussparungen kann die Lage der Öffnung sein. So sollte in weiteren Versuchen darauf geachtet werden wie sich die Lage der Öffnung auf das Bauteil auswirkt. Hierbei ist es noch interessant zu untersuchen, wie sich mehrere Öffnungen nebeneinander bezüglich der Breite des Bauteils und übereinander bezüglich der Länge des Bauteils hinsichtlich der Steifigkeit und Tragfähigkeit von Sandwichtragwerken verhalten.
Zur Berücksichtigung der Lage von Aussparungen gibt es einen Weg, die kritische Position je nach Versagensart zu testen. Somit muss in Mitte des Versuchsobjektes das Knittern sowie das Fließen der Deckschicht und in Auflagernähe die Schubverformung der Kernschicht untersucht werden.
Wird von dieser Versuchsart ausgegangen, gelten die späteren Berechnungen auch für andere Positionen der Öffnungen, da diese für die Maximalbeanspruchungen, sprich das maximale Biegemoment in Feldmitte für die Versagensart Knittern und Fließen der Deckschicht sowie die maßgebende bzw. maximale Querkraft in Auflagernähe für die Schubverformung der Kernschicht, ausgelegt werden.
Bezüglich dieser Lösungsmöglichkeit, die in dem Bericht „Structural detailing of openings in sandwich panels“ vorgestellt wird, wurde jedoch nur eingeschränkt berücksichtigt, dass sich die Lage der Öffnung nicht nur in Längs- sondern auch in Querrichtung des Sandwichbauteils verändern kann.
Folgende Theorie wird angewendet:
Ist eine Öffnung, im Hinblick auf die Breite des Elements, nicht in der Mitte angeordnet, so wird die tatsächliche Öffnung durch ein fiktives Quadrat oder Rechteck für die Berechnung soweit vergrößert, bis sie für den Nachweis mittig ausgerichtet ist. Diese Möglichkeit wird auch für runde oder ovale Öffnungen ausgenutzt aber nur dann, wenn auch diese Öffnungen durch ein umschriebenes Quadrat oder Rechteck berücksichtigt werden.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 2.1 umschreibende Öffnung
Die blauen Linien umschreiben die fiktiven Öffnungen.
Die eigentliche Öffnung ( schwarz ) wird für die Berechnung so vergrößert, dass die in Realität außermittige Öffnung wieder mittig erscheint.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
So gesehen sind dies Vereinfachungen in der Berechnung, die auf der sicheren Seite liegen, jedoch erfassen sie nicht ganz die Problemstellung bezüglich der Lage der Aussparungen.
Somit ist es sogar sinnvoller die Minderung der Tragfähigkeit durch unterschiedliche Faktoren abhängig von der Öffnungslage auszudrücken. Es ist nämlich wahrscheinlich, dass eine Öffnung am Rand der Sandwichpaneele die Tragfähigkeit stärker beeinflusst als eine Aussparung in Mitte des Elements.
Eine mögliche Erklärung dafür könnte sein, dass je kleiner die restliche ungestörte Breite des Bauteils ist, die Spannungen sich in diesem Bereich nicht gleichmäßig verteilen können und es deshalb eher zu Spannungskonzentrationen kommt. Deshalb ergibt sich bei einer Öffnungslage nahe am Bauteilrand eine größere Schwachstelle, da sich auf einer Seite des Sandwichbauteils ein geringerer ungestörter Querschnitt ergibt als auf der anderen Seite. Die Öffnungslage ist folglich nicht symmetrisch und es muss davon ausgegangen werden, dass der auf der einen Seite liegende geringere ungestörte Bauteilquerschnitt die Tragfähigkeit des Bauteils mindert.
Obwohl es vorkommen kann, dass die Summe der restlichen ungestörten Bauteilbreite bei einer Öffnung in Mitte und in Randnähe des Bauteils gleich sein kann, ist es nicht richtig gleichzeitig davon auszugehen, dass diese Bauteile der gleichen Belastung standhalten..
Um Faktoren zu ermitteln, die diese Theorie berücksichtigen, müssen mit Hilfe von mehreren Versuchen vier maßgebende Stellen untersucht werden. Für das Versagen Knittern oder Formänderung der Deckschichten muss eine Öffnung in Mitte des Sandwichelements (welche als Platte belastet wird) mit einer Öffnung die nahe am Elementrand liegt verglichen werden. Das selbe Prinzip gilt für den Versagensfall Schubverformung der Kernschicht, der in Auflagernähe untersucht werden muss.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb.2.2 zu untersuchende Stellen
Die kleinen Kreise markieren die kritischen Stellen für eine
Untersuchung von Sandwichbauteilen mit Aussparungen.
Kann in Versuchen herausgefunden werden, wie groß das Verhältnis der Tragfähigkeit von Öffnungen in der Mitte oder am Rand des Bauteils ist, so ist es möglich Berechnungen und durch Faktoren festzulegen, die generell für jede Öffnungslage gelten, da die Untersuchungen an den maßgebenden Stellen durchgeführt werden.
Bei ovalen oder runden Öffnungen, ist es so, dass bei einer lotrechten Belastung auf die Bauteile die Tragfähigkeit weniger darunter leidet als bei rechteckigen oder quadratischen Öffnungen, da die Spannungen sich in diesem Fall besser um die Öffnung herum verteilen können und es somit zu keinen solch großen Spannungskonzentrationen (Kerbspannungen), wie bei rechteckigen Öffnungen kommt.
So gesehen, kann ebenfalls untersucht werden, in wie weit die Tragfähigkeit in Abhängigkeit dieser verschiedenen Formen der Öffnungen voneinander abweicht. Auf der einen Seite kann durch Versuche eine prozentuale Erhöhung der jeweiligen zulässigen Spannungen für ovale oder runde Aussparungen im Vergleich zu rechteckigen Öffnungen festlegt werden, andererseits ist es möglich eine konservative Annahme zu treffen, bei der die tatsächliche Öffnung durch eine etwas größere quadratische oder ovale Öffnung für die Berechnung ersetzt wird (siehe Abb. 2.1).
2.2.3. Bewertungskontrolle
Als Bewertungskontrolle für die Tragfähigkeit von Sandwichbauteilen mit Öffnung liegt es nahe, die maximal auftretenden Spannungen entlang der Aussparung mit den zulässigen Spannungen (Knitterspannungen, Streckgrenze , Schubspannung) zu vergleichen.
Wenn die zulässigen Spannungen örtlich überschritten werden, führt dies nicht unbedingt zu einem totalen Versagen dieser Sandwichelemente, deshalb ist das oben genannte Vorgehen zu konservativ.
Abgesehen von dem Spannungsverteilungskoeffizient, wird nun auch ein Koeffizient benötigt, um die Traglastkapazität des vorhandenen Querschnitts zu bewerten. Aufgrund dessen, werden Versuche notwendig, welche die Traglastkapazität sowie die maximalen Spannungen von Bauteilen ohne Öffnungen mit denen mit Öffnungen vergleichen. Schlussendlich muss, um annähernd das Tragverhalten der Sandwichbauteile mit Öffnung zu erfassen, ein Verhältnis der beiden Koeffizienten gebildet werden.
Dies müsste gleichermaßen für verschiedene Berechnungen gelten, wie für:
- die Verteilung der Normalkraft um die Öffnung ( neben der Öffnung wird die Normalkraft entlang der restlichen Breite verteilt, was zu einem örtlichen Anwachsen der Normalkraft führt. )
- die Verteilung der Schubkraft in der Kernschicht im Bereich der Öffnung
- die Kontrolle der Querschnittsfläche in Bezug auf das Knittern der Deckschicht
- die Kontrolle der Querschnittsfläche in Hinblick auf die Schubverformung des Hartschaums
- die Kontrolle der Querschnittsfläche in Bezug auf das Fließen des Deckblechs
2.2.4. Beeinflussung durch die Deckblechart
Für profilierte Deckbleche müssen eigene Untersuchungen durchgeführt werden, da die Profilierung über die Sandwichelementbreite für die Festigkeit von großer Wichtigkeit ist.
Bei Profilsandwichplatten wirkt nicht nur die Kernbettung dem Ausbeulen bzw. Knittern des Deckblechs entgegen, sondern auch die Profilkanten und Sicken besitzen eine zusätzliche aussteifende Wirkung, so dass das Knittern der Bauteile verzögert wird. Somit kann durch die Zusammenwirkung von Kernschicht und profiliertem Deckblech die Fließgrenze des Stahls in den Sicken und Kanten des Deckblechs erreicht werden.
Bei ebenen oder leicht profilierten Deckblechen wird die Biegesteifigkeit der Deckschicht im Gegensatz zu der des Sandwichbauteils vernachlässigt. Das Biegemoment wird als Normalkraft in die Deckschicht und die Schubkraft als Schubspannung in die Kernschicht geleitet, somit ist im Hinblick auf die Durchbiegung die Mitwirkung der Schubverformung in der Kernschicht zu berücksichtigen.
2.2.5. Ein- und Mehrfeldträger
Einen weiteren Unterschied muss bei Ein- oder Mehrfeldträgern gemacht werden, da die Berechnungen sich in einigen Punkten unterscheiden. So wird zum Beispiel bei Mehrfeldträgern angenommen, dass sie bei entsprechender Belastung Fließgelenke ausbilden. Die Bemessung erfolgt an einem Einfeldträger mit plastischen Moment als zusätzliche Belastung. ( genaue Berechnung siehe ECCS ).
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Bei Ein- und Mehrfeldträgern wird (im Hinblick auf benachbarten Sandwichbauteilen) zur Bestimmung der Gesamtspannungsverteilung eine konservative Annahme getroffen, die beinhaltet, dass das Bauteil mit Öffnung die ganze Last aufnimmt. Werden die Bedingungen bezüglich der Steifigkeit und Festigkeit von den Bauteilen mit Öffnungen eingehalten, so gilt das selbe auch für Elemente ohne Öffnung.
Bei Einfeldträgern ist in Bezug auf die Durchbiegung zu untersuchen, ob der Unterschied der Durchbiegung benachbarter Sandwichplatten als Folge einer bzw. keiner Öffnung zu groß ist. Ist dies der Fall, so muss die Verbindung auf Versagen geprüft werden.
Für die Prüfung der Verbindungen, gibt es zwei mögliche Vereinfachungen, die getroffen werden können, falls die Verbindungsmittel so verteilt werden, dass die Schubkraft problemlos weitergeleitet wird.
1. Eine Möglichkeit ist eine gleichmäßige Verteilung der Belastung auf die Sandwichbauteile
2. Eine andere Möglichkeit ist die Annahme, dass das Bauteil mit Aussparung die Belastung gänzlich auf das benachbarte Bauteil ohne Öffnung überträgt, um die Steifigkeit und Festigkeit der Verbindungsmittel zu untersuchen.
2.2.6. Dichte des Kernstoffs
Eine weitere wichtige Einflussgröße im Zusammenhang mit der Tragfähigkeit von Sandwichplatten mit ebenem oder quasi-ebenem Deckblech, ist die Dichte des Kernstoffs. In früheren Versuchen wurde festgestellt, dass bei einer Verdopplung der Dichte des Kernstoffs gleichermaßen die Traglast erhöhet werden kann.
Bei einer niedrigen Dichte versagt der Durchlaufträger direkt schon im Feld, ohne dass die Grenzlast über der Mittelstütze erreicht wurde. Bei einer hohen Dichte hingegen wird das Deckblech so gut stabilisiert, dass zuerst die Grenzlast über der Stütze erreicht wird.
Im allgemeinen gibt es drei Versagensursachen als Folge verschiedener Dichten des Kernstoffs:
1. Bei einer geringen Dichte, überschreiten die Stabilisierungsspannungen in der Kernschicht den Spannungs- Dehnungs- Bereich, wobei sich die Deckschicht nur elastisch verformt. Dadurch, dass die Kernschicht in ihrer Wirkung nachlässt, kommt es zu einem stetigen Zuwachs der Durchbiegung bis die Randspannung die Streckgrenze erreicht wird.
2. Bei einer mittleren Dichte des Kernstoffs ist auch die Kernsteifigkeit größer. Ein Versagen kann folgendermaßen beschrieben werden: In Plattenmitte überschreitet die resultierende Randspannung aus Biege- und Längsspannung die Streckgrenze. Eine nichtlineare Plattendurchbiegung durch eine beginnende Plastizierung der Randbereiche ist die Folge, die schließlich zu einem frühzeitigen Versagen des Kerns führt.
3. Bei einer größeren Dichte wie zum Beispiel bei PUR- Hartschaum, kann davon ausgegangen werden, dass durch die Kernschicht eine teilplastizierte Deckschicht besser stabilisiert werden kann.
2.3. Möglichkeiten für Elemente mit Öffnungen den Bauteilanforderungen stand zu halten
Bauteile mit Aussparungen müssen genau wie Bauteile ohne Aussparungen einigen Anforderungen gerecht werden. Demzufolge müssen diese Bauteile die nötige Durchbiegung, Schubfestigkeit und die geforderte Steifigkeit aufweisen.
Es gibt nun verschiedene Möglichkeiten für Bauteile mit Öffnungen diesen Anforderungen gerecht zu werden:
Einerseits ist es möglich die Öffnungen so zu planen, dass sie außerhalb von kritischen bzw. maximalen Spannungen liegen, andererseits ist es genauso ungünstig Öffnungen nur dort einzufügen, wo sie zwar möglich aber nicht unbedingt gewollt sind.
Ein anderer Vorschlag würde darauf hinauslaufen, die Kraft die auf das Bauteil mit Aussparung wirkt, auf ein benachbartes Sandwichelement ohne Aussparung weitestgehend zu übertragen. Natürlich muss die zusätzliche Last auf das benachbarte Element berücksichtigt werden, so dass die zusätzliche Belastung auch aufgenommen werden kann.
Letztendlich erscheint es am sinnvollsten das durch eineÖffnung geschwächte Bauteil, durch Verklebung zum Beispiel der Fensterrahmen mit dem Deckblech oder durch eine mechanische, kraftschlüssige Verbindung oder Aussteifung zu verstärken. Wird diese Möglichkeit einer Aussteifung gewählt, so muss untersucht werden, in wie fern sich die Aussteifung oder Verbindung positiv auf das Bauteil auswirkt.
2.4. Vorschläge zur Aussteifung von Öffnungen
Einige vorstellbare Aussteifungen für Bauteile mit Öffnungen werden nun beschrieben:
Eine Möglichkeit zur Aussteifung ist das Verkleben von zusätzlichen Blechteilen auf der Druckbeanspruchten Seite des Sandwichelements. Hierbei muss darauf geachtet werden, dass die Verstärkung schon weit vor und um die Öffnung herum mit dem Deckblech verbunden bzw. verklebt wird, damit das maximale Biegemoment zu dem Querschnitt übertragen werden kann, der nicht durch eine Öffnung beeinträchtigt ist. Die Schubspannung hingegen muss durch das übrige Kernmaterial aufgenommen werden.
Eine weitere Aussteifung kann auch durch Verklebung profilierter Bereiche mit den Deckblechen um die Aussparung herum erreicht werden, da wie schon erwähnt die Profilkanten und Sicken eine aussteifende Wirkung besitzen und somit die Tragfähigkeit erhöhen. Bei dieser Methode kann bezüglich der restlichen Breite neben der Öffnung konservativ angenommen werden, dass die Belastungen völlig durch die profilierten Bereiche aufgenommen werden. Genau wie bei der ersten Möglichkeit auch müssen die profilierten Bereiche ausreichend weit vor und um die Öffnung mit der Deckschicht verklebt werden, um wiederum das Biegemoment in die Deckschicht zu leiten. Die Schubkraft hingegen wird in die Kernschicht übertragen.
Ein kompletter Rahmen verbunden mit beiden Deckblechen erscheint hier auch aus optischen Gesichtspunkten als einfachste und sinnvollste Lösung, eine Öffnung in einem Sandwichbauteil auszusteifen. Erst durch eine kraftschlüssige Verbindung von Rahmen und Deckblechen, kann man erreichen, dass die Belastung gleichmäßig über das ganze Bauteil verteilt wird und somit der Rahmen einen gewissen Anteil der Belastung aufnimmt. Bei einer lotrechten Belastung, muss das Biegemoment durch ein Kräftepaar in den Deckschichten aufgenommen werden, so dass die Ecken des Rahmens in der Lage sein müssen, sich bis zu einem gewissen Maße zu verdrehen, um die Normalkraft in die Deckschicht leiten zu können. Die Querkraft oder Schubkraft resultierend aus der Belastung wird von der Kernschicht aufgenommen.
Eine Verbindung des Rahmens mit den Deckblechen könnte durch Verklebung, Verschraubung, Vernietung, Verdübelung oder sonstige kraftschlüssige Verbindungen erfolgen. In wie fern die Verbindung von Rahmen und Deckblechen die Tragfähigkeit erhöht, sollte jedoch noch ausgiebig mit Hilfe von Versuchen untersucht werden.
Im Zusammenhang mit Rahmen zum Beispiel für Fenster, muss ebenfalls berücksichtigt werden, dass gegebenenfalls die Öffnung geschlossen ( geschlossenes Fenster ) sein kann. In diesem Fall darf die resultierende Kraft auf die Öffnung nicht in Vergessenheit geraten und kann als gleichmäßig verteilte Belastung zwischen Öffnung und Bauteilecken angesetzt werden.
Ein wichtiger Punkt bei der näheren Betrachtung der Aussteifungen von Fenstern, stellen die unterschiedlichen Steifigkeiten von Fensterrahmen und den eigentlichen Bauteilen dar. Aus diesem Grund sind für elastische Bauteile und steife Fenster folgende Annahmen zu treffen:
- Im Falle einer elastischen Verbindung zwischen Sandwichbauteil und Fenster ist die Last gleichförmig um die Öffnung herum aufzubringen.
- Für steife Verbindungen gilt es, die resultierende Belastung mehr zu den Eckbereichen der Öffnung hin zu leiten. Kommt es zu einer Lastübertragung auf benachbarte Sandwichelemente, muss dies durch Berechnungen berücksichtigt werden.
2.5. Weiteres Vorgehen
Es wird mit Hilfe der bereits durchgeführten Versuche, siehe Bericht „Structural detailing of openings in sandwich panels“ , European Commission, und der dort verwendeten ”Finite Elemente Methode” ( FEM ) sowie durch eine eigene Versuchsreihe versucht herauszufinden, wie sich Öffnungen, unter Berücksichtigung von Größe und Form, in einem Sandwichbauteil auf die Steifigkeit und Tragfähigkeit auswirken.
In einem Vergleich zwischen numerischen Analysen mit FEM und praktischen Tests können eventuell einige Anhaltspunkte gefunden werden, die das tatsächliche Tragverhalten von Sandwichbauteilen mit Aussparungen beschreiben, so dass sie auch rechnerisch erfasst werden können.
In einem zweiten Schritt werden Aussteifungsmöglichkeiten getestet, um die Steifigkeit und Tragfähigkeit von Sandwichbauteilen mit Aussparungen zu steigern.
3. Untersuchungen mit Hilfe der „Finite Elemente Methode“
Die Bestimmung von Spannungen in den Sandwichelementen mit Aussparungen ist nicht zuletzt durch das nichtlineare Werkstoffverhalten so komplex, dass sie mit Hilfe numerischer Methoden bestimmt werden müssen. Solche Methoden müssen in der Lage sein die spezifischen Eigenschaften der Sandwichelemente mit ihren speziellen Problemen zu berücksichtigen.
So zu sagen , muss es möglich sein, in Querrichtung des Elements die Spannungsverläufe um die Öffnung darzustellen und ebenfalls zu berechnen. Im Hinblick auf die Spannungsverteilung über die Dicke des Bauteils darf natürlich die Verbundwirkung nicht vernachlässigt werden. Folglich wird in Abhängigkeit von den Materialkennwerten das Biegemoment hauptsächlich als Normalkraft in die Deckschicht geleitet, während die Schubkraft von dem Kernmaterial getragen wird.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 3.1. Aufteilung des Biegemoments in Normal- und Querkraft
In dieser Zeichnung wird dargestellt, wie das Biegemoment als Kräftepaar in die Deckschichten und die Querkraft bzw. Schubkraft in die Kernschicht geleitet wird.
Das Biegemoment kann in zwei Bestandteile unterteilt werden, in eine Normalkraft in der Deckschicht und in einen Teil, der von der Biegesteifigkeit der Deckschicht aufgenommen wird. Dieser teil kann jedoch bei ebenen- oder quasi-ebenen Deckschichten vernachlässigt werden.
Ein weiteres spezielles Problem stellt die Schubverformung der Kernschicht dar. Sie muss gleichermaßen von der numerischen Methode erfasst werden, da diese Verformung den selben Stellenwert hat wie die Biegeverformung. Folglich kann sie nicht vernachlässigt werden.
Im allgemeinen kann die „ Finite Elemente Methode“ das Prinzip des nachgiebigen Verbundes, das Werkstoffverhalten und die Materialeigenschaften in der Darstellung sowie auch in der Berechnung der Spannungen um eine Aussparung berücksichtigen.
Als ein Vorteil dieser Methode erweist sich die Möglichkeit ein Sandwichbauteil mit Aussparung als volles dreidimensionales Modell mit Länge, Breite und Höhe darzustellen.
Dieses Modell kann verwendet werden, um die Gesamtspannungsverteilung bezüglich der Bauteile mit Öffnungen zu berechnen, oder um alternativ die örtlichen Spannungen zum Beispiel in den Eckbereichen der Öffnungen näher zu betrachten, was für die Entwicklung von Berechnungsregeln und die spätere Bewertung von Wichtigkeit ist.
Da im Rahmen der weiteren Untersuchungen kein geeignetes FEM - Programm zur Verfügung stand, welches die besonderen Eigenschaften von Sandwichbauteilen berücksichtigen konnte, wurde versucht mit einem linear rechnenden FEM Programm die Tendenzen des Spannungsverlaufs von Sandwichbauteilen mit Aussparungen aufzuzeigen, um die experimentellen Ergebnisse besser beurteilen zu können.
Für die Entwicklung von Berechnungen bedeutet dies, dass keine numerischen Parameterstudien durchgeführt werden konnten und deshalb auf die bereits durchgeführten Parameterstudien („Structural detailing of openings in sandwich panels“, European Commission) zurückgegriffen werden muss.
3.1. Spannungsverläufe
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 3.2 Spannungsverlauf eines Bauteils mit großer Öffnung
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 3.3 Spannungsverlauf eines Bauteils mit kleiner Öffnung
4. Experimentelle Untersuchungen von Sandwichbauteilen mit Aussparungen
4.1. Abmessungen
Die Sandwichbauteile, die für die experimentellen Versuche verwendet werden, bestehen aus zwei linierten oder quasi-ebenen Deckschichten mit einer Stärke von 0,6 mm und einem Kern aus Polyurethan-Hartschaum.
Die Bauteile haben eine Höhe von 80 mm, eine Breite von 1,15 m und eine Länge von 2,5 m.
4.2. Ziele der Versuche
Bei den folgenden Versuchen werden lediglich Einfeldträger betrachtet, so dass nur die Knitterspannungen im Feld berücksichtigt werden müssen. Ebenfalls die Einwirkungen aus Temperatur und Kriechen können vernachlässigt werden, da einerseits keine erhöhte und unterschiedliche Deckblechtemperaturen untersucht werden und andererseits die Belastungsdauer während den Versuchen für ein Kriechen der Kernschicht zu gering ist.
In den folgenden Versuchen soll ermittelt werden, wie sich das Tragverhalten und die Steifigkeit in Abhängigkeit von Größe und Form einer Aussparung verhält. Hierbei ist es wichtig herauszuarbeiten wie die Gesamtspannungen in Längs- und Querrichtung des Sandwichelements verteilt sind.
Um später einen Vorschlag für eine Aussteifung der Öffnung machen zu können, sollten die örtlichen Spannungserhöhungen ( Kerbspannungen ) um die Aussparung genauer untersuchen werden.
4.3. Aufstellung der durchzuführenden Versuche
Anlehnend an die schon durchgeführten Versuche und Untersuchungen mit FEM („Structural detailing of openings in sandwich panels“, European Commission), kann ein begrenztes Versuchsprogramm erstellt werden, um die gewünschten Aufschlüsse bezüglich Sandwichbauteilen mit Aussparungen zu erhalten.
In diesem Zusammenhang ist es wichtig zu prüfen, in wie fern sich die örtlichen Spannungskonzentrationen tatsächlich auf die Steifigkeit und Tragfähigkeit der Bauteile auswirken.
Um diese zu untersuchen werden 5 Versuche durchgeführt.
4.3.1. Versuchsprogramm
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Tabelle 4.1 Durchzuführende Versuche
Die große Öffnung ist eine 80 % - tige Öffnung bezüglich der Breite des Bauteils, wobei die kleinere Aussparung halb so groß gewählt wurde. Die Eckbereiche der Öffnung wurden bewusst mit einem Radius von 25 mm ausgerundet, da es die maximal mögliche Ausrundung ist, falls ein Rahmen bzw. Fenster eingebaut werden soll.
Um nun eine Aussage über die Einwirkung der Größe und Form der Öffnung auf die Tragfähigkeit und Steifigkeit machen zu können, müssen die jeweiligen Versuchsergebnisse miteinander verglichen werden.
So sollen die Versuche 1 und 2 dazu dienen einen Bezug zwischen Öffnungsgröße und Tragfähigkeit herzustellen. Die Versuche 2 und 3 sowie 1 und 4 hingegen sollen die Aussage bestätigen, dass die Tragfähigkeit von Sandwichbauteile mit Aussparungen gesteigert werden kann, falls die Eckbereiche der Öffnungen ausgerundet werden.
Um die Versuche richtig bewerten zu können, ist es notwendig die Ergebnisse in Relation zu einem Sandwichbauteil ohne Aussparung zu setzen. Deshalb werden alle Versuche hinblickend auf die Ergebnisse von Versuch 5 ausgewertet.
5. Experimenteller Versuchsaufbau
Es wird ein 4- Punkt Biegeversuch, nach ECCS/CIB TWG 7.9 Richtlinie, an einem Einfeldträger durchgeführt. Beim weggesteuerten Versuch wurde eine Verfahrensgeschwindigkeit von 0,05 mm/s bei den Versuchen 1 – 4, und 0,15 mm/s bei versuch 5 gewählt.
Es wurde festgestellt, dass die beiden Deckbleche eine unterschiedliche Haftung durch den PUR – Hartschaum aufweisen. Bei den Versuchen wurde nun darauf geachtet, dass immer die Seite auf Druck beansprucht wurde, bei der Lunker im Hartschaum zu erkennen waren.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Haftung der Deckbleche
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Bild 5.2
Versuchsaufbau
Die Versuchsanordnung wird für Kurzzeitbelastungen verwendet. Während den Versuchen, sollen Versagenslast, Durchbiegung, sowie die Dehnung der Deckbleche mit Hilfe von Dehnungs- Mess-Streifen (DMS) und Wegaufnehmer (WA) näher betrachtet werden.
Folgender Versuchsaufbau wird für die Versuche gewählt:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 5.1
Versuchsaufbau (Ansicht)
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 5.2
Versuchsaufbau (Draufsicht)
Der Versuchsaufbau in Ansicht und Draufsicht wird mit Hilfe der Abb. 5.1 und 5.2 dargestellt. Das Sandwichelement ist an den Enden aufgelagert, bei einer Auflagerbreite von etwa 6 cm. Die tatsächliche Belastung hier eine Einzellast, muss durch eine Konstruktion so verteilt werden, dass sie wie eine Gleichstreckenbelastung auf das Bauteil wirkt.
5.1. Anordnung von DMS und WA
Um die Öffnung herum, sind Dehnungs-Mess-Streifen (DMS) sowie Wegaufnehmer (WA) anzuordnen, die an maßgebenden Stellen die Dehnungen sowie die Durchbiegung messen sollen. Die gegenseitige Verschiebung der Deckschichten an den Stirnflächen hingegen werden im Zusammenhang weiterer Untersuchungen nicht benötigt und können somit vernachlässigt werden.
Um die maximalen Werte aufgrund von einer Gleichstreckenlast zu erhalten ist es notwendig, die Positionen der Messungen im vorhinein festzulegen.
5.1.1. Positionen für die Messung der Durchbiegung eines Sandwichbauteils mit Öffnung
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 5.3 Position der Wegaufnehmer
In Abb. 5.3 sind die sinnvollen Positionen der Wegaufnehmer dargestellt, jedoch muss auf einen Wegaufnehmer bei den Versuchsdurchführungen verzichtet werden, da insgesamt nur sechs Messungen von Durchbiegung und Deckblechdehnungen pro Versuch durchgeführt werden können.
5.1.2. Positionen für die Messungen der Deckblechdehnungen
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 5.4 Positionen der DMS
Bei den Versuchen wird trotz unterschiedlichen Öffnungsgrößen einen ähnlichen Aufbau der Messstellen festgelegt. Dies gilt auch für Öffnungen mit Eckausrundungen.
Im Moment kann experimentell nur an insgesamt sechs Stellen die Durchbiegung und die Dehnungen der Deckbleche gemessen werden, so dass die Anzahl der Messpunkte begrenzt ist. Es wurde jedoch versucht die wichtigsten Stellen in den Zeichnungen zu markieren und die Richtung der Messungen zur Ermittlung der Dehnungen der Deckschichten festzulegen.
5.2. Wirkungsweise der Dehnungs-Mess-Streifen (DMS)
Eine Dehnungsmessung mit Hilfe der DMS, setzt eine verlustlose Übertragung der Dehnung von dem zu untersuchenden Bauteils auf die DMS voraus. Um sinnvolle Messergebnisse zu erzielen, muss eine innige, flächenhafte Verbindung zwischen Messobjekt und DMS vorliegen. Diese Vorraussetzung wird am besten durch eine Verklebung mit speziellen Klebstoffen erfüllt.
Die Dehnung des zu untersuchenden Bauteils wird auf den DMS übertragen und verursacht dadurch eine messbare Veränderung des elektrischen Widerstands. Zum Vergleich der Temperatur werden neben den, auf das Versuchsobjekt geklebten DMS, Kompensations- DMS angeordnet.
Der Messeffekt beruht auf der Veränderung des elektrischen Widerstands infolge mechanischer Beanspruchung zum Beispiel durch Zug- oder Druckkräfte. Die Dehnungen, die von den DMS während einem Versuch aufgenommen werden sollen, sind in der Regel sehr klein. Folglich sind die Widerstandsänderungen ebenfalls so klein, so dass sie auf direktem Weg nicht mehr gemessen werden könne.
Aus diesem Grund ist es erforderlich den DMS in eine sogenannte Messkette einzubinden. Eine genaue Bestimmung der Widerstandsänderung des DMS wird somit möglich.
Das erste Glied der Messkette bildet der DMS selbst, der die mechanische Dehnung in einen messbaren elektrische Widerstand wandelt. Das zweite Glied ist eine Messschaltung, hier eine Halbbrücke, die aufgrund einer Widerstandsänderung des DMS infolge Dehnung aus ihrer Symmetrie kommt, sich so zu sagen verstimmt und letztendlich eine Brückenverstimmung proportionale Brückenausgangsspannung liefert. Das dritte Glied der Messkette bildet ein Verstärker, der die Brückenausgangsspannung auf eine für die Anzeigeinstrumente ausreichende Höhe verstärkt. Das vierte und letzte Glied der Messkette ist die Anzeige, die das Ausgangssignal des Verstärkers umformt, so dass es durch angezeigte Werte sichtbar wird.
5.3. Wirkungsweise des Wegaufnehmers (WA)
Der Wegaufnehmer (WA) wird unter dem zu untersuchende Bauteil, an den vorher festgelegten Messstellen aufgestellt. Er ist in der Lage die Durchbiegung an dieser Stelle festzustellen.
[...]
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Originalausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2001
- ISBN (eBook)
- 9783832450854
- ISBN (Paperback)
- 9783838650852
- DOI
- 10.3239/9783832450854
- Dateigröße
- 9.9 MB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- Hochschule Mainz – Bauingenieurwesen
- Erscheinungsdatum
- 2002 (März)
- Note
- 1,3
- Schlagworte
- verbesserung berechnungen tragfähigkeit
- Produktsicherheit
- Diplom.de