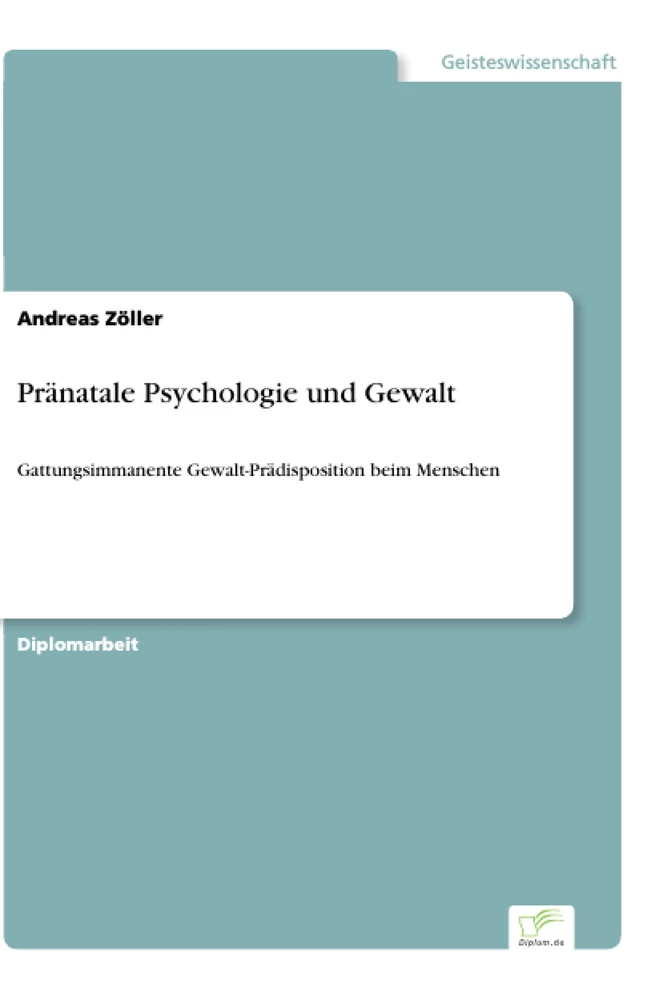Pränatale Psychologie und Gewalt
Gattungsimmanente Gewalt-Prädisposition beim Menschen
Zusammenfassung
Die augenscheinlich medizinisch grenzwertige Geburtsmechanik beim Menschen und die schon pränatal entwickelte Lern- und Erlebensfähigkeiten lassen mögliche Rückschlüsse zu auf eine unvermeidliche Gewalt-Prädisposition beim Menschen. Diese ergibt sich aus dem, in dieser Form evolutiv herausgebildetem Geburtsakt, der sich gewaltvoll ereignet. Verschiedene Kräfte drängen beim Menschen in entgegengesetzte Richtungen. Das wachsende Gehirn bewirkte einen vergrößerten Schädel, der aufrechte Gang erforderte hingegen physiologische Stabilisierungsmaßnahmen im Beckenbereich. Das verstärkte Becken büßte Flexibilität ein, die benötigt würde um den großen Schädel passieren zu lassen. Diese Situation wird durch die Verformbarkeit des kindlichen Schädels teilweise kompensiert. Die per Evolution in Kauf genommene Massenverschiebung des kindlichen Hirns und die Verletzungsgefahr deuten auf eine Unvermeidbarkeit hin.
Verstehen wir den menschlichen Geburtsakt als eine junge Erscheinung, wird die fehlende Ausgewogenheit plausibel. Die Gesamtsituation erklärt die Gewaltsamkeit des Geburtsaktes beim Menschen. Eine Prädisposition zu Gewalt wird vermittelt. Hier handelt es sich um einen Sozialisationseffekt, der mit parallel herausgebildeten Ausgleichsmechanismen relativiert werden kann. Dies ist ein überlebensnotwendig gewordenes Eingebettetsein in eine Gemeinschaft von Artgenossen, die die Versorgung und Betreuung übernehmen. Vollzieht sich die Betreuung des Säuglings artgerecht, d.h. wird seinen tatsächlichen Bedürfnissen entsprochen, so kann ein gewaltvolles Geburtsereignis integriert werden. Hierin liegen die Möglichkeiten zur Relativierung der Gewalt-Prädisposition.
Inhaltsverzeichnis:Inhaltsverzeichnis:
Einführung1
Erkenntnisinteresse1
Vorgeschichte/Motivation4
Pränatale Psychologie7
Aufbau10
1.Gattungsimmanente Prädisposition zu Gewalt beim Menschen. Ätiologische Aspekte12
1.1Ontogenetische Vorbedingungen12
1.1.1Die plazentale Viviparität13
1.1.2Evolutiv bedeutsame Fortpflanzungserscheinungen15
1.2Der Mensch: ontogenetische Besonderheiten17
1.2.1Evolutionsbedingte Geburtsproblematik20
1.3Gewaltätiologie26
1.3.1Gewaltpotential per Geburt28
2.Der Mensch als soziales Wesen: ein gattungsspezifisches Charakteristikum32
2.1Verschiedene Erlebensphasender Pränatallebenszeit39
2.1.1Letztes Drittel der Uterinzeit: Charakteristika46
2.2Die Geburt: gewaltvoller Daseinswechsel48
2.2.1Die Geburt als zweiter Start ins […]
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
INHALTSVERZEICHNIS
Einführung
Erkenntnisinteresse
Vorgeschichte/Motivation
Pränatale Psychologie
Aufbau
1. Gattungsimmanente Prädisposition zu Gewalt beim Menschen. Ätiologische Aspekte.
1.1. Ontogenetische Vorbedingungen
1.1.1. Die plazentale Viviparität
1.1.2. Evolutiv bedeutsame
Fortpflanzungserscheinungen
1.2. Der Mensch: ontogenetische Besonderheiten
1.2.1. Evolutionsbedingte Geburtsproblematik
1.3. Gewaltätiologie
1.3.1. Gewaltpotential per Geburt
2. Der Mensch als soziales Wesen: ein gattungsspezifisches Charakteristikum
2.1. Verschiedene Erlebensphasen der Pränatallebenszeit
2.1.1. Letztes Drittel der Uterinzeit: Charakteristika
2.2. Die Geburt: gewaltvoller Daseinswechsel
2.2.1. Die Geburt als zweiter Start ins Leben
2.3. „Sozialer Uterus“ und Frühgeburtlichkeit
2.4. Frustration sozialer Erwartungen
2.5. Fallbeispiele
3. Artgerechte prä-, peri und frühe postnatale Lebenszeit beim Menschen
3.1. Disstreß während der Pränatallebenszeit: Auswirkungen
3.2. Bedeutung der Perinatallebenszeit
3.3. Frühe Postnatallebenszeit
4. Die Erziehungswissenschaften und die prä - und perinatale Psychologie
4.1. Bedeutung für die Erziehungswissenschaften
4.2. Abschließende Betrachtung
Literaturverzeichnis
Einführung
Erkenntnisinteresse
Kürzlich fragte mich ein Professor, in dessen Seminar ich die Gliederung meiner Diplom-Arbeit vorstellte, um einige methodologische Fragen zu klären, was denn die Pränatale Psychologie mit den Erziehungswissenschaften zu tun habe. Freilich konnte ich die Frage dort nicht umfänglich beantworten. Doch scheint sie mir in jedem Fall der Beantwortung würdig.
Eine Aufgabe der Erziehungswissenschaften könnte sein, all diejenigen, die sich in pädagogischen Feldern, also im weitesten Sinne erziehend, betreuend und sozialisierend bewegen, einen „wissenschaftlichen“ Fundus an Wissen zur Verfügung zu stellen. Außerdem, den Wissensstand stets zu erweitern, zu überprüfen, ggf. zu revidieren. Hier scheint eine Beschäftigung mit der Prä- und Perinatallebenszeit, als eine Lebensspanne der Frühsozialisation verstanden, eine sinnvolle Erweiterung zu sein.
Es mag schnell der Eindruck entstehen, die Pränatale Psychologie beanspruche für sich die Lösung aller noch unbeantworteter zutiefst menschlicher Fragen nach psychischer Herkunft und Ursachen unserer Erlebensmöglichkeiten. „Die Erkenntnisse der Pränatalen Psychologie sind kein magisches Allheilmittel, die alle Krankheiten erklären und Heilungswege aufzeigen können. Sie sind ein wichtiger - bislang ausgeblendeter - Teil des menschlichen Lebens...“ (Gross, 1991, S. 170).
Auch in dieser Arbeit wird die vorgeburtliche Lebenszeit als sehr bedeutsam und als unbedingt beachtenswert verstanden, ohne unser Basiswissen über den Einfluß postnataler Sozialisation, Traumatisierungen und Heilungsmöglichkeiten nicht ebenfalls anzuerkennen.
Einem Determinismus, die Frühprägungen seien unabänderlich stark in ihrer Erlebenswirksamkeit, sei hier vorgebeugt. Einer „katastrophalen“ Schwangerschaft, die mit einer entbehrungsreichen und traumatischen Geburt endet, kann ein ausgespochen glückliches nachgeburtliches Leben folgen, das dem Kind ermöglicht, die Erlebnisse zu verarbeiten, zu „integrieren“, als Teil des eigenen Lebens zu behalten. Ebenso kann der umgekehrte Fall eintreten, einer vorbildlichen Schwangerschaft und Geburt und einem „katastrophalen“, traumatischen nachgeburtlichen Leben.
Doch scheint die Pränatallebenszeit ungeachtet der nachgeburtlichen Veränderbarkeit eine besondere Dimension zu enthalten, die ihre Bedeutsamkeit ausmacht.
Zunächst ist die Pränatallebenszeit ein Lebensabschnitt, der sich in einem für alle Menschen gleichen Milieu vollzieht. Noch gibt es keinen lebenden Menschen, der nicht seine Embryonal- und Fötallebenszeit im Mutterleib verbracht hätte, obschon auch diese Besonderheit möglicherweise mittels fortschreitender Technisierung der Reproduktionsmedizin, in absehbarer Zeit der Vergangenheit angehören könnte.
Die vorgeburtliche Zeit charakterisiert sich nicht ausschließlich durch das körperliche Heranreifen eines Menschen, sondern auch in der Notwendigkeit der Ausbildung psychischer Fähigkeiten, die dem völlig hilflosen Neugeborenen das Überleben sichern sollen. Dies kann freilich nur in einer Gemeinschaft mit anderen Menschen gewährleistet werden, was bedeuten würde, daß Interaktionsfähigkeiten - spätestens - von Geburt an verfügbar sein müssen. Jüngste Beobachtungen von Föten mittels Ultraschall in Verbindung mit einer nachgeburtlichen Beobachtungen bis in sechste Lebensjahr, zeigen deutlich wie Interaktionsmodi, die sich während der Schwangerschaft entwickelt hatten, in der nachgeburtlichen Zeit beibehalten und sogar zum Teil intensiviert wurden (Piontelli, 1996).
Wir können davon ausgehen, daß wir es mit interaktions- und lernbereiten Menschen zu tun haben, wenn wir von Föten sprechen. „Je besser wir die Anfänge des Seelenlebens kennen, desto mehr wird uns das Gewordene verständlich“ (Graber, 1973, S.17). Im Zuge der Entwicklung dieser Arbeit wird noch eingehender davon die Rede sein.
Auf drei Hauptthesen wird die Arbeit aufgebaut sein:
I. Der Mensch als Gattung trägt in sich unvermeidbar eine Prädisposition zu Gewalt. Diese findet sich ursprünglich und immanent in der prä- und perinatalen Lebenszeit aufgrund ihrer gattungsspezifischen Charakteristika.
Die pränatale Lebenszeit kann in unterschiedliche Erlebensphasen gegliedert werden, die dem jeweiligen Entwicklungsstadium entsprechen. Über einen ersten pränatalen Lebensabschnitt wissen wir, daß jede Millieuveränderung umfassenden Einfluß auf die weitere Entwicklung des Kindes hat. In späteren Abschnitten, spätestens im 7. Monat können wir Reaktionen des Fötus auf äußere Reize per Ultraschall beobachten. Die Plazenta zeigt eine temporäre, später chronische Insuffizienz, dem Ungeborenen mangelt es an Versorgung und Bewegungsmöglichkeit. Die Geburt schließlich entspricht einem gewaltsamen Milieuwechsel, der erduldet werden muß, gänzlich unabhängig ob es sich um eine "natürliche" Geburt, im Sinne einer vaginalen Geburt handelt, oder um eine Kaiserschnittentbindung. Die vaginale Geburt ist ein physiologischer Grenzfall, durch das evolutionär bedingte, vergrößerte Schädelvolumen, das einen Geburtszeitpunkt in einem frühen Reifestadium verursacht. Die somit erzeugte "Frühgeburtlichkeit" erfordert unweigerlich ein Eingebunden-Sein in eine soziale Gemeinschaft, die Mechanismen und Verhaltensweisen entwickelt hat, um den Nachkommen das extra-uterine Nachreifen und Überleben zu ermöglichen, um das Fortbestehen der Gattung zu gewährleisten.
II. Optimale - d.h. artgerechte - Bedingungen während der prä,- peri- und frühen postnatalen Lebenszeit wirken relativierend auf die gattungsspezifische Prädisposition zu Gewalt.
III. Das Selbstverständnis einer Erziehungswissenschaft, die der prä- und perinatalen Lebenszeit Rechnung trägt, kann artgerechte Betreuung des Nachwuchses und somit die Entschärfung der gattungsspezifischen Gewaltdisposition bewirken.
Vorgeschichte/Motivation
„Prä- und perinatale Psychologie und Gewaltätiologie“ zum Thema meiner Diplomarbeit zu machen hat freilich seine ganz persönlichen Gründe.
Es ist das vorläufige Ende einer Suche nach dem „Warum“, oder eines der „Warums“ der Ursachen, der Wurzeln menschlichen Handelns. Als Jugendlicher hatte ich die Gelegenheit zu einem fünfjährigen Aufenthalt in Lateinamerika mit Schulbesuch an einem einheimischen Gymnasium. Das zunächst einprägsamste für mich war zu beobachten, daß sich dort die Gleichaltrigen völlig anders verhielten, als ich es erwartet hätte. Ich war von ähnlichen Verhalten ausgegangen wie ich es bisher kannte und glaubte, mir nur die Sprache aneignen zu müsse, um integriert zu werden.
Hier begann sich ein Interesse für die Ursprung der unterschiedlichen Handlungsweisen zu entwickeln. Ich lernte zu verstehen und zu akzeptieren, daß sich meine Mitschüler in Handlungsweisen „richtig“ fühlten, auch wenn ich persönlich diese zunächst noch nicht kannte, als unangebracht empfand, oder nicht billigen konnte.
Zurück in Deutschland erlernte ich zunächst das Friseur-Handwerk. Die Tätigkeit in meinem Beruf erlaubt mit den unterschiedlichsten Menschen in Kontakt zu treten. Viele dieser Kontakte gingen über Jahre in regelmäßigem Abstand, was den Aufbau dauerhafter und stabiler Beziehungen ermöglichte.
Gerade im Umgang mit den Kunden stellten sich mir immer wieder die Fragen noch den „Warums“ der Handlungen. Nach bestandener Meisterprüfung ging ich an die Universität Frankfurt, um diesen Fragen wissenschaftlich nachzugehen.
Zunächst erhofft ich mir von der Soziologie einige Semster lang Antworten. Die Ergebnisse waren durchweg interessant, doch gefragt nach dem Ur-Sprung, dem ersten Funken, der Herkunft sozialer Phänomene, fand ich keine umfänglich befriedigenden Antworten. Das Individuum mußte der Schlüssel zu den Lösungen sein, die Pädagogik müßte Auskunft geben können. Sie erschien mir näher an der Auseinandersetzung mit den „Problemen“ der Menschen und deren Ursachen und Heilungen, als die Psychologie, die sich augenscheinlich mit beobachtbaren Phänomenen beschäftigt.
In der Entwicklungspsychologie fand ich die Säuglingsforschung als einen Teilbereich, der sich mit dem Menschen in einer Lebensspanne befaßt, die noch kultur- und sozialisationsunabhängig erschien. Die Beobachtungen scheinen universelle Geltung zu haben.
Fast zeitgleich bekam ich Zugang zur Pränatalen Psychologie , die mir in Verbindung mit biologischen, zoologischen und human-medizinischen Aspekten einen umfassenderen Blick für eine Betrachtungsweise der Ursprünge menschlichen Handelns gab.
Bei der Frage nach Gewalt und Gewaltsamkeit reduzierte sich das Erkenntnisinteresse auch auf deren Ursprung, der möglicherweise mit gattungsspezifischen Gegebenheiten zu tun hat.
Wie ist eine hohe Gewaltverbreitung möglich, wie ist eine immer wieder beobachtbare Gewaltlegitimation möglich, sowohl in Politik und Wirtschaft, als auch im familiären Bereich, obgleich eine Ächtung und Vermeidung ebenso angestrebt wird.
Kann es eine angeborene oder angelernte Gewaltbereitschaft geben?
Diese Frage stellte sich mir stets, wenn ich Gewaltanwendung in Bereichen feststellen konnte, die als grundsätzlich gewaltfrei gelten. In Krisensituationen neigte man nun dazu, Gewaltanwendung als letztendliche Lösung zu wählen, wenn friedliche Lösungsversuche fehlschlugen.
Es erscheint mir deutlich, daß Gewaltanwendung nur dann möglich ist, wenn sie trotz bekundeter Gewaltfreiheit, als Gewaltbereitschaft latent in die Handlungsabläufe miteinfließt.
Ist eine gewaltsame Lösung denkbar, so ist die pazifistische eine Scheinlösung, die uns erlaubt, ein gesellschaftlich anerkanntes friedvolles Selbstbild aufrechtzuerhalten.
Mißlingen nun die friedlichen Aktionen[1] dann werden gewaltvolle Lösungen mittels einer abstrakten Verschiebung der Verantwortlichkeiten legitimiert. Sodann wird der potentielle Gewaltanwender quasi durch die inadäquate Reaktion des nun potentiellen Gewaltempfängers „gezwungen“, seine Handlungen, seine Einstellungen im Sinne des ersten zu verändern.
Hier muß die Überzeugung - möglicherweise unbewußt - existieren, jemanden mittels Gewaltanwendung umstimmen und dies legitimieren zu können. Ist dies der Fall, so könnte man annehmen, daß Gewaltanwendung zu der „Sprache“, oder zum Handlungsrepertoire der Sippe oder Gruppe gehört, der man angehört. Diese „humanen Sondermerkmale „ (Portmann, 1962, S. 295) werden früh - auch schon pränatal - erlernt, sind Sozialisationsergebnisse.
Das Gewalt-Erleiden hat offensichtlich eine weniger akzeptierte Dimension, als das Gewalt-Anwenden, das durchaus als „...Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln“ anerkannt ist. Freilich hat Carl von Clausewitz dies im Zusammenhang mit dem Krieg geschrieben, den er allerdings als einen Versuch, „...den anderen durch physische Gewalt zur Erfüllung ...“ des eigenen Wunsches zu zwingen ( 1980, S. 17, zit. bei Mentzos, 1993, S. 49), definierte.
Doch politisch im strengen Sinne handeln wir auch innerhalb der Familien, jede zwischenmenschliche Interaktion kann als ein politischer Akt angesehen werden.
Die Verknüpfung war nun hergestellt. Zwei Fragenkomplexe waren nun aufgestellt. Wann und wie ist unser Verhalten determiniert? Und wann und wie können wir erste Gewaltsamkeit beim Menschen feststellen?
Pränatale Psychologie
Sich eine pränatale (vorgeburtliche) Psychologie als Studienrichtung vorzustellen mutet zunächst sonderbar an, da unser Bewußtseinsfeld sich bei diesem Begriff geradezu blitzartig verengt. Der Blick wendet sich fort vom Thema, fort von der Vorstellung eines noch ungeborenen Kindes, seines Erlebens, seiner Wahrnehmung, seiner Umwelt und richtet sich auf einen ebenso verengten Wissenschaftsbegriff, der nach „Beweisbarkeit“ ruft und weniger um Erkenntnis ringt. Was sich nun ereignet ist eine Verkehrung des Beobachtungsgegenstandes: wollten wir uns ursprünglich mit der Psychologie der ungeborenen Menschen auseinandersetzen, so beschäftigen wir uns nun mit den möglichen Schwierigkeiten der Beweisbarkeit.
Nach ihr richtet sich jetzt die Präferenz der zu untersuchenden Themen, nicht nach einem möglichen Erkenntnisgehalt, der sich aus der Beschäftigung mit der pränatalen Psychologie ergeben könnte.
Doch die „Erkenntnis beginnt nicht mit Wahrnehmungen oder Beobachtungen oder Sammlung von Daten oder von Tatsachen, sondern beginnt mit Problemen“ (Popper, 1969 , S. 104) .
Die Pioniere der Pränatalen Psychologie waren mit der Ausblendung einer Lebenszeit konfrontiert, über die man auch nicht mit Gewissheit sagen konnte, daß sie keinen Einfluß auf das spätere Leben haben könnte. Dies stellte das „Problem“ dar.
Diesen Weg scheint die Pränatale Psychologie stets gegangen zu sein: sich mit einer vernachlässigten Lebensphase beim Menschen zu beschäftigen, unabhängig ob ihrer unmittelbaren Beweisbarkeit, doch immer auf der Suche nach Belegen. Das „Problem“ in popperschen Sinne, also der Beobachtungsgegenstand war das ungeborene Kind und seine Erlebensweisen, sein „fötaler Psychismus“ (Rascovsky, 1974) und dies versuchten man zunächst, sich vorzustellen.
Als Otto Rank 1924 das „Trauma der Geburt“ veröffentlichte und Hans Gustav Graber, im selben Jahr in seinem, Buch „Die Ambivalenz des Kindes“ den Blick auf die Bedeutung des vorgeburtlichen Lebens richtete, gab es weder Ultraschall- noch Fruchtwasseruntersuchungen bei schwangeren Frauen, die die Entwicklung des Kindes im Mutterleib und das Seelenleben des Ungeborenen hätten anschaulich machen können.
Doch mit der fortschreitenden Erweiterung des Erkenntnisstandes in den anthropologischen Forschungsbereichen, entwickelte sich auch für die Pränatale Psychologie ein immer klareres Bild dessen, was in der uterinen Welt des Ungeborenen vor sich geht.
Schließlich wurde 1971 in Wien die Internationale Studiengemeinschaft für Pränatale Psychologie ( ISPP) gegründet, mit dem Ziel, die pränatale Welt systematisch zu erforschen und die Ergebnisse und Theorien zu sammeln und auszuwerten. Seit 1986 heißt die Studiengemeinschaft ISPPM; die medizinische Forschung wurde miteinbezogen.
Für Gustav Hans Graber, einem der Gründerväter der ISPP, ist Sigmund Freud Wegbereiter der Pränatalen Psychologie mit der Definierung des „Es“[2]. Dieses ist für Graber gleichsam psychischer Ort der unbewußten Inhalte aus der vorgeburtlichen Lebenszeit, die lebenslang als Erlebensgrundlage nachhallen.
Freud distanzierte sich, nach anfänglicher Begeisterung, bald von den Ideen Ranks und Grabers, die Geburt könne als Trauma Ursprung seelischer Störungen sein. Dies hätte konsequent zu Ende gedacht weitreichende Folgen in der psychoanalytischen Behandlung gehabt.
Rank und Ferenczi, beide Schüler Freuds, wiesen 1924 auf notwendige Veränderungen in der Behandlungsmethode im „Sinne einer Akzentverschiebung von Erinnern und Einsicht zu Wiederholen und kreativer Neuerfahrung“ (Janus, 31993). Diese veränderte Betrachtungsweise hätte sich unweigerlich im psychoanalytischen Theoriegebäude niederschlagen müssen. Freud umging diesen Weg, indem er - wenig umfangreich - dem Geburtsakt mit seinen Unlustempfindungen als Entstehungserlebnis aller Angstzustände definierte. Die erste Angst, der Angstaffekt ist mit der Geburt verwoben (Freud, 1917). Freud verfolgte diesen Bereich nun nicht weiter, wodurch er in der Psychoanalyse in Vergessenheit geriet.
Die Pränatale Psychologie gibt sich wenig theoriegebungen. Die Herangehensweisen sind augenscheinlich ebenso zahlreich, wie die Fachgebiete, die sie umfaßt. Dies scheint einen offenen und kreativ-einfühlsamen Umgang mit dem Thema der pränatalen Psyche des Menschen zu ermöglichen, da keine Theoriekompatibilität gefordert ist, sondern Antworten auf offene Erkenntnisfragen.
Aufbau
Diese Arbeit ist in vier Kapitel mit verschiedenen Unterkapiteln gegliedert.
Das 1. Kapitel befaßt sich mit der stammesgeschichtlichen Herkunft des Menschen als Gattung. Aus dieser Herleitung ergibt sich eine besondere „gattungsspezifische“ Geburtssituation die als eine der Ursprünge für eine speziell menschliche Prädisposition zu Gewalt diskutiert wird. In diesem Zusammenhang wird auf die ontogenetischen Besonderheiten des Menschen im Vergleich zu den nächsten Verwandten, den Menschenaffen hingewiesen. Die Ontogenese des Menschen ist demnach eine unverwechselbare, da hier in der Evolution der Gattung neue Wege gegangen worden sind.
Das 2. Kapitel beleuchtet die Entstehung einer Sozialität beim Menschen, die mit den in Kapitel 1 erläuterten ontogenetischen Bedingugen ihre Ursachen hat.
Mit den Erlebensweisen des ungeborenen Kindes und der Geburt als Drehpunkt im Leben des Menschen befaße ich mich zu Beginn. Schließlich erkläre ich den Menschen als soziales Wesen über die Tatsache seines unreifen Entwicklungszustandes bei der Geburt, der zu einer überlebensnotwendigen Intensivbetreuung durch Artgenossen führt. Diese Betreuung erwartet das Kind, doch diese Erwartung kann enttäuscht werden. Die Folgen werden anhand einiger Fallbeispiele verdeutlicht.
Das 3. Kapitel zeigt eingangs wie eine artgerechte Betreuung sein könnte. Die verschiedenen Lebensabschnitte werden gesondert behandelt, es werden Aussagen über Auswirkungen pränataler Steßerlebnisse ebenso getroffen, wie über die Bedeutsamkeit der perinatalen und der frühen Postnatallebenszeit für die Entfaltung des menschlichen Potentials.
Das 4. Kapitel verbindet die Pränatale Psychologie mit den Erziehungswissenschaften. Zunächst entwickele ich die Vorstellung einer Verbindung beider Forschungsbereiche. Schließlich erfährt die Bedeutsamkeit der Pränatalen Psychologie für ein verändertes Selbstverständnis der Erziehungswissenschaften und des hier etablierten Wissenschaftsbegriffes Beachtung. Die Erkenntnisse der Pränatalen Psychologie in den Erziehungwissenschaften werden als Ausgangspunkte einer sich wandelnden Konzeption des Menschen diskutiert. Als Grundlage und Angelpunkt wird eine gattungsimmanante Sozialität des Menschen verstanden, conditio sine qua non das Überleben des Menschen nicht denkbar wäre.
1. Gattungsimmanente Prädisposition zu Gewalt beim Menschen. Ätiologische Aspekte.
Vorbemerkung
Gattungsspezifische Aspekte zu nennen verlangt nach einem kleinen Exkurs in die Biologie, um einen Versuch einer Standortbestimmung der Gattung Mensch innerhalb der Säugetiere vorzunehmen und um auf die Besonderheiten der stammesgeschichtlichen Entwicklung der menschlichen Ontogenese hinzuweisen.
Um den Rahmen dieser Arbeit nicht zu sprengen, beschränke ich mich bei diesen Ausführungen auf die mir zwingend zu nennenden Punkte, die dem Gesamtverständnis dienen sollen, und werde unweigerlich immer wieder Bereiche streifen müssen, die zunächst den Anschein vermitteln, nur mittelbar mit dem Thema in Zusammenhang zu stehen.
1.1. Ontogenetische Vorbedingungen
Um den evolutiven Stand der einzelnen Gattungen festzustellen, scheint es sinnvoll, die Frage nach der Säugerontogenese in zwei Fragekomplexe zu untergliedern (Portmann, 1938, S. 202). Einerseits die Entstehung der für alle Säuger charakteristischen plazentalen Viviparität, der Fähigkeit, die Frucht lebend zu gebären und die sich unweigerlich stellende Frage nach der Entstehung des Amnions, der Embryonalhülle, in der die Frucht heranreift.
Andererseits die Frage nach der Entstehung der Fortpflanzungserscheinungen, also der Anzahl der Jungtiere, der Tragzeit und Reifegrades der Jungtiere bei der Geburt.
Bestimmte Fortpflanzungserscheinungen können erst als evolutiv bedeutsam angesehen werden, wenn sie als Teil einer Ontogenese verstanden werden, die ein hochkomplexes System der verschiedensten Einwirkfaktoren repräsentiert. So bedeutet beispielsweise eine Reduktion der Jungenzahl bei steppenbewohnenden Huftieren, die unter anderen als Hinweis auf einen hohen evolutiven Stand der Gattung schließen ließe, alleine betrachtet nicht zwingend eine hohe evolutive Wertigkeit, da diese Erscheinung auch aus einer, den Millieubedingungen zuzuschreibenden Anpassung entstehen kann.
Ähnlich verhält es sich mit der ontogenetischen Bewertung des Colostrums, der Frühmilch, das bei einigen Säugern als bedeutsam einzustufen ist, da hier die Übermittlung nicht plazentagängiger Antikörper[3] vollzogen wird. Diese Betrachtung bezieht sich allerdings auf jene Säuger mit gedehnter Plazenta. Bei Säugern mit massiger Plazenta hat dieser Vorgang eine weit geringere Bedeutung.
1.1.1. Die plazentale Viviparität
Die Nachkommenschaft lebend gebären zu können scheint ein wesentlicher evolutiver Schritt in der Tierwelt zu sein. Diese Entwicklung bedarf einer Vielzahl ontogenetisch bedeutsamer Veränderungen, wie beispielsweise die Entstehung des Amnions, jener Hülle, in der die Frucht heranwächst und einer Plazenta, die in ihren Funktionsweisen den neuen Anforderungen entspricht. Die Plazenten alleine dienen freilich nur in Verbindung mit der Beobachtung der Art und den Funktionsweisen der Nabelblase, der Allantoinblase und der Urniere als Kriterien, eine Gattung auf ihren evolutiven Stand hin einzuordnen.
Des weiteren sei dies stets mit dem Blick auf die Fortpflanzungserscheinungen betrachtet, die es in die Ontogenese einzubeziehen gilt, da nur so ein verlässliches Bild dieser komplexen Vorgänge entstehen kann
(Portmann, 1938, S. 208).
Portmann (1938, S. 203) greift in seiner Klassifizierung der Plazenten die von Assheton (1910) auf, der drei Plazentatypen unterscheidet, einen massigen, einen gedehnten und einen Mischtypus.
Die unterschiedlichen Ausdehnungen der Allantois, dem sackartigen Organ, der Embryonen von Reptilien, Vögeln und Säugetieren zunächst als Harnblase dient, später den Reptilien und Vögeln als Atmungsorgan, den Säugern zur Nährstoffaufnahme, ist das entscheidende Merkmal.
Es ist auffällig, daß die Allantois bei Gruppen mit massiger Plazenta entweder klein ist oder ganz fehlt, bei allen Gruppen mit gedehnter Plazenta, oder mit Plazenta des Mischtypes hingegen ist die Allantois stark entwickelt und füllt zusammen mit dem Amnion (innere Embryonalhülle) das Innere der Keimblase an.
Diese beiden unterschiedliche Evolutionsrichtungen lassen sich bei den Amnioten[4] aus den unterschiedlichen Verhaltensweise der Allantois erkennen. Bremer (1916, zit. bei Portmann, 1938, S. 205) gibt den Hinweis, daß eine geringe Ausbildung der Allantois mit einer ebensolchen des Mesonephros (Urniere) einhergeht und eine starke Ausbildung der Allantois sich bei einer ähnlich starken Ausbildung des Mesonephros zeigt.
Ferner stellt er fest, daß selbst der Metanephros (Nachniere), der schon vor der Geburt funktionsfähig ist, nicht notwendigerweise auch das Ausscheidungsorgan der fötalen Exkremente ist.
Die so merkwürdig stark unterschiedlichen Entwicklungsrichtungen eines für die Säuger so bedeutsamen Organs, läßt den Schluß zu, daß die Allantois nicht alleine die Exkretion vornimmt. Zwar ist fötaler Urin in der Allantoisflüssigkeit nachweisbar, die Ausscheidung der stickstoffhaltigen Endprodukte des Stoffwechsels aber werden in der Hauptsache von der Plazenta, gleich welcher Form sie sei, übernommen.
Portmann unterscheidet in bezug einer Evolutionsrelevanz drei Gruppen der Säugetiere:
1. Archaische Formen. Ihre Keimblase zeigt eine massige Plazenta, eine große oder mäßige Nabelblase und eine mäßig ausgebildete Allantois (Insektivoren).
2. Evoluierte Formen. Mit kleiner oder fehlender entodermaler Allantois, gering entwickeltem Mesonephros und massiger Plazenta (Chiroptera, Xenarthra, Rodentia, Primates).
3. Evoluierte Formen. Mit sehr großer Allantois, großem, lange funktionierendem Mesonephros, mit gedehnter Plazenta des Mischtyps (Carnivora, Cetacea, Ungulata, Manis).
Diese dreigeteilte Gliederung gilt bei Portmann in Verbindung mit den ontogenetischen Besonderheiten der Fortpflanzungserscheinungen, mit denen sie in engsten Wirkzusammenhang stehen.
1.1.2. Evolutiv bedeutsame Fortpflanzungserscheinungen
Eine kurze Tragzeit der Embryonen ist allgemein als ein Hinweis für eine ursprüngliche Gattung anerkannt, eine lange Tragzeit für eine evoluierte Gattung. Als kurze Tragzeit können 3-6 Wochen wie bei den Insektivoren angenommen werden, lange Tragzeiten sind beispielsweise bei den Huftieren mit 16-20 Wochen, oder Elefanten mit 20 ½ Monaten.
Die längere Tragzeit wird als ein Charakteristikum einer phylogenetisch (stammesgeschichtlich) jüngeren Gattung betrachtet. Morphologische Tatsachen lassen diesen Schluß zu (Portmann, 1938, S. 212).
Eine große Anzahl an Nachkommen pro Wurf bei den primitiven, eine geringere Anzahl an Nachkommen pro Wurf bei höher entwickelten Gruppen gilt als Gesetzmäßigkeit (a.a.O., 1938, S. 213).
Der Reifegrad der Jungtiere bei der Geburt ist insofern bedeutsam, als bei den Säugetieren die verschiedensten Reifegrade zu beobachten sind. Die Unterscheidung zwischen Nesthockern und Nestflüchtern (a.a.O., 1938, S. 214 ff.) bietet sich hier an, wie sie zur Differenzierung der Vögel verwandt wird. Nesthocker ist die Bezeichnung für meist wehrhafte oder versteckt lebende Tiere, deren Junge noch längere Zeit nach der Geburt oder dem Schlüpfen von den Elterntieren im Nest gehütet oder gefüttert werden ( z.B. Greifvögel, Nage- und Raubtiere)[5], Nestflüchter werden jene, meist nicht wehrhafte Tiere genannt, deren Junge sofort nach der Geburt oder dem Schlüpfen das Nest verlassen (z.B.Hühner, Enten)[6]. Hassenstein fügte zu den portmann´schen Begriffen den des Traglings (Hassenstein, 1970, zit. bei Manns/Schrader, 1995, S.18) hinzu.
Der junge Tragling ist ein Säugetierjunges, das von einem Elternteil getragen wird, weil es sich noch nicht oder nur bedingt alleine fortbewegen kann (a.a.O., S. 18 ff.).
Zu den Traglingen können wir eine Reihe der Menschenaffen, sowie den Menschen zählen, deren allgemeiner Entwicklungsstand dem des Nestflüchters entspricht.
Der Reifegrad der Jungtiere bei der Geburt oder beim Schlüpfen ist nun ein von ethologischen[7] Faktoren unabhängiges Phänomen, das eine eigene Entwicklung zu durchlaufen scheint. So sind beispielsweise bei den Raubtieren gleichartige Entwicklungszustände bei der Geburt beobachtbar, trotz sehr verschiedenartiger Lebensweisen der Alttiere (Benazzi, 1933, zit. bei Portmann, 1938, S. 214).
Die Säugetiergattungen, die zu den Nestflüchtern gezählt werden, durchlaufen offenbar intrauterin morphologische Entwicklungsschritte der Nesthocker. Augen und Gehörgänge sind hier verschlossen (Portmann, 1962, S. 225), öffnen sich aber entweder schon pränatal oder wenige Tage nach der Geburt, ohne einer speziellen reifungsrelevanten Notwendigkeit entsprochen zu haben, wie es bei den Nesthockern der Fall ist. Hier sichert der Verschluß der Augen und Gehörgänge eine postnatale Vollendung der Reifung in feuchtem Millieu. Dieser Vorgang, der bei den Nestfüchtern sonderbar erscheint, ergibt einen Sinn, betrachtet man ihn als einen Durchlaufen der primitiven Phase der Ontogenese.
Die Folgerung liegt nahe, diese Erscheinung als ein Zeugnis der Abstammung vom Nesthocker zu verstehen, der somit als das urprüngliche Geschöpf gelten darf, der Nestflüchter als das phylogenetisch jüngere Geschöpf, da bei dem Organverschluß eine völlige Funktionslosigkeit vorliegt, wie sie selten dergestalt evident wird.
1.2. Der Mensch: ontogenetische Besonderheiten
Die Ontogenese, die individuelle Entwicklung jeder Gattung ist besonders, ist eine eigene, spezielle, auch wenn Ähnlichkeiten oder Übereinstimmungen zwischen verschiedenen Gattungen feststellbar sind. Aus diesem Grund sind Vergleiche in ihrer Aussagekraft meist unzulänglich.
Dennoch scheint ein Vergleich der menschlichen Ontogenese mit jener der Anthropoiden (Menschenaffen) sinnvoll.
Die Verwandtschaft des Menschen mit den Menschenaffen ist unzweifelhaft, doch zeigt sich auch hier im Vergleich, wie eigen die Individualentwicklung jeder Gattung gestaltet ist.
Dies wird beispielsweise anhand des unterschiedlichen Wachstums deutlich, das bei den Anthropoiden im ersten Lebensjahr deutlich geringer ist als bei uns, um schließlich gleichmäßig anzusteigen, wohingegen es sich beim Menschen bis zum Wachstumsschub der Pubertät verlangsamt.
Zur Zeit der Geschlechtsreife beschleunigt sich nun wieder das Wachstum bei uns. Diese verschiedenen Abschnitte sind bei den Anthropoiden nicht zu beobachten.
Zum anderen fällt eine unterschiedliche Zerebralisation auf. Bei gleicher Körpermasse übertrifft die Gehirnmasse des Menschen die der Anthropoiden um ein drei- bis vierfaches.
Doch der simple Gewichtsunterschied sagt wenig bezüglich einer evolutiven Wertigkeit oder den Entwicklungstand einer Gattung aus. Er muß in Zusammenhang mit einer umfangreicheren und zeitlich verlängerten Differenzierungsphase der Gehirnzellen betrachtet werden, die eine ebenfalls verlängerte Phase der Abhängigkeit von Betreuung bewirkt.
Die Differenzierungsphase des Gehirns beim Menschen vollendet sich etwa mit dem ersten postnatalen Lebensjahr.
Die Tragzeit wird also nicht verlängert um einen höheren Reifegrad bei der Geburt zu erreichen. Der Mensch scheint in seiner Ontogenese neue Wege zu beschreiten. Sie kann nicht als eine Steigerung der Ontogenese der Antropoiden verstanden werden, so verschieden ist sie. Um einen Reifegrad bei der Geburt zu erreichen, wie bei den Anthropoiden, müßte die Tragzeit beim Menschen von etwa 270 auf etwa 600 Tage steigen, was sich nicht ereignet.
Bei genauer Betrachtung zeigt sich, daß die menschliche Lösung eine ganz spezifische ist. Der morphologische Zustand bei der Geburt ist der eines Nestflüchters, der im Mutterleib die typischen Phasen des Verschlusses der Sinnesorgane durchläuft.
Doch des weiteren zeigt er eine völlige Abweichung von dem, was wir von höheren Säugern erwarten. Eine oberflächliche Betrachtung ließe wohl einen Nesthocker vermuten, der in seiner Hilflosigkeit intensiver Pflege bedarf, doch kommt der Mensch mit wachen Sinnen zur Welt, seine motorischen Fähigkeiten sind zu diesem Zeitpunkt schon sehr ausgeprägt, was die Nestflüchter charakterisiert.
Morphologisch ist der Mensch nun ein Nestflüchter, auch wenn er das „Nest“ nicht ohne fremde Hilfe verlassen kann. Stammesgeschichtlich herausgebildet hat sich bei einigen Anthropoiden und beim Menschen das Tragen als eine Form der Verquickung von Betreuung und Fortbewegung.
Den Mensch können wir zu den Traglingen zählen, die das erste nachgeburtliches Lebensjahr in engsten Körperkontakt mit der Pflegeperson verbringen.
Entwicklungsschritte können sich durch das Getragenwerden optimal vollenden. So bewirkt die aufrechte Haltung beim Tragen eine günstige neuronale Entwicklung durch die Stimulanz des Gleichgewichtssinns. Wirbelsäule und Hüfte werden stimuliert und in einer evolutiv bestimmten Form gehalten. Bindungen an Betreuungspersonen der Sippe sind leichter herzustellen(Manns/Schrader, 1995, S. 116).
Das Neugeborene scheint aufgrund dieser Situation, gerade in der frühpostnatalen Lebenszeit stark aufnahmebereit für äußere Reize und beeinflußbar durch Simulation (Montagu, 1974, S. 145 ff., Gruen, 1993, S. 37ff.) .
Birbaumer und Schmidt (1996, S. 27) gehen von einer notwendigen Interaktion zwischen dem genetischen Potential und den „sofort (Hervorhebung AZ) nach der Befruchtung einsetzenden, dieses fördernden oder behindernden Umwelteinflüssen“[8] aus, die letztendlich die phänotypische Varianz determinieren. So wird das genetische Potential sich erst dann ausdrücken (sich also phänotypisch manifestieren), wenn es gefördert wird. Dies gilt im Sinne einer umfänglichen körperlich-substantiellen, wie auch einer psychisch-affektiven Förderung, letztlich alle Umwelteinflüsse betreffend.
Schließlich scheint es evident, die menschliche Ontogenese als eine speziell menschliche Seinsart anzusehen und zu bewerten. Zu berücksichtigen in der vergleichenden Ontogenie ist dieser Aspekt, der uns so fundamental von allen höheren Säugetieren unterscheidet. Gemeint ist eine „Weltoffenheit“ die aus einer weniger instinkthaften Seinsart resultiert als aus komplexen Denk- und Abstraktionsvorgängen , die uns zu prägbaren Geschöpfen im Sinne von Sozialisation macht (Portmann, 1945).
Offenheit für sozialisationsbedingte Prägung birgt in sich das Potential für eine Vielzahl von Handlungs- und Verhaltensvarianten. Diese entspringt beim Menschen aus der umfänglichen Möglichkeit und Notwendigkeit der Prägung und des Erlernens der charakteristisch menschlichen Verhaltensweisen und Ausdrucksformen. Aufgrund dieser Situation und der nicht instinkthaften Handlungsicherheit, die bei Tieren durch Instinktdeterminiertheit im Handeln gegeben ist, scheint ein Rückschluß auf eine schon pränatal vorhandene Rezeptivität auf äußere Reize durchaus naheliegend.
1.2.1. Evolutionsbedingte Geburtsproblematik
Augenscheinlich durchläuft der Mensch intrauterin das Stadium des Nesthockers mit dem charakteristischen Verschluß der Sinnesorgane. Doch dies ist ein transitorischer Zustand.
Der Mensch zeigt bei der Geburt den Reifegrad eines Nestflüchters. Mit seiner Hilflosigkeit erinnert er an die Nesthocker, mit seinen wachen Sinnen und seinen motorischen Fähigkeiten scheint er aber ein Nestflüchter zu sein. Der Begriff „Tragling“(Hassenstein, 1970) erscheint für die Situation des Menschen kurz nach der Geburt zutreffend.
Dies ist eine Besonderheit in der menschlichen Individualentwicklung. Die Bedingungen, die die menschliche Geburt umschließen sind ebenso gattungsspezifisch wie sie, medizinisch gesprochen, grenzwertig sind.
Die Ursachen hierfür sind komplex. Man kann die Evolution des Menschen wohl zweifelsfrei als einen steten Kampf der Erbsubstanz der Vorväter mit den Bedingungen und Gegebenheiten der Umwelt bezeichnen. Hierbei handelt es sich um ein Bestreben der Gattung, sich an die Umwelt dergestalt anzupassen, daß die Wahrscheinlichkeit des Überlebens der Gattung möglichst hoch ist.
Eine der Anpassungsleistungen der Gattung Mensch an seine Umwelt war der aufrechte Gang. Weitreichende Veränderungen brachte diese Neuerung mit sich. Zunächst bliebe die Möglichkeit sich aufzurichten folgenlos, könnte sie nicht in Verbindung mit komplexen Denkleistungen und dem Sehen entscheidende Überlebensvorteile sichern.
Stellen wir uns steppenbewohnende Frühmenschen vor, die sich einerseits vor Raubtieren schützen mußten, andererseits in Gruppen jagend ihre Nahrung erkämpften, so ergibt der aufrechte Gang eine Vielzahl neuer Verhaltensmöglichkeiten. Beispielsweise konnten Gefahren wie jagende Raubtiere frühzeitig erspäht und die Nachkommenschaft in Sicherheit gebracht werden (Bowlby, 1975, S. 71). Eine sinnvolle Verteidigung war frühzeitig planbar.
Die optische Erfassung des Geländes erlaubte die Entwicklung effektiver Jagdstrategien. Mit zeitlicher Antizipation konnten Vorgehensweisen bestimmt werden, die aus den Ergebnissen eingehender Beobachtungen erfolgen konnten.
Auch erlaubte die aufrecht Körperhaltung in Verbindung mit der Nutzung der Augen als wichtiges Sinneswerkzeug, die nicht-akustische Verständigung. Diese erweist sich schnell als Jagdvorteil, wenn sich es bei den Beutetieren um solche handelt, deren Riech- oder Hörsinn sich als die ausgeprägten Sinne erweisen.
Diese Entwicklung vollzieht sich über viele Zehntausend Jahre und über Hunderte von Generationen.
Die Veränderungen, Neuerungen in Verhalten und Kommunikation wie sie oben beschrieben wurden, bedeuten eine massive Leistungssteigerung des Zentralnervensystems und des Gehirns. Diese Leistungssteigerung könnte man als kontinuierliche Erhöhung der Kapazität verstehen, die sich aus stetig wachsender Beanspruchung ergibt, ähnlich wie der Leistungssteigerung bei Muskeln bei wachsender Beanspruchung.[9]
Um immer höhere Leistungen zu bewältigen benötigt das Gehirn des Frühmenschen eine stetig wachsende Anzahl an Gehirnzellen, die die immer differenzierteren Aufgaben erfüllen. Das Gehirn vergrößert sich.
Physiologisch betrachtet ergibt sich eine völlig neue Geburtssituation, durch einen vergrößerten Kopfumfang und die Stabilisierungs erfordern. Die aufrechte Haltung des Menschen andererseits verlangt nach einem engen und festen Beckenring und nach einer Veränderung der Lendenwirbelsäule zu einer S-Bewegung. Beides sind Stabilisierungsmaßnahmen.
Hier scheinen verschiedene Kräfte zu wirken, die gegensätzliche Lösungswege erfordern und letztlich eine Kompromislösung bewirken, maßnahmen die sich im Beckenbereich ereignen mußten, um die aufrechte Körperhaltung zu ermöglichen.
Der vergrößerte Kopfumfang würde eine Erweiterung des Geburtskanals die die Problematik der menschlichen Geburt ausmacht.
Der im Verhältnis zum Geburtskanal große Kopf bleibt ausgleichend „konfigurabel“, er ist bei der Geburt noch nicht voll ossifiziert (verknöchert), kann sich an die Enge der Geburtswege anpassen. Unvermeidbar und quasi per Evolution eingeplant scheint folglich eine unterschiedlich ausgeprägte „Massenverschiebung des kindlichen Hirns“, da der kindliche Kopf als verformbares Geburtsinstrument benutzt wird.(Müller, 1991, S. 9).
Mit dem Blasensprung, der die Geburt initiiert, entfällt die Schutzhülle um den kindlichen Kopf. Zwei entgegengesetzt wirkende Kräfte sind hier bedeutsam. Durch den Wehendruck wird der Kopf vulvawärts gepreßt, gleichzeitig wirkt der Muttermundsaum, der den Kopf umschließt entgegen, verlangsamt sein Tiefertreten.
Der Kopf wird nun von den Weichteilen des Geburtskanals umschnürt. Der gesamte Druck, den diese ausüben beschränkt sich auf einen etwa 1 bis 1 ½ Finger breiten Gürtel, den „zirkulären Schnürring“. Dadurch wird der Kopf an seiner ganzen Rundung stark zusammengepreßt. Die unmittelbaren Folgen sind ein Übereinanderschieben der - bis dahin nebeneinanderliegenden - Scheitelbeine des Kopfes, Faltenbildung unterhalb des Schnürrings und die Ausbildung eines Kopfgeschwulstes infolge einer Abklemmung der Venen. (Pschyrembel, 141973, S. 143 ff.).
Für das Kind muß bei der Geburt durch ein relativ starres, enges Becken treten und eine 90 Drehung vollziehen. Die Distanz, von der hier die Rede ist beträgt etwa 8 cm, die zurückgelegt werden müssen.
Die Drehung ist notwendig, da der Beckeneingang querovaler Form ist (betrachtet in Blickrichtung der Mutter) vom oberen Ansatz des Schambeines bis zur Lendenwirbelsäule, der Beckenausgang längsoval vom unteren Ansatz des Schambeines bis zum Steißbein betrachtet. Die Beckenmitte zeigt einen runden Durchmesser.
Die Drehbewegung ist strenggenommen eine Dreifachbewegung. Der Kopf wird nach unten in den Geburtskanal gepreßt (Progressionsbewegung), er wird mit der für ihn leichtesten Eintrittsform in die Beckenmitte bewegt, mit einer Beugung (Flexion). Das Hinterhaupt geht nun voran, da die Längsachse des Kopfes mit der Höhenachse der Beckenmitte dem leichtesten Durchtrittsmodus[10] entsprechen, sie passen gewissermaßen am besten zusammen. Schließlich dreht sich der Kopf in den am Beckenausgang vorhandenen längsovalen Querschnitt (Rotation).
Diese drei Teilbewegungen vollziehen sich quasi simultan.
Diese Vorgänge um die Geburt beim Menschen lassen auf den ersten Blick nicht unweigerlich auf eine besondere Geburtsproblematik schliessen. Zwar kann man bei näherer Betrachtungsweise auf eine Besonderheit in der Tierwelt verweisen. Einige Unterschiede sind einzigartig und augenfällig. Doch auch hier gilt es, die Ontogenese als einen umfänglichen Prozeß anzusehen, der mehr ist als ausschließlich eine phänotypische Verschiedenheit zwischen des Gattungen. Doch ist diese phänotypische Verschiedenheit der Ontogenese der Ausgangspunkt meiner Überlegungen und zugleich auch die Grundlage der Besonderheit der menschlichen Gattung. Bedeutsam sind hier die einhergehenden Veränderungen im sozialen Gefüge.
Die Geburtsbedingungen bei den Anthropoiden, unseren nächsten Verwandten, sind im Vergleich zu unseren deutlich risikoloser.
Da die Menschenaffen den aufrechten Gang nicht als dauerhaften Fortbewegungsmodus gewählt haben, sind eine Reihe geburtsrelevanter Faktoren hinfällig. Eine starker und enger Beckenring wie beim Menschen findet sich beim Menschenaffen nicht in dieser Ausprägung.
Demzufolge ist das Becken der trächtigen Äffin flexibler, dehnbarer, die Drücke auf den Kopf des Jungen während der Geburt geringer. Die stehende Fruchtblase kann Druck abfedern. Beim Menschen gibt das ungünstige Größenverhältnis zwischen Geburtskanal und Kopfvolumen keinen Raum für eine intakte Fruchtblase, die den Wehendruck abmildern könnte. Der Kopf ist dem Druck während der Austreibungsphase in voller Stärke ausgesetzt.
Das beim Menschen vollzogene Auseinanderdriften der Hüftgelenke nach außen als Stabilisierungsmaßnahme, bewirkte den querovalen Beckeneingang, der in Verbindung mit dem längsovalen Beckenausgang eine 90 Schraubbewegung bei der Geburt erzwingt. Die Drehung im Geburtskanal erfordert eine Achsverdrehung des Halses. Die Wirbelsäulenarterie wird abgeknickt und somit die Blutzirkulation zum Gehirn behindert. Diese Situation gibt es bei den Anthropoiden dergestalt nicht.
Ein geringeres Hirnvolumen erlaubt eine fortgeschrittene Ossifikation des Kopfes, die vor Hirnverletzungen schützt. Beim Schimpansen und Orang sind die Scheitelbeine des Kopfes wesentlich stärker verschlossen als bei uns. Der Grad der Ossifikation des Kopfes, den die Anthropoiden-Jungen bei der Geburt zeigen, erreicht der Mensch nach dem ersten Lebensjahr, etwa um den 15. Lebensmonat (Portmann, 1962, S. 289). Die schon recht starre Kopfstruktur bei den Menschenaffen läßt folgern, daß Geburtswege und Kopfgröße in einem angemessenen Größenverhältnis zueinander stehen, das ein Nachgeben des Kopfes während der Geburt nicht notwendig macht.
Die nahezu gerade Lendenwirbelsäule der Anthropoiden bewirkt einen ähnlich geraden Geburtskanal. Das scheint die Durchtrittmöglichkeit zu erleichtern. Der Mensch hingegen muß einerseits eine 90 Drehung vollziehen. Zum anderen muß er sich um das Schambein winden, in dem Bereich des Beckens, der durch die S-Krümmung der Lendenwirbelsäule auch einen gekrümmten Geburtskanal aufweist.
1.3. Gewaltätiologie
Es stellt sich die Frage, wie bedeutsam, oder wie erlebenswirksam diese Ereignisse für das Kind sein könnten. Kann man diese Geburtsvorgänge als einen Teil der frühesten Erlebnisse bezeichnen und wie wirken sie sich auf das spätere Erleben aus? Ist schließlich eine Prädisposition zu Gewalt oder Gewaltsamkeit hiervon ableitbar?
Der technische Fortschritt in der Medizin erlaubt immer jüngere, unreifere frühgeborene Kinder am Leben zu halten. Dieser Umstand ermöglichte es, den Wissensstand über die Bedürfnisse und Bedingungen für Wachstum und Entwicklung ungeborener Kinder zu erweitern. Wir wissen heute, wie empfindlich Kinder auch später auf Berührungen reagieren, wenn sie beispielsweise zur Beatmung intubiert wurden, oder Infusionen bekamen. Es ist ebenso hinlänglich bekannt und in die Praxis vieler Kinderkliniken umgesetzt, daß die Überlebenschancen und Entwicklungsmöglichkeiten bei Frühgeburten erheblich verbessert werden, wenn sie regelmäßig Körperkontakt mit einer „mütterlichen Person“ 11 erleben 12.
Wir können zweifelfrei davon ausgehen, daß diese Erlebensmöglichkeit in der Pränatallebenszeit ausgebildet wird. Auch besonders in der frühen Postnatallebenszeit gilt die Aussage über gute Entwicklungschancen durch affektiv positive, körperlich enge Betreuung. Eine zeitlich genaue Datierung, wann Erleben in der Pränatallebenszeit beginnt scheint schwierig. Doch können wir anhand des Entwicklungsverlaufes des ungeborenen Kindes im Mutterleib eine Einschätzung vornehmen, wann spätestens Erlebensfähigkeit und Gedächtnisleistungen möglich sind: vom 7. Monat an. Die Entwicklung der Organe ist weitgehend abgeschlossen. Die Entwicklung der Ganglienzellen[13] des Großhirns erreicht seinen Höhepunkt, das EEG zeigt Hirntätigkeit, das Kind zeigt Wach- und Schlafrhythmen, die auch nach der Geburt bestehen (Gross, 1991, S. 34 ff.).
Eine spontane Reaktionsfähigkeit und -bereitschaft auf äußere Stimuli ist somit gegeben. Das ungeborene Kind ist in diesem Reifestadium lernfähig und sozialisierbar.
Die Lernfähigkeit im Sinne einer „Angleichung oder Anpassung von Anforderungen der Umwelt (Reizen) und eigenen Bedürfnissen“ (Gross, 1991, S. 65), ist ein evolutives Ergebnis der Unabhängigkeit von streng instinkthaftem Verhalten. Sie entspricht dadurch auch einer essentiellen Notwendigkeit. Ohne erfolgreiche und baldige Aneignung der „humanen Sondermerkmale“ (Portmann, 1962, S. 295) in Verhalten und Kommunikation der jeweiligen Sippe oder Gruppe, könnte das Überleben des hilflosen Kindes gefährdet sein.
Doch auch ohne die Zielgerichtetheit des Überlebens sind kontinuierliche Lernvorgänge im Mutterleib unumgänglich. Die Gesamtsituation ist für den Fötus in ständigem Wandel. Seine Umwelt verändert sich durch sein Wachstum, sein Aktionsspielraum verengt sich zusehens bis er praktisch völlig entfällt. Die Reize die von außen auf den Fötus einwirken sind im Laufe der Schwangerschaft ebenso veränderlich. Bewegungen der Mutter tangieren ihn je nach eigenem Reifegrad und Größe unterschiedlich. Er leistet Anpassungsleistungen an immer wieder neue Gegebenheiten seiner Umwelt, steht also in Wechselbeziehung zu ihr.
Die erfolgten Anpassungs-und Lernleistungen werden in einer Art Frühgedächtnis gespeichert und sind abrufbereit, sobald ein adäquater Reiz sie stimuliert.[14]
1.3.1. Gewaltpotential per Geburt
Die Geburt ist nun als ein außergewöhnliches (im Wortsinne zu verstehen: „ außerhalb des Gewohnten “), in das Leben des Fötus einschneidendes Ereignis, zu bewerten.
Wir gehen von einem erlebensfähigen Kind aus, das die Umweltreize aufnimmt und in Interaktion zu ihnen steht.
(Janus, 1993, S. 42).
[...]
[1] Diese sind prozeßhaft in ihrem Wesen und zeigen folglich kaum ad hoc Ergebnisse, sondern erfordern zeitlich umfangreicheres Engagement als gewaltsame Handlungen.
[2] Freud schreibt im „Abriß der Psychoanalyse“, 1938, bei der Erläuterung der Bereiche des „psychischen Apparates: „Die älteste dieser psychischen Provinzen oder Instanzen nennen wir das Es; sein Inhalt ist alles, was ererbt, bei Geburt mitgebracht, konstitutionell festgelegt ist, vor allem also die aus der Körperorganisation stammenden Triebe..“ (S. 9).
[3] Sie können die Plazenta (Mutterkuchen) nicht passieren.
[4] Wirbeltiere, die in ihrer Embryonalentwicklung ein Amnion, eine Embryonalhülle, ausbilden.
[5] Das Neue Deutsche Lexikon, Bertelsmann Lexikon Verlag, Gütersloh, 1992, Bd. 11, S. 76.
[6] a.a.O., S. 75.
[7] Die Lebensgewohnheiten betreffend.
[8] Es ist durch die klassische und die molekulare Genetik belegt, daß für eine Vielzahl von Verhaltensweisen eine dynamische Interaktion zwischen Erbgut und den sofort einsetzenden Umwelteinflüssen das Erscheinungsbild dieses Verhaltens, den Phänotyp, bestimmt (a.a.O., S.26 ff.).
[9] Eine mögliche Leistungssteigerung des Gehirns ergibt sich nicht allein aus einer Vergrößerung. So hatte beispielsweise das Gehirn des Neandertalers ein durchschnittliches Volumen von 1500 bis 1700 Kubikzentimenter, also etwa 140 bis 220 Kubikzentimeter mehr als dasjenige des heutigen Menschen
Die Anzahl der Vernetzungen zwischen den Gehirnzellen und Gehirnregionen ist vermutlich ein Faktor, der Leistungssteigerung ausmacht. Ebenso ist das Verhältnis des Körpergewichtes zum Gehirngewicht von Bedeutung. Ein großes Tier benötigt ein größeres Gehirn als ein kleines Tier, um die gleichen Leistungen zu erbringen, da das Gehirn des großen Tieres mit einer größeren Peripherie in Verbindung stehen muß, als das des kleinen Tieres (Niemitz, 1987, S. 96f u. 108).
[10] Hier entspricht die Biegungsrichtung des Kopfes dem „Biegungsfazillium“ nach Sellheim. Den Kopf nach vorn, brustwärts zu biegen ist leichter als nackenwärts („Biegungsdiffizillium“) Pschyrembel, 1973, S. 116).
[11] Gemeint ist eine, das Kind liebevoll annehmende Person, unabhängig welchen Geschlechts und Verwandtschaftsverhältnisses zum Kind.
[12] Ausführlich beschreibt Montagu (1974, S. 142 ff.) die Ergebnisse bei Tierversuchen. Mit Ratten unternahm Dr. Alfred F. Washburn vom Child Research Council, Denver, Colorado umfangreiche Versuche um die Wirkung von taktilen Stimuli auf Entwicklung und Wachstum zu untersuchen. Eine Gruppe von Laboratoriumratten wurde liebevoll angefaßt und gestreichelt, während eine andere Gruppe in denselben Bedigungen lebte, doch “sachlich“ behandelt wurde.Als Ergebnisse konnte festgestellt werden, daß die gestreichelten Ratten schneller wuchsen und lernten, ein stärker ausgebildetes Nervensystem entwickelt hatten und als erwachsene Tiere ein stärker differenzierteres immunologisches System aufwiesen. Im Verhalten zeigten sich die berührten und gestreichelten Ratten „sehr viel lebhafter, neugieriger und fähiger, Probleme zu lösen, als normale Laboratoriumsratten“. Beobachtungen ähnlicher Art wurden von Patton und Gardner (1963, zit. bei Montagu, a.a.O., S.148) bei Kindern gemacht, die der mütterlichen Liebe entbehrten. Ihr physisches wie psychisches Wachstum war ernsthaft gestört: ihr Knochenwachstum entsprach etwa der Hälfte des Knochenwachstums eines normalen Kindes.
13 Nervenzellen, die notwendig sind um psychisch Leistungen wie Gedächtnis, Bewußtsein, Wille zu vollziehen (Gross, 1991, S.35).
[14] Die vorgeburtlichen Lernvorgänge scheinen äußerst intensiv, feinste Details werden unterschieden. So erkennen Kinder die Stimmen ihrer Eltern nachgeburtlich wieder, ebenso Ihnen bekannte vorgeburtlich vorgelesene Geschichten und vorgespielte Musikstücke. Der Herzschlag der Mutter (nur der eigenen!) wirkt, Säuglingen vorgespielt, unmittelbar beruhigend.
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Originalausgabe
- Erscheinungsjahr
- 1997
- ISBN (eBook)
- 9783832450755
- ISBN (Paperback)
- 9783838650753
- DOI
- 10.3239/9783832450755
- Dateigröße
- 658 KB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main – Erziehungswissenschaft, Statistik und Mathematik
- Erscheinungsdatum
- 2002 (März)
- Note
- 1,0
- Schlagworte
- gewalt geburt tragling mensch sozialisation
- Produktsicherheit
- Diplom.de