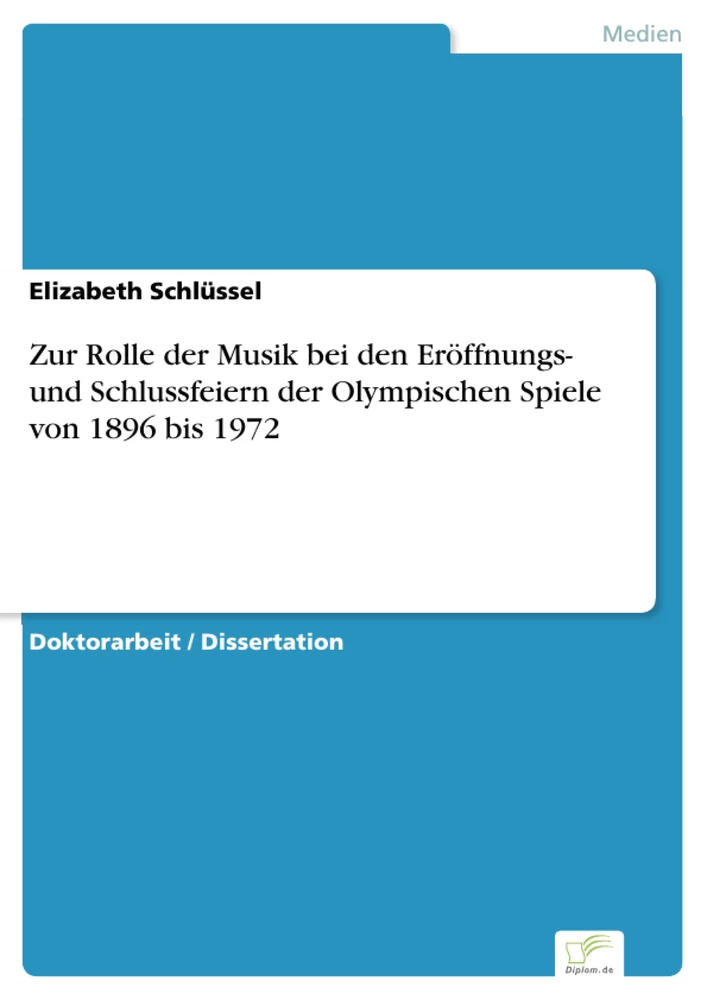Zur Rolle der Musik bei den Eröffnungs- und Schlussfeiern der Olympischen Spiele von 1896 bis 1972
©2001
Doktorarbeit / Dissertation
865 Seiten
Zusammenfassung
Inhaltsangabe:Einleitung:
Die Arbeit beginnt mit einem Rekurs auf das antike griechische Musikverständnis, erläutert musikalische Geschmackspräferenzen Coubertins und behandelt eingehend in chronologischer Abfolge das Musikdargebot der Festfeiern von Athen bis München. Die Rolle der Olympischen Hymnen wird besonders herausgestellt.
Der Streit um die Spisak-Hymne von 1956 erscheint als Kampf um das ideelle Erbe Coubertins, d. h. um die Frage, ob die OS vorrangig sich erzieherischem Impetus oder der Zelebration von Siegertypus und gefälligem Unterhaltungsinteresse verschreiben sollten. Zwischen Markt oder Tempel habe man sich zu entscheiden, hatte Coubertin pointiert gefordert. Das Bild des Tempels stand für die weltverbessernde pädagogisch-ethische Dimension seiner Olympischen Idee, in der Markt-Orientierung sah er deren Untergang voraus. Der Symbolik der olympischen Kernrituale suchte er eine entsprechend erhaben-feierliche Tönung beizugeben. Carl Diem, Generalsekretär der Olympischen Spiele 1936, verwies darauf, Coubertins Vorstellungen in vollendeter Form entsprochen zu haben.
Die Berliner Eröffnungsfeier verlief hinsichtlich ihrer nationalistischen Implikationen in den Bahnen vorheriger olympischer Festfeiern. Einzigartig war der Grad der Indienstnahme der musikalischen Inszenierung für den Führerkult. Merkwürdigkeiten weisen auf Eingriffe des Regimes hin und lassen die Verantwortlichen opportunistischer erscheinen, als sie im nachhinein zugestehen wollten. Verdeckte politische Einflussnahme auf Musik und Musiker hinter den Kulissen war auch dem Gestaltungsprozess der Festfeiern der sog. heiteren Spiele von 1972 nicht fremd. Als Gegenbild zu den Berlin-Feiern konzipiert, kehrte die Münchener Eröffnungsinszenierung eine beflissene Nation- und Traditionsvergessenheit hervor. Die Absatzbewegung von Coubertinschen Festvorstellungen, die unterhaltungsoptimierende Neustrukturierung des Olympischen Festprotokolls und die globale Marktgängigkeit heutiger hollywoodesker olympischer Festshows erhielten durch Münchener Vorarbeit kräftigen Anstoß.
Inhaltsverzeichnis:Inhaltsverzeichnis:
1.ZU ZIELSETZUNG, METHODIK UND GLIEDERUNG DER ARBEIT1
2.ÜBER MUSIK UND MUSIKVERSTÄNDNIS IM ANTIKEN GRIECHENLAND UND DEREN NEUZEITLICHE REZEPTION7
2.1Zur Musik im archaischen und klassischen Griechenland9
2.2Antike Musikreflexion: Ethische und anti-ethische Musikauffassungen17
2.2.1Platon19
2.2.2Demokrit und Philodemos21
2.2.3Aristoteles23
2.3Zum Einfluss […]
Die Arbeit beginnt mit einem Rekurs auf das antike griechische Musikverständnis, erläutert musikalische Geschmackspräferenzen Coubertins und behandelt eingehend in chronologischer Abfolge das Musikdargebot der Festfeiern von Athen bis München. Die Rolle der Olympischen Hymnen wird besonders herausgestellt.
Der Streit um die Spisak-Hymne von 1956 erscheint als Kampf um das ideelle Erbe Coubertins, d. h. um die Frage, ob die OS vorrangig sich erzieherischem Impetus oder der Zelebration von Siegertypus und gefälligem Unterhaltungsinteresse verschreiben sollten. Zwischen Markt oder Tempel habe man sich zu entscheiden, hatte Coubertin pointiert gefordert. Das Bild des Tempels stand für die weltverbessernde pädagogisch-ethische Dimension seiner Olympischen Idee, in der Markt-Orientierung sah er deren Untergang voraus. Der Symbolik der olympischen Kernrituale suchte er eine entsprechend erhaben-feierliche Tönung beizugeben. Carl Diem, Generalsekretär der Olympischen Spiele 1936, verwies darauf, Coubertins Vorstellungen in vollendeter Form entsprochen zu haben.
Die Berliner Eröffnungsfeier verlief hinsichtlich ihrer nationalistischen Implikationen in den Bahnen vorheriger olympischer Festfeiern. Einzigartig war der Grad der Indienstnahme der musikalischen Inszenierung für den Führerkult. Merkwürdigkeiten weisen auf Eingriffe des Regimes hin und lassen die Verantwortlichen opportunistischer erscheinen, als sie im nachhinein zugestehen wollten. Verdeckte politische Einflussnahme auf Musik und Musiker hinter den Kulissen war auch dem Gestaltungsprozess der Festfeiern der sog. heiteren Spiele von 1972 nicht fremd. Als Gegenbild zu den Berlin-Feiern konzipiert, kehrte die Münchener Eröffnungsinszenierung eine beflissene Nation- und Traditionsvergessenheit hervor. Die Absatzbewegung von Coubertinschen Festvorstellungen, die unterhaltungsoptimierende Neustrukturierung des Olympischen Festprotokolls und die globale Marktgängigkeit heutiger hollywoodesker olympischer Festshows erhielten durch Münchener Vorarbeit kräftigen Anstoß.
Inhaltsverzeichnis:Inhaltsverzeichnis:
1.ZU ZIELSETZUNG, METHODIK UND GLIEDERUNG DER ARBEIT1
2.ÜBER MUSIK UND MUSIKVERSTÄNDNIS IM ANTIKEN GRIECHENLAND UND DEREN NEUZEITLICHE REZEPTION7
2.1Zur Musik im archaischen und klassischen Griechenland9
2.2Antike Musikreflexion: Ethische und anti-ethische Musikauffassungen17
2.2.1Platon19
2.2.2Demokrit und Philodemos21
2.2.3Aristoteles23
2.3Zum Einfluss […]
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
ID 5006
Schlüssel, Elizabeth: Zur Rolle der Musik bei den Eröffnungs- und Schlussfeiern der
Olympischen Spiele von 1896 bis 1972 / Elizabeth Schlüssel - Hamburg: Diplomica GmbH,
2002
Zugl.: Köln, Sporthochschule, Dissertation, 2001
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte, insbesondere die
der Übersetzung, des Nachdrucks, des Vortrags, der Entnahme von Abbildungen und Tabellen,
der Funksendung, der Mikroverfilmung oder der Vervielfältigung auf anderen Wegen und der
Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen, bleiben, auch bei nur auszugsweiser Verwertung,
vorbehalten. Eine Vervielfältigung dieses Werkes oder von Teilen dieses Werkes ist auch im
Einzelfall nur in den Grenzen der gesetzlichen Bestimmungen des Urheberrechtsgesetzes der
Bundesrepublik Deutschland in der jeweils geltenden Fassung zulässig. Sie ist grundsätzlich
vergütungspflichtig. Zuwiderhandlungen unterliegen den Strafbestimmungen des
Urheberrechtes.
Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in diesem
Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme, dass solche
Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei zu betrachten
wären und daher von jedermann benutzt werden dürften.
Die Informationen in diesem Werk wurden mit Sorgfalt erarbeitet. Dennoch können Fehler nicht
vollständig ausgeschlossen werden, und die Diplomarbeiten Agentur, die Autoren oder
Übersetzer übernehmen keine juristische Verantwortung oder irgendeine Haftung für evtl.
verbliebene fehlerhafte Angaben und deren Folgen.
Diplomica GmbH
http://www.diplom.de, Hamburg 2002
Printed in Germany
Wissensquellen gewinnbringend nutzen
Qualität, Praxisrelevanz und Aktualität zeichnen unsere Studien aus. Wir
bieten Ihnen im Auftrag unserer Autorinnen und Autoren Wirtschafts-
studien und wissenschaftliche Abschlussarbeiten Dissertationen,
Diplomarbeiten, Magisterarbeiten, Staatsexamensarbeiten und Studien-
arbeiten zum Kauf. Sie wurden an deutschen Universitäten, Fachhoch-
schulen, Akademien oder vergleichbaren Institutionen der Europäischen
Union geschrieben. Der Notendurchschnitt liegt bei 1,5.
Wettbewerbsvorteile verschaffen Vergleichen Sie den Preis unserer
Studien mit den Honoraren externer Berater. Um dieses Wissen selbst
zusammenzutragen, müssten Sie viel Zeit und Geld aufbringen.
http://www.diplom.de bietet Ihnen unser vollständiges Lieferprogramm
mit mehreren tausend Studien im Internet. Neben dem Online-Katalog und
der Online-Suchmaschine für Ihre Recherche steht Ihnen auch eine Online-
Bestellfunktion zur Verfügung. Inhaltliche Zusammenfassungen und
Inhaltsverzeichnisse zu jeder Studie sind im Internet einsehbar.
Individueller Service
Gerne senden wir Ihnen auch unseren Papier-
katalog zu. Bitte fordern Sie Ihr individuelles Exemplar bei uns an. Für
Fragen, Anregungen und individuelle Anfragen stehen wir Ihnen gerne zur
Verfügung. Wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit.
Ihr Team der Diplomarbeiten Agentur
INHALT
ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS
VORWORT
1 ZU ZIELSETZUNG, METHODIK UND GLIEDERUNG DER ARBEIT
1
2 ÜBER MUSIK UND MUSIKVERSTÄNDNIS IM ANTIKEN
GRIECHENLAND UND DEREN NEUZEITLICHE REZEPTION
7
2.1 Zur Musik im archaischen und klassischen Griechenland... 9
2.2 Antike Musikreflexion: Ethische und anti-ethische Musikauffassungen... 17
2.2.1 Platon... 19
2.2.2 Demokrit und Philodemos ... 21
2.2.3 Aristoteles ... 23
2.3 Zum Einfluß platonischen Gedankengutes auf Musikwissenschaftler im
Vorfeld der Olympischen Spiele 1936... 27
2.3.1 Georg Götsch... 30
2.3.2 Richard Müller-Freienfels... 33
2.3.3 Arnold Schering... 34
2.3.4 Hanns Eisler... 37
2.4 Zusammenfassung... 39
3 PIERRE DE COUBERTIN UND DIE OLYMPISCHE FESTMUSIK 44
3.1 Zum Musisch-Pädagogischen der Vision des modernen Stadtgymnasiums 47
3.2 Zum Militärischen in Festmusik und musikalischer Erziehung ... 58
3.3 Olympische Festmusik als Träger der Ideale des modernen Olympismus .. 67
3.4 Zu den Bemühungen um festmusikalische Angemessenheit... 71
3.4.1 Das ,,moderne Olympia" als Kultstätte... 74
3.4.2 ,,Tempel"-Musik als Ausweis olympischer Angemessenheit... 79
3.5 Zu Coubertins konkreten Geschmacksvorstellungen und Präferenzen... 80
3.6 Zu Coubertins Einfluß auf musikrelevante Fixierungen im Festprotokoll 101
3.6.1 Situation von 1996 ... 104
3.6.2 Situation von 1972 ... 108
3.6.3 Situation von 1936 ... 113
3.6.4 Situation am Ende der Amtszeit Coubertins als IOC-Präsidenten ...115
3.6.5 Veränderungen der Pflichtmusik im Überblick...117
3.7 Zusammenfassung... 120
4 ZUR MUSIK DER ERÖFFNUNGS- UND SCHLUSSFEIERN VON ATHEN
BIS MÜNCHEN
125
4.1 Athen 1896 ...125
4.1.1 Festliches außerhalb des Stadions als Vorläufer gegenwärtiger
,,künstlerischer Darbietungen" ...130
4.1.2 Hymnen von Athen: Olympische Pflichtmusik bis heute ...133
4.1.2.1 Die griechische Königshymne ...133
4.1.2.2 Die "Olympische Hymne" von Palamas und Samaras...137
4.2 Paris 1900...149
4.3 St. Louis 1904 ...151
4.4 London 1908 ...154
4.5 Stockholm 1912...165
4.6 Antwerpen 1920 ...177
4.7 Paris 1924...194
4.8 Amsterdam 1928 ...207
4.9 Los Angeles 1932...221
4.9.1 Exkurs: Olympische Hymne von Walter Bradley-Keeler...236
4.9.1.1 Zur Identität des Komponisten...236
4.9.1.2 Zur Rezeption der Hymne...239
4.10 Berlin 1936...248
4.10.1 Zum Verhältnis von Carl Diem und Baron de Coubertin ...250
4.10.2 Zum Musikdargebot ...260
4.10.2.1 Friedensgeläut ...269
4.10.2.2 Triumphale Begrüßung des deutschen Staatsoberhauptes ...269
4.10.2.2.1 Fanfaren...270
4.10.2.2.2 Wagners ,,Huldigungsmarsch" ...276
4.10.2.2.3 ,,Doppelhymne"...278
4.10.2.3 Preußens Märsche zum Einzug der Mannschaften...282
4.10.2.4 Weihemusik im kultischen Kernritual...291
4.10.2.4.1 Händels ,,Halleluja"...291
4.10.2.4.2 Die Olympische Hymne von Lubahn/Strauss ...294
4.10.2.4.2.1 Zur Textentstehung ...294
4.10.2.4.2.2 Zur Vertonung...301
4.10.2.5 Diems Festspiel ,,Olympische Jugend" - ein ,,spectacle
approprié"?... 309
4.10.2.5.1 Zum olympischen Geist des Entwurfs ,,Sieg der Jugend" .. 313
4.10.2.5.2 Zum Problem der Textänderungen... 320
4.10.2.5.3 Zum ,,Olympischen Hymnus", dem Chorfinale der IX.
Symphonie Ludwig van Beethovens ... 335
4.10.3.6 ,,Spiele sind aus" musikalische Bedenklichkeiten der
Schlußfeier... 344
4.11 London 1948 ... 352
4.11.1 Olympische Hymne ,,Non Nobis, Domine" von Kipling/Quilter... 360
4.11.2 Londons Abschiedslied... 369
4.11.3 Diems Festkritik... 374
4.12 Helsinki 1952 ... 377
4.12.1 Olympische Hymne von Lyy/Linjama... 382
4.12.2 Zum finnischen Andachtsnimbus ... 388
4.12.3 Sibelius` Zutat zur Schlußfeier ... 390
4.12.4 Westdeutsche Stimmen zum Fest ... 393
4.13 Melbourne 1956 ... 400
4.13.1 Zur Eröffnungsfeier... 401
4.13.2 Zur Schlußfeier ... 405
4.13.3 Exkurs: Die Geschichte der Olympischen Hymne von 1956 ... 410
4.13.3.1 Zur Vorgeschichte der IOC-Entscheidung... 412
4.13.3.2 Prince Pierre contra Lord Burghley: der Textstreit... 422
4.13.3.3 Spisaks Komposition: eine teure musikalische Sternschnuppe . 439
4.13.3.3.1 Zum internationalen Komponistenwettbewerb... 440
4.13.3.3.2 Das Desaster um die Urheberrechte... 448
4.14 Rom 1960... 466
4.14.1 Hymnische Bemühungen... 469
4.14.2 Zum Problem der Verträglichkeit von Feierlichkeit und Spektakel. 473
4.15 Tokio 1964 ... 477
4.16 Mexiko-Stadt 1968... 501
4.16.1 Zur Eröffnungsfeier... 504
4.16.2 Zur Schlußfeier ... 512
4.17 München 1972...519
4.17.1 Münchens Bewerbung als Olympia-Stadt...522
4.17.2 Der Prozeß der musikalischen Gestaltung der Festfeiern...535
4.17.2.1 Zur Arbeit von mit Festmusik befaßten Gremien...541
4.17.2.1.1 Reformimpulse aus dem Arbeitskreis Sport und Kultur im
Beirat des DSB...543
4.17.2.1.2 Der Kunstausschuß...553
4.17.2.1.3 Das sogenannte Komponistentreffen...565
4.17.2.1.4 Der sperrige Arbeitskreis Musik...570
4.17.2.1.5 Die vorläufige Arbeitsgruppe für die Eröffnungs- und
Schlußfeier: Umsetzung der Anti-Berlin-Option in Münchener
"Reform"-Drehbücher ...577
4.17.2.1.5.1 Zur 1. Sitzung: Zielvorgaben und erste Vorschläge...587
4.17.2.1.5.2 Zur 2. Sitzung: Merkwürdigkeiten in und um
Ummingers Drehbuch-Entwurf...589
4.17.2.1.5.3 Zur 3. Sitzung: Detailerörterung ...608
4.17.2.1.5.4 Zur 4. Sitzung: Not an Musikverstand ...611
4.17.2.1.5.5 Zur 5. Sitzung: Erörterungen zum
Schlußfeierkonzept...616
4.17.2.1.5.6 Zur 6. Sitzung: Killmayers befruchtende Mitarbeit ...619
4.17.2.1.6 Zu den gebilligten Konzepten...625
4.17.2.2 Zum Werden einzelner Musikstücke bzw. -segmente ...633
4.17.2.2.1 Einzugsmusik im Edelhagen-,,Sound"...634
4.17.2.2.2 Olympische Fanfare von Rehbein...647
4.17.2.2.3 Goodmans Neufassung der Olympischen Hymne ...654
4.17.2.2.4 ,,Goaßlschnalzen" als politisches Problem...660
4.17.2.2.5 Orffs ,,Gruß der Münchener Schuljugend" ...666
4.17.2.2.6 Killmayer: Komponist für das Unpathetisch-Feierliche ...669
4.17.2.2.6.1 Ankunft, Entzündung und Verlöschen des
Olympischen Feuers...671
4.17.2.2.6.2 Alphornblasen...676
4.17.2.2.6.3 Musik zu Pienes ,,Regenbogen" ...677
4.17.2.2.7 Pendereckis ,,Ekecheiria"...682
4.17.2.2.8 Glockenspiel...687
4.17.3 Zum Attentat und seinen Folgen... 690
4.17.4 Zum Verkauf der Fernsehrechte ... 696
4.17.5 Zur Rezeption der Münchener Eröffnungsfeier... 699
4.17.6 Verlust von Festwürde, Gewinn von Marktwert als Folgen der
Münchener Reformstrategie... 703
4.17.7 Schlußbemerkungen zum Münchener Festkonzept ... 710
QUELLEN- UND LITERATURVERZEICHNIS
715
1 Archivalien
715
2 Zeitungen und Zeitschriften
716
3 Monographien und Aufsätze
717
4 Herkunft der Abbildungen im Text
732
ANHANG
ABKÜRZUNGEN
AAF
Amateur Athletic Foundation of Los Angeles
ABC
Avery Brundage Collection
ASCAP
American Society of Composers, Authors and Publishers
BOA
British Olympic Association
BR
Bayerischer Rundfunk
BRD
Bundesrepublik Deutschland
CDI
Carl-Diem-Institut an der Deutschen Sporthochschule Köln
CDU
Christlich-Demokratische Union
CSU
Christlich-Soziale Union
DDR
Deutsche Demokratische Republik
DHfL
Deutsche Hochschule für Leibesübungen
DOG
Deutsche Olympische Gesellschaft
DSB
Deutscher Sportbund
DSBfA
Deutsche Sport-Behörde für Athletik
DSHS
Deutsche Sporthochschule Köln
GEMA
Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische
Vervielfältigungsrechte
FAZ
Frankfurter Allgemeine Zeitung
FDP
Freie Demokratische Partei
ICOSH
International Committee of Sport History
IOC
International Olympic Committee (Internationales Olympisches
Komitee)
NOK
Nationales Olympisches Komitee
NPD
Nationaldemokratische Partei Deutschlands
NSDAP
Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei
OB
Oberbürgermeister
OK
Organisationskomitee
SPD
Sozialdemokratische Partei Deutschlands
WDR
Westdeutscher Rundfunk
VORWORT
Wissenschaftliche Untersuchungen auf dem weitgehend noch unbeackerten Feld
der im Rahmen der Olympischen Spiele der Neuzeit aufgeführten Musik wären
beträchtlich erleichtert worden, hätte man an zentraler Stelle zurückgreifen
können auf eine Art von Partiturenkataster sowie eine stehende Sammlung der
Regie-Entwürfe letzter Hand bzw. der Drehbücher der Eröffnungs- und
Schlußfeiern, soweit solche im Laufe der nunmehr über hundertjährigen
Geschichte der Gestaltung moderner olympischer Festfeiern erstellt worden sind.
Dies steht bis heute aus.
Im Partiturenkataster sollten sämtliche gespielten Musikstücke in Notation und
Text mit Kurzbiographien über Komponisten und Textdichter sowie Grunddaten
über die Besonderheiten ihrer olympischen Aufführung hinsichtlich Arrangement,
beteiligter Interpreten, Produzenten u. ä. ordentlich zusammengestellt sein. Mittels
der Regiebücher gewönne man relativ zuverlässig Auskunft über den
festzeremoniellen Kontext, in dem die betreffende Musik zum Zuge gekommen
ist. Solche Dokumentationen an zentraler Stelle, etwa am Sitz des IOC in
Lausanne, kämen den Versuchen um eine sachgerechte Beschreibung der
Festmusikentwicklung sehr zugute. Als Angebot zu einer schnellen ersten
Orientierung wären sie auch für die Planung zukünftiger musikalischer
Festszenarien von unmittelbar praktischem Wert.
Die seit den Spielen von Athen 1896 von den jeweilig verantwortlichen
Organisatoren herauszugebenden Offiziellen Abschlußberichte sind zwar in den
Bibliotheksbeständen der Nationalen Olympischen Komitees der ehemaligen
olympischen Gastgeberländer ebenso wie in renommierten Hochschulbibliotheken
mehr oder weniger vollständig - vorhanden und abrufbar. Sie bezeugen jedoch
die musikalische Seite der Eröffnungs- und Schlußfeiern in sehr unterschiedlicher
Weise: nie vollständig, häufig bewußt selektiv, immer mit höchstlöblicher
Intention. Sie müssen bis heute als Hauptquelle für erste Gesamtdarstellungen der
olympischen Festmusik herhalten.
Um sich tieferen Einblick in den Prozeß der Gestaltung der Festmusik bei den
Olympischen Spielen zu verschaffen, bedürfte es der Erstellung von
Monographien über die einzelnen Eröffnungs- und Schlußfeiern, die auf dem
Studium der Akten der jeweils befaßten Beratungs- und Entscheidungsgremien
fußen. Erst die Berücksichtigung der Ergebnisse einer ausreichenden Anzahl
fundierter Einzelbeschreibungen würde eine hinreichende Gesamtbewertung der
musikalischen Paradigmenwechsel ermöglichen. Eine solche Vorarbeit ist noch
nicht geleistet.
Auch die vorliegende Arbeit sieht sich lediglich als ein ergänzungsbedürftiger
Versuch der Erklärung der zurückliegenden Festmusikentwicklung. Völlig
unberücksichtigt mußten die Olympischen Winterspiele bleiben. Deren
musikalische Inszenierungen zu analysieren und ihre Entwicklung in Vergleich zu
setzen mit den hier vorgelegten Ergebnissen ist künftiger Kärrnerarbeit
überlassen.
Die Verfasserin hätte gern ein ruhiges Studium der Primärquellen in den Archiven
der olympischen Gastgeberländer betrieben. Die zerstreute Lage der relevanten
Aktenbestände, das Sprachen- bzw. Übersetzungsproblem, vor allem der nötige
Finanzierungsaufwand eines derartigen ,,Archiv-Ferntourismus" machten eine
solche ideale Option von vornherein unerfüllbar. Mit Hilfe eines Willi-Daume-
Stipendiums des NOK für Deutschland waren im Ausland aber
Bibliotheksrecherchen in London, Los Angeles, Atlanta und Colorado Springs
sowie in Lausanne möglich.
Die Quellensuche in relativ kurz bemessener Zeit vor Ort gestaltete sich im
Ergebnis recht unterschiedlich effizient, bei durchweg großer Hilfsbereitschaft der
Archivverwalter. Embargos verwehrten größtenteils Akteneinsicht zu Vorgängen
der letzten Jahrzehnte. Musikrelevante Hintergrundinformationen zu den
Festfeierkonzepten der ersten Jahrzehnte der modernen Olympischen Spiele
scheinen kaum archiviert. Ausgesprochen spärlich war die Ausbeute im
Olympischen Museum am Sitz des Internationalen Olympischen Komitees in
Lausanne. Der Rechercheaufenthalt auf amerikanischem Boden war insofern
ergiebiger, als Gespräche der Verfasserin mit Persönlichkeiten, die in die
musikalische Konzeptgestaltung jüngster Festfeiern involviert waren, hier und
dort einen Eindruck von Ereignissen hinter den Kulissen vermittelten.
Ungehetztes Aktenstudium war nur im Rahmen dessen möglich, was sich an
olympischem Quellenmaterial in Archiven und Bibliotheken in Deutschland
anbot, insbesondere im Carl-und-Liselott-Diem-Archiv der Deutschen
Sporthochschule Köln, im Bundesarchiv in Koblenz sowie im Stadtarchiv
München.
Das relativ übergewichtige Quellenmaterial zu den Berliner Spielen von 1936,
insbesondere aber zur Entwicklung des Musikkonzeptes für die Eröffnungs- und
Schlußfeier der Spiele von München 1972, bedingte eine unverhältnismäßig breite
Behandlung der Festmusik unter deutscher Verantwortung. Der Blick auf Werden
und Wert der übrigen Festmusikkonzepte mag dabei zu kurz geraten oder gar
getrübt worden sein. Die Verfasserin, wiewohl selbst Amerikanerin schottischer
Herkunft und Prägung, bittet darum, ihr die vielleicht zu sehr auf die deutschen
Musikkonzepte ausgerichtete Arbeitssicht nachzusehen. Sie selbst wünscht,
gerade dadurch zusätzlichen Anstoß für Anschlußarbeiten gegeben zu haben, die
den Blick auf die Entwicklungsgeschichte der modernen olympischen Festmusik
weiter schärfen helfen und gegebenenfalls neu ausrichten.
Die Verfasserin dankt ihren vielen hier ungenannten Helfern sehr herzlich.
Namentlich seien Klaus Kasperek und Martin Hanek erwähnt, die gerne mir zur
Seite standen, wenn technische Probleme zu lösen waren.
Ich danke Herrn Prof. Dr. Manfred Lämmer, der die Arbeit angestoßen hat und
mich in Phasen zwischenzeitlicher Resignation wiederholt zum Aushalten und
Weitermachen ermutigen konnte, und vor allem meinem Mann, der mir in
schwieriger Situation unentbehrliche Stütze und steter Antrieb war.
Köln, im Juli 2001
Elizabeth Schlüssel
1
1 ZU ZIELSETZUNG, METHODIK UND GLIEDERUNG DER ARBEIT
Die Arbeit ist im Grenzbereich zwischen Sport- und Musikwissenschaft
angesiedelt. Im Vordergrund steht jedoch das sporthistorische Interesse am
Musikdargebot und dessen außermusikalischer Wirkung.
Die Arbeit will keinesfalls die Fülle der dargebotenen Musikstücke einer
wertenden Einzelkritik unterziehen oder deren musikalisch-künstlerischen
Eigenwert abschätzen, etwa im Sinne von Hanslick das ,,wahrhafte Herz der
Musik, die in sich befriedigte Formschönheit"
1
in den Stücken zu entdecken
versuchen. Angesichts des herrschenden ,,ästhetischen Pluralismus"
2
und des
vorwiegend historischen Interesses würden vertiefte formästhetische
Interpretationsversuche mehr verwirren, als daß über die Funktion der
,,olympischen" Musik, über die Situationsgebundenheit der Aufführungswirkung
und die hinter der Werkauswahl stehenden Motive aufgeklärt würde.
3
Werkanalytische Ansätze machten Sinn bei den ,,primärolympischen"
Musikstücken, also jenen, die eigens für die jeweilige olympische Feier in Auftrag
gegeben und komponiert wurden. Diese im strengen Sinne eigentliche
,,olympische" Musik stellt bislang dem Umfange nach und aufs Ganze der
hundertjährigen Entwicklung gesehen noch den geringeren Teil der aufgeführten
Stücke dar. Neu geschaffene filmmusikartige Hintergrundbegleitung über weite
Strecken jüngster olympischer Festfeiersegmente hinweg gewinnt zwar zusehends
an Bedeutung. Bis ins letzte Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts herrscht jedoch
,,sekundärolympische" Musik vor, also solche, die einen Funktionswandel
insofern erfahren hat, als sie ursprünglich zu einem anderen als dem olympischen
Zweck kreiert wurde und von daher zunächst aus ihren originären
,,unolympischen" Entstehungs- und Sinnzusammenhängen zu verstehen wäre.
1 E. HANSLICK, Vom Musikalisch-Schönen, 18. Auflage, Wiesbaden 1975, S. 92.
2V. KARBUSICKY, Empirische Musiksoziologie. Erscheinungsformen, Theorie und Philosophie
des Bezugs ,,Musik - Gesellschaft", Wiesbaden 1975, S. 164.
3 Auf die zeitbedingt unterschiedlichen Ansätze zur Definition von Kunst weist LISSA hin: ,,Jede
Ästhetik ist die Ästhetik der betreffenden historischen Periode, sie wendet die ihr eigenen
Kriterien an, stellt die ihr eigenen Fragen" (Z. LISSA, Aufsätze zur Musikästhetik, Berlin 1969, S.
2
Wenn die Frage nach der gesellschaftlichen Funktion bestimmter olympischer
Musiken gestellt wird, so bleibt bewußt, daß der hörerdifferenzierte Nachweis
besonderer intendierter Wirkungen nicht geliefert werden konnte. Hierzu hätte
man empirische musiksoziologische Fallstudien zu einzelnen Festfeiern benötigt,
die unseres Wissens nicht existieren oder nicht veröffentlicht sind.
Aktuelle journalistische Musikkritik in der Tagespresse stellt eine wertvolle
Quelle zur Wirkungsgeschichte der Festfeiern dar, zumal wenn sie aus
exponiertem, seriösem Hause stammt, dessen Berichterstattung für gewöhnlich
nicht zu Oberflächlichkeit und blindgläubiger Multiplikation der mit
vorauseilendem Selbstlob befrachteten Vorabinformationen neigt, die neuerlich
von den Presse- und Public-Relations-Abteilungen der olympischen
Organisationskomitees kurzfristig vor Festbeginn als Kommentierungshilfen
verteilt werden.
Rezeption und Bewertung durch die bestallten Medienvertreter des Sports
repräsentieren nicht alle Empfänger- und Bewertungsebenen. Die Erwartungs-
und Verständnishorizonte der Fest- und Festmusikrezipienten sind sehr
unterschiedlich. Die sportjournalistische Festberichterstattung kann und will in
der Regel auch nicht als Ausweis eines gefestigten künstlerischen Sachverstandes
gelten. Der unmittelbar miterlebende Sportler und Zuschauer im besonderen Flair
eines Olympia-Stadions empfängt und verarbeitet die Stadionmusik anders als die
nationalen und internationalen Rundfunkhörer und Fernsehzuschauer, denen ein
vorgefiltertes selektives Hör- und Schauerlebnis ins Wohnzimmer übertragen
wird. Um wieviel kritischer als die Masse der ,,Laienkonsumenten" einer
olympischen Festfeier mögen Fachleute aus dem Bereich von Musik und
Musiktheater oder Sporthistoriker in rückschauendem Vergleich olympische
Festfeiern verfolgen.
Angesichts der enormen ökonomischen Erwartungen, welche derzeit mit der
weltweiten Fernsehübertragung von Olympischen Spielen, insbesonders mit einer
54). - Die ausufernde Zahl der Teilästhetiken der Moderne vergrößert die bezeichnete Problematik
3
die nachfolgenden Zuschauerquoten stimulierenden ,,erfolgreichen"
Eröffnungsfeier, verbunden sind, darf nach der Unabhängigkeit und kritischen
Substanz der begleitenden Fernsehkommentierung gefragt werden. Deutliche
musik- bzw. showkritische Anmerkungen gegen das im olympischen Geschäft
engagierte Hausinteresse des Fernsehens (samt involvierter Produktwerbung)
waren von dieser Seite bei dieser Gelegenheit nicht zu erwarten. Kommentierung
solcher Art käme am Beginn des olympischen Festes dem Schlechtreden des
gesamten nachfolgenden Ereignisses gleich, wäre ökonomisch kontraproduktiv
und gefährdete damit den Ruf der gegenwärtigen olympischen Festshows als
einträgliche telegene Selbstläufer. Die weitgehende Außerachtlassung
festfeierbegleitender Fernsehkommentare in der vorliegenden Arbeit trägt dieser
Einschätzung Rechnung.
In strengem ,,Kausalnexus"
4
von der Musik selbst, hier von der
primärolympischen Festmusik, auf die Weltanschauung ihres Komponisten oder
die realen politischen, sozialen und ökonomischen Verhältnisse einer
Gesellschaft, in vorliegendem Falle also der Gesellschaft des Landes der
Ausrichterstadt der jeweiligen Spiele, rückschließen zu wollen, war nicht
beabsichtigt.
In seiner Symbolsprache kann ein Musikstück auf Außermusikalisches zwar
verweisen, dessen vermeintliche Realität jedoch nicht abbilden. Die Reduzierung
des Musikverständnisses auf einen sozio-ökonomischen Determinismus verfehlte
die Komplexität des künstlerischen Schaffungsprozesses, das ,,breite und
dynamische Feld von Bezügen, Spannungen, aufgefangenen Einflüssen, Ideen",
aus dem heraus ein Werk entsteht.
5
Bestenfalls einen vagen Eindruck vom
Bezügegeflecht im Schaffensprozeß des einen oder anderen olympischen
Musikstücks will die vorliegende Arbeit geben. Die Gelegenheit, das Kräftespiel
hinter der Zielbestimmung sowie den Mechanismus der Entwicklung des
zusätzlich.
4 Dieser Begriff und ein anknüpfender ähnlicher Gedankengang finden sich bereits in:
HANSLICK, Vom Musikalisch-Schönen, S. 82.
5 V. KARBUSICKY, Musikwerk und Gesellschaft, Wien 1977, S. 19.
4
musikalischen Gesamtkonzeptes näher zu beleuchten, wurde wahrgenommen, wo
ausreichendes Quellenmaterial zur Verfügung stand.
Die Arbeit versucht, sich auf zwei methodischen Wegen der Wahrheit um
Funktion und Wirkung olympischer Festmusik zu nähern. Der eine Weg ist der
der spekulierenden literarischen Interpretation mit dem Ziel, bestimmte
olympische Musikstücke, die in Partitur und/oder Text vorlagen, gleichsam aus
sich selbst sprechen zu lassen und die potentielle Wirkung ihrer Klang- und
Wortbotschaften im Kontext des olympischen Festrituals abzuschätzen.
Dieser Weg ergänzt den der historischen Beschreibung und Analyse vielfach und
erschien besonders dort lohnend, wo der Zugriff auf wesentliche Quellen der
Entstehungs- und Rezeptionsgeschichte erschwert oder verwehrt war.
Es machte die Crux, aber auch den besonderen Reiz der Arbeit aus, daß die
Gradwanderung zwischen den Fachgebieten Grenzüberschreitungen implizierte.
Das ,,,historische Begreifen` und das ,ästhetische Beurteilen` [sind] verschiedene
Dinge"
6
, beide aber waren bei der Erklärung von außermusikalischen
Musikwirkungen hilfreich.
Im Wechsel der methodischen Ansätze von literarischer Reflexion und historisch-
analytischer Quellenverarbeitung eröffneten sich provozierende Fragestellungen
insbesondere hinsichtlich der Glaubwürdigkeit des von olympisch-
institutionalisierter Seite artikulierten Anspruchs, Hüter des sogenannten ,,wahren
Olympischen Geistes" zu sein.
Widerspruch und Unsicherheit in IOC und OKs der Olympischen Spiele im
Umgang mit der ideellen Erbschaft Pierre de Coubertins begleiten die
hundertjährige Geschichte der musikalischen Festfeierinszenierung auf höchster
Verantwortungsebene. Auf solche Ungereimtheiten hinzuweisen und Anstoß zu
deren weiterer wissenschaftlichen Aufarbeitung zu geben, ist ein Anliegen der
Verfasserin, die nicht zuletzt einen Beitrag zur Vitalisierung des ,,modernen"
6 HANSLICK, Vom Musikalisch-Schönen, S. 82f.
5
Olympischen Gedankens im Vollzug künftiger olympischer Eröffnungs- und
Schlußfeiern leisten möchte.
Die vorliegende Arbeit besteht aus drei Hauptteilen unterschiedlichen Umfangs
mit jeweils besonderem Blickwinkel des Interesses, aber mit der gemeinsamen
Zielsetzung, die erklärende Beschreibung der Entwicklung moderner olympischer
Festmusik auf ein festeres und breiteres Fundament zu setzen, als dies in der
bisher veröffentlichten Literatur der Fall war.
Der erste Teil ist ein Rekurs auf das antike griechische Musikverständnis und
dessen Rezeption in neuhumanistisch orientierten Kreisen des 19. und frühen 20.
Jahrhunderts, aus deren Antiken- bzw. Griechenlandbegeisterung der modernen
Olympischen Bewegung, vor allem den Berliner Spielen von 1936, gewisse
Impulse zuflossen.
Der zweite Teil beschäftigt sich mit dem Einfluß der musikalischen
Geschmackspräferenzen Pierre de Coubertins auf olympische Festfeiern und die
Entwicklung des Festprotokolls, außerdem mit der Forderung des Barons, die
festliche Gestaltung der von ihm gegründeten modernen Olympischen Spiele auf
unverwechselbare Art Ausdrucks- und Fördermittel seiner visionären
Olympischen Idee sein zu lassen.
Der dritte, umfangreichste Teil behandelt in chronologischer Abfolge das
musikalische Dargebot der Eröffnungs- und Schlußfeiern der Olympischen Spiele
von Athen 1896 bis München 1972. Er bemüht sich um eine möglichst
vollständige Dokumentation der aufgeführten Musikstücke, um Erhellung der
Funktionszuweisung der Festmusik, um den Blick auf das Wirkpotential der
aufgeführten Musiknummern im zeremoniellen und situativen Kontext.
Wo es im Rahmen der Festmusikentwicklung geboten schien und zudem der
Zugriff auf Primärquellen dies möglich machte, wird - wie etwa im Falle der
Spiele von München 1972 - versucht, beispielhaft den gesamten komplexen
Gestaltungsprozeß nachzuzeichnen. Einige Festfeiern werden eingehender als
andere behandelt, wenn in ihnen Akzente gesetzt wurden, die eine bestimmte
6
Richtung oder Richtungsänderung der Zweckbestimmung der Festmusik
markieren oder signalisieren.
Die Entstehungsgeschichte und die Umstände der Aufführung der Olympischen
Hymnen erfahren wegen ihrer Verweisfunktion auf die olympisch-ideelle
Befindlichkeit bzw. Motivation der jeweilig verantwortlichen Festgestalter
vertiefte Beachtung und kritische Bewertung. Der Streit um die Spisak-Hymne
bot Anlaß zu einem ausgedehnten Exkurs im Rahmen der Darstellung der
Festmusik der Spiele von Melbourne 1956.
7
2 ÜBER MUSIK UND MUSIKVERSTÄNDNIS IM ANTIKEN
GRIECHENLAND UND DEREN NEUZEITLICHE REZEPTION
Altsprachlich-humanistische Bildung war im gehobenen europäischen Bürgertum
des 19. Jahrhunderts hochgeschätzt. Ein ausgeprägter Philhellenismus
7
, der weit
in die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts hinein fortwirkte, äußerte sich in der
herausragenden Wertschätzung antiker Kunst und Kultur. Besonders einflußreich
war die humanistische Orientierung etwa in Staaten wie dem Deutschen Reich,
Frankreich und Großbritannien, die im politischen Bereich vielfach konkurrierten
und denen Erfolge bei der Wiederentdeckung und Ausgrabung antiker
Kulturstätten nicht unwillkommenen nationalen Prestigegewinn bedeuteten.
Ob bewußt und gegebenenfalls mit welcher Intensität in der hektischen
Vorbereitungsphase zu den ersten Olympischen Spielen 1896 wie in der
Zeitspanne der nächstnachfolgenden olympischen Festfeiern seitens der
Organisatoren eine Suche nach verwertbarem antik-musikalischen und antik-
musiktheoretischen Vorbildgut betrieben wurde, soll hier nicht erörtert werden.
Die Frage nach der Rezeption antiken bzw. für antik gehaltenen Musikgutes und
antiker Musiktheorie im Zuge der Festfeierplanungen kann man jedoch nicht ganz
vernachlässigen, weil deren zumindest indirekter Einfluß sich unüberhörbar in der
Festmusik des olympischen Zeremoniells niedergeschlagen hat.
Dem besseren Verständnis der Entwicklung der musikalischen Gestaltung der
neuzeitlichen olympischen Festfeiern ist es dienlich, sich in einem kurzen
Rückblick bestimmter Kenntnisse altgriechischer Musik und altgriechischen
Musikverständnisses zu vergewissern.
7 Dieser Philhellenismus ging so weit, daß ,,Griechheit" und ,,Menschheit" synonym gesetzt
wurden. Spranger weist auf ein solches Charakteristikum des Neuhumanismus in Deutschland hin:
,,Aus der Vermählung des antiken Geistes mit dem modernen sollte der neue Mensch geboren
werden, der wahre Mensch; denn die Griechen erschienen als die Menschen schlichtweg, und
,Griechheit` gleichbedeutend mit ,Menschheit` " (E. SPRANGER, Das humanistische und das
politische Bildungsideal im heutigen Deutschland, Leipzig 1916, S. 9).
8
Daß Musik bei Panhellenischen Spielen als Wettkampfdisziplin oder zumindest -
wie in Olympia - als begleitendes Festelement eine bedeutende Rolle gespielt
hatte, stand zu Beginn der modernen olympischen Entwicklung außer Zweifel. Zu
fragen blieb, um was für eine Art von Musik es sich handelte und ob es sich
lohnte, ihr bei den modernen Olympischen Spielen zu neuem Klang zu verhelfen.
Hier tat sich ein Dilemma auf. Die Altertumsforschung um die Jahrhundertwende
hätte diesbezüglich Nachfragenden keine konkrete Klangvorstellung antiker
Musik vermitteln können, die auch nur annähernd einen authentischen Eindruck
abgegeben hätte. Daran hat sich bis heute im wesentlichen nichts geändert.
Läßt sich nach dem bisherigen Wissenstand übereinstimmend festhalten, daß die
griechische Musik in ihren Melodien, Harmonien und Tonarten von der
neuzeitlich abendländischen gänzlich verschieden gewesen ist, so lieferte die
Musikwissenschaft jedoch eine Menge an Informationen musiktheoretischer Art,
die Aufschluß darüber gaben, was man in der Antike von der Musik erwartete,
welche Wirkungen man ihr zuschrieb, welche Funktionen man ihr auftrug. Sie
zeigte zudem, daß Musikverständnis und Musikgeschmack von der archaischen
über die klassische zur hellenistischen Zeit einem steten Wandel unterworfen
waren.
Heute gelten die musiktheoretischen Reflexionen z. B. eines Pythagoras, Platon,
Aristoteles, Demokrit, Philodemos als weitgehend aufgearbeitet. Die antike
Musikdiskussion entpuppt sich danach als durchaus kontrovers, in entscheidenden
Positionen der modernen Kunstdiskussion ähnlich und insofern als erstaunlich
aktuell. Aktuell auch hinsichtlich unserer Thematik, stellten doch
Auffassungsunterschiede über das moderne Kunstverständnis unseres Erachtens
einen nicht unerheblichen Grund für das Scheitern der Olympischen
Kunstwettbewerbe bei den neuzeitlichen Olympischen Spielen (1912 - 1948) dar.
Manche Kritik an der musikalischen Ausgestaltung der modernen olympischen
Festfeiern berührt die bereits in der Antike kontrovers beantwortete
Grundsatzfrage nach der Funktionalität von musischer Kunst.
9
2.1 Zur Musik im archaischen und klassischen Griechenland
Die Musik der alten Griechen ist für immer verschollen und verklungen: ,,Alles,
was wir über Musik bei den Griechen wissen, ist nur mittelbar: musiktheoretische
Werke, Andeutungen der Dichter und Schriftsteller, Bilder auf Vasen, auch
Reliefdarstellungen".
8
Uns unmittelbar überkommen ist griechische Dichtung. Georgiades sieht die
Sprache bei den Griechen bis etwa Ende des 5. Jahrhunderts v. Chr. durch den
Rhythmus zu einer unlöslichen Einheit mit der Musik verknüpft.
9
Das
Aufeinanderbezogensein und Zusammengehören von sprachlicher Botschaft und
rhythmisch-musikalischer Gestalt stellten demnach ein essentielles Merkmal der
altgriechischen Musik dar.
Zaminer konstatiert ebenso bis zur klassischen Zeit einen ,,noch ungeteilten
Sinnträger", eine ,,rhythmisch ausgeprägte Singsprache [...], die sich bald mehr
durch Musik und bald mehr durch Tanz stützen und verwirklichen ließ".
10
Griechische Dichter seien insofern stets auch Musiker gewesen.
11
Die
Fremdartigkeit dieser Musikkultur, die dem heutigen Geschmack ,,ferner denn
je"
12
erscheine, zeige sich unter anderem darin, daß sie ,,im Prinzip über die
Einstimmigkeit nicht [...] hinausging, auch nicht im Chorgesang und im
Zusammenwirken mit Instrumenten".
13
Begleitet wird die musikalische Entwicklung dieser Zeit von einem langen
Weg des Denkens über Ursprung und Wesen der Musik, ,,von den Musen der
Frühzeit, die das ,Singen und Sagen` in die Welt brachten, über die klassische
8 T. GEORGIADES, Musik und Rhythmus bei den Griechen, Hamburg 1958, S. 8f.
9 GEORGIADES, S. 7.
10 F. ZAMINER, ,,Musik im archaischen und klassischen Griechenland", in: A. RIETHMÜLLER/
F. ZAMINER (Hrsg.), Die Musik des Altertums (= Neues Handbuch der Musikwissenschaft, Bd. I,
hg. v. C. DAHLHAUS), Laaber 1989, S. 115.
11 ZAMINER, S. 122.
12 ZAMINER, S. 123.
13 ZAMINER, S. 114.
10
Musiké, die noch Poesie, Musik und Tanz umfaßte, [...] zur nachklassischen
Musiké in der doppelten Bedeutung von ,Musik` und ,Musiklehre`".
14
Daß Poesie und Gesang göttlichen Ursprungs seien, war in der Antike fester
religiöser Glaube.
15
Im Kreise der Olympischen Götter sind die Musen nach der
homerischen Ilias (2, 598) ,,Töchter des Zeus", denen vorbehalten sei, ,,Sänger"
zu berufen.
16
Hesiod (um 700 v. Chr.) nennt die Musen beim Namen.
17
Den
einzelnen Musen kommen demnach bereits Funktionen zu, die der Musik bis
heute zugesprochen werden können: jene des Heldenlobs und Ruhmverkündens
(Klio), des Freudebringens und Stimmunghebens (Thalia), der Tanzbegleitung
(Melpomene und Terpsichore), der transzendierenden Selbstüberschreitung
(Urania) oder einfach der rein ästhetischen, stimmlich-klanglichen Faszination
(Kalliope).
Es verwundert daher kaum, wenn die so von den Musen berufenen Poeten und
Sänger bei jenen festlichen Gelegenheiten, wo den Göttern gehuldigt wurde, eben
zu Ehren dieser Gottheiten sich ihrer göttlichen Berufung würdig erwiesen und
,,sangen", sei es nun in Verbindung mit Musenkulten oder im Rahmen der aus
Anlaß des Festtages dem Gott zur Ehre abgehaltenen musischen Agone.
Es gab verschiedene Traditionen des Singens und der Gesänge: die ,,Tradition des
Epos", die der ,,sogenannten Lyrik" und die quantitativ wahrscheinlich
überwiegenden Traditionen des ,,Altüberlieferten [...] zumal im religiösen und
kultischen Bereich".
18
Aus der Masse der letzteren werden sich als Götterweisen
14 ZAMINER, S. 113.
15 ZAMINER, S. 165.
16 Ebenda.
17 ,,Klio bewirkt, daß der Gesang und zumal das Heldenlied den Ruhm[...] kündet; Euterpe, daß
das Lied den Hörer erfreut [...]; Thalia knüpft die Poesie an das Fest; Melpomene und Terpsichore
verbinden sie mit Musik und Tanz; Erato erweckt das Verlangen nach Dichtung unter den
Menschen; Polyhymnia schafft reiche Abwechslung; Urania hebt den Gesang über das
Menschliche hinaus; Kalliope aber [...] sorgt für die schöne Stimme beim Vortrag des Gedichtes"
(B. SNELL, Die Entdeckung des Geistes, Hamburg 1955, S. 66).
18 ZAMINER, S. 124.
11
die Hymnen und andere Gesänge zu Opferhandlungen besonders abgehoben
haben.
19
Der epische Sänger ist erst in der zweiten Hälfte des 8. Jahrhunderts ,,auf der
kritischen Spätstufe einer Sängertradition [...], verkörpert in der Gestalt
Homers"
20
faßbar.
In diese Zeit fällt auch die junge Tradition der antiken Olympischen Spiele in Elis
(seit 776 v. Chr.). Das typische Instrument des Sängers war die Phorminx bzw.
Kitharis (eine Art vierseitiger Leier).
21
Den hohen gesellschaftlichen Rang der
musikalischen Talente scheinen die Ilias-Verse (13, 730f) zu belegen, in denen
Gesang und Kitharisspiel in eine Reihe mit dem Kampf gestellt sind:
,,Einem hat wohl ein Gott die Gabe des Kampfes verliehen,
Jenem den Reigen, diesem Gesang und das Kitharisspielen."22
Homer bezeugt in der Odyssee (8, 261ff.) den Sänger Demodokos, der mit seiner
Phorminx sowohl singt als auch zum Reigentanz aufspielt:
,,Und sie stampften den göttlichen Reigen. Aber Odysseus
Sah voll stiller Bewunderung das Glänzen und Schimmern der Füße.
Aber der Phorminx-Spieler hub an mit dem schönen Gesange ..."23
Neben dem epischen Gesang erwähnt Homer andere Gesangsgattungen wie
Hochzeitslied, Totenklage, Chorlieder und Hymnos, Formen, die in
19 ZAMINER, S. 125.
20 Ebenda.
21 Es handelt sich hier um zwei verschiedene Namen für das gleiche Instrument. - Zu den
wichtigen Musikinstrumenten der homerischen (und damit auch der frühen ,,olympischen") Zeit
gehörten zudem als Blasinstrumente der Aulos (der heutigen Oboe verwandt), besonders geschätzt
wegen der Ähnlichkeit seines Klanges mit dem der menschlichen Stimme, sodann die Syrinx
(Panflöte) als Hirteninstrument und die Salpinx (altgriech. Trompete mit einem bronzenen oder
eisernen langgestreckten Rohr, einem glockenförmigen Schalltrichter und einem eingesetzten
Mundstück aus Horn) als metallisches Signalinstrument (vgl. ZAMINER, S. 130).
22 GEORGIADES, Musik und Rhythmus, S. 75.
23 GEORGIADES, S. 73.
12
frühgeschichtliche Zeiten hinaufreichen.
24
An diese Traditionen knüpfte die
griechische Lyrik als ,,gesungene Poesie und poetischer Gesang" an.
25
Üblicherweise unterscheidet man heute eine solistische Lyrik und eine chorische
(mit Tanz verbundene) Lyrik. Seit dem 7. Jahrhundert v. Chr. erfreute sich
besonders die instrumentale Begleitung des Sologesanges zunehmender
Beliebtheit in den Formen der Kitharodie (Gesang mit eigener Leierbegleitung)
und Aulodie (Gesang mit Begleitung durch einen Aulosspieler, mit dem der
Sänger zusammenwirken mußte).
26
Für die auf der Singsprache beruhenden Musenkunst der Griechen ist das 5.
Jahrhundert v. Chr. die Zeit des letzten Aufstiegs.
Pindar
27
, dessen antike Lobpreisung von Sieg und Sieger im athletischen
Wettstreit auch im Rahmen moderner olympischer Eröffnungsfeiern wiederholt
zitiert wird und hier - wie zu zeigen sein wird - kontrovers-programmatische
Bedeutung gewinnt, erweist in seiner 12. Pythischen Ode aus dem Jahr 490 v.
Chr. einem antiken Meister der musischen Kunst, dem Aulosspieler Midas von
Akragas, als einem Sieger in einem [nicht in Olympia durchgeführten!] musischen
Agon, seine Reverenz. Pindar preist das Aulosspiel und den von Midas
erfolgreich vorgetragenen ,,Nómos polyképhalos", die ,,Viele-Häupter-Weise".
28
24 ZAMINER, S. 133.
25 ZAMINER, S. 133f.
26ZAMINER sieht als Hintergrund für neue musikalische Aktivitäten, nämlich des
Aufeinandertreffens differenzierter Melodiemodelle, gebunden an die griechische Kithara
(,,kitharodische Nomoi"), mit jenen Gesangstypen, die an den als kleinasiatisch geltenden, ,,im
Zusammenhang mit Terpanders Neuerungen erstmals in artifiziellem Spiel verwendet[en] und
nobilitiert[en]" Aulos gebunden waren (,,aulodische Nomoi"), die seit dem 7. Jahrhundert v. Chr.
bezeugten musischen Agone (ZAMINER, S. 143 ). - Wahrscheinlich haben diese aus der
Konkurrenz, hier: dem Wettlauf zweier Instrumente um die Gunst des Publikums, wichtige
künstlerische Impulse empfangen.
27 Pindaros (etwa 518 446 v. Chr.), geboren in Theben, wurde von den Griechen hochgeehrt,
galt wie Simonides als griechischer Nationaldichter; Verfasser von Liedern zum Preise sportlicher
Sieger, Epinikien; es waren Chorlieder, die bei dem feierlichen Einzuge des Siegers in seine
Vaterstadt von Altersgenossen gesungen wurden. ,,P. bevorzugt schwere, majestätische Rhythmen.
Der dadurch erzeugten feierlich-ernsten, erhabenen Stimmung entspricht der strenge Aufbau der
Lieder." H. LAMER, Wörterbuch der Antike, Stuttagrt 1963, unter ,,Pindaros".
28 ZAMINER, S. 149. - Bei der ,,Viele-Häupter-Weise" handelt es sich nach Georgiades um eine -
besonders dem menschenstimmeähnlichen Klang des Aulos angepaßte und eine dem Mythos nach
von Athena erfundene - Modellweise, um ,,das herzzerreißende, lauttönende Wehklagen
13
Diesem preisgekrönten Aulos-Spiel würde man gerne einen ästhetischen und zu
Herzen gehenden sinnlich-schönen Reiz zusprechen wollen. Zumindest sollte sich
das agonistische Aulosspiel stark unterschieden haben von den den gymnischen
Agonen zugerechneten Wettkämpfen der Herolde und Trompeter.
29
Immerhin verweisen solche Herold- und Trompeterkonkurrenzen deutlich auf die
Funktion des dabei verwendeten Blechblasinstruments (Salpinx) als
Signalinstrument, dessen spezifisches Ton- bzw. Kurzmelodie-Signal
außermusikalischen, für gewöhnlich vorwiegend militärischen Zwecken diente.
Bemerkenswerterweise beschreibt Pindar nach Georgiades in der 12. Pythischen
Ode das Spiel der ,,Viele-Häupter-Weise" als eine ,,das Volk zum Wettkampf"
zusammenführende ,,Mahnerin".
30
Demzufolge kann man diese antike Weise als
agonale Erkennungs-Weise oder ,,akustischen Logos"
31
bezeichnen, dessen
Gebrauch nach dem pindarschen Mythos bereits in älterer - zumindest
frühklassischer - Zeit anzusetzen wäre. Der oboenartige Aulos, ,,das wichtigste
Blasinstrument der Griechen"
32
, ist folglich schon in hochklassischer Zeit als
zeremonielles Signalinstrument vorstellbar. Die besagte Weise könnte mithin als
eine Art Vorläuferin der modernen olympischen Erkennungsmelodien bzw.
olympischen Fanfaren gelten
33
.
darzustellen" und um ,,als ruhmvolle Mahnerin das Volk zu Wettkämpfen" zusammenzuführen
(GEORGIADES, S. 9f).
29 Ein solcher Wettkampf war bereits in spätklassischer Zeit bei den Spielen der 96. Olympiade
(396 v. Chr.) eingeführt worden (H. BENGTSON, Die Olympischen Spiele der Antike, 2. Aufl.,
Zürich/München 1983, S. 34f). Nach DECKER handelt es sich dabei ,,nicht etwa um musische
Disziplinen, wie sie z. B. in Delphi und in vielen anderen Orten der griechischen Welt
Bestandteile von Agonen waren, es ging lediglich darum, für die Ankündigungen und
Siegerehrungen denjenigen festzustellen, der die lauteste und gleichzeitig eine wohlklingende
Stimme hatte, sowie den besten Trompeter, der diesem assistierte, zu küren"(W. DECKER, Sport
in der griechischen Antike, München , S. 46). Vgl. auch: M. I. FINLEY / H. W. PLEKET, Die
Olympischen Spiele der Antike, Tübingen 1976, S. 93.
30 GEORGIADES, Musik und Rhythmus, S. 9.
31 KREBS sieht die ,,Epinikien, die olympischen Siegeslieder und Oden PINDARs, des
BAKCHYLIDES VON KEOS und dessen Onkel SIMONIDES" im Genre der Fanfaren für
Olympische Spiele ,,gewissermaßen als akustische[n] Logos" (H. D. KREBS, Zwischenspiele,
Schorndorf 1996, S. 1).
32 GEORGIADES, Musik und Rhythmus, S. 9.
33 Interessant ist in diesem Zusammenhang die Definition der ,,Fanfare ([...] wahrscheinlich von
arabisch anfár = Trompete)", worunter ,,im Französischen jede Art von Blechbläsersignal (z. B.
14
Abb. 1: Wettstreit des Apollon Kitharodos und des aulosblasenden Marsyas. Musenbasis von
Mantinea, praxitelisch, 3. Viertel 4. Jh. v. Chr. (Athen, Nationalmuseum)
Unabhängig davon, ob man der These vom Aulos in Verbindung mit der ,,Viele-
Häupter-Weise" als mythischer antik-agonaler Ur-Erkennungsmelodie und
Vorläufer neuzeitlich-olympischer Fanfarenmusik folgen mag, weist der
pindarsche Midas-Preis darauf hin, daß die Kunst der solistischen Interpretation
im Sinne des individuellen Ausdrucks vorgegebener Melodien bzw. melodischer
Schemata bereits in hochklassischer Zeit eine große Rolle spielte.
In diesem Zusammenhang beleuchtet Aberts Feststellung, daß im Altertum der
,,vortragende Künstler dem schaffenden durchaus ebenbürtig" gewesen und die
,,heutige scharfe Scheidung zwischen ,produzierendem` und ,reproduzierendem`
Künstler [...] ja eigentlich falsch" sei
34
, die Ausklammerung der reproduzierenden
musikalisch-solistischen Kunst aus den letztlich gescheiterten neuzeitlichen
auch Jagdsignal)" verstanden wird, eine Bedeutung, die im Zusammenhang steht mit der
,,ursprünglichen Funktion der Blechblasinstrumente, die im Mittelalter als Heroldsinstrumente aus
dem Orient übernommen wurden und vor allem höfisch-militärischen Zwecken dienten.
Entsprechend wurden in Frankreich und Italien seit dem 19. Jh. auch Militär- oder andere
Blechblaskapellen F. genannt" (M. HONEGGER/G. MASSENKEIL (Hrsg.), Das große Lexikon
der Musik, Freiburg 1992, unter ,,Fanfare").
34 H. ABERT, ,,Die Stellung der Musik in der antiken Kultur", in: Die Antike. Zeitschrift für
Kunst und Kultur des klassischen Altertums 2(1926)1, S. 138f.
15
Olympischen Kunstwettbewerben als eher ungriechisch und der Entwicklung der
künstlerischen Dimension der Olympischen Idee kaum förderlich.
35
Wenn Lenk etwa anregte, ,,Sieger der entsprechenden Wettbewerbe von ,Jugend
musiziert` (die bei den Olympischen Spielen ein Konzert geben könnten -
vielleicht sogar bei der Eröffnungsfeier spielen könnten)" in die moderne
olympische Festfeier zu integrieren, um diesen entsprechend der coubertinschen
Ideen von der Beteiligung von Kunst und Geist einen frischen, jugendlichen
Impuls zu geben, so steht er damit auf dem Boden antiker Tradition.
36
Zudem
dürfte die bevorzugte Berücksichtigung eines solcherart bestqualifizierten und
auserlesenen jugendlichen Interpretenpotentials bei der derzeitigen
Festfeiergestaltung ungleich preiswerter kommen als die Verpflichtung
weltberühmter Namensträger, deren Erscheinen durchaus nicht automatisch
Garantie für einen uneingeschränkten künstlerischen Genuß ist.
In den Chorliedern des attischen Dramas fanden die artifiziellen Bestrebungen
von Jahrhunderten einen rhythmisch besonders differenzierten Ausdruck. Chor
37
und chorische Gesänge gehören von Anfang an zur antiken Tragödie, deren
Ursprung ebenso wie der der Panhellenischen Spiele in rituell-religiösen
Festfeiern gesehen wird.
Die gegen Ende des 6. Jahrhunderts v. Chr. in Athen eingeführte Tragödie erlebt
ihren Höhepunkt im Rahmen der Großen Dionysien, dem athenischen
35 Hätte man solistische interpretatorische Qualität, ggf. auch Virtuosität, statt kompositorischer
Kreativität bei den Olympischen Kunstwettbewerben von 1924 zu beurteilen gehabt, wäre eine
Preisverleihung durch die damalige hochkarätig (u. a. mit Bartók, Ravel, Strawinsky, Widor)
besetzte Jury - unbeschadet aller zeitbedingt ideologisch-politischen Barrieren - an die ,,besten"
Musikinterpreten vielleicht eher möglich gewesen. Stattdessen mußte man sich die Unfähigkeit
eingestehen, aus den eingereichten Musikkompositionen wenigstens eine für preiswürdig erkennen
zu können. - Erinnert sei an die nationalistisch-emotional besonders aufgeladene Atmosphäre
zwischen Franzosen und Deutschen nach dem Ersten Weltkrieg, die sich aus Claude Debussys
Polemik wider den von deutscher Musik dominierten Geschmack lesen läßt, wenn er 1917
schreibt: ,,[...] wir haben ihn [unseren Geschmack, Anm. von mir] nur unter nordischen
Daunenbetten begraben. Er wird unsere beste Stütze sein im Kampf gegen die Barbaren, die viel
schrecklicher geworden sind, seit sie ihr Haar in der Mitte scheiteln" (C. DAHLHAUS/M.
ZIMMERMANN (Hrsg.), Musik zur Sprache gebracht, Kassel 1984, S. 341).
36 H. LENK, ,,Olympia wird nur leben, wenn es olympisch sein wird", in: Olympisches Feuer
42(1992)1, S. 9.
37 Choros bedeutet ursprünglich Tanzplatz, Schar von Sängern und Tänzern (ZAMINER, S. 143).
16
,,Frühlingsfest"
38
. Zur legendären Wirkung der attischen Tragödie im Theater, zu
ihrer ,,sinnlich-geistigen Unmittelbarkeit", trug das Musikalische, die ,,melisch
gestaltete Rede", wesentlich bei.
39
Gewisse Strukturelemente des griechischen Dramas scheinen großen
Festveranstaltungen bis auf den heutigen Tag eigen zu sein: das chorische
Strophenlied, die solistische Gesangspartie (Monodie), nicht zuletzt der feierlich-
musikalische Einzug der Hauptakteure oder der Honoratioren eines Festes,
ähnlich dem Einmarschieren
40
des antiken Chores bei der Tragödienaufführung in
die Orchestra, ,,gleichförmig" und ,,im Takt"
41
, singend, mit oder ohne
instrumentale Begleitung.
42
Sollten sich bei der festlichen Inszenierung der neuzeitlichen Olympischen Spiele
diesbezügliche Rückgriffe auf antike Traditionen nicht wie von selbst
aufgedrängt haben und das Wesen einer Eröffnungsfeier als eines großen kultisch-
religiös vorgeprägten Massenschauspiels bis heute mitbestimmen? Sollte die
Popularität dieser Inszenierung nicht einer tief im menschlichen Unterbewußtsein
verwurzelten archaisch-religiösen Affinität zuzuschreiben sein, die im Zuge eines
unbewußten Wiedererkennens archaisch-ritueller optischer wie akustischer
38 ZAMINER, S. 154. Wenn P. de Coubertin von den Olympischen Spielen als dem
,,Vierjahresfest des menschlichen Frühlings" spricht, wobei der menschliche Frühling sich im
,,jugendlichen Erwachsenen" ausdrücke (P. de COUBERTIN, Der Olympische Gedanke. Reden
und Aufsätze, Schorndorf 1967, S. 152), so drängen sich von diesem Sprachbild her Assoziationen
zum dionysischen Frühlingsfest und seinen Gesängen auf.
39 ZAMINER, S. 157.
40 Es gilt an dieser Stelle einem bei musikalischen Laien verbreiteten Irrtum entgegenzutreten, als
sei die Musikform des Marsches etwa beim Militär erfunden worden. Ebenso unangebracht - vom
rein musikalischen Standpunkt aus betrachtet - ist es, a priori Militärmusik, d. h. im Militärwesen
gebrauchte, von Militärkapellen gespielte Musik, worunter nahe liegend auch die musikalische
Form des Marsches zählt, als musikalisch minderwertig zu ächten. Dazu H. EICHBORN,
Militarismus und Musik, Berlin 1909, S. 27ff: ,,Die Erfindung und Ausbildung des Marsches hat
aber so gut wie gar nichts mit dem Kriegswesen zu tun, sondern ist nur die Anwendung schon
vorhandener Formen der Musik auf die Begleitung von Aufzügen und Märschen, sei es beim
Militär, sei es bei anderen Gelegenheiten. Zahllos sind die alten Tanzlieder und Tänze im
zweiteiligen wie dreiteiligen Rhythmus, nach denen es sich gut marschieren läßt. [...] Es ist auch
überhaupt nicht gelungen, dem Marsch ein festes unwandelbares Gepräge zu geben; vom
kriegerischen, ernsten, gravitätischen, feierlichen Wesen fiel er immer wieder ins Tänzelnde
zurück. [...] Märsche änderten sich eben wie die Töne und überhaupt alle Musikformen mit der
Musik ihres Zeitalters."
41 ZAMINER, S. 159.
42 ZAMINER, S. 161.
17
Signale auch in der scheinbar aufgeklärteren Neuzeit immer noch die Entstehung
einer Art von seelischer Massendevotion und geistiger Wehrlosigkeit begünstigt?
Wenn die Wirkung der Atmosphäre mancher moderner olympischer
Eröffnungsfeier von Anwesenden im Olympiastadion im nachhinein mit Worten
wie des ,,Übermannt-Seins", des ,,Gebannt-Seins", des ,,Gefesselt-Seins"
beschrieben wurde, drängen sich derartige Gedanken auf.
2.2 Antike Musikreflexion: Ethische und anti-ethische Musikauffassungen
Nach Abert glaubten die Griechen in klassischer Zeit noch an die ,,magische
Kraft" der Musik; sie galt als ,,Zaubermacht", die die Herzen der Menschen
,,hierhin und dorthin" zu lenken vermochte, als ,,Stimme übernatürlicher Mächte"
mit Herrschaft über das menschliche Leben.
43
Der vielfältige Einfluß der Musik
auf das emotionelle Befinden war augenscheinlich. Die Inanspruchnahme der
Musik bis hin als ,,Mittel zur Aufregung und Ekstase mit kathartischer, ja beinahe
exorzistischer Wirkung", ihre therapeutische Funktion, reicht in archaische Zeiten
zurück.
44
Der unheimlichen Macht der Musik versuchten die Griechen gedanklich auf den
Grund zu kommen. Riethmüller sieht in den erhaltenen antiken
musiktheoretischen Texten eine ,,zentrale Leistung", die ,,unzweifelhaft
Geschichte, Musikgeschichte gemacht hat"
45
. Dabei spielt die Zeitspanne von
etwa 100 Jahren zwischen der ersten Hälfte des 5. Jahrhunderts und der ersten
Hälfte des 4. Jahrhunderts v. Chr. eine besondere Rolle.
Ein als ,,Wertwandel begriffener Strukturwandel" in der Musik war mit dem
starken gesamtgeschichtlichen Wandlungsprozeß verbunden, der diese Periode
besonders kennzeichnete. Der musikalische Strukturwandel zeigte sich in einer
43 ABERT, ,,Die Stellung der Musik", S. 140.
44A. RIETHMÜLLER, ,,Musik zwischen Hellenismus und Spätantike", in: A.
RIETHMÜLLER/F. ZAMINER (Hrsg.), Die Musik des Altertums, Laaber 1989, S. 214.
45 ZAMINER, S. 207.
18
,,größere[n] Selbständigkeit des Musikalischen gegenüber der Einbindung der
Musik in ein polyästhetisches Ensemble (auf die der alte Begriff ,musiké` ja
zielte) und einem Erstarken des Solistischen (gegenüber dem Chorischen) und des
,Virtuosentums`".
46
Im regen philosophischen Disput über die Frage der Wertschätzung ,,alter" und
,,neuer" Musik stießen traditionell konservative Positionen, die alles Neue und
jeden Wandel beargwöhnen, mit vorgeblich progressiveren Standpunkten
zusammen, die geneigt sind, den Wert des Alten grundsätzlich zu negieren, wobei
in logischer Konsequenz das Neue schnell der revolutionären Dekadenz bezichtigt
wird.
47
Es handelte sich am Ende der klassischen Periode um eine Zeit des
kulturellen Umbruchs im antiken Griechenland, unserem zurückliegenden ersten
Jahrhundert seit Begründung der modernen Olympischen Spiele in vielem
verwandt.
Auch im nachchristlichen 20. Jahrhundert ist die Auseinandersetzung um das
künstlerisch Neue radikal aufgebrochen: etwa als Kontroverse zunächst um die
atonale Musik, später um die serielle und elektronische Musik, gegenwärtig um
die Musik der sog. Postmoderne, und als Grundsatzfrage, ob Kunst zweckfrei
oder funktional zu sein habe, schließlich als pädagogisch-didaktisches Problem,
welcher erzieherische Stellenwert welcher Musik im Rahmen der Gesamtbildung
zukommen könne.
Wieder spielten gegenseitige Vorwürfe musikalischer Dekadenz und ideologische
Ächtung bestimmter Musiken eine altvertraute wirkmächtige Rolle, die sich in der
musikalischen Ausgestaltung der neuzeitlichen olympischen Eröffnungs- und
Schlußfeiern niederschlagen sollten. In diesem Zusammenhang ist die Frage nach
dem Rezeptionsgrad eines antiken Musikverständnisses bei den verantwortlichen
Festgestaltern aufgeworfen, ob sie ihrer jeweiligen olympischen Festmusikwahl
etwa eine ethisch-pädagogische Bedeutung zumaßen oder eher nicht.
46 ZAMINER, S. 209.
47 ZAMINER, S. 207ff.
19
Mit Blick auf diese Fragestellung ist festzuhalten, daß Platon (427-347 v. Chr.)
unter den altgriechischen Philosophen als strikter Vertreter einer ethisch-
politischen und pädagogischen Auffassung von Musik gilt, wogegen etwa
Demokrit (ca. 460 - ca. 370 v. Chr.) für die anti-ethische Position streitet.
Aristoteles (384/3 - 322/1 v. Chr.) nimmt eine mittlere Position ein.
2.2.1 Platon
Platon vertrat noch die Auffassung der alten musiké, die sich nach Georgiades
,,auf die Seele, ähnlich wie die Gymnastik auf den Leib" bezieht.
48
Musik und
Gymnastik wirken demnach gemeinsam als Träger der Erziehung.
49
Nach
platonischer Auffassung gehört zum Begriff der musiké stets der lógos, der in der
Erziehung dem Inhalt nach ,,wahr" zu sein habe und in der Form hier nur ,,edle
menschliche Haltungen" darstellen soll.
,,Die Musiké hat die erste Stelle in der Erziehung, weil Harmonia und Rhythmus
am meisten ins Innere der Seele dringen und damit die Haltung des Menschen
bestimmen. Aber auch die Gymnastik hat entscheidenden Anteil an der
Erziehung; daher kann nur durch das harmonische Zusammenwirken beider das
Ziel der Erziehung erreicht werden: Mut und Weisheitsliebe in den Menschen zu
wecken".
50
Der amusische Mensch bei Platon ist in diesem Verständnis der
Ungebildete schlechthin.
51
48 GEORGIADES, Musik und Rhythmus, S 104.
49 Vgl. PLATON, Der Staat, eingeleitet, übersetzt und erklärt von Karl Vretska, Stuttgart 1980, S.
171-178. Vgl. auch PLATON, Nomoi, hg. v. K. Hülser, Frankfurt/Main 1991, S. 517-541.
50 PLATON, Der Staat, S. 171-178.
51 E. KONSTANTINOU, ,,Geleitwort zum Symposium 'Die Beziehungen der griechischen Musik
zur europäischen Musiktradition' vom 9.-11. Mai 1986 in Würzburg", in: BRANDL, R.
M./KONSTANTINOU, E. (Hrsg.), Griechische Kunst und Europa: Antike - Byzanz - Volksmusik
der Neuzeit, Aachen 1988, S. 11.
20
Den musikalischen Neuerungen seiner Zeit, dem Erstarken des Solistischen und
der Entwicklung zur Virtuosität
52
steht Platon ablehnend gegenüber, weil dadurch
das Hineingestelltsein der Musik in die zu schützende kultische und staatliche
Ordnung erschüttert werde.
53
Platons Doktrin vom politischen und psychischen, charakterlichen wie
pädagogischen Nutzen der Musik zielt auf seine Vorstellung vom ,,idealen Staat"
und ist besonders für die Ausbildung der ,,Wächter" dieses Staates gedacht, die
nach musikalisch-ethischer Unterweisung in Verbindung mit der notwendigen
gymnastischen Ertüchtigung in der Jugend später dann als erwachsene Polizisten
oder Krieger die staatliche Verfassung wirksam schützen können sollen.
54
Moderne Optionen wie die von der Freiheit der Kunst und ihrer
Daseinsberechtigung aus sich selbst heraus sind Platons Musikdenken diametral
entgegengesetzt, wären ihm ein Gräuel gewesen. Platons musiké ist dann gut und
schön und ,,überhaupt nur [...] diskutabel"
55
, wenn sie zur moralischen
Ausbildung des Charakters taugt, wenn sie ihre pädagogische Staats- und
Verfassungsschutzfunktion voll ausfüllt.
56
Herausgelöst aus ihrem originären geschichtlichen Kontext und losgelöst vom
platonischen Sittenkodex, ist der ,,kulturelle Dirigismus" Platons
57
in der Form
einer solchen musikalischen Doktrin leicht zur Absicherung eines jedweden
staatlichen Ordnungssystems dienstbar zu machen bzw. umzufunktionieren, auch
und gerade eines totalitären, das für sich in Anspruch nähme, das einzig humane
und gute zu sein.
52 Ohne einen gewissen Grad an virtuoser Brillianz scheint das Aulosspiel des Siegers eines
musischen Agons kaum vorstellbar (vgl. RIETHMÜLLER, Musik zwischen Hellenismus, S. 212).
Nicht von ungefähr lehnt Platon die Auloi ab (GEORGIADES, S. 104). Es ist dies ein Zeichen,
daß bereits Platon - sozusagen mit dem Rücken zur Wand - gegen eine Entwicklung kämpfte,
deren Unaufhaltsamkeit ihm schon gewahr gewesen sein mußte.
53 RIETHMÜLLER, Musik zwischen Hellenismus, S. 212.
54 Ebenda. Zur Rolle der Erziehung bei Platon vgl. auch R. M. HARE, Platon, Stuttgart 1990, S.
103ff.
55 W. VETTER, ,,Die antike Musik in der Beleuchtung durch Aristoteles", in: Archiv für
Musikforschung 1(1936)1, S. 30.
56 Es sei in diesem Zusammenhang etwa auf die offizielle Wertschätzung von Musik etwa in
sozialistischen Staaten hingewiesen, wo z. B. westliche Rockmusik lange Zeit als jugend- und
staatsgefährdend galt.
21
Riethmüller weist in diesem Zusammenhang auf den ,,bemerkenswerten
Schulterschluß" hinsichtlich des Dienstcharakters der Musik zwischen so
extremen Positionen wie christlichen Idealisten, marxistischen Materialisten
sowie allen hin, ,,die sich mit der radikalen Trennung des Ästhetischen vom
Ethischen und Moralischen nicht abfinden können".
58
Im Hinblick auf die Antiken- und insbesondere die Platon-Rezeption in den
Bildungstheorien des 19. u. 20. Jahrhunderts formuliert Riethmüller deutliche
Bedenken gegen eine generalisierende Interpretation des platonischen
Erziehungsgedankens: ,,Platon könnte mißverstanden sein, wenn man ihn, wie es
später zweifelsfrei unterlaufen ist, so verstehen wollte, als habe er ein Programm
zur musikalischen Volkspädagogik ausgegeben."
59
An so etwas wie Bildung für
alle und in jedem Lebensabschnitt hätte Platon demnach nicht gedacht.
2.2.2 Demokrit und Philodemos
Gegen den Idealisten Platon mit seiner musikalischen Ethos-Lehre stand das
materialistische Denkgebäude Demokrits. Für Demokrit dient Musik lediglich
Luxuszwecken, ihm ist Musik ein mehr oder minder hochstehendes Mittel für
Genuß und Unterhaltung
60
, keineswegs Träger ethischer Inhalte.
In seiner Tradition steht drei Jahrhunderte später Philodemos (110 - 40 v. Chr.)
aus der epikureischen Schule, ein Zeitgenosse Ciceros, der die denkbar schärfste
Absage an die Ethoslehre ausspricht, wenn er jede Möglichkeit einer seelisch-
57 J.-M. ANDRÉ, Griechische Feste, römische Spiele, Stuttgart 1994, S. 50.
58 RIETHMÜLLER, Musik zwischen Hellenismus, S. 214. Hier lohnte es sich, einmal Coubertins
musisch-pädagogische Visionen mit Vorstellungen der von ihm hochgeschätzten Briten Thomas
Arnold und John Ruskin zu vergleichen und der Frage nachzugehen, ob und ggfs. inwieweit
Coubertins musische Antikerezeption durch die Platon- bzw. Aristotelesrezeption jener Briten
vorgeprägt ist.
59 RIETHMÜLLER, S. 212. Es ist dies wohl eine Anspielung auf die musikpädagogischen
Ambitionen der deutschen Jugendbewegung.
60 ABERT, ,,Die Stellung der Musik", S. 145.
22
charakterlichen Beeinflussung des Menschen durch die Musik von vornherein
ausschließt. Musik habe mit dem Seelenleben so wenig zu schaffen wie die
Kochkunst. Die rein äußerlichen musikalischen Elemente könnten - wie bei Speis
und Trank - allein ein sinnliches Lustgefühl erregen.
61
Abert sieht in den
philodemischen Attacken einen Versuch, der Musik ,,aus ihr allein heraus
ästhetisch beizukommen ohne jeden außermusikalischen Zusatz"
62
. Philodemos`
Position stünde demnach neuzeitlich-ästhetischer Betrachtungsweise nahe.
Platons Satz von der Verbindung von Musik und Gymnastik als der Grundlage der
wahren Bildung, das auch von Aristoteles geforderte enge Zusammenwirken von
Gymnastik und Musik in der Jugenderziehung - eine bis jüngst immer wieder
eingeforderte ,,Wunschvorstellung"
63
in der neuhumanistischen
Bildungsdiskussion, insbesondere bei den Verfechtern einer ganzheitlichen
Bildung, und dazu gehörten wohl Pierre de Coubertin ebenso wie Carl Diem und
andere pädagogisch engagierte Vertreter der Olympischen Bewegung der ersten
Hälfte des 20. Jahrhunderts - wird von Philodemos stark befehdet.
64
Die antiken Vertreter der Anti-Ethoslehre versuchten, die Musik nur aus der
Musik zu erklären, kaum mehr als die Eindringlichkeit des Vortrags, die
Schönheit der Stimme und den poetischen Inhalt des Gesanges gelten zu lassen
und allen außermusikalischen Ballast über Bord zu werfen.
65
Abert bemerkt
hierzu provokant: ,,Ungriechisch war diese Anschauung durchaus nicht. Im
homerischen Epos herrscht sie durchaus vor."
66
61 Ebenda.
62 ABERT, S. 147.
63 RIETHMÜLLER, Musik zwischen Hellenismus, S. 218
64 ABERT, ,,Die Stellung der Musik", S. 146.
65 ABERT, S. 147f.
66 ABERT, S. 148.
23
2.2.3 Aristoteles
Aristoteles` Überlegungen neigen einer mittleren Position, einem Sowohl-als-auch
zu. Einerseits steht er in manchen Fragen fest auf dem Boden der Ethoslehre
seines Lehrers Platon, andererseits verschließt er sich nicht neuen Realitäten.
Er weiß noch um die alte enge ,,Verschwisterung der verschiedenen Künste", der
Dicht-, der Ton- und der Tanzkunst, nimmt aber die seinerzeit bereits weit
fortgeschrittene Loslösung der Einzelkünste als Tatsache hin.
67
Wenn Aristoteles
von musiké spricht, dann meint er damit ,,Tonkunst", also ungefähr das, was wir
heute unter Musik verstehen, nämlich ,,jenen Bereich des Hörbaren [...], der weder
bloßes Geräusch noch Sprache ist".
68
Aristoteles rechnet die Musik drei
Bereichen zu: der Bildung, dem Spiel und der Lebensgestaltung.
69
Im Bereich der Erziehung der Kinder und Heranwachsenden geht es um das
Streben nach Tugend und um die Bildung des Gemüts. Aristoteles teilt mit Platon
durchaus die ethische Beurteilung der Tonqualitäten. So erscheinen auch ihm die
tiefen Töne edler und schöner als die hohen.
70
Musikalische Betätigung, die zur
körperlichen Verweichlichung führe, lehnt er als banausisch ab.
71
Wie der Körper
durch Gymnastik trainiert werde, so werde der Charakter durch die Musik
gebildet.
72
In jedem Falle könne die Musik ,,die Seele sittlich [...]
beeindrucken".
73
67 VETTER, ,,Die antike Musik in der Beleuchtung durch Aristoteles", in: Archiv für
Musikforschung, 1(1936)1, S. 25.
68 RIETHMÜLLER, Musik zwischen Hellenismus, S. 216.
69 RIETHMÜLLER, S. 220. - VETTER hatte bereits 1936 vermerkt, Aristoteles teile der Musik
vier Auswirkungsmöglichkeiten bzw. Funktionsbereiche zu: der harmlosen Unterhaltung und
Belustigung (paidiá), der wissenschaftlich-künstlerischen Bildung und höheren Kultur (paideía),
dem geistigen, edlen Vergnügen (diagogé), der reinigend-homöopathischen Wirkung
enthusiastischer Melodien (kátharsis).VETTER, S. 30f.
70 VETTER, S. 9. - Die Pflege der besonders tiefen Vorsängerstimmen in der Gottesdienstliturgie
der orthodoxen Kirche mag in dieser Tradition stehen. Wenn Penderecki in seiner
Schlußapotheose ,,Ekecheiria" für die Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele von München 1972
tiefe Männerstimmen einen Orakelspruch Apollons altgriechisch singen läßt, scheint ihm ihre
,,edle" Zuordnung in antiker Zeit bewußt gewesen zu sein.
71 VETTER, S. 5.
72 RIETHMÜLLER, Musik zwischen Hellenismus, S. 221.
73 VETTER, S. 30.
24
Aristoteles führt hinsichtlich der Ausbildung der Kinder einen Katalog von
Empfehlungen vornehmlich dessen auf, was zu vermeiden ist: Insbesondere sei im
Unterricht ,,das zu unterlassen, was auf Musikausübung bei Kunstwettkämpfen
[...] hinzielt; dazu gehören das Auftreten für und das Rücksichtnehmen auf das
Publikum"
74
. Von den Wettkämpfen herkommende ,,Zauberstückchen" und
,,künstlerische Übertreibungen" sollen nicht gelernt und gelehrt werden.
75
Riethmüller sieht hierin wiederum eine Ächtung der künstlerischen Virtuosität,
,,modern gesprochen jene[s] Teil[s] der musikalischen Ausübung, der bloß
äußerlich statt innerlich und weder tiefsinnig noch hochgeistig ist".
76
Dabei stellt er als das eigentliche Anliegen des Aristoteles heraus, sich einer
Entwicklung in der Erziehung entgegenzustemmen, die Gefahr läuft, den auf mehr
oder weniger grobes Vergnügen ausgerichteten Publikumsgeschmack zum
Maßstab des musikerzieherischen Wirkens zu machen: ,, [...] der springende Punkt
liegt darin, daß es die anspruchslosen, flachen Bedürfnisse des Publikums sind,
die auf die Musik verschlimmernd zurückwirken und damit auch die
Instrumentalisten, die sich dem nolens volens anpassen müssen, sozusagen
ruinieren."
77
Das heißt mit anderen Worten, Aristoteles befürchtet, daß es mit der
Qualität der Musik und ihrer erzieherischen Wirksamkeit bergab gehe, wenn statt
der Fachleute die gemeine Masse die Maßstäbe des guten Geschmacks bestimmt,
die Beliebtheit also der entscheidende Faktor bei der musikalischen Bewertung
werde.
Es war damit ein pädagogisches Grundproblem angerissen, das sich neuzeitlicher
Musik-, aber auch sonstiger Fachdidaktik bis heute immer wieder neu stellt, wie
man es nämlich halte mit der Befriedigung modischen Massengeschmacks im
jeweiligen Fachunterricht, ohne den erzieherischen Wert des Faches zu schmälern.
74 RIETHMÜLLER, Musik zwischen Hellenismus, S. 224.
75 Ebenda.
76 Ebenda.
25
Eine ähnliche Problematik stellt sich auch in unmittelbarem Zusammenhang der
Sinn- und Zweckbestimmung der musikalischen Inszenierung einer modernen
olympischen Festfeier, inwieweit man nämlich den Bedürfnissen eines
Unterhaltung konsumierenden Massenpublikums entgegenkommen dürfe, ohne
der Gefahr zu erliegen, ,,olympischen" Massenkitsch zu produzieren und dazu
beizutragen, die ursprünglich noblen pädagogischen Grundanliegen des
coubertinschen Olympismus und der zu deren Förderung begründeten modernen
Olympischen Spielen gleich bei deren feierlicher Eröffnung zu diskreditieren.
Es galt jeweils neu zu entscheiden, ob das, was vielleicht bei einer
augenblicklichen Publikums- bzw. Konsumentenmehrheit populär war
(beispielsweise das Circensisch-Sensationelle oder etwa das Gerade-für-modisch-
Befundene), bei der Ausgestaltung der Eröffnungsfeier bevorzugt berücksicht
werden sollte und künstlerisch-geschmackliche Bedenken sowie die
Rücksichtnahme auf gewisse idealistisch-pädagogische Vorstellungen der
olympischen Gründerväter hintangestellt werden dürften.
Platon war den ersten verantwortlichen olympischen Festgestaltern der Neuzeit
abrufbar als ganz entschiedener früher Warner vor letztgenannter Entwicklung.
Aristoteles sah den Sachverhalt gelassener, vor allem differenzierter. Im Bereich
der musischen Jugenderziehung und hinsichtlich der allgemeinen
Charakterbeeinflussung folgte er Platons idealistischer, ethischer Doktrin. Doch
zeigte er sich als Realist, dem die Wirkung von Musik als Mittel der Entspannung
und Erholung, als Quelle des Vergnügens und des reinen schönen Genusses - des
physisch-sinnenhaften wie auch veredelt-geistigen - nicht verborgen geblieben
war und der dieses Vergnügen seinen erwachsenen Zeitgenossen auch
zugestand.
78
Im Zusammenhang mit seinen Gedanken über die Tragödie bezeichnete
Aristoteles die Musik in derselben als ,,wichtigste von allen Würzen", als
77 RIETHMÜLLER, S. 229f.
78 RIETHMÜLLER, Musik zwischen Hellenismus, S. 220.
26
,,würzende" Zutat (Poetika VI 1450b,16). Mit dieser Herausstellung des
,,akzessorischen Charakter[s] der Musik"
79
schlägt er den Bogen zu Homer, der
bereits in der Odyssee (I 350) den frohen wie den schwermütigen Melodien die
Bedeutung der würzenden Zutat zum festlichen Mahle zugeschrieben hatte
80
und
von dem Geist der jüngeren Ethoslehre noch nichts hatte spüren lassen
81
. Anders
als dem Jugendlichen, der noch zu gutem Geschmack zu erziehen ist, gönnt
Aristoteles dem Erwachsenen, sich einfach an der Musik nach je eigenem
Bedürfnis erfreuen zu dürfen.
Dabei verwendet sich Aristoteles ausdrücklich dafür, bei Musikaufführungen
Rücksicht auf die unterschiedliche soziale Schichtung des Publikums zu nehmen,
da dies nicht nur aus hochgebildeten Staatsbürgern bestehe, sondern auch aus
Handwerkern und Lohnarbeitern. Er hat hier nichts gegen einen ,,effektvolleren
und leichter geschürzten Stil"
82
, damit sozusagen auch die musikalisch weniger
vorgebildeten Bürger auf ihre Kosten kommen können, einzuwenden.
83
Aristoteles` Gedanken scheinen den Beginn einer soziologischen Ästhetik zu
markieren. Vom Standpunkt des erwachsenen Musikhörers gesehen, schafft er der
musikalischen Weiterentwicklung nötigen Freiraum. Er relativiert Platons ethisch-
musikalische Position, ohne den geforderten hohen Anspruch an die künstlerische
Qualität der Tonkunst aufzugeben.
Aristoteles uneingeschränkt als antiken Zeugen einer konservativ beharrenden
Festmusikkultur mit generell pädagogischer Intention zu reklamieren verbietet
79 VETTER, S. 25.
80 VETTER, S. 23.
81 ABERT, ,,Die Stellung der Musik", S. 148.
82 VETTER, S. 5.
83 Vor einer ähnlichen Problematik stand auch P. de Coubertin, wenn er einerseits die olympische
Festfeier als Mittel ansah, mit den olympischen Idealen die ,,Massen zu erreichen" (P. de
COUBERTIN, Der Olympische Gedanke, Schorndorf 1967, S. 87), und es begrüßte, wenn die
Zuschauer anläßlich olympischer Festlichkeiten ,,auf ihre Kosten" kamen (COUBERTIN,
Einundzwanzig Jahre Sportkampagne, Ratingen 1974, S. 155), andererseits es ihm bei der
musikalischen Ausgestaltung der olympischen Feier jedoch unbedingt geboten erschien, deren
Vornehmheit, die bei den gewöhnlichen weltlichen Festen nirgends anzutreffen sei, zu wahren und
sich ,,strikt an die Grenzen des guten Geschmacks und des Maßes zu halten" (COUBERTIN,
Olympischer Gedanke, S. 40).
27
sich somit. Andererseits bedeutet dies keineswegs einen gleichsam klassisch-
philosophischen Freibrief für die Produktion jedweder musikalischen Massenware
oder Abgeschmacktheit, am allerwenigsten für deren Aufführung im Rahmen der
Olympischen Spiele, dem weltgrößten Sportfest der Jugend, einer Jugend, deren
musische Wohlerziehung Platon und Aristoteles ebenso wie Baron de Coubertin
ein ernstes Anliegen war.
2.3 Zum Einfluß platonischen Gedankengutes auf Musikwissenschaftler im
Vorfeld der Olympischen Spiele 1936
Die Olympischen Spiele von Berlin 1936 stellen in der jungen Geschichte der
modernen Olympischen Spiele den markanten Abschluß jener frühen
Entwicklungsperiode dar, die der 1937 verstorbene Baron de Coubertin
gedanklich noch begleiten konnte und in deren Eröffnungsfeierlichkeiten er seine
musikalischen Wunschvorstellungen auf vollendete Weise realisiert sah.
Die deutschen olympischen Enthusiasten waren lange Zeit als Musterschüler der
coubertinschen Ideen angesehen. Carl Diem, der Generalsekretär der Berliner
Spiele, tat sich hier besonders hervor.
Als Diem in Berlin als Sportdozent und -organisator tätig war, lehrten an Berliner
Hochschulen renommierte Musikdozenten wie beispielsweise Götsch (Musik- und
Tanzpädagoge), Müller-Freienfels (Musikpsychologe), Schering
(Musikwissenschaftler), Eisler (Musiker und Musikkritiker), die hier zwar nicht
als repräsentativ für die deutsche akademische Musikreflexion jener Zeit
hingestellt werden sollen, deren Stimmen im Vorfeld der Berliner Spiele jedoch in
mancher Hinsicht die enge Verwandschaft mit Platons Ideenwelt verdeutlichen
können.
Ihre Verlautbarungen schaffen einen atmosphärischen Hintergrund, aus dem
bestimmte Geschmacksimpulse für die über Jahre hinweg währende musikalische
28
Gestaltungsarbeit für die olympischen Festfeiern in Berlin geboren werden bzw.
Verstärkung erfahren konnten.
Besonders in der überaus vielschichtigen, pädagogisch fruchtbaren, von
mannigfachen Unterströmungen geprägten und in fortlaufender Veränderung sich
entwickelnden deutschen Jugendmusikbewegung
84
erscheinen einige der oben
genannten platonischen Vor-Urteile stark verinnerlicht, den eigenen
jugendbewegt-musikalischen und pädagogischen Intentionen anverwandelt.
85
Auffallende Parallelen zwischen Platons kulturkritischen Auslassungen zu
gesellschaftlichen Erscheinungen seiner Zeit, die der Philosoph durch das
Festhalten an alten Traditionen und nicht zuletzt durch die Jugenderziehung
mittels des Zusammenwirkens von musiké und Gymnastik zurückdrängen wollte,
sowie einem im gesamten industrialisierten Europa, durchaus nicht nur im
deutschsprachigen Raum, weitverbreiteten Kultur- und Gesellschaftspessimismus
sind offensichtlich.
Die Jugendbewegung, die Singbewegung, die Kunsterziehungsbewegung, die
gymnastische Bewegung in Deutschland zeigen, wie die wachsende internationale
Olympische Bewegung, in der kulturkritischen Zeitanalyse manche Ähnlichkeiten
und in den pädagogischen Lösungsansätzen gemeinsame Schnittflächen, die auf
die Verarbeitung platonischen Gedankengutes zurückverweisen.
84 Zur Wirkgeschichte der Jugendbewegung, aus der die Jugendmusikbewegung erwächst,
bemerkt NOHL: ,,Wo heute in der Pädagogik mehr ist als bloße Organisation, Methode und
Technik, nämlich das Suchen nach dem einheitlichen Ideal einer neuen Humanität [...] und ein
neuer Stil pädagogischer Gemeinschaft und pädagogischen Wirkens, da ist der Einfluß der
Jugendbewegung festzustellen" (H. NOHL, Die pädagogische Bewegung in Deutschland und ihre
Theorie, Berlin 1963, S. 12).
85 Lange wurden einzelne Instrumente geächtet (z. B. das Akkordeon). Zwischenzeitlich wurde
sogar das Klavier in seiner Eigenschaft als hervorragendes konzertantes Virtuoseninstrument mit
einer gewissen Reserviertheit betrachtet. Als das gemeinschaftsfördernde Instrument par
excellence - weil das gemeinsame Singen in der Gruppe und auf Fahrt stets begleitend - galt in der
ersten Phase der Jugendbewegung die Laute bzw. die Gitarre, welche als Saiteninstrument wie in
der Funktion als Begleitinstrument der antiken Kithara zumindest anverwandt ist. Dies soll hier
nur als eine merkwürdige, wenn auch eher zufällige Ähnlichkeit mit Platons instrumentalen
Affinitäten angeführt sein.
29
Wenn Eduard Spranger 1925 vor deutschen Philologen ausführt, der ,,deutsche
Idealismus findet seine Nahrung in der ewigen Rückkehr zu Plato"
86
, und für
seine Zeit bekennt: "[...] die Alten haben für einiges, was die Menschheit ewig
bewegt, i h r e Lösungen gefunden [...]. Deshalb können sie uns helfen, u n s e r e
Lösungen zu sehen"
87
, so ist das für alle Zeitgenossen, die sich von Oswald
Spenglers
88
Untergangsvisionen traumatisiert fühlten, ein deutlicher Hinweis,
sich zur Rettung des Abendlandes der politisch-pädagogischen Heilmittel aus der
platonischen Ideen-Apotheke zu erinnern und sich derer gegebenenfalls in
angemessener Dosierung und zeitgemäßer Beimischung zu bedienen.
89
Indem sie wohl solche antikisierende Affinitäten der Musikwissenschaft seiner
Zeit im Blickfeld hat, klingt eine polemisierende Minderheitenmeinung gegen die
in Deutschland vehement vertretene Bildungsträchtigkeit von Musik ebenso
ketzerisch-erfrischend wie philodemisch, wenn es bei Eichborn heißt: ,,Wohl aber
gibt es heute noch merkwürdige Enthusiasten, die der Musik einen Einfluß auf
'Sittlichkeit und Besserung des menschlichen Herzens' zuschreiben. Das heißt die
Musik zu einer wohltätigen Gottheit proklamieren, die mit Allmacht ausgerüstet
ist, ihre Verehrer und Jünger von Grund aus umzugestalten, ihren angeborenen
Charakter und ihre geistigen Fähigkeiten zu ändern. Musikalische Begabung [...]
hat mit dem Charakter [...] eines Menschen gar nichts zu schaffen und verträgt
sich [...] mit einer anständigen Portion Dummheit. Musik ist auch nicht zur
'Bildung' notwendig, wie eine falsche ästhetische Richtung in unseren Tagen uns
vorflunkert. Musik ist für die Musikalischen eine notwendige Lebensäußerung,
die unabweisbare Betätigung einer angeborenen Fähigkeit oder ein Genuß, eine
Lebensfreude für die Hörenden und die Ausübenden. Unmusikalische entbehren
nichts, wenn sie mit Musik verschont bleiben, und sind dann weder schlechter
86 E. SPRANGER, ,,Die Antike und der deutsche Geist", in: Bayerische Blätter für das
Gymnasial-Schulwesen 61(1925), S. 201.
87 SPRANGER, S. 197. Vgl. dazu auch E. SPRANGER, Das humanistische und das politische
Bildungsideal im heutigen Deutschland, Leipzig 1916.
88 O. SPENGLER, Der Untergang des Abendlandes, München 1923.
89 Carl Diem steht mit Spranger seit den 20er Jahren in Hauskontakt bzw. nach der Berliner Zeit
bis zu seinem Tode in freundschaftlichem Briefwechsel. Dieser Zeugnisse lagern im CDI.
30
noch dümmer oder ungebildeter, also nicht schlimmer daran als andere
Menschen."
90
In die Phalanx jener ,,merkwürdigen Enthusiasten", die der Musik auch im 20.
Jahrhundert noch charakterbildende und sozialethische Funktionen zuschreiben,
reihen sich Vertreter verschiedener Fachgebiete und unterschiedlichster politisch-
ideologischer Einfärbung ein, zunächst unabhängig von deren innerem Bezug
etwa zum sportlichen Treiben ihrer Zeit oder von einem idealistisch-olympischen
Sportverständnis, das bei einem Mann wie Carl Diem im Blick auf die
Jugenderziehung durch ein platonisch-aristotelisches Gymnastik-Verständnis
eindeutig vorgeprägt war.
91
2.3.1 Georg Götsch
92
Bei Georg Götsch (1895-1956), Musik- und Tanzpädagoge, führendes Mitglied
der deutschen Jugendmusikbewegung
93
, fügen sich musisches und sportliches
Interesse glücklich zusammen. Er erhält 1924 einen Lehrauftrag an der von Diem
geleiteten Deutschen Hochschule für Leibesübungen (DHfL) in Berlin. 1928 ist er
für die Musik und die tänzerisch-turnerische Vorführung der DHfL bei den
Olympischen Spielen in Amsterdam verantwortlich,
94
die C. Diem und der DHfL
90 H. EICHBORN, Militarismus und Musik, Leipzig 1909, S. 40f.
91 DIEM bekennt sich eindeutig zu einer Reform des zeitgenössischen Sportunterrichts unter
Berufung auf klassisch-antike Zielsetzungen. Er ironisiert die Situation an seinem ehemaligen
humanistischen Gymnasium, das sich zwar in seiner offiziellen Platon-Verehrung kaum habe
überbieten lassen, dessen veraltete Turnunterrichtspraxis jedoch den beherzigungswerten
Anforderungen Platons an eine pädagogisch effiziente Leibeserziehung Hohn gesprochen habe (C.
DIEM, ,,Plato, du bist veraltet!" (1924), in: C. DIEM, Olympische Flamme, Bd. I, Berlin 1942, S.
139ff.).
92 Götsch, Georg: Volksschullehrer und Wandervogelführer; gründete 1921 die Märkische
Spielgemeinde; 1929 - 1943 Direktor des Musikheimes Frankfurt/Oder; begründete 1949 die
Musische Gesellschaft in Fürsteneck.
93 ,,Was zu Beginn der zwanziger Jahre Jöde und Hensel [die führenden Köpfe der
Musikantengilden bzw. Singbewegung, Anm. von mir] für die Verbreitung des Volksliedes getan
haben, das hat Götsch für den Tanz getan" (L. PISTOR, ,,Georg Götsch - Tänzer und
Tanzmeister", in: E. BITTERHOF (Hrsg.), Georg Götsch, Lebenszeichen, Wolfenbüttel 1969, S.
196).
94 Götsch berichtet selbst über dieses Projekt in seinem Aufsatz G. GÖTSCH, ,,Musik und
sportliche Bewegung", in: ARCHIV DER JUGENDMUSIKBEWEGUNG E. V. HAMBURG
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Originalausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2001
- ISBN (eBook)
- 9783832450069
- ISBN (Paperback)
- 9783838650067
- DOI
- 10.3239/9783832450069
- Dateigröße
- 18.5 MB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- Deutsche Sporthochschule Köln – unbekannt
- Erscheinungsdatum
- 2002 (Februar)
- Note
- 1,0
- Schlagworte
- berlin idee hymne münchen coubertin
- Produktsicherheit
- Diplom.de