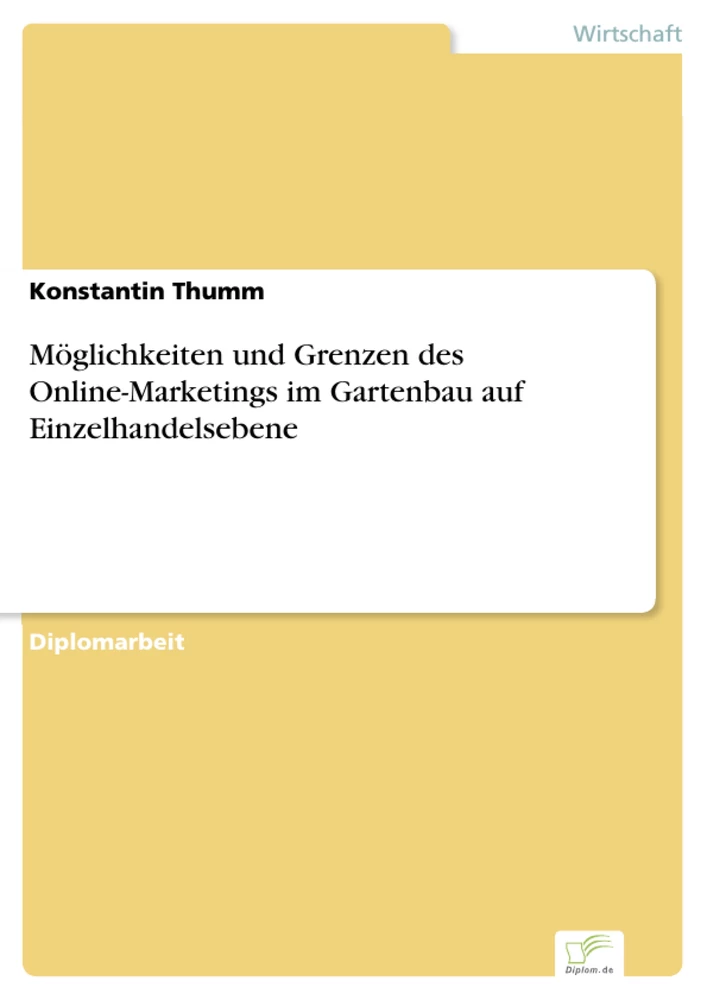Möglichkeiten und Grenzen des Online-Marketings im Gartenbau auf Einzelhandelsebene
©2001
Diplomarbeit
115 Seiten
Zusammenfassung
Inhaltsangabe:Einleitung:
Durch die weitreichenden Einflüsse des Internet sind neue Unternehmenskonzepte entstanden, die sich die neue Technik zunutze machen und das klassische Marketing um den Begriff Online-Marketing erweitert haben. Dabei lassen sich die konventionellen Konzepte des Marketing, wie sie heute in allen Berufssparten zum Einsatz kommen, nicht eins zu eins auf das Internet übertragen. Es gilt vielmehr, die technologischen Grundlagen, sowie die sich daraus ergebenden neuen marketingpolitischen Konzeptionsansätze kennenzulernen, um deren Möglichkeiten und Grenzen bei der Umsetzung neuer Unternehmensmodelle im Gartenbau erfolgreich einzusetzen. Da ich keinerlei weiterführende Literatur zu Online-Marketing mit speziellem Fokus auf den Gartenbau gefunden habe, unternimmt diese Arbeit den Versuch diese Lücke zu schließen.
Gang der Untersuchung:
Nach einer fundierten Einführung in die technologischen Grundlagen des Internets, erweitert durch ein Glossar mit allen behandelten Begriffen, gehe ich auf die Aspekte des konventionellen Marketing im Allgemeinen und im Speziellen ein.
Der Hauptteil der Arbeit behandelt das sehr weitreichende Thema des Online-Marketing branchenübergreifend.
Erst im Kapitel 7 gehe ich auf die speziellen Belange des Online-Marketing im Gartenbau ein, dabei wurden zahlreiche Quellen analysiert und weiterverarbeitet.
Die Arbeit endet in der Vorstellung eines praktischen Beispiels, in welchem alle Aspekte eines gelungenen Webauftritts unter Berücksichtigung der konzeptionellen Ansätze wie sie im Online-Marketing behandelt wurden, vertreten sind.
Die Arbeit wurde fast ausschließlich im Internet recherchiert.
Inhaltsverzeichnis:Inhaltsverzeichnis:
1.Einleitung1
1.1Einführung in das Thema1
1.2Ziele der Arbeit1
1.3Aufbau der Arbeit1
2.Grundlagen Internet2
2.1Historie und Definition2
2.2Netzwerk3
2.3Transfer-Control-Protocol / Internet-Protocol (TCP/IP)4
2.4Domain-Name-System (DNS)5
2.5Uniform-Resource-Locator (URL)5
2.6Zugang zum Internet7
2.7Dienste8
2.7.1World-Wide-Web (WWW)9
2.7.2E-Mail11
2.7.3File-Transfer-Protocol (FTP)11
2.7.4Newsgroup (Usenet)12
2.7.5Wireless-Application-Protocol (WAP)12
2.7.6Internet-Relay-Chat (IRC)13
2.8Suchmaschinen und Kataloge14
3.Aktuelle Zahlen15
3.1Statistiken und Studien15
3.2Statistiken zur Internet-Nutzung vom Gartenbau-Einzelhandel19
4.Marketing21
4.1Produktpolitik22
4.2Preispolitik26
4.3Distributionspolitik26
4.4Kommunikationspolitik28
4.5Marketing […]
Durch die weitreichenden Einflüsse des Internet sind neue Unternehmenskonzepte entstanden, die sich die neue Technik zunutze machen und das klassische Marketing um den Begriff Online-Marketing erweitert haben. Dabei lassen sich die konventionellen Konzepte des Marketing, wie sie heute in allen Berufssparten zum Einsatz kommen, nicht eins zu eins auf das Internet übertragen. Es gilt vielmehr, die technologischen Grundlagen, sowie die sich daraus ergebenden neuen marketingpolitischen Konzeptionsansätze kennenzulernen, um deren Möglichkeiten und Grenzen bei der Umsetzung neuer Unternehmensmodelle im Gartenbau erfolgreich einzusetzen. Da ich keinerlei weiterführende Literatur zu Online-Marketing mit speziellem Fokus auf den Gartenbau gefunden habe, unternimmt diese Arbeit den Versuch diese Lücke zu schließen.
Gang der Untersuchung:
Nach einer fundierten Einführung in die technologischen Grundlagen des Internets, erweitert durch ein Glossar mit allen behandelten Begriffen, gehe ich auf die Aspekte des konventionellen Marketing im Allgemeinen und im Speziellen ein.
Der Hauptteil der Arbeit behandelt das sehr weitreichende Thema des Online-Marketing branchenübergreifend.
Erst im Kapitel 7 gehe ich auf die speziellen Belange des Online-Marketing im Gartenbau ein, dabei wurden zahlreiche Quellen analysiert und weiterverarbeitet.
Die Arbeit endet in der Vorstellung eines praktischen Beispiels, in welchem alle Aspekte eines gelungenen Webauftritts unter Berücksichtigung der konzeptionellen Ansätze wie sie im Online-Marketing behandelt wurden, vertreten sind.
Die Arbeit wurde fast ausschließlich im Internet recherchiert.
Inhaltsverzeichnis:Inhaltsverzeichnis:
1.Einleitung1
1.1Einführung in das Thema1
1.2Ziele der Arbeit1
1.3Aufbau der Arbeit1
2.Grundlagen Internet2
2.1Historie und Definition2
2.2Netzwerk3
2.3Transfer-Control-Protocol / Internet-Protocol (TCP/IP)4
2.4Domain-Name-System (DNS)5
2.5Uniform-Resource-Locator (URL)5
2.6Zugang zum Internet7
2.7Dienste8
2.7.1World-Wide-Web (WWW)9
2.7.2E-Mail11
2.7.3File-Transfer-Protocol (FTP)11
2.7.4Newsgroup (Usenet)12
2.7.5Wireless-Application-Protocol (WAP)12
2.7.6Internet-Relay-Chat (IRC)13
2.8Suchmaschinen und Kataloge14
3.Aktuelle Zahlen15
3.1Statistiken und Studien15
3.2Statistiken zur Internet-Nutzung vom Gartenbau-Einzelhandel19
4.Marketing21
4.1Produktpolitik22
4.2Preispolitik26
4.3Distributionspolitik26
4.4Kommunikationspolitik28
4.5Marketing […]
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
ID 4968
Thumm, Konstantin: Möglichkeiten und Grenzen des Online-Marketings im Gartenbau auf
Einzelhandelsebene / Konstantin Thumm - Hamburg: Diplomica GmbH, 2002
Zugl.: Berlin, Technische Fachhochschule, Diplom, 2001
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte, insbesondere die
der Übersetzung, des Nachdrucks, des Vortrags, der Entnahme von Abbildungen und Tabellen,
der Funksendung, der Mikroverfilmung oder der Vervielfältigung auf anderen Wegen und der
Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen, bleiben, auch bei nur auszugsweiser Verwertung,
vorbehalten. Eine Vervielfältigung dieses Werkes oder von Teilen dieses Werkes ist auch im
Einzelfall nur in den Grenzen der gesetzlichen Bestimmungen des Urheberrechtsgesetzes der
Bundesrepublik Deutschland in der jeweils geltenden Fassung zulässig. Sie ist grundsätzlich
vergütungspflichtig. Zuwiderhandlungen unterliegen den Strafbestimmungen des
Urheberrechtes.
Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in diesem
Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme, dass solche
Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei zu betrachten
wären und daher von jedermann benutzt werden dürften.
Die Informationen in diesem Werk wurden mit Sorgfalt erarbeitet. Dennoch können Fehler nicht
vollständig ausgeschlossen werden, und die Diplomarbeiten Agentur, die Autoren oder
Übersetzer übernehmen keine juristische Verantwortung oder irgendeine Haftung für evtl.
verbliebene fehlerhafte Angaben und deren Folgen.
Diplomica GmbH
http://www.diplom.de, Hamburg 2002
Printed in Germany
Wissensquellen gewinnbringend nutzen
Qualität, Praxisrelevanz und Aktualität zeichnen unsere Studien aus. Wir
bieten Ihnen im Auftrag unserer Autorinnen und Autoren Wirtschafts-
studien und wissenschaftliche Abschlussarbeiten Dissertationen,
Diplomarbeiten, Magisterarbeiten, Staatsexamensarbeiten und Studien-
arbeiten zum Kauf. Sie wurden an deutschen Universitäten, Fachhoch-
schulen, Akademien oder vergleichbaren Institutionen der Europäischen
Union geschrieben. Der Notendurchschnitt liegt bei 1,5.
Wettbewerbsvorteile verschaffen Vergleichen Sie den Preis unserer
Studien mit den Honoraren externer Berater. Um dieses Wissen selbst
zusammenzutragen, müssten Sie viel Zeit und Geld aufbringen.
http://www.diplom.de bietet Ihnen unser vollständiges Lieferprogramm
mit mehreren tausend Studien im Internet. Neben dem Online-Katalog und
der Online-Suchmaschine für Ihre Recherche steht Ihnen auch eine Online-
Bestellfunktion zur Verfügung. Inhaltliche Zusammenfassungen und
Inhaltsverzeichnisse zu jeder Studie sind im Internet einsehbar.
Individueller Service
Gerne senden wir Ihnen auch unseren Papier-
katalog zu. Bitte fordern Sie Ihr individuelles Exemplar bei uns an. Für
Fragen, Anregungen und individuelle Anfragen stehen wir Ihnen gerne zur
Verfügung. Wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit.
Ihr Team der Diplomarbeiten Agentur
Inhaltsverzeichnis
1
Einleitung
1
1.1
Einführung
in
das
Thema
1
1.2
Ziele der Arbeit
1
1.3
Aufbau der Arbeit
1
2
Grundlagen Internet
2
2.1
Historie
und
Definition
2
2.2
Netzwerk
3
2.3
Transfer-Control-Protocol / Internet-Protocol (TCP/IP)
4
2.4
Domain-Name-System
(DNS)
5
2.5
Uniform-Resource-Locator
(URL)
5
2.6
Zugang
zum
Internet
7
2.7
Dienste
8
2.7.1
World-Wide-Web
(WWW)
9
2.7.2
E-Mail
11
2.7.3
File-Transfer-Protocol
(FTP) 11
2.7.4
Newsgroup
(Usenet)
12
2.7.5
Wireless-Application-Protocol
(WAP)
12
2.7.6
Internet-Relay-Chat
(IRC)
13
2.8
Suchmaschinen
und
Kataloge
14
3
Aktuelle Zahlen
15
3.1
Statistiken
und
Studien
15
3.2
Statistiken zur Internet-Nutzung vom Gartenbau-Einzelhandel
19
4
Marketing
21
4.1
Produktpolitik
22
4.2 Preispolitik
26
4.3
Distributionspolitik
26
4.4
Kommunikationspolitik 28
4.5
Marketing
im
Gartenbau
31
5
Online-Marketing
34
5.1 Vorüberlegungen zum Online-Auftritt
36
5.1.1 Wahl des geeigneten Domain-Namens
37
5.1.2
Dokumentenstruktur
und
Navigation
37
5.2 Maßnahmen im Online-Marketing
40
5.2.1 Cross-Media-Marketing
40
5.2.2 Suchmaschinen
41
5.2.3 Webkataloge 43
5.2.4 Branchendienste
43
5.2.5 Online-Werbung
44
5.2.5.1
Banner
und
Buttons
46
5.2.5.2 Werbung auf Suchmaschinen
49
5.2.5.3
Bannertauschprogramme
52
5.2.5.4
Partnerprogramme 52
5.2.5.5 Unterbrecherwerbung
(Interstitials)
53
5.2.5.6
Pop-Up-Werbefenster
54
5.2.6 E-Mail
54
5.3
Marketing-Konzepte
56
5.3.1 One-to-one-Marketing
56
5.3.2 E-Mail-Marketing
58
5.3.2.1
Newsletter
59
5.3.2.2
Diskussionslisten und Diskussionsforen
61
5.3.3 Permission-Marketing
61
5.3.4 Viral-Marketing
62
6
Erfolgskontrolle
63
6.1
Counter
und
Logfile-Analyse
63
6.2
Konkurrenzanalyse
65
6.3
Kundenbefragungen
66
7
Gartencenter und Blumenfachgeschäfte im Internet
67
8
Gartencenter-Strategie am Beispiel von Gartencenter24
69
9
Ausblick in die Zukunft
74
Glossar
76
Literaturverzeichnis
101
1
1 Einleitung
1.1
Einführung in das Thema
Die Auswirkungen von Internet und neuen Medien auf viele Bereiche des täglichen
Lebens werden viel diskutiert. Die enorme Geschwindigkeit der Veränderungen
durch das Wachstum und die Weiterentwicklung der Technik haben völlig neue
Möglichkeiten des Informationsaustausches und der Kommunikation geschaffen.
Die Auswirkungen sind dabei so weitreichend, daß einige von einem Weg ins
Informationszeitalter sprechen. Andere sind durch den globalen Einfluß der
Entwicklungen verunsichert und fürchten viele Risiken.
Durch die weitreichenden Einflüsse des Internet sind neue Unternehmenskonzepte
entstanden, die sich die neue Technik zunutze machen und das klassische
Marketing um den Begriff ,,Online-Marketing" erweitert haben.
Dabei lassen sich die konventionellen Konzepte des Marketing, wie sie heute in
allen Berufssparten zum Einsatz kommen, nicht eins zu eins auf das Internet
übertragen. Es gilt vielmehr, die technologischen Grundlagen, sowie die sich
daraus ergebenden neuen marketingpolitischen Konzeptionsansätze
kennenzulernen, um deren Möglichkeiten und Grenzen bei der Umsetzung neuer
Unternehmensmodelle im Gartenbau erfolgreich einzusetzen.
Die Beschreibung der Auswirkungen auf das Marketing im Gartenbau auf
Einzelhandelsebene wird durch die Eingrenzung auf Fachgartencenter und
Blumenfachgeschäfte vorgenommen. Besonderer Fokus der Betrachtungen gilt
jedoch den Fachgartencentern.
1.2 Ziele der Arbeit
Erhebungen zu den Auswirkungen des Internet auf den Gartenbau, sowie die
Diskussion um den Einsatz von Online-Marketing im Gartenbau liegen nur in
vereinzelten Fachartikeln vor. Vertiefende Informationen unter Berücksichtigung
der gartenbaulichen Belange beim Einsatz von Online-Marketing liegen nicht vor.
Diese Arbeit unternimmt den Versuch diese Lücke zu füllen.
1.3 Aufbau der Arbeit
Um das sehr umfangreiche Thema der technologischen Grundlagen einerseits
möglichst vollständig, andererseits aber möglichst knapp darzustellen und die
Konzentration der Arbeit auf das Online-Marketing zu verbessern wurde ein
umfangreiches Glossar angelegt. Das Glossar soll zusätzliche Informationen zu
Fachbegriffen geben.
In Kapitel 2 werden die technologischen Grundlagen des Internet dargestellt und in
Kapitel 3 durch statistische Zahlen und Studien zur momentanen Nutzung der
Technologien ergänzt.
2
Kapitel 4 grenzt den Begriff Marketing ein und stellt die marketingpolitischen
Instrumente dar. In Kapitel 5 werden umfassend die Möglichkeiten und Grenzen
des Online-Marketing aufgezeigt. Die Methoden der Erfolgskontrolle beim Einsatz
des Online-Marketing werden in Kapitel 6 dargestellt. Kapitel 7 zeigt den
momentanen Stand des Einsatzes von Online-Marketing in Gartencentern und
Blumenfachgeschäften.
In Kapitel 8 wird am Beispiel des Gartencenter24-Konzeptes der Einsatz von
Online-Marketing veranschaulicht.
Abschließend werden Zukunftsperspektiven in Kapitel 9 diskutiert.
2 Grundlagen
Internet
2.1
Historie und Definition
Das heutige Internet hat seine Ursprünge in den USA, Ende der sechziger, Anfang
der siebziger Jahre zur Zeit des kalten Krieges. Ein atomarer Erstschlag hätte einen
Totalausfall der damals noch zentral organisierten militärischen ,,Netzwerke"
(siehe Kapitel 2.2, siehe Glossar) zur Folge gehabt. Wissenschaftler hatten zuvor
schon die Machbarkeit einer Verbindung zweier weit auseinanderliegender
Netzwerke mittels bestehender ,,Telekommunikationsleitungen" (siehe Glossar)
experimentell bewiesen.
So entwickelte die Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) ein
dezentrales, paketorientiertes Netzwerk, in welchem verschiedene Netzwerke zwar
miteinander verbunden waren, bei Ausfall eines Teilnetzwerkes aber immer noch
funktionsfähig blieben. Die Daten wurden dabei in Form von kleinen Paketen
übertragen. Das Arpanet war entstanden, welches im Jahre 1972 der Öffentlichkeit
vorgestellt wurde.
Nun konnten auch nicht militärische Rechenzentren dieses Netz verwenden.
Insbesondere die amerikanischen Universitäten nutzten die neuen Möglichkeiten
dieser Technik.
Nicht an jeder Universität wurde allerdings die gleiche Software und Hardware
eingesetzt, so daß sich schnell Probleme beim Datenaustausch ergaben.
Um dieses Problem zu umgehen wurde 1980 das ebenfalls paketorientierte
,,Transmission Control Protocol/Internet Protocol" (TCP/IP) (siehe Kapitel 2.3,
siehe Glossar), von dem Departement of Defense (DoD) als nationaler
Übertragungsstandard erklärt, der bestimmte Regeln festlegte, an die sich
Computer bei der Kommunikation zu halten haben.
1983 wurde das Arpanet auf TCP/IP umgestellt.
Dieses ,,Protokoll" (siehe Kapitel 2.7, siehe Glossar) bildet noch heute die Grundlage
des Datenflusses im Internet.
1986 erfolgte eine Trennung in ein rein militärisches, nicht öffentliches (Milnet) und
dem zivilen, forschungsorientierten Arpanet. Das zivile Netz bekam den Namen
Internet ("interconnected-set-of-networks") und verbreitete sich schnell auch in
anderen Ländern. So wurde bereits seit 1985 die Anbindung an Europa realisiert
(vgl. Leiner et al. 2000).
3
1990 überlegen Wissenschaftler am Genfer Hochenergieforschungszentrum CERN,
wie man für die zivile Nutzung Dokumente weltweit abrufen kann.
Grafiken sollten einbindbar sein und vor allem sollte eine ,,Hypertextfunktionalität"
(siehe Kapitel 2.7.1, siehe Kapitel 5.1.2, siehe Glossar) vorhanden sein, so daß ein
Dokument auf andere verweisen konnte, auch wenn sie auf anderen
Internet-Rechnern gespeichert waren.
Es entstand das neue Internet-Protokoll ,,Hypertext-Transfer-Protocol" (http)(siehe
Kapitel 2.7.1, siehe Glossar). Das Projekt wurde ,,World-Wide-Web" (WWW)(siehe
Kapitel 2.7.1, siehe Glossar) getauft (vgl. Leiner et al. 2000).
Der eigentliche Triumphzug des Internet begann allerdings erst 1993 als der erste
,,Web-Browser" (NSCA-Mosaic)(siehe Kapitel 2.7.1, siehe Glossar) entwickelt
wurde. Diese waren leicht zu bedienen und machten das Internet für die breite
Masse zugänglich. Sie ermöglichten ein Navigieren im Internet zur Abfrage von
Informationen.
Die Grundidee des Internet wurde somit geboren.
Unter Berücksichtigung dieser historischen Zusammenhänge entstand auch
die Definition von 1995:
"Heute bezeichnet man mit Internet das Zusammenspiel aller (nicht nur im Umfeld
des Arpanet) über das gemeinsame Protokoll TCP/IP miteinander
kommunizierender Netze, durch das Wissenschaftler und akademische Lehrer in
Ausbildungs- und Regierungsinstitutionen, aber auch in kommerziellen
Umgebungen Kontakte finden und Informationen austauschen können" (Kuhlen
1995, Seite 165).
2001 definiert Kuhlen das Internet:
,,Heute wird mit Internet das Zusammenspiel aller (nicht nur im Umfeld des
Arpanet) über TCP/IP miteinander kommunizierender Netze bezeichnet, durch das
Wissenschaftler und akademische Lehrer in Ausbildungs- und
Regierungsinstitutionen, aber auch in kommerziellen, administrativen und privaten
Umgebungen kommunizieren, Informationen abrufen, sich darstellen und
Geschäfte, nicht nur, aber auch kommerzieller Art abwickeln können.
Kommunikation, Information, Präsentation und Geschäftstransaktion sind die
wesentlichen Bereiche jeder Netzkommunikation." (Kuhlen 2001)
2.2 Netzwerk
Verbindungen von Computern werden als Netzwerke bezeichnet wobei man nach
Klapsing verschiedene Größenordnungen unterscheiden kann (vgl. Klapsing 2001).
Werden Rechner einer Abteilung oder Firma miteinander verbunden, um die
Ressourcen, wie Drucker oder Festplatten der Einzelrechner gemeinsam zu nutzen,
so spricht man von Lokalen Netzen (,,Local-Area-Network", LAN)(siehe Glossar),
dabei können die Einzelrechner bis zu mehreren hundert Metern voneinander
entfernt sein. Die Datenübertragungsraten sind je nach eingesetzter Technik
unterschiedlich, jedoch im Vergleich zu reinen Internetverbindungen per ,,Modem"
(siehe Kapitel 2.6, siehe Glossar) oder ,,ISDN" (siehe Kapitel 2.6, siehe Glossar) ein
vielfaches schneller.
4
Sind die Distanzen der Einzelrechner noch größer, wie bei vernetzten Filialen
innerhalb einer Region oder Stadt, so spricht man von einem Großstadtnetz
(,,Metropolitan-Area-Network", MAN)(siehe Glossar) oder von einem
Weitverkehrsnetz (,,Wide-Area-Network, WAN)(siehe Glossar), wenn die Rechner
der Netzwerke überregional weit auseinander liegen. Dabei können die einzelnen
Netzwerke wiederum miteinander verbunden sein (siehe Darstellung 1).
Jedes Netzwerk hat unter bestimmten technischen Voraussetzungen die Möglichkeit
sich mit dem Internet zu verbinden. Durch technische Sicherheitseinrichtungen
erfolgt eine Trennung von öffentlichem Internet und privaten oder Firmennetzen.
Sollen eigene Informationen für das Internet zur Verfügung gestellt werden, so wird
im Netzwerk ein ,,Web-Server" (siehe Kapitel 2.6, siehe Glossar) installiert, der
nach entsprechender Konfiguration Informationen im Internet zur Verfügung stellen
kann.
Darstellung 1:
Aufbau von Netzwerken
WAN
MAN
MAN
LAN
LAN
LAN
LAN
LAN
LAN
Quelle: Eigene Darstellung
1994 wurden weltweit 12000 neue Teilnetze an das Internet angeschlossen, was
einer Größenordnung von 66 Teilnetzen pro Tag entspricht. Im Jahre 2000 sind
bereits 60 Millionen Rechner an das Internet angeschlossen (vgl. Heinzmann 2001,
Seite 1-3).
2.3 Transfer Control Protocol / Internet Protocol (TCP/IP)
Um jedoch zu gewährleisten, daß alle diese Rechner miteinander Daten
austauschen können, bedarf es einer gemeinsamen Sprache, die jeder Teilrechner
des Internets versteht. Ferner muß gewährleistet sein, daß die Daten auch
tatsächlich an den adressierten Rechner geschickt werden, oder von dem richtigen
Rechner abgerufen werden. Die gemeinsame Sprache die hier Verwendung findet,
ist das TCP/IP Protokoll.
5
Dabei ist TCP/IP für das Adressieren der Rechner, das Unterteilen der Daten in
Teilpakete, das Suchen des Empfängers im Netzwerk und für die Zuverlässigkeit
des Transports zuständig. Erst durch diesen gemeinsamen Standard ist es möglich,
daß weltweit unterschiedlichste Plattformen innerhalb des Internet miteinander
,,Datenkommunikation" betreiben können (siehe Glossar).
2.4 Domain-Name-Service
(DNS)
Für
die
Aufschlüsselung
der
einzelnen
Internet-Adressen
ist
der
,,Domain-Name-Service" (DNS)(siehe Glossar) verantwortlich.
Jeder an das Internet angeschlossene Rechner wird als ,,Host" oder ,,Host-Rechner"
(siehe Glossar) bezeichnet und erhält automatisch eine ihm fest oder
dynamisch
(also
pro
Einwahl)
zugewiesene
,,Internet-Protokoll-Adresse"
(IP-Adresse)(siehe Glossar).
Die IP-Adresse der Host-Rechner wird durch eine 32-Bit-Nummer, in der Form
111.222.333.444, dargestellt.
Wird diese Nummer in die Adressfeldeingabe eines Browsers eingegeben, so
erscheinen die unter dieser Adresse abgelegten Informationen.
Die 32-Bit-Nummer ist jedoch für den Anwender zumeist schwer zu merken und
umständlich zu handhaben, so daß das DNS einer IP-Adresse einen Namen
zuordnet, den ,,Domain-Namen" (siehe Glossar). Diese Zuordnung der IP-Adressen
zu den Domain-Namen wird durch sogenannte ,,Domain-Name-Server" (siehe
Glossar) realisiert. Jeder Domain-Name verfügt über eine eindeutige IP-Adresse,
die einmal programmiert, jedem Domain-Name-Server bekannt ist.
Unter diesem Domain-Namen können zahlreiche Dateien hinterlegt werden, die sich
durch den vollständigen ,,Uniform-Ressource-Locator" (URL)(siehe Kapitel 2.5,
siehe Glossar) direkt aufrufen lassen.
2.5 Uniform-Resource-Locator
(URL)
Der URL gibt einerseits an wie auf eine entsprechende Datei zugegriffen werden
soll, zum anderen, wo genau sich die entsprechende Datei im Internet befindet.
Der Aufbau einer URL ist wie folgt festgelegt:
Dienst://<3.Subdomäne>.<2.Subdomäne>.<1.Subdomäne>.<Top Level Domain>/Pfad/Datei
Beispiele:
1) http://teleteaching.mi-lab.fh-furtwangen.de/dienste/dienste3.html
2) http://www.gartencenter24.de/gc24/start.html.
3) http://www.online-concepts.de
Die einzelnen Elemente des URL:
a) Dienst:
Hier wird der zur Anwendung kommende Dienst (siehe Kapitel 2.7) definiert.
6
b) Subdomänen:
Im Beispiel 2) ist die hierarchisch niedrigste Subdomäne ,,www". Die Wertigkeit der
Domänen fällt von rechts nach links und wird durch Punkte voneinander getrennt.
Subdomänen können vorkommen sind aber nicht zwingend, so daß ein korrekter
vollständiger URL ohne Subdomänen zum Beispiel http://www.gartencenter24.de
heißen kann.
Subdomänen können jedoch als weitere Unterteilung eines Internetangebotes
verwendet werden. So weisen in obigem Beispiel 1) die 2. und 3. Subdomäne
,,teleteaching.mi-lab." auf die Fernunterrichtsangebote des Medieninformatiklabors
der Fachhochschule Furtwangen.
Die zweite Subdomäne wird auch als ,,Second-Level-Domain" bezeichnet.
FH-Furtwangen ist die erste Subdomäne oder wird auch als ,,First-Level-Domain"
bezeichnet.
c) Top-Level-Domain
(TLD):
Die TLD besteht entweder aus zwei Buchstaben für die sogenannten
,,Country-Code-Top-Level-Domains" (ccTLD) bzw. drei Buchstaben für die
,,Generic-Top-Level-Domains" (gTLD), wie ,,com oder ,,net", die einen generischen
Rückschluß zulassen können. Die ccTLD lassen einen geographischen bzw.
nationalen Rückschluß auf die verschiedensten Nationen der Welt zu. So steht die
TLD ,,de" für Deutschland, weitere sind z.B. ,,us" für die USA, ,,uk" für
Großbritannien, ,,jp" für Japan, ,,nl" für die Niederlande und ,,cr" für Costa Rica. Bei
den gTLD werden nur sieben unterschieden:
-
,,com"(engl.: Companies) für kommerzielle Seiten,
-
,,edu'"(engl.: Educational Institutions) für amerikanische Universitäten,
-
,,gov" (engl.: Governmental Entities) für Regierungsinstitutionen,
-
,,int" (engl.: International Organisations) für internationale Organisationen,
-
,,mil" (engl.: US Armed Forces) für das amerikanische Militär,
-
,,net" (engl.: Network) für Netzwerke,
-
,,org" (engl.: Organisations) für Organisationen.
(vgl. Webressources 2001)
d) Pfad:
Der Pfad gibt den Ort der Datei auf dem Server an, wobei die Verzeichnisse durch
,,/" getrennt werden.
e) Datei:
Die Dateiangabe folgt zum Schluß und gibt per ,,Extension" (siehe Glossar) den
Dateityp an.
Für die Top-Level-Domains gibt es entsprechende Verwaltungsbehörden, bei denen
ein Domain-Name registriert werden kann.
Soll beispielsweise eine ,,Firma.de" angemeldet werden, so muß diese bei der
deutschen De-Nic (www.denic.de), zuständig für alle deutschen Domain-Namen mit
der Top-Level-Endung ,,de", beantragt werden. Diese Domain-Namen können
jedoch nur durch ,,Internet-Service-Provider" (ISP)(siehe Glossar) beantragt
werden.
7
Ist der Domain-Name beantragt, so muß der DNS um diesen Eintrag erweitert
werden. In der Folge ist eine eindeutige Zuordnung von Domain-Namen und IP-
Adressen gegeben.
Verfügt der Antragsteller über keinen eigenen Web-Server, so kann bei den ISP
auch sogenannter ,,Web-Space" (siehe Glossar) beantragt werden. Auf diesem
Web-Space kann der Antragsteller dann Dateien für seine ,,Homepage" (siehe
Glossar) hinterlegen. Sie sind somit für alle an das Internet angeschlossenen
Rechner verfügbar.
2.6
Zugang zum Internet
Die technischen Möglichkeiten eine Verbindung zum Internet aufzubauen sind
mittlerweile vielfältig. So sind neben dem Verbindungsaufbau über die
Telekommunikationsleitungen auch Verbindungen über Richtfunk, TV-Kabel,
Satellitenanlagen, das Mobilfunk-Netz, das Stromnetz oder andere möglich. Die
Verbindung über das Telefonnetz ist jedoch immer noch die am meisten verbreitete
Methode, so daß hier nur diese Arten des Verbindungsaufbaus besprochen werden.
Per Modem oder ,,ISDNZugangstechnik" (siehe Glossar) erfolgt eine Verbindung
zum Internet über ISP oder ,,Online-Dienste" (siehe Glossar).
Die Verbindung entsteht durch das Wählen einer Telefonnummer, wobei Anwähler
und angewählter Adressat über die gleiche Verbindungstechnik verfügen müssen.
So werden per Modem nur Verbindungen über bestimmte ,,Modem-Protokolle"
(siehe Glossar) aufgebaut, und per ISDN ebenso nur bestimmte ISDN-
Verbindungen aufgebaut. Sie unterscheiden sich dabei in Ihrer Technik und der
möglichen maximalen Übertragungsgeschwindigkeit, die beim Aufrufen von
Internet-Inhalten oder anderer Daten die Geschwindigkeitsmaxima begrenzen.
Die Online-Dienste bieten ihren Mitgliedern dabei nicht nur die Einwahl ins Internet,
sondern darüber hinaus auch den Zugriff auf speziell aufbereitete Informationen, so
daß diese OnlineDienste auch als ,,Online-Service-Provider" (siehe Glossar)
bezeichnet werden.
Erfolgt die Einwahl über einen ISP, so stehen keine extra aufbereiteten
Informationen zur Verfügung, sondern es wird nur der Zugang zum Internet
hergestellt, also eine Netzwerkanbindung des eigenen Rechners an das Internet.
Durch die Anbindung an das Internet entstehen dem Kunden Kosten, die nach
unterschiedlichen Modellen abgerechnet werden.
Die Tarifierungen der ISP und der Online-Dienste sind sehr unterschiedlich. Teils
mit Grundgebühr, teils ohne, erfolgt die Abrechnung aber zumeist pro genutzter
Minute, wobei die Rechnungsstellung über die Telefonrechnung oder über eigene
Rechnungsstellung erfolgt.
Bei den Pauschaltarifen, den ,,Flatrates" (siehe Glossar), wird ein Preis pro Monat
unabhängig von der effektiven Nutzung fällig. Dabei besteht die Möglichkeit 24
Stunden am Tag die einzelnen Internet-Dienste ohne Unterbrechung zu nutzen.
Die ISP unterbrechen jedoch nach spätestens 24 Stunden die Verbindung. Eine
sofortige Wiedereinwahl ist möglich.
8
Dadurch wird ein Betreiben eigener Web-Server an den Anschlüssen weitestgehend
verhindert, da bei jeder Einwahl dem Rechner eine neue IP-Adresse zugewiesen
wird.
Soll jedoch ein eigener Web-Server in Betrieb genommen werden, so muß eine
ständige Verbindung mit dem Internet sichergestellt sein.
Dies kann durch sogenannte ,,Standleitungen" erfolgen.
Diese Standleitungen werden pauschal oder nach den Datenmengen, die über die
Standleitung pro Zeiteinheit fließen, berechnet.
Die ISP sowie auch die Online-Dienste bieten meist gebündelt mit dem Internet-
Zugang noch weitere Dienstleistungen wie eine eigene E-Mail, Web-Space für die
eigene ,,Web-Site" (siehe Glossar) oder auch spezielle Software, um die Verbindung
zum Internet herstellen zu können.
Die Betriebssysteme sind jedoch mittlerweile von Hause aus mit entsprechender
Software, wie das sogenannte ,,DFÜ-Netzwerk" (siehe Glossar) ausgestattet. Der
ISP gibt lediglich noch die Zugangsdaten wie Telefonnummer, Nutzername und
Paßwort bekannt, die in der entsprechenden Software dann einzutragen sind.
2.7 Dienste
Ist die Verbindung zum Internet hergestellt, können die einzelnen Dienste
angewendet werden.
Irrtümlicherweise wird das World-Wide-Web (WWW)(siehe Kapitel 2.7.1) oft als
Internet bezeichnet. Dabei ist das WWW nur ein Teil-Dienst des Internet.
Die wichtigsten Dienste des Internet sind das WWW und die elektronische Post (E-
Mail). Weitere Dienste sind das ,,File-Transfer-Protocol" (FTP)(siehe Kapitel 2.7.3,
siehe Glossar), mit dessen Hilfe Dateien von einem Rechner auf einen anderen
Rechner übertragen werden, die ,,Newsgroups" (,,Usenet")(siehe Kapitel 2.7.4),
sogenannte ,,Diskussionsforen", ,,Internet-Relay-Chat" (IRC)(siehe Kapitel 2.7.6),
und das ,,Wireless-Application-Protocol" (WAP)(siehe Glossar). Weitere Dienste wie
,,WAIS", ,,Gopher", ,,Archie" und ,,Telnet" haben durch Suchmaschinen, Internet-
Verzeichnisse und der grafischen WWW-Oberfläche an Bedeutung verloren. Bei FTP
und WAP wird zur Bezeichnung der Dienste das entsprechend zur Anwendung
kommende Protokoll genommen. Protokoll und Dienst tragen hier die gleiche
Bezeichnung.
Die Internet-Dienste setzen auf TCP/IP auf und werden wiederum durch Protokolle
standardisiert, welche deren reibungsloses Funktionieren regeln.
Die Dienste werden als erste Angabe des URL (siehe Kapitel 2.5) in die Adresszeile
des Browsers eingegeben, damit der Browser weiß, welchen Internet-Dienst er
ansprechen soll (siehe Darstellung 2). Wenn Sie den Dienst nicht angeben, wird
vom Browser automatisch ,,http://" ergänzt.
9
Darstellung 2:
Zuordnung der Dienst-Angabe in der Adresszeile im Browser zu den Internet-
Diensten
Dienstangabe im Browser
Internet-Dienst
http://
WWW
https://
WWW,
HTTP-Variante für sichere
Datenübertragung, z.B. beim Telebanking
oder Shopping
ftp://"
FTP
mailto:post@fachgartencenter.com E-Mail
news:de.rec.garten
Newsgroup
Quelle: eigene Darstellung, in Anlehnung an Zimmermann 2000
Alle Dienste des Internet basieren auf dem ,,Client-Server-Prinzip" (siehe
Darstellung 3, siehe Glossar). Dienste, wie das WWW oder E-Mail verwenden auf
der Benutzerseite ein Programm (z.B. Browser), welches auf dem ,,Client" (siehe
Glossar) läuft, das mit einem bestimmten Dienstrechner im Netz, dem
,,Server"(siehe Glossar) Daten austauscht. Der Server ist dabei i.d.R. für die
Datenhaltung zuständig, während der Client die Präsentation dieser Daten und die
Interaktion mit dem Benutzer übernimmt. So gibt der Nutzer am Client z.B. einen
URL in die Adresszeile des Browsers ein und erhält von dem Server die
angeforderte Datei. Dazu bedienen sich Client und Server eines genau definierten
Protokolls.
Darstellung 3:
Client-Server-Prinzip am Beispiel eines Web-Servers
Protokoll
Software / Prozeß
Server
Dateien
Datenbank
Dokument
Browser
Hardware / Computer
Client
Quelle: eigene Darstellung
10
2.7.1 World Wide Web (WWW)
Das WWW ist neben der E-Mail der mit am häufigsten (siehe Kapitel 3.1) genutzte
Dienst des Internet.
Durch das WWW sind Begriffe wie Informationsgesellschaft und Globalisierung mit
entstanden. Das WWW ermöglicht einen weltweiten Zugriff auf Informationen
jeglicher Art. So können Firmeninformationen aus Mittelamerika genauso abgerufen
werden, wie die aktuellsten Preise für Gartenbauprodukte der verschiedensten
Handelsplattformen in den Niederlanden oder Deutschland.
Ferner liegen die Informationen medienübergreifend in Form von Texten, Bildern,
Animationen oder Videos vor. Die tagesaktuellen Nachrichten liegen somit nicht
nur in Schriftform vor, sondern können z.B. unter www.tagesschau.de als Video
abgerufen werden. Auch Live-Bilder aus Gartencentern (www.dinger.de) können
betrachtet oder aber marketingpolitische Aktionen durch eindrucksvolle
Animationen präsentiert werden.
Darüber hinaus sind alle Informationen nicht nur weltweit abrufbar, sondern auch in
sekundenschnelle aktualisierbar.
Der Datentransfer der WWWInhalte wird durch das Hypertext-Transfer-Protocol
geregelt. Die Dokumente verfügen über eine Hypertextfunktionalität. Die
WWW-Inhalte können durch Verknüpfungen, sogenannte ,,Hyperlinks" (siehe
Glossar), verbunden werden.
So können diese Hyperlinks (auch Links genannt) auf Dokumente verweisen, die
auf anderen Rechnern des Internet liegen. Es besteht also die Möglichkeit weltweit
Dokumente miteinander in Beziehung zu setzen.
Daraus ergibt sich eine völlig neue Form der Navigation zwischen den Dokumenten
(siehe Kapitel 5.1.2).
Es müssen jedoch einige Bedingungen erfüllt sein, um all diese Dokumente weltweit
nicht nur abrufen, sondern auch lesen zu können.
So werden die Dokumente mittels der ,,Hypertext-Markup-Language" (HTML)(siehe
Glossar) programmiert. Die Worte ,,Markup-Language" beschreiben die Art der
Programmierung. Der Originaltext bekommt Markierungen, hinter denen Internet-
Werkzeuge stehen. Der Quelltext der Programmierung beinhaltet den Originaltext
und die Markierungen der Programmiersprache. Originaltext und
Programmelemente werden in einer HTML-Datei mit der Dateiextension ,,htm" oder
,,html" gespeichert.
Die HTML-Dateien werden in ,,Head" und ,,Body" unterteilt. Die im Bereich Body
programmierten Elemente enthalten den Originaltext mit seinen Markierungen, die
durch den Browser interpretiert und auf dem Bildschirm dargestellt werden. Die im
Bereich Head programmierten Elemente enthalten Informationen zur Datei selber,
wie Autor und Programmiersprache, aber auch Informationen für die
Suchmaschinen, sogenannte ,,Meta-Tags" (siehe Kapitel 5.2.2, siehe Glossar). Diese
sind für den Betrachter der Internet-Seiten unsichtbar. In die HTMLDateien
können alle Multimediaformate, wie Bilder, Audio, Animationen bis zu Videodateien
eingebunden werden.
Die Programmiersprache HTML liegt aktuell in der Version 4.01 vom 24.12.1999
vor, spezifiziert vom W3 Konsortium (www.w3.org). Sie gilt als Sprachstandard für
Dokumente im Internet (vgl. Münz 1998).
11
Für die Darstellung dieser Dokumente sind die Browser zuständig,
Anwendungsprogramme wie der Internet Explorer von Microsoft oder der Navigator
von Netscape.
Die Browser interpretieren die HTML-Dateien und stellen diese entsprechend ihrer
Markierungen dar. Dabei kann es jedoch zu unterschiedlichen Erscheinungsbildern
der Dokumente kommen, da die Art der Interpretation der einzelnen Browser
variiert. So kann es vorkommen, daß ein und dieselbe Datei vom Internet Explorer
anders dargestellt wird als vom Navigator. Dies ist insbesondere bei der
Programmierung eigener Seiten zu berücksichtigen.
Der Funktionsumfang der Browser, insbesondere in der Darstellung von
Multimediaformaten, ist eingeschränkt, kann aber mittels ,,Plugins" (siehe Glossar)
erweitert werden. Plugins sind kleine Zusatzprogramme für die Browser, die deren
Funktionsumfang um die Darstellung dieser speziellen Multimediaformate erweitert.
So können bestimmte Video- und Animationsdateien erst nach Installation eines
Plugins dargestellt werden.
2.7.2 E-Mail
Die elektronische Post ist der am meisten (siehe Kapitel 3.1) genutzte Dienst im
Internet. Das Prinzip der elektronischen Post ist dabei der konventionellen Post
ähnlich.
Zum Senden einer E-Mail kommt das ,,Simple-Mail-Transfer-Protocol" (SMTP)(siehe
Glossar) zum Einsatz. Zum Empfangen einer E-Mail hingegen das
,,Post-Office-Protocol" (POP3)(siehe Glossar).
In der Regel wird ein elektronischer Brief auf dem Mail-Client geschrieben, mit der
Destinationsadresse versehen (z.B. konstantin.thumm@online-concepts.de) und
abgeschickt.
Das Mail-System besorgt den Transport des Briefes zum Mail-Server der
Empfangsorganisation. Von dort holt sich der gewünschte Empfänger die Mail ab,
sobald er sein Mail-Client-Programm startet.
Bekannte MailClients sind neben anderen die Anwendungsprogramme ,,Outlook
Express" von Microsoft oder ,,Messenger" von Netscape.
Der erste Teil der E-Mail-Adresse ist zumeist ein Kürzel des Namens oder eine
funktionsbasierende Bezeichnung wie ,,Webmaster@fachgartencenter.com" oder
,,Sekretariat@firma.de". Der zweite Teil ist die zugehörige Domain des Mail-Servers.
Das Zeichen ,,@" trennt die E-Mail-Adresse in ihre beiden Bestandteile und stellt
den Zusammenhang beider dar. Das ,,@" wird als ,,at" bezeichnet, abgeleitet aus
dem englischen ,,bei". Der Name des Empfängers wird der Domain zugeordnet.
Wie auch bei der Briefpost erfolgt die Adressierung durch einen Kopf, wo Absender
und Adressat und ein Betreff angegeben werden. Die eindeutige Zustellung erfolgt
binnen Minuten. Wird das eigene Postfach, auf dem Mail-Server abgefragt, so
erfolgt diese Abfrage per Post-Office-Protocol. Diese Abfrage ist durch ein Paßwort
geschützt.
Die E-Mail kann in zwei Dateiformaten versendet werden. Als reine Textdatei im
,,ASCII-Format" (siehe Glossar) oder als HTML-Format. Allerdings sind nicht alle
E-Mail-Programme in der Lage das HTML-Format darzustellen (siehe Kapitel
5.3.2.1).
12
Wird eine E-Mail versandt, so kann durch Anhänge (Attachments) jede Art von
zusätzlichen Dateien mit der eigentlichen E-Mail versendet werden. Alle
Multimediadateien können per E-Mail als Anhang versendet werden. Ist die E-Mail-
Adresse falsch oder wurde eine unbekannte Empfängeradresse verwendet, so wird
die E-Mail mit einem Vermerk wieder zurückgesendet. Hingegen wird bei erfolgter
Zustellung keine Bestätigung der erfolgreichen Zustellung zurückgesandt.
2.7.3 File-Transfer-Protocol
(FTP)
Mit dem File-Transfer-Protocol (FTP) können Dateien von einem Rechner auf einen
anderen Rechner versendet werden. Dies ist beispielsweise bei der Erstellung einer
eigenen Web-Site nötig. Dabei werden die erstellten Daten von einem
Arbeitsrechner auf den Web-Server transferiert (Upload).
Andererseits können mittels FTP auch Softwarepakete aus dem Internet
heruntergeladen werden (Download).
FTP findet aber auch in Firmennetzwerken Verwendung, wenn Datensätze innerhalb
des Netzwerkes transferiert werden müssen.
Durch den Einsatz von grafischen Oberflächen nimmt diese Form der
Datentransferierung zumindest im Endnutzerbereich jedoch immer mehr ab (vgl.
Networkworld 2001).
Auf Seiten der Netzwerkadministration findet FTP jedoch immer noch Verwendung.
Zur Verwendung von FTP kommen spezielle Programme zum Einsatz, allerdings
können auch der Internet Explorer und der Netscape Navigator verwendet werden.
2.7.4 Newsgroup (Usenet)
Die Newsgroups dienen dem Interessenaustausch ihrer Mitglieder. Es gibt
zahlreiche Newsgroups zu den unterschiedlichsten Themen, bei denen die
Teilnehmer der Interessengemeinschaften zu übergeordneten Themen wie Biologie,
Hobby, Wirtschaft etc. Newsbeiträge senden und lesen können und darüber hinaus
die Möglichkeit haben zu den einzelnen Beiträgen zu antworten.
Es gibt kaum ein Thema, welches nicht schon durch eine Newsgroup vertreten ist.
Die Beiträge sind dabei öffentlich und unentgeltlich durch Abonnement einer
Newsgroup lesbar.
Der News-Dienst ist vergleichbar mit Mailing-Listen (siehe Kapitel 5.3.2). Personen,
welche sich für eine bestimmte Thematik interessieren, betrachten die News-Artikel
regelmäßig und reagieren auf gewisse Artikel, indem sie selbst Artikel publizieren.
Auch für diesen Dienst können neben anderen die Anwendungsprogramme Outlook
Express oder Netscape Messenger verwendet werden.
Die meisten ISP und Online-Dienste stellen News-Server zur Verfügung, von
welchen parallel zur E-Mail-Abfrage die abonnierten Newsgroups eingesehen
werden können und entsprechende Beiträge verfaßt und gesendet werden können.
Ein Artikel kann soweit das erwünscht ist, auf mehrere News-Server verteilt werden
und somit in kürzer als drei Stunden (vgl. Heinzmann 2001, Seite 1-15)
auf der gesamten Welt verteilt sein. Nationale Einschränkungen sind jedoch auch
möglich.
13
Dieser News-Service wird auch im WWW angeboten (www.deja.com).
Über die grafische Benutzeroberfläche des Browsers können News geschrieben und
gelesen werden. Mit einer komfortablen Suchmaschine lassen sich die Newsgroups
nach Stichworten durchsuchen (vgl. Heinzmann 2001, Seite 15-18).
2.7.5
Wireless-Application-Protocol (WAP)
Das Wireless-Application-Protocol (WAP)(siehe Glossar), das Protokoll für drahtlose
Anwendungen wie Mobiltelefone und ,,Personal-Digital-Assistants" (PDA) (siehe
Glossar), wurde vom WAP-Forum entwickelt, einer Organisation, der mehr als 400
Telekommunikationsunternehmen der verschiedensten Bereiche angehören.
Das WAPForum wurde 1997 gegründet. Es hat sich zum Ziel gesetzt, einen
einheitlichen und offenen Standard für mobile Internet-Dienste zu schaffen, um
eine weltweite Zusammenarbeit von drahtlosen Diensten sicherzustellen. WAP ist
daher nicht an einen bestimmten Mobilfunk-Standard gebunden. Zur Unterstützung
dieses Standards haben sich mittlerweile nahezu alle großen Hersteller von
tragbaren Geräten bekannt.
Die aktuelle Version 1.1 des Protokolls wurde im Juni 1999 spezifiziert.
Die Dokumente werden mittels der ,,Wireless-Markup-Language" (WML)(siehe
Glossar) speziell aufbereitet und müssen den besonders kleinen Displays der
Mobilfunktelefone oder des PDA angepaßt sein.
Es werden weder Tastatur noch Maus als Eingabegerät vorausgesetzt.
WML beschränkt sich allerdings nur auf reine Textinformationen und einfachste
Grafiken. Zum Einsatz kommen hier insbesondere Informationen, die ihren Vorteil
in der Schnelligkeit ihrer Informationsübermittlung finden, wie Börsendaten,
Wetterdaten und ähnliches. HTML-Dokumente des WWW können nicht dargestellt
werden. Für WAP müssen also extra Services bereit gestellt werden (vgl. WAP-
Forum 2001).
2.7.6 Internet-Relay-Chat (IRC)
Internet-Relay-Chat (IRC) wurde 1988 von dem Finnen Jarkko Oikaninen
entwickelt.
Das IRC ist ein Online-Kommunikationsforum im Internet. Es erlaubt
Internet-Teilnehmern weltweit miteinander zu kommunizieren. Der Chat-Dienst
verbindet mehrere Clients über einen Chat-Server.
Beim "Chatten" wird nicht das gesprochene, sondern das in den Computer getippte
Wort übertragen. Sobald ein Chat-Teilnehmer seinen Beitrag auf der Tastatur
eingetippt und mit der Eingabetaste abgeschickt hat, erscheint er auf den
Bildschirmen aller anderen Teilnehmer. So können mehrere Internet-Nutzer über
Chat-Angebote eines Online-Dienstes oder über das Internet-Relay-Chat online und
nahezu in Echtzeit miteinander kommunizieren.
Der Chat kann über eine entsprechende Web-Site laufen, wo die eigentliche
Chat-Anwendung gestartet werden kann. Diese Bereiche werden meist ,,Chat-
Room" genannt. Im IRC spricht man dagegen von "Channels". Channels sind
themengebundene Gesprächsgruppen. Manche Channels haben einen
Diskussionsleiter (Moderator), der Teilnehmer zum Chat zulassen oder davon
aussperren kann.
14
Weltweit gibt es Hunderte von IRC-Servern, die untereinander ihre Daten
austauschen. Nutzer lassen sich mit Hilfe spezieller IRC-Software mit einem dieser
Server verbinden, oder sie chatten direkt im WWW. Hierfür sind Plugins für den
Browser erforderlich, sogenannte ,,Chat-Plugins" oder ,,Java-Applets" (siehe
Glossar). Der IRC-Server dient gleichzeitig als Empfangs- und Sendestation für die
Nachrichten der IRC-Nutzer.
IRC eignet sich auch für Online-Konferenzen oder Absprachen zwischen
Teilnehmern, die räumlich voneinander getrennt sind. Dafür wird zu einem
festgelegten Termin ein eigener privater Kanal eröffnet, der nicht auf der Liste der
Channels erscheint.
Auch Unternehmen bieten ihren Kunden gelegentlich IRC-Channels als "Support-
Line" an, oder ermöglichen über einen Internet-Relay-Chat-Kanal den Austausch
ihrer Kunden untereinander (siehe Kapitel 8, vgl. Weil 2001).
2.8
Suchmaschinen und Kataloge
Um im Internet Web-Seiten der zahlreichen Anbieter zu finden oder ganz
spezifische Informationen möglichst schnell zu finden gibt es Suchmaschinen. Diese
Suchmaschinen werden durch die Eingabe Ihrer URL im Browser aufgerufen. Über
eine Eingabemaske werden Suchbegriffe eingegeben, nach der die Suchmaschine
im Anschluß das Internet durchforstet. Die Ergebnisse werden in Form von
Hyperlinks in einer Ergebnisliste anzeigt.
Suchmaschinen sind im Internet unablässig am Durchforsten der Web-Seiten um
einen Überblick über die enorme Fülle von Seiten zu erhalten. Dabei schaffen es
auch die Suchmaschinen nicht komplett alle Seiten des Internets zu erfassen.
Nach Krause lassen sich prinzipiell drei Arten von Suchmaschinen unterscheiden:
Echte Suchmaschinen, Verzeichnisse und hybride Suchmaschinen (vgl. Krause
2000, Seite 235).
Echte Suchmaschinen, auch Spider, Crawler oder Robot genannt, sind aus
mehreren Komponenten bestehende Systeme, die automatisch Adressen im
Internet einlesen und aus den damit verknüpften Informationen einen
durchsuchbaren Index erstellen.
Die Suchsoftware der Suchmaschine durchsucht Web-Dokumente,
liest diese und verfolgt die enthaltenen Links. Dieser Vorgang wird in
regelmäßigen Zeitabständen wiederholt.
Die so gefundenen Informationen werden an die Indizierungssoftware
weitergegeben, die diese Informationen strukturiert. Abhängig von der
Indizierungsmethode werden Teile der gefundenen Informationen Meta-Tags, Titel,
Überschrift, Textanfang, Text in einen Index umgewandelt und in der Datenbank
der Suchmaschine gespeichert. Erst dann sind die Informationen über eine
Suchabfrage auffindbar.
15
Das Suchprogramm durchsucht den Index nach Übereinstimmungen mit der
Sucheingabe, bewertet die Relevanz der gefundenen Informationen und zeigt eine
sortierte Trefferliste an.
In diesen "maschinell" erstellten Indizes erfolgt die Suche anhand von
Stichworteingaben. Um nicht mit einer riesigen, nicht auswertbaren Trefferzahl als
Ergebnis arbeiten zu müssen, ist eine sinnvolle Verknüpfung von Suchbegriffen
erforderlich.
Die bekannteste echte Suchmaschine ist AltaVista (www.digital.altavista.com).
Weitere wichtige echte Suchmaschinen sind Google (www.google.com),
Fireball (www.fireball.de), Excite (www.excite.com und www.excite.de für
Deutschland), Lycos (www.lycos.com und www.lycos.de für Deutschland), Hotbot
(www.hotbot.com), Infoseek (www.infoseek.com und www.infoseek.de für
Deutschland) und andere.
Verzeichnisse oder auch Kataloge hingegen sind manuell selektierte Link-Listen, die
ähnlich einem Katalog in verschiedene Kategorien unterteilt sind.
Diese arbeiten ohne Robot, so daß die Seiten bei den Katalogen angemeldet werden
müssen, wenn diese dort gefunden werden sollen. Betreiber von Web-Seiten
müssen ihre Seiten bei dem Verzeichnis für eine bestimmte Kategorie anmelden.
Sie werden von den Mitarbeitern bearbeitet und bei Eignung in das Verzeichnis mit
aufgenommen. Dies geschieht subjektiv nach unterschiedlichen Qualitätskriterien.
Der Unterschied zu echten Suchmaschinen besteht hier in der manuellen
Vorselektion der zu durchsuchenden Web-Seiten. Das Angebot der Verzeichnisse
kann meist auch per Suchabfrage durchsucht werden.
Der bekannteste Katalog ist Yahoo (www.yahoo.com und www.yahoo.de für
Deutschland).
Weitere wichtige Kataloge sind Web.de (www.web.de) und Lotse (www.lotse.de).
Hybride Suchmaschinen sind Kombinationen von beiden Arten.
Einige echte Suchmaschinen betreiben zusätzlich ein Verzeichnis aus dem
Hauptindex.
Darüber hinaus gibt es noch Meta-Suchmaschinen, die eine Suchabfrage an
mehrere echte Suchmaschinen weiterleiten und deren jeweilige Ergebnisse in einer
einzigen Liste liefern. (z.B. www.metacrawler.com oder www.metager.de für
Deutschland).
16
3 Aktuelle
Zahlen
3.1
Statistiken und Studien
Die Messung der genauen Anzahl an Internet-Nutzern stellt allgemein ein
schwieriges Unterfangen dar, weswegen bisher kaum verifizierbare
Teilnehmerzahlen vorliegen. Durch die meßbare Anzahl der Internet-Hosts lassen
sich die möglichen Teilnehmerzahlen der Internetanwender schätzen, da letztlich
über die Hosts bzw. Computer mit Internet-Adresse der Zugang in das Netz erfolgt.
Die geläufigen Methoden variieren bezüglich ihres Multiplikatorfaktors, dieser wird
unterschiedlich hoch angesetzt. Die Schätzungen variieren zwischen 3 und 7,5
Anwendern pro Rechner. Mit der vorhandenen Zahl der Internet-Hosts kann somit
die mögliche Anzahl der Nutzer geschätzt werden, wobei die Hostzahl bei einer
optimistischen Variante mit 7,5 oder bei einer konservativen mit 3 multipliziert wird
(vgl. NUA 2001). Statistiken mit Angaben über die Anzahl von Internet-Nutzern
müssen somit kritisch betrachtet werden.
Die NUA Ltd. gibt auf ihren Internet-Seiten an, daß bereits im Dezember 1998 150
Millionen Menschen weltweit Internet-Nutzer (Erwachsene und Kinder) waren.
Nach nur 22 Monaten hat sich diese Zahl verdoppelt, im November 2000 wurden
genau 407,1 Millionen Menschen gezählt (vgl. NUA 2001a).
Allerdings verteilen sich diese sehr unterschiedlich auf die einzelnen Kontinente
(siehe Darstellung 4). So sind allein in Nordamerika (einschließlich Kanada) 43 %
der Internet-Nutzer zu finden.
In Afrika und dem mittleren Osten wurden hingegen zum gleichen Zeitpunkt nur
5,51 Millionen Menschen gezählt, was einem globalen Anteil von etwa 1,5 %
entspricht.
Darstellung 4:
Internet-Nutzer weltweit
Ort
Anzahl Internet-Nutzer
Welt total
407,1 Millionen
Afrika
3,11 Millionen
Asien/Pazifik (einschl. Nz, Aus)
104,88 Millionen
Europa
113,14 Millionen
Mittlerer Osten
2,40 Millionen
Kanada und USA
167,12 Millionen
Lateinamerika
16,45 Millionen
Quelle: eigene Darstellung in Anlehnung an Nua 2000b
Betrachtet man ausschließlich die Host-Rechner und deren
Top-Level-Domain-Zuordnung so ergibt sich ein ähnliches Bild.
93 Millionen Host-Rechner wurden im Juli 2000 vom ,,Internet-Software-
Consortium" gezählt (vgl. ISC 2001). Dabei entfielen 35 % der Rechner auf die TLD
,,com". Erst nach einigem Abstand folgen ,,net" und ,,edu".
17
Diese lassen keine eindeutige geographische Zuordnung zu, jedoch stammen die
nächstplazierten TLD aus Japan, Nordamerika, Großbritannien und Deutschland.
Die De-Nic macht Angaben von 11,25 Millionen Hosts im europäischen Raum und
von 1,9 Millionen Hosts in Deutschland zum Oktober 2000 (vgl. De-Nic 2000).
So führt die De-Nic auch eine Statistik der angemeldeten Domain-Namen mit der
TLD ,,de" (siehe Darstellung 5).
Die Anmeldung von neuen Domain-Namen steigerte sich kontinuierlich. Im Januar
1994 waren 1123 Domain-Namen registriert worden, die in den Folgejahren noch
um das 1000fache gesteigert werden sollten.
Der eigentliche Boom der Domain-Namen-Anmeldungen begann etwa Ende 1998,
Anfang 1999. Erschwingliche Preise auch für Privatpersonen ließen die Zahlen
enorm wachsen. So wurden bis zum Januar 1999 324000 Domain-Namen
angemeldet. Die aktuellsten Zahlen vom Dezember 2000 (vgl. De-Nic 2000a)
liegen bei 3,69 Millionen.
Darstellung 5:
Anzahl Domains mit der Endung ,,.de" bis Oktober 2000
0
500000
1000000
1500000
2000000
2500000
3000000
3500000
4000000
Jan 94Mai 94Sep 94Jan 95Mai 95Sep 95Jan 96Mai 96Sep 96Jan 97Mai 97Sep 97Jan 98Mai 98Sep 98Jan 99Mai 99Sep 99Jan 00Mai 00Sep 00
Datum
Anzahl Domains
Quelle: eigene Darstellung in Anlehnung an De-Nic 2000b
Die GfK AG Medienforschung hat im Zeitraum vom 24.05.2000 bis zum 05.07.2000
computergestützte Telefoninterviews bei 8004 Personen im Alter zwischen 14 und
69 Jahren mit Telefonanschluß durchgeführt.
18
Durch die Verwertung dieser Daten können repräsentative Aussagen zur Nutzung
des Internet in Deutschland gemacht werden.
So nutzten im August 2000 34 % der deutschen Bevölkerung zwischen 14 und 69
Jahren das Internet. Die Zunahme dieser Nutzer auf 18 Millionen Menschen ist
allerdings nicht ganz so rasant verlaufen wie in der Vergangenheit (vgl. Gfk 2000,
Seite 9). Zwar stellen die 20-49-jährigen noch immer die größte Nutzergruppe im
Internet, allerdings sind deren Zuwächse nicht sehr hoch. Anders hingegen die über
50-jährigen, die den stärksten Zuwachs bei allen Gruppen aufweisen.
Vor fünf Jahren machte diese Gruppe einen Anteil von 3% aus, der sich zum August
2000 auf 18% steigerte (vgl. iBusiness 2000).
In den jüngeren Altersgruppen ist die InternetNutzung fast schon zu einem
normalen Alltagsverhalten geworden. Fast jeder zweite unter 40-jährige nutzt
mittlerweile das Internet (siehe Darstellung 6) (vgl. Gfk 2000, Seite 26).
Darstellung 6:
Internet-Nutzer in Deutschland in der Zeit von 24.05-05.07.2000 nach
Altersgruppen
30%
60%
47%
34%
29%
19%
5%
34%
58%
52%
38%
35%
23%
10%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
Gesamt
14 - 19 J.
20 - 29 J.
30 - 39 J.
40 - 49 J.
50 - 59 J.
60 - 69 J.
Feb 00
Aug 00
Quelle: eigene Darstellung in Anlehnung an GfK 2000, Seite 9
Die einzelnen Dienste des Internet wurden unterschiedlich intensiv genutzt.
Hier ist eine eindeutige Vormachtstellung der E-Mail zu erkennen. 76% der 18
Millionen Menschen in Deutschland nutzen die elektronische Post. Es werden mit
48% überwiegend private und mit 28% geschäftliche E-Mails zur Kommunikation
eingesetzt. Zwar ist diese Zahl durch mögliche Doppelnennungen nicht eindeutig,
jedoch ist die überwiegende Nutzung dieses Dienstes erkennbar.
19
Die Web-Seiten werden darüber hinaus noch von immerhin 36 % der Internet-
Nutzer besucht (siehe Darstellung 7) (vgl. GfK 2000, Seite 14).
Darstellung 7:
Nutzungsstrukturen der 14-69jährigen im Internet
in der Zeit von 24.05.-
05.07.00
42%
33%
25%
21%
14%
48%
36%
28%
24%
22%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
Private E-Mail
Surfen
Geschäftl. E-Mail Online-Banking
Wirtschaftsinfos
Feb 00
Aug 00
Quelle: eigene Darstellung in Anlehnung an GfK 2000, Seite 14
Die Geschlechterverteilung änderte sich wenig, nach wie vor sind 60% männliche
und 40 % weibliche Benutzer aktiv mit dem Internet beschäftigt (vgl. Gfk 2000,
Seite 16). Der Computer hat allerdings nach Angaben von Comcult seinen
Spitzenplatz bei den Interessen eingebüßt und ist dem Bedürfnis nach Nachrichten
und Bildung gewichen (vgl. Comcult 2001). Das noch immer hohe Bildungsniveau
sollte bei der Informationsbereitstellung berücksichtigt werden, da 38% mittlere
Reife, 18% Abitur
und 19% ein Studium abgeschlossen haben.
Besonders beeindruckend ist die Einkommensstruktur: Das
Haushaltsnettoeinkommen liegt bei 28% über 6000 DM monatlich.
Die Bedeutung der 25- bis 49-jährigen Personen für die Entwicklung erfolgreicher
Markeing-Maßnahmen wird mit diesen Zahlen bestätigt.
Die GfK AG folgert daraus: ,,WWW-User sind nach wie vor eine äußerst attraktive
Zielgruppe. Sie sind einkommensstark, überdurchschnittlich
gebildet, optimistisch und sehr reagibel."(GfK 2000, Seite 21).
20
3.2 Statistiken zur Internet-Nutzung vom Gartenbau-Einzelhandel
Über die Internet-Nutzung von Seiten der Gartencenter und Blumenfachgeschäfte
liegen keine detaillierteren Informationen vor (vgl. Kuegler 2000, Altmann 2000).
Es lassen sich aber anhand von Umfragen zumindest Tendenzen aufzeigen.
Im Februar 1999 machte das Institut für gärtnerische Betriebslehre und EDV an der
Fachhochschule in Weihenstephan eine Umfrage unter 15 Gartencentern und
Gärtnereien, die bereits über eine eigene Web-Site verfügten.
Alle Befragten nutzten das Internet zur Kommunikation per E-Mail und zur
Informationsbeschaffung im Web, wobei alle die E-Mail Kommunikation als wichtig
und sehr wichtig einschätzten. Auf den eigenen Internet-Seiten wurden
dementsprechend eigene Informationen angeboten und neben dem Service per E-
Mail auch für die Zukunft als wichtig eingeschätzt.
Das Anbieten eigener Dienstleistungen oder Produkte über das Internet, war bei
einem Betrieb bereits realisiert und bei einem Drittel der Betriebe in Planung.
Rund die Hälfte der Betriebe nutzt den Einkauf per Online-Shops bei Lieferanten
und sonstigen Anbietern.
Diese Zahlen können durch eine Panelumfrage der BBE Unternehmensberatung im
Auftrag der Thalacker Medien bestätigt werden. Zur monatlich stattfindenden
Panelumfrage unter 50 Gartencentern und Blumenfachgeschäften wurden im
Oktober 2000 einmalig zusätzliche Fragen zum Internet gestellt.
Hierbei handelt es sich allerdings nicht um Gartencenter, die bereits eine
Internetpräsenz haben, wie bei der Untersuchung in Weihenstephan.
45% der befragten Gartencenter verfügten über einen Internet-Zugang und eine
eigene E-Mail-Adresse. Da alle Gartencenter mit Zugang zum Internet auch über
eine E-Mail-Adresse verfügen, wird deren Wichtigkeit bestätigt.
Das eigene Angebot stellen bereits 15 Gartencenter auch im Internet vor. 36% aller
befragten nutzen das Internet geschäftlich, allerdings nur 15% zum Anbieten
eigener Waren oder Dienstleistungen.
Die eigene Informationsbeschaffung und die Nutzung der E-Mail sind die
Hauptmerkmale einer Nutzung der Gartencenter im Internet. Auch die
Möglichkeiten des Einkaufs für das eigene Geschäft werden geschätzt. 14% nutzen
das Internet zum Einkauf. Je ein Blumenfachgeschäft und ein Gartencenter bezogen
ihre Ware zu 80% bzw. sogar zu 100% über das Internet.
Der Verkauf der eigenen Waren über das Internet wurde von 15% der Befragten
vorgenommen. Allerdings können nur 7% aller befragten Unternehmen Angaben
zum Umsatz über das Internet machen.
Ein Drittel der Unternehmen nutzt bereits das Internet. E-Mail und die eigene
Informationsbeschaffung stehen dabei an erster Stelle.
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Originalausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2001
- ISBN (eBook)
- 9783832449681
- ISBN (Paperback)
- 9783838649689
- DOI
- 10.3239/9783832449681
- Dateigröße
- 1.2 MB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- Beuth Hochschule für Technik Berlin – Verfahrens- und Umwelttechnik
- Erscheinungsdatum
- 2002 (Januar)
- Note
- 1,3
- Schlagworte
- marketing online-marketing internet gartenbau
- Produktsicherheit
- Diplom.de