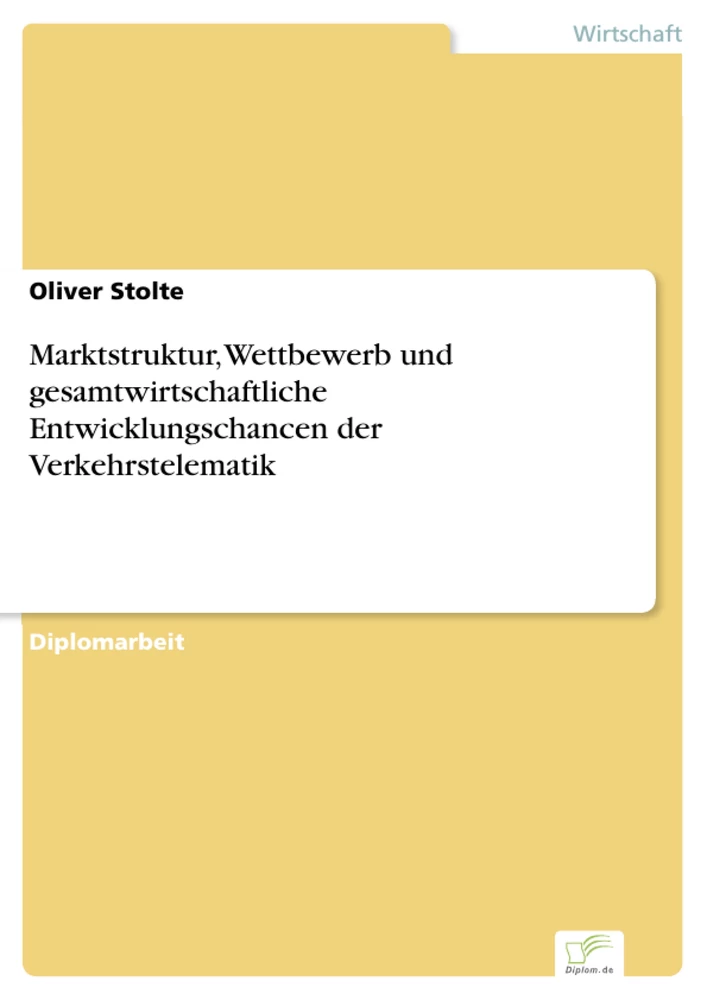Marktstruktur, Wettbewerb und gesamtwirtschaftliche Entwicklungschancen der Verkehrstelematik
©2001
Diplomarbeit
101 Seiten
Zusammenfassung
Inhaltsangabe:Einleitung:
Das heutige quantitative Verkehrsaufkommen entwickelt sich zunehmend zu einem Problem für unsere moderne Gesellschaft. In den letzten Jahrzehnten und insbesondere seit der Osterweiterung ist das Verkehrsaufkommen in Deutschland stark angestiegen. Diese Entwicklung ist hauptsächlich auf das kontinuierliche Wirtschaftswachstum zurückzuführen. Mit steigendem Verkehrsaufkommen ging jedoch kein proportionaler Ausbau der Infrastruktur einher. Vielmehr stagniert hier die Entwicklung, so daß das heutigen Straßennetz immer häufiger das Verkehrsaufkommen nicht mehr bewältigen kann.
Seit 1950 stieg der Straßengüterverkehr von 7,1 Mrd. Tonnenkilometer auf 315,9 Mrd. Der Straßenpersonenverkehr stieg im gleichen Zeitraum von 24,5 Mrd. auf 75,9 Mrd. Personenkilometer. Nach Analyse der deutschen Länderverkehrsminister im Jahr 1998 fehlen allein bei der Bundesfernstraßen 4 Mrd. DEM für Neu- und Ausbau sowie die Instandhaltung. Dies führt zu zäh-fließendem Verkehr, Staus sowie Parkplatzproblemen. Damit gehen stark ansteigende externe Kosten einher. Die externen Kosten bestehen zum größten Teil aus Emissionskosten. Weiterhin sind Lärm, Verbauung des Raumes u.ä. externe Kosten. Diese belasten die Allgemeinheit und werden nicht vom Nutzer durch Entschädigungen kompensiert.
Diese Entwicklung verstärkt sich in zunehmendem Maße, so daß die Gesellschaft immer mehr durch den Straßenverkehr belastet wird. Jüngste Prognose gehen von einem Wachstum des Personenverkehrs um 20 % sowie des Güterverkehrs um 64 % bis zum Jahr 2015 aus. Unter anderem werden die Verkehrsleistungen im Güterverkehr auf ca. 600 Mrd. Tonnenkilomter bis zum Jahr 2015 ansteigen. Hier wird der Verkehrsträger Straße weiterhin den größten Teil tragen.
Inhaltsverzeichnis:Inhaltsverzeichnis:
1.Telematikanwendungen im Verkehrssektor und ihre gesamtwirtschaftliche Bedeutung1
2.Marktstrukturanalyse für Verkehrstelematik5
2.1Produkte und Anbieter5
2.1.1Die Produktkette telematischer Leistungen und ihre Marktsegmente5
2.1.1.1Individual-Produkte10
2.1.1.1.1Navigation P + G10
2.1.1.1.2Flotten- und Frachtenmanagement G12
2.1.1.1.3Ferndiagnose P + G13
2.1.1.1.4Sicherheitsüberwachung und Notfallsysteme P + G14
2.1.1.1.5Abstands- und Geschwindigkeitsbeeinflußlung P14
2.1.1.1.6Abstandswarnung P14
2.1.1.1.7Abbiege- und Spurwechselassistenz P + G15
2.1.1.1.8Informationssysteme P15
2.1.1.1.9Kommunikation P + G16
2.1.1.1.10Unterhaltung P16
2.1.1.2Kollektive […]
Das heutige quantitative Verkehrsaufkommen entwickelt sich zunehmend zu einem Problem für unsere moderne Gesellschaft. In den letzten Jahrzehnten und insbesondere seit der Osterweiterung ist das Verkehrsaufkommen in Deutschland stark angestiegen. Diese Entwicklung ist hauptsächlich auf das kontinuierliche Wirtschaftswachstum zurückzuführen. Mit steigendem Verkehrsaufkommen ging jedoch kein proportionaler Ausbau der Infrastruktur einher. Vielmehr stagniert hier die Entwicklung, so daß das heutigen Straßennetz immer häufiger das Verkehrsaufkommen nicht mehr bewältigen kann.
Seit 1950 stieg der Straßengüterverkehr von 7,1 Mrd. Tonnenkilometer auf 315,9 Mrd. Der Straßenpersonenverkehr stieg im gleichen Zeitraum von 24,5 Mrd. auf 75,9 Mrd. Personenkilometer. Nach Analyse der deutschen Länderverkehrsminister im Jahr 1998 fehlen allein bei der Bundesfernstraßen 4 Mrd. DEM für Neu- und Ausbau sowie die Instandhaltung. Dies führt zu zäh-fließendem Verkehr, Staus sowie Parkplatzproblemen. Damit gehen stark ansteigende externe Kosten einher. Die externen Kosten bestehen zum größten Teil aus Emissionskosten. Weiterhin sind Lärm, Verbauung des Raumes u.ä. externe Kosten. Diese belasten die Allgemeinheit und werden nicht vom Nutzer durch Entschädigungen kompensiert.
Diese Entwicklung verstärkt sich in zunehmendem Maße, so daß die Gesellschaft immer mehr durch den Straßenverkehr belastet wird. Jüngste Prognose gehen von einem Wachstum des Personenverkehrs um 20 % sowie des Güterverkehrs um 64 % bis zum Jahr 2015 aus. Unter anderem werden die Verkehrsleistungen im Güterverkehr auf ca. 600 Mrd. Tonnenkilomter bis zum Jahr 2015 ansteigen. Hier wird der Verkehrsträger Straße weiterhin den größten Teil tragen.
Inhaltsverzeichnis:Inhaltsverzeichnis:
1.Telematikanwendungen im Verkehrssektor und ihre gesamtwirtschaftliche Bedeutung1
2.Marktstrukturanalyse für Verkehrstelematik5
2.1Produkte und Anbieter5
2.1.1Die Produktkette telematischer Leistungen und ihre Marktsegmente5
2.1.1.1Individual-Produkte10
2.1.1.1.1Navigation P + G10
2.1.1.1.2Flotten- und Frachtenmanagement G12
2.1.1.1.3Ferndiagnose P + G13
2.1.1.1.4Sicherheitsüberwachung und Notfallsysteme P + G14
2.1.1.1.5Abstands- und Geschwindigkeitsbeeinflußlung P14
2.1.1.1.6Abstandswarnung P14
2.1.1.1.7Abbiege- und Spurwechselassistenz P + G15
2.1.1.1.8Informationssysteme P15
2.1.1.1.9Kommunikation P + G16
2.1.1.1.10Unterhaltung P16
2.1.1.2Kollektive […]
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
ID 4952
Stolte, Oliver: Markstruktur, Wettbewerb und gesamtwirtschaftliche Entwicklungschancen der
Verkehrstelematik / Oliver Stolte - Hamburg: Diplomica GmbH, 2002
Zugl.: Köln, Universität, Diplom, 2001
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte, insbesondere die
der Übersetzung, des Nachdrucks, des Vortrags, der Entnahme von Abbildungen und Tabellen,
der Funksendung, der Mikroverfilmung oder der Vervielfältigung auf anderen Wegen und der
Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen, bleiben, auch bei nur auszugsweiser Verwertung,
vorbehalten. Eine Vervielfältigung dieses Werkes oder von Teilen dieses Werkes ist auch im
Einzelfall nur in den Grenzen der gesetzlichen Bestimmungen des Urheberrechtsgesetzes der
Bundesrepublik Deutschland in der jeweils geltenden Fassung zulässig. Sie ist grundsätzlich
vergütungspflichtig. Zuwiderhandlungen unterliegen den Strafbestimmungen des
Urheberrechtes.
Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in diesem
Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme, dass solche
Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei zu betrachten
wären und daher von jedermann benutzt werden dürften.
Die Informationen in diesem Werk wurden mit Sorgfalt erarbeitet. Dennoch können Fehler nicht
vollständig ausgeschlossen werden, und die Diplomarbeiten Agentur, die Autoren oder
Übersetzer übernehmen keine juristische Verantwortung oder irgendeine Haftung für evtl.
verbliebene fehlerhafte Angaben und deren Folgen.
Diplomica GmbH
http://www.diplom.de, Hamburg 2002
Printed in Germany
Wissensquellen gewinnbringend nutzen
Qualität, Praxisrelevanz und Aktualität zeichnen unsere Studien aus. Wir
bieten Ihnen im Auftrag unserer Autorinnen und Autoren Wirtschafts-
studien und wissenschaftliche Abschlussarbeiten Dissertationen,
Diplomarbeiten, Magisterarbeiten, Staatsexamensarbeiten und Studien-
arbeiten zum Kauf. Sie wurden an deutschen Universitäten, Fachhoch-
schulen, Akademien oder vergleichbaren Institutionen der Europäischen
Union geschrieben. Der Notendurchschnitt liegt bei 1,5.
Wettbewerbsvorteile verschaffen Vergleichen Sie den Preis unserer
Studien mit den Honoraren externer Berater. Um dieses Wissen selbst
zusammenzutragen, müssten Sie viel Zeit und Geld aufbringen.
http://www.diplom.de bietet Ihnen unser vollständiges Lieferprogramm
mit mehreren tausend Studien im Internet. Neben dem Online-Katalog und
der Online-Suchmaschine für Ihre Recherche steht Ihnen auch eine Online-
Bestellfunktion zur Verfügung. Inhaltliche Zusammenfassungen und
Inhaltsverzeichnisse zu jeder Studie sind im Internet einsehbar.
Individueller Service
Gerne senden wir Ihnen auch unseren Papier-
katalog zu. Bitte fordern Sie Ihr individuelles Exemplar bei uns an. Für
Fragen, Anregungen und individuelle Anfragen stehen wir Ihnen gerne zur
Verfügung. Wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit.
Ihr Team der Diplomarbeiten Agentur
Seite II
Marktstruktur, Wettbewerb und gesamtwirtschaftliche
Entwicklungschancen der Verkehrstelematik
Seite
Gliederung
II
1.
Telematikanwendungen im Verkehrssektor und ihre gesamtwirt-
schaftliche Bedeutung
1
2.
Marktstrukturanalyse für Verkehrstelematik
5
2.1
Produkte und Anbieter
5
2.1.1
Die Produktkette telematischer Leistungen und ihre Markt-
segmente
5
2.1.1.1
Individual-Produkte
10
2.1.1.1.1
Navigation P + G
10
2.1.1.1.2
Flotten- und Frachtenmanagement - G
12
2.1.1.1.3
Ferndiagnose P + G
13
2.1.1.1.4
Sicherheitsüberwachung und Notfallsysteme P + G
14
2.1.1.1.5
Abstands- und Geschwindigkeitsbeeinflußlung - P
14
2.1.1.1.6
Abstandswarnung - P
14
2.1.1.1.7
Abbiege- und Spurwechselassistenz P + G
15
2.1.1.1.8
Informationssysteme P
15
2.1.1.1.9
Kommunikation P + G
16
2.1.1.1.10
Unterhaltung - P
16
2.1.1.2
Kollektive Telematiksysteme
16
2.1.1.2.1
Lokales, regionales und überregionales Verkehrs-
management
17
2.1.1.2.2
Verkehrsabhängige Lichtsignalsteuerung
17
2.1.1.2.3
Beeinflussung mit Wechselverkehrszeichen
18
2.1.1.2.4
Automatische Zahlungssysteme, road pricing
18
2.1.2
Telematikanbieter
19
2.1.2.1
ADAC - Deutschland
19
2.1.2.2
Alpine - USA
20
2.1.2.3
BMW - Deutschland
20
2.1.2.4
Bosch/Blaupunkt - Deutschland
22
2.1.2.5
CAA - Deutschland
22
2.1.2.6
Comroad - Deutschland
23
2.1.2.7
DaimlerChrysler - Deutschland
24
Seite III
2.1.2.8
Deutsche Gesellschaft für Verkehrsdaten - Deutschland
25
2.1.2.9
Deutsche Telekom/Tegaron - Deutschland
26
2.1.2.10
Ford - USA
27
2.1.2.11
GAP - Deutschland
28
2.1.2.12
GM - USA
28
2.1.2.13
Harman/Becker Group - Deutschland
29
2.1.2.14
Landesbetrieb NRW Straßen - Deutschland
30
2.1.2.15
Minorplanet - England
31
2.1.2.16
Navtech - USA
31
2.1.2.17
Nissan - Japan
32
2.1.2.18
OHB Teledata - Deutschland
33
2.1.2.19
Philips Niederlande/England
33
2.1.2.20
PSA Peugeot/Citroen - Frankreich
34
2.1.2.21
Renault - Frankreich
34
2.1.2.22
Teleatlas - Niederlande
34
2.1.2.23
Trafficmaster England
35
2.1.2.24
Vodafone/Mannesmann/Passo - England
36
2.1.2.25
VW (Audi, Seat, Skoda, VW) - Deuschland
37
2.1.2.26
Zenrin - Japan
38
2.2
Marktformen und Unternehmensstrukturen
39
2.3
Intermodale Telematikanwendungen
41
2.4
Zur Funktionsfähigkeit des Wettbewerbs
41
3.
Marktvolumen, -verhalten und -entwicklung
49
3.1
Europäische Union
50
3.2
Internationale Vergleiche: EU-USA und EU-Asien
51
3.3
Weltmarkt
55
3.4
Marktperspektiven für Telematik in Deutschland
57
3.5
Entwicklungen der Marktsegmente
58
4.
Gesamtwirtschaftliche Bedeutung der Verkehrstelematik
59
4.1
Verkehrliche Wirkungen sowie Kostenersparnisse
59
4.1.1
Individual-Produkte auf Autobahnen
61
4.1.2
Kollektive Telematiksysteme auf Autobahnen
65
4.1.3
Telematik im städtischen Bereich
67
4.1.4
Abschließende Betrachtung der Nutzen-Kosten-Relationen
67
4.2
Wachstums- und beschäftigungspolitische Impulse der Ver-
kehrstelematik
67
4.3
Ökologische Wirkungen des Telematikeinsatzes
68
Seite IV
5.
Wirtschafts- und Wettbewerbspolitische Folgerungen
74
5.1
Aufgaben des Staates
74
5.2
Wettbewerbskontrolle
78
5.3
Innovatitionsfähigkeit des Marktes
79
6.
Literaturverzeichnis
V
7.
Abbildungsverzeichnis
IX
8.
Tabellenverzeichnis
X
9.
Abkürzungsverzeichnis
XII
10. Erklärung
XV
11. Lebenslauf
XVI
12. Unterschrift
XIX
Seite 1
1. Telematikanwendungen im Verkehrssektor und ihre gesamtwirtschaftliche
Bedeutung
Das heutige quantitative Verkehrsaufkommen entwickelt sich zunehmend zu ei-
nem Problem für unsere moderne Gesellschaft. In den letzten Jahrzehnten und
insbesondere seit der Osterweiterung ist das Verkehrsaufkommen in Deutsch-
land stark angestiegen. Diese Entwicklung ist hauptsächlich auf das kontinuier-
liche Wirtschaftswachstum zurückzuführen.
Mit steigendem Verkehrsaufkommen ging jedoch kein proportionaler Ausbau
der Infrastruktur einher. Vielmehr stagniert hier die Entwicklung, so daß das
heutigen Straßennetz immer häufiger das Verkehrsaufkommen nicht mehr be-
wältigen kann. Seit 1950 stieg der Straßengüterverkehr von 7,1 Mrd. Tonnenki-
lometer auf 315,9 Mrd. Der Straßenpersonenverkehr stieg im gleichen Zeitraum
von 24,5 Mrd. auf 75,9 Mrd. Personenkilometer.
1
Nach Analyse der deutschen
Länderverkehrsminister im Jahr 1998 fehlen allein bei der Bundesfernstraßen 4
Mrd. DEM für Neu- und Ausbau sowie die Instandhaltung.
2
Dies führt zu zäh-
fließendem Verkehr, Staus sowie Parkplatzproblemen.
Damit gehen stark ansteigende externe Kosten einher. Die externen Kosten be-
stehen zum größten Teil aus Emissionskosten. Weiterhin sind Lärm, Verbauung
des Raumes u.ä. externe Kosten. Diese belasten die Allgemeinheit und werden
nicht vom Nutzer durch Entschädigungen kompensiert. Diese Entwicklung ver-
stärkt sich in zunehmendem Maße, so daß die Gesellschaft immer mehr durch
den Straßenverkehr belastet wird. Jüngste Prognose gehen von einem Wachs-
tum des Personenverkehrs um 20% sowie des Güterverkehrs um 64% bis zum
Jahr 2015 aus. Unter anderem werden die Verkehrsleistungen im Güterverkehr
auf ca. 600 Mrd. Tonnenkilomter bis zum Jahr 2015 ansteigen.
3
Hier wird der
Verkehrsträger Straße weiterhin den größten Teil tragen.
Zur Lösung der skizzierten Problematik gibt es viele Ansätze, Diskussionspunk-
te und Thesen. Sie lassen sich in drei Komplexe einteilen:
1. Preispolitische Ansätze verfolgen das Ziel mittels Veränderung der Prei-
se, d.h. internen Kosten der Nutzer ihre Nachfrageverhalten zu verän-
1
Pällmann, W. et al, ,,Kommission Verkehrsinfrastrukturfinanzierung", Berlin, 05. September
2000, S. 10 und 11.
2
Pällmann, W. et al, ,,Kommission Verkehrsinfrastrukturfinanzierung", Berlin, 05. September
2000, S. 5.
3
Bundesministerium für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen, ,,Verkehrsbericht 2000 - Integrier-
te Verkehrspolitik: Unser Konzept für eine mobile Zukunft", Berlin, 2000, S. 6.
Seite 2
dern. Diesen Anstz verfolgten 1995 eine EU-Studie
4
sowie 2000 die
Pällmann-Untersuchung
5
. Aktuelle Beispiele sind die Verteuerung des
Straßenverkehrs mittels der vierstufigen Ökosteuer. Weitere Überlegun-
gen sind die Einführung von Stau- oder Straßenbenutzungsgebühren.
Die Nachfrage nach Straßenverkehr soll durch höhere Preise reduziert
werden. Zu Grunde liegt hier das Prinzip der Internalisierung der exter-
nen Kosten. Wodurch eine optimale Allokation am Markt stattfinden
kann.
2. Durch investive Maßnahmen wird versucht, das Angebot an Infrastruktur
zu erhöhen. Somit soll das Angebot auf die gestiegene Nachfrage rea-
gieren. Es stehen insbesondere Aus-, Neu sowie Erweiterungsbauten im
Straßennetz im Vordergrund.
3. Einen ganz anderen Weg beleuchtet der dritte Komplex. Mittels techni-
schem Fortschritt soll das gleichbleibende Nachfragevolumen auf dem
gleichbleibenden Straßennetzangebot abgewickelt werden. Hierdurch
kann der gleiche Verkehr mit geringeren Kosten bewältigt werden. Durch
die Optimierung und Einsparung von Verkehr kann der Ausbau neuer
Straßen reduziert werden. Somit sinken hierfür die Kosten. Für diesen
Rationalisierungsansatz stehen verschiedene technische Fortschritte zur
Verfügung. Ein Ansatz ist hier die Verkehrstelematik.
Verkehrstelematische Anwendungen sollen mittels intelligenter Steuerung der
Verkehrsströme im einzelnen sowie im kollektiven Ansatz das Straßennetz bes-
ser und effizienter auslasten. Somit dient Telematik der Resourcenersparnis
und fördert die optimale Allokation der Produktionsfaktoren.
Telematische Verkehrsdienstleistungen existieren auf mehreren Ebenen:
1) Zunächst profitieren die Anwender von individuell gekauften Telema-
tikprodukten. Der Straßenverkehr teilt sich in Personen- und Güterver-
kehr auf. Der Personenstraßenverkehr wird hier in den Individualverkehr
und den Geschäftsverkehr untergliedert. Beim erstgenannten führen die
gekauften Telematikprodukte zu einer persönlichen Nutzensteigerung.
Für den Geschäftsverkehr steht das Streben nach Gewinnmaximierung
oder Kostenminimierung im Vordergrund. Auch im Güterverkehr werden
mit telematischen Produkten und Dienstleistungen bei den Transportun-
4
Kinnock, Neil et al, ,,Faire und effiziente Preise im Verkehr", Brüssel, 1995, S. 47 bis 51.
5
Pällmann, W. et al, ,,Kommission Verkehrsinfrastrukturfinanzierung", Berlin, 05. September
2000, S. 31.
Seite 3
ternehmen entweder Gewinnmaximierungs- oder Kostenminimierungs-
ziele verfolgt. Für alle drei Gruppen entstehen direkte Zeit- und Kosten-
ersparnisse sowie Komfortsteigerungen. Insbesondere durch kürze
Fahrtstrecken und weniger Beteiligungen an Staus sinken die Treibstoff-
kosten.
2) Die Gesellschaft profitiert davon, daß der Anwender von individuell ge-
kauften Telematikprodukten nur noch seltener mit den Nicht-Anwendern
im Stau steht. Zudem verbrauchen die Anwender weniger Treibstoff und
es entstehen weniger Emissionen, die bei aktuellen Preisen noch nicht
die externen Kosten des Straßenverkehrs vollständig internalisieren.
Auch hier führt Telematik zu Zeit- und Kostenersparnissen und somit zu
sinkenden externen Kosten.
3) Die nächste Ebene umfaßt kollektive Telematiksysteme. Alle Ver-
kehrsteilnehmer profitieren gemeinsam von kollektven Telematikangebo-
ten. Hierzu gehören variable Geschwindigkeitsbegrenzungen, Nebel-
warnanlagen oder variable Fahrbahnsperrungssysteme.
4) Die Telematikindustrie stellt die vierte Ebene dar. Sie profitiert durch Te-
lematikinvestitionen von privaten Individual-Nutzern sowie durch staatlich
aufgebaute Kollektivlösungen.
Aufgrund der starken Zunahme der Verkehrsproblematik sieht man vielerorts in
der Telematik einen zweckmäßigen Lösungsansatz. Unter Annahme eines sich
weiter verstärkenden Wirtschaftswachstums und damit eines zunehmenden
Verkehrsaufkommens sieht man in der Telematik einen attraktiven Wachs-
tumsmarkt der Zukunft.
6
Hauptargument telematischer Anwendung ist die Einsparung und Optimierung
von Verkehr bei einer gleichzeitigen Reduzierung der Kosten für weiteren Stra-
ßenausbau. ,,Je mehr Telematik, umso weniger Ausbau" scheint zunehmens
auch die politische Ausrichtung zu werden.
7
Telematik ist somit ein volkswirt-
schaftliches Thema der Zukunft, an dessen Weichenstellung sich die Gesell-
schaft zur Zeit befindet.
Aber auch unter betriebswirtschaftlichen Aspekten kommt der Telematik eine
immer größere Bedeutung zu. Bis zum Jahr 1998 sind nur 8% des Gesamt-
6
Zielke, A. McKinsey Inc., ,,Neue Jobs auf Rädern", in: Junge Karriere vom März 2001, S. 22.
7
Bodewig, K. Verkehrsminister der amtiereneden SPD/Die Grünen-Regierung, ,,Transportab-
läufe rationeller gestalten", in: Eurocargo im Februar 2001, S. 12 und 13.
Seite 4
marktvolumens im Endkundensegment entstanden. Bei 300 Mio. DEM waren
dies im Endkundensegment gerade 24 Mio. DEM. Der Hauptteil bestand in
Fuhrpark- und Flottenmanagement sowie in Verkehrsleitsysteme mit jeweils
105 Mio. DEM sowie in Systemen des öffentlichen Verkehrs mit 60 Mio. DEM in
1998. Bis 2010 soll der deutsche Gesamtmarkt auf ein Volumen von insgesamt
25 Mrd. DEM gewachsen sein. Hiervon soll der Endkundenmarkt dann einen
Volumenanteil von 18,5 Mrd. DEM haben. Dies entspricht einer Steigerung um
das 770-fache in 12 Jahren.
8
Die vorliegende Arbeit befaßt sich zunächst mit einer Marktstrukturanalyse.
Hierbei werden die Produkte sowie im Anschluß daran die Anbieter detailliert
dargestellt. Weiterer Schwerpunkt der Analyse ist eine Untersuchung über die
Funktionsfähigkeit des Wettbewerbs auf diesem Markt. Das folgende Kapitel
stellt das aktuelle Marktvolumen sowie das Marktpotential in den Mittelpunkt. Es
werden der europäische sowie der amerikanische und asiatische Markt betrach-
tet, woraus dann eine Betrachtung des Weltmarktes resultiert. Im Anschluß
daran wird noch der deutsche Markt basierend auf dem europäischen Zahlen-
material separat betrachtet. Im darauf folgenden Kapitel erfolgt eine gesamt-
wirtschaftliche Betrachtung. Der Fokus liegt auf der Bedeutung der Verkehrste-
lematik für Individualnutzer, Kollektivnutzer sowie für die Telematikindustrie.
Das abschließende Kapitel fixiert drei wirtschafts- und wettbewerbspolitische
Folgerungen.
Bedingt durch die prognostizierte Marktentwicklungen sowie das vorhandene
Datenmaterial wird die private Telematiknutzung in den Vordergrund gestellt,
ohne jedoch wesentliche Aspekte der gewerblichen Anwendung auszulassen.
8
Roland Berger Strategy Consultants AG, ,,Verkehrstelematik im Automobil Ein eigenständi-
ger Zukunftsmarkt?", München, 08. Juni 1999, Folie: ,,Nur ca. 8% des Gesamtmarktvolumens
entstehen heute im lukrativen Endkundensegment" und Folie: ,,Bis zum Jahr 2010 werden 75%
des Gesamtmarktvolumens vom Individualreisenden zu finanzieren sein".
Seite 5
2. Marktstrukturanalyse für Verkehrstelematik
In diesem ersten Schwerpunkt der Arbeit wird zunächst auf die Produktkette der
telematischen Leistungen eingegangen. Darauf aufbauend werden die Telema-
tikprodukte näher dargestellt. Es erfolgt eine Aufteilung in Individual-Produkte
sowie in kollektive Telematiksysteme. Zudem werden die Individual-Produkte in
Angebote für private und gewerbliche Nutzer unterteilt. Anschließend erfolgt ei-
ne Betrachtung der Anbieter, die in einer Wettbewerbsbetrachtung schließt.
2.1 Produkte und Anbieter
2.1.1 Die Produktkette telematischer Leistungen und ihre Marktsegmente
Telematische Leistungen werden nach ihren Nutzern unterschieden:
-
Zum einen existieren Individual-Produkte. Es werden technische Geräte
und/oder Dienstleistungen von privatwirtschaftlich agierenden Personen
zur Nutzenerzielung sowie von gewerblichen Akteuren zur Gewinnmaxi-
mierung oder Kostenminimierung erworben.
-
Zum anderen gibt es kollektive Telematiksysteme. Meist werden hier von
staatlicher Seite allen Verkehrsteilnehmern gemeinsam und unentgeltlich
Informationen zur Verfügung gestellt. Das staatliche Ziel besteht darin,
Verkehrsstörungen zu beseitigen, um damit den Verkehrsfluß zu optimie-
ren. Es handelt sich hier um einen investiven, technisch orientierten An-
satz der Verkehrsbeeinflussung.
9
Es existieren drei Arten telematischer Dienstleistungen:
a) Statische Navigation:
Zur jeweiligen Verkehrsempfehlung werden lediglich konstante und un-
veränderliche Daten herangezogen. Dies sind das aktuelle Straßennetz
sowie die aktuelle Fahrzeugposition und geschwindigkeit.
9
Bundesministerium für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen, ,,Anti-Stau-Programm", Berlin und
www.bmvbw.de, 2000.
Seite 6
b) Dynamische Navigation:
Die Verkehrsempfehlung wird von der aktuellen Situation auf der zu emp-
fehlenden Straßenroute abhängig gemacht. Bei schlechten Bedingungen
auf der eigentlichen Route, bspw. durch Unfall oder Baustelle, wird au-
tomatisch auf eine alternative Route ausgewichen.
c) Dynamische Navigation mit Zusatzinformationen:
Aufbauend auf die dynamische Telematik werden hier noch weitere In-
formationen an den Nutzer übermittelt. Dies können Informationen zum
Ziel oder Unterhaltung auf dem Weg zum Ziel sein.
10
Es können verschiedene Datenarten unterschieden werden:
-
Zunächst exisitieren die Straßendaten. Es wird zwischen statischen und
dynamischen Straßendaten unterschieden. Die statischen Straßendaten
beschreiben die Länge und Art der Straße. Sie werden meist in CD-
ROM-Format dem Nutzer als ,,digitale Straßenkarte" zur Verfügung ge-
stellt. Die dynamischen Straßendaten beschreiben den aktuellen Stra-
ßenzustand bezüglich der Nutzung. Es werden Informationen über Fahr-
zeuganzahl pro Teilabschnitt und unter anderem durchschnittliches
Tempo auf der jeweiligen Spur angegeben.
-
Neben den Straßendaten existieren noch die individuellen Fahrzeugda-
ten. Diese werden durch den aktuellen Zustand des Fahrzeuges deter-
miniert. Hauptsächlich werden die Geschwindigkeit und die Fahrtrichtung
gemessen. Zusätzlich werden Kurven- oder Rückwärtsfahrten ermittelt.
Die statische Telematik bedient sich eines festen Datengerüstes. Dieses bein-
haltet die statischen Straßendaten. Zumeist werden sie via CD-ROM zur Verfü-
gung gestellt. Darüberhinaus werden die aktuellen Fahrzeugdaten vom Endge-
rät erfaßt. Es handelt sich hier um ein zweistufiges System:
1. Bereitstellung der statischen Straßendaten:
Zunächst werden alle relevanten Straßen der Länge nach vermessen.
Weiterhin erfolgt eine Unterteilung nach der jeweiligen Art der Straße.
10
Woller, R. - Bayerischen Hypotheken und Vereinsbank AG, Gemäß Telefonat vom 10. April
2001.
Seite 7
Diese Daten werden auf CD-ROMs gespeichert und den Käufern von
Endgeräten ausgehändigt. Eine Erneuerung der statischen Daten erfolgt
ausschließlich durch Kauf einer neuen Daten-CD-ROM.
2. Statische Endgeräte:
Der Käufer baut das Endgerät ,,ab Werk" oder ,,nachträglich" in sein
Fahrzeug ein. Nach dem Einlegen der CD-ROM mit den statischen Da-
ten erkennt das Endgerät die aktuelle Position und ermittelt von nun an
die jeweils zweckmäßigste Route. In der Regel lautet die Entscheidung,
ein Fahrziel entweder möglichst schnell oder auf kürzestem Wege zu er-
reichen. Zur Entscheidung, welches die zweckmäßigste Route ist, be-
dient sich das System ausschließlich der statischen Daten der CD-ROM.
Neu erbaute Straßen oder aktuelle Staus werden nicht berücksichtigt.
Die dynamische Telematik baut auf der statischen Telematik auf, so daß die
voran beschriebenen beiden Stufen auch hier Gültigkeit haben. Für die dynami-
sche Telematik, unabhängig von der Zusatzinformationsbereitstellung, müssen
die aktuellen Straßensituationen erfaßt werden. Dazu muß die Situationsermitt-
lung in einem mehrstufigen Prozeß erfolgen. Alle Stufen der Situationsermitt-
lung bauen aufeinander auf und müssen zwingend durchlaufen werden. Das
Fehlen einer Stufe verhindert die Funktionsfähigkeit des Gesamtsystems.
1. Erfassung der dynamischen Straßendaten:
Die aktuellen Verkehrssituationen werden in Datenmodellen erfaßt. Ent-
scheidende Parameter sind hier die Quantität, Qualität und Art der erfaß-
ten Verkehrsteilnehmer. Quantität stellt zunächst auf die reine Anzahl an
Fahrzeugen an einem Meßpunkt ab. Die Qualität beschreibt meist die
Geschwindigkeit je Fahrzeug. Die Art drückt die Form des Fahrzeuges
aus: Pkw, kleiner Lkw, großer Lkw oder Bus. Im optimalen Meßfall kann
auf einen Meßpunkt exakt die Durchschnittsgeschwindigkeit und Anzahl
in der letzten Minute je Fahrspur je Fahrzeugart ermittelt werden. Neben
der Ermittlung von Fahrzeugdaten werden auch Umfelddaten wie bspw.
Temperatur, Sichtweite, Nebelgefahr oder Witterung erfaßt.
2. Datenbewertung:
Die erfaßten Daten werden in Abhängigkeit vom Meßpunkt in Situati-
onsmodelle umgewandelt. Hier können Situationen bspw. ,,freie Fahrt",
,,zähfliessend", ,, Vollsperrung" oder ,,Nebelgefahr" lauten. In der aktuellen
Marktsituation bewerten alle Datenerfasser auch die ermittelten Daten,
so daß man die Punkte 1 und 2 auch zusammenfassen könnte. Aufgrund
Seite 8
der unsicheren Zukunft halte ich eine detaillierte Aufteilung jedoch für
zweckmäßiger.
3. Datenweitergabe = Datentransfer:
Die ermittelten Situationszustände werden via Transferdienstleistern an
die Nutzer weitergegeben. Diese Transferdienstleister können als Zwi-
schenhändler betrachtet werden. Sie kaufen von den Datenerfassern, re-
spektive Datenbewertern, die Daten ab und verkaufen sie weiter. Aktuell
werden drei Verfahren zum Datentransfer favorisiert. Zum einen wird sich
dem klassischen ARI-Verkehrsfunk via UKW-Radio bedient. Die Daten
werden in den TMC-Standard codiert und somit in dem Endgerät in ver-
arbeitbare Daten umgewandelt. Alternativ hierzu werden Daten mittels
des Mobilfunk D-Netzes im GSM-Standard zu den Endgeräten übertra-
gen. Als dritte Möglichkeit bietet sich für den Nutzer der individuelle Anruf
in einem Callcenter an.
11
4. Dynamische Engeräte:
Die gekauften Informationen über die aktuellen Verkehrsituationen wer-
den vom Endgerät in die bisher statische Navigationsentscheidung ein-
bezogen. Auch hier lautet in der Regel die Entscheidung, ein Fahrziel
entweder möglichst schnell oder auf kürzestem Wege zu erreichen. Au-
ßerdem kommt hier noch der Wunsch hinzu, Staus zu umfahren.
12
Es ist zwischen On- und Offboard-Systemen zu unterschreiten. Bei Onboard-
Systemen wird die Navigationsentscheidung an Bord getroffen. Dies ist bei al-
len statischen und dynamischen Systemen mit Daten-CD-ROM der Fall. Bei
Offboard-Systeme hingegen wird die Route auf einem nicht an Bord befindli-
chen Rechner ermittelt und dann lediglich die einzelnen Routenparameter in
das Fahrzeug übertragen.
Inbesondere in Deutschland ist die dynamische Navigation im Vergleich zu den
europäischen Nachbarn relativ weit verbreitet und einsatzfähig. Ein Vergleich
von statischer und dynamischer Navigation wurde im Sommer 2000 vom ADAC
durchgeführt. Das Fazit lautet:
11
ADAC e.V., ,,Marktentwicklung Navigationssysteme ADAC-Prognose bis 2001", S.1. sowie
ADAC, ,,ADAC-Test ,,Verkehrsinfosysteme"", München, 2000, S. 2.
12
Deutsche Bank Equity Research, "Telematics the times they are a changing", London, März
2001, S. 31 sowie Zackor, H. und Keller, H., "Entwurf und Bewertung von Verkehrsinformati-
ons- und leitsystemen unter Nutzung neuer Technologien", Bergisch Gladbach, November
1999, Tab.1 und 2, S. 9 und 10.
Seite 9
Dynamische Navigation mittels TMC kann durchaus zu Verkürzung der Reise-
zeiten bei verstopften Autobahnen führen. Die Technik der Navigationssysteme
ist dafür gut geeignet und, abgesehen von kleineren Problemen, bereits ausge-
reift. Die TMC-Versorgung ist in Deutschland fast flächendeckend, die Staumel-
dungen konnten während der Testfahrten fast immer, abgesehen von gelegent-
lichen Funklöchern, störungsfrei empfangen werden. Voraussetzung für richtige
Umleitungsempfehlungen sind zuverlässige Staumeldungen. Diese müssen
vollständig und konsequent in TMC codiert werden. Weiterhin müssen Alterna-
tivstrecken über Autobahnen oder gut ausgebaute, sichere Bundesstraßen ver-
fügbar sein. Stauumfahrungen über enge Landstraßen oder Ortsdurchfahrten
können aufgrund der Ergebnisse dieser Testfahrten aus Sicherheitsgründen
und wegen des unzureichenden Verhältnisses zwischen zeitlichen Vorteilen
und der Streckenlänge außer in Notfällen oder bei Vollsperrungen der Autobah-
nen meist nicht empfohlen werden. Umleitungen über Land- oder Stadtstrassen
sind darüber hinaus mit dem Risiko behaftet, auf eine bereits überfüllte Strecke
geleitet zu werden, da dort die Verkehrserfassung nur sehr lückenhaft ist und
diese Straßen aus technischen Gründen über TMC nicht gemeldet werden kön-
nen. Die besten Ergebnisse konnten dann erzielt werden, wenn die vorliegen-
den aktuellen Staumeldungen laufend und vor allem rechtzeitig in die Berech-
nung der optimalen Route vom Navigationssystem eingearbeitet wurden. Erst
dann sind großräumige, vorausschauende Stauumfahrungen über Autobahnen
oder andere Hauptverkehrsstraßen möglich.
13
Eine weitere Aufteilung der Produkte kann nach ihren Eingriffsgraden erfolgen:
-
Erstens existieren reine Informationssysteme. Hier werden dem Kollektiv
Informationen ohne Handlungsempfehlung oder sogar Verpflichtung
übermittelt. Verkehrsfunk, Videotext und Parkleitsystemtafeln sind hier
exemplarisch zu nennen. Für einzelne Individuen gibt es solche Informa-
tionen in dieser Form nicht.
-
Zum anderen gibt es Leitsysteme. Für Individuen werden bei dynami-
schen Navigationen konkrete Zielführungen vorgegeben. Das Kollektiv
erfährt solche Leitsysteme durch dynamische Geschwindigkeitsbeein-
flussungen, Wechselschilder oder verkehrsabhängige Spursperrungen.
-
Darüber hinaus stehen in jüngster Zeit Automatisierungssysteme an. Der
individuelle Nutzer kann sich zukünftig und zum Teil schon heute Wahr-
13
ADAC e.V., ,,ADAC-Untersuchung ,,Dynamische Navigation" Testfahrten und Praxistest
2000", München, 2000, S. 8.
Seite 10
nehmungsassitenten, bspw. für andere Verkehrsteilnehmer im toten
Winkel, sowie Abstandsregeltempomate bedienen. Für die kollektive
Nutzung wird in weiterer Zukunft das automatische Fahren angeboten
werden.
Alle hier angesprochen Elemente haben zwei Sachverhalte gemeinsam:
-
In zunehmenden Maße erhält der Autofahrer für seine aktuelle spezielle
Situation die beste Handlungsempfehlung.
-
Zum anderen werden immer mehr Faktoren zur Bewertung einer Situati-
on heran gezogen.
2.1.1.1 Individual-Produkte
Bei den Individual-Produkten werden alle Produkte angesprochen, die von pri-
vaten und/oder gewerblichen Nutzen gekauft werden und mit denen sie ihren
individuellen Vorstellungen nachgehen und ihre Fahrtziele besser erreichen
wollen. Es gibt inbesondere in jüngster Zeit sehr viele Ausprägungen von Indi-
vidualprodukten in mehr oder minder weiten Erfolgsstadien. In den letzten Jah-
ren haben sich zwei Produkte etabliert: Die unter 2.1.1.1.1 angesprochene Na-
vigation, meist für den Personenkraftverkehr, und das unter 2.1.1.1.2 dargestell-
ten Flotten- und Frachtenmanagement für den Gewerbekraftverkehr.
2.1.1.1.1 Navigation P + G
Das Produkt Navigation wird überwiegend vom Personenkraftverkehr genutzt.
Nur bedingt erfolgt ein Einsatz in Lkw und Bussen. Der Fahrer gibt hier vor
Fahrtantritt in das Endgerät sein Fahrtziel ein und erhält eine Empfehlung, wie
er sein Ziel am besten erreicht.
Vor Kauf eines solchen Systems muß die Entscheidung für den Systemtyp ge-
troffen werden. Es ist zwischen statischen, dynamischen oder dynamischen
Navigationsgeräten mit Zusatzinformationen zu unterscheiden. Bei einem stati-
schen Gerät fallen nach Kauf keine weiteren Kosten an. Die Nutzung ist kosten-
frei. Bei einem dynamischen Gerät mit oder ohne Zusatzinformationen erfolgt
Seite 11
zusätzlich ein Vertragabschluß mit einem Datenlieferanten. Dieser ist der unter
2.1.1 beschriebene Zwischenhändler. Er stellt gegen ein jährliches Entgelt von
ca. 250,-- DEM bei Nutzung der Navigation jeweils die aktuelle Straßensituaion
dem Gerät zur Verfügung, so daß im Staufall von der eigentlichen Strecke ab-
gewichen werden kann.
Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, durch Zusatzinformationen den Fahrer
noch umfassender zu betreuen. Gegen 2,-- DEM je Minute kann bspw. ein Call-
center zur Suche eines adäquaten Hotels mittels Autotelefon angewählt wer-
den. Nach Angabe des gewünschten Zieles und der Preisvorstellung ermittelt
das Callcenter einen Hotelvorschlag und sendet diesen via SMS auf das
Autotelefon. Die SMS wird direkt in das Navigationsgerät übertragen und dient
zur Zieldefintion. Der Fahrer wird automatisch zum empfohlenen Hotel hinge-
führt.
Mehrere Gerätealternativen stehen zur Wahl. Am weitesten verbreitet sind Na-
vigationsgeräte in Verbindung mit Autoradios. Zum einen können Sie direkt ab
Herstellerwerk geordert werden (3.000,-- DEM bis 6.500,-- DEM). Zum anderen
können beim Händler die Fahrzeuge durch nachträgliche Einbauten aufgerüstet
werden (3.000,-- DEM bis 10.000,-- DEM). Weiterhin bietet der Elektroartikelsu-
permarkt, bspw. Saturn, Media-Markt u.ä., diverse Universalgeräte zum nach-
träglichen Einbau (ab 2.500,-- DEM, zzgl. Einbau 500,-- DEM). Es stehen Gerä-
te im Radioformat mit Pfeildarstellung (2.500,-- DEM ohne Einbau) und Geräte
mit Farbmonitoren mit zusätzlicher Kartendarstellung (4.000,-- DEM bis 6.000,--
DEM ohne Einbau) zur Auswahl. Die Option zur Nutzung der dynamischen Zu-
satzinformationen bedarf eines Autotelefons ,,ab Werk" oder ,,ab Händler". Hier
ist nochmals mit ca. 1.500,-- DEM bis 2.500,-- DEM zu rechnen.
Unabhängig vom Zustand ,,ab Werk", ,,vom Händler" oder ,,Selbsteinbau" sowie
vom Zustand ,,Radioformat" oder ,,inklusive Monitor" bedienen sich alle Systeme
der folgenden Daten zur einwandfreien Funktionsfähigkeit:
·
Mittels GPS wird die aktuelle Fahrzeugposition ermittelt
·
Mittels Tachosignalabgreifer wird die aktuelle Geschwindigkeit bewertet
·
Mittels Rückfahrsignal vom Rückwärtsgang wird die Fahrtrichtung bewer-
tet vorwärts oder rückwärts
·
Mittels CD-ROM werden die statischen Streckendaten zur Verfügung ge-
stellt
·
Mittels Giersensor wird die Kurvenfahrt ermittelt
Seite 12
Alle fünf Faktoren zusammen dienen der korrekten Ermittlung des aktuellen
Fahrzustandes. In Abhängigkeit des eingegeben Fahrtziels erhält der Fahrer
nun via Sprache und/oder via optischer Einblendung Empfehlungen. Bspw. ,,in
300 Metern links abbiegen", ,,die Autobahn an der nächsten Ausfahrt verlassen"
oder ,,Sie haben das Ziel erreicht".
Alternativ hierzu besteht auch in jüngster Zeit das Angebot sich via Handy re-
spektive Palm oder Laptop leiten zu lassen. Diese Systeme navigieren aus-
schließlich aufgrund der aktuellen GSM-Handyposition und der vom Handypro-
vider empfohlenen Route oder der Laptop-Software. Bedingt durch die zur Zeit
nur sehr mäßige Navigationsqualität werden diese Alternativen im folgenden
nur kurz dargestellt.
2.1.1.1.2 Flotten- und Frachtenmanagement - G
Das Flotten- und Frachtenmanagement ist das zweite etablierte Individualpro-
dukt. Vornehmlich für Gewerbekraftwagen konzipiert, ermöglicht es die genaue
Planung einer gesamten Fahrzeugflotte. Zunächst werden alle Flottenfahrzeuge
mit GPS ausgerüstet. Als Alternative besteht die Möglichkit der Ausrüstung mit
GSM. Jedoch wird GPS aufgrund nicht optimaler GSM-Netzabdeckung bevor-
zugt. Es kann jedes Fahrzeug der Flotte auf ca. 10 Meter genau weltweit lokali-
siert werden. Weiterhin wird in der Unternehmenszentrale ein PC mit Software
präpariert, so daß dann dort auf einer Bildschirmlandkarte alle aktuellen Fahr-
zeugpositionen ersichtlich werden. Durch Verknüpfung dieses Programmes mit
der Auftrags- und Abwicklungssoftware ist es möglich, die jeweilige aktuelle Po-
sition, die Ladung, den Abfahrtsort, den Ankunftsort und die jeweilgen Zeitpunk-
te übersichtlich dargestellt zu bekommen. Somit besteht die Möglichkeit, die
einzelnen Fahrzeuge von der Zentrale aus zu lenken. Unter Einbindung einer
dynamischen Navigationskomponente umfahren im Optimalfall alle Firmenfahr-
zeuge die Staus und erreichen ihre Ziele schneller und mit höheren Wahr-
scheinlichkeiten. Darüber hinaus können auch noch Fahrtstrecken reduziert
werden, wenn einzelne Fahrzeuge auf Teilstücken nicht voll ausgelastet sind,
indem sie die Fahrten anderen Fahrzeuge gleichzeitig noch mit abwickeln. Die
Vorteile im lauten einzelnen:
-
ständig aktuelle Fahrzeug/-Logistikdaten
-
bessere Kontrolle über die einzelnen Einheiten
-
genauere Planung der einzelnen Touren
Seite 13
-
bessere Auslastung
-
bessere Analyse des Fuhrparks
-
Reduzierung der Kommunikationskosten
-
Abrechnung kann integriert werden
14
Somit kann die gesamte Flotte wesentlich effizienter und präziser arbeiten.
15
Die Kosten liegen pro Fahrzeugeinheit zwischen 1.500,-- DEM und 6.500,--
DEM sowie nochmals 70,-- DEM bis 200,-- DEM pro Einheit im Monat. Ab einer
Fahrzeugflotte mit mehr als 25 Wagen sind diese Systeme rentabel.
16
2.1.1.1.3 Ferndiagnose P + G
Bei der Ferndiagnose handelt es sich um ein sehr neues Produkt. Es wird im
Personen- (ab 2002) sowie Gewerbekraftverkehr eingesetzt. Im Personenkraft-
verkehr wird der 7er BMW ab Modelljahr 2002 diese Technik serienmäßig bein-
halten.
17
Im Gewerbekraftverkehr zog dieses Produkt mit dem Flotten- und
Frachtmanagement ein.
18
Die jeweilige Fahrzeugtechnik steht hier in ständi-
gem oder anwählbarem Kontakt mit einem entfernten PC bspw. beim Fahr-
zeughersteller. Somit können Fehler oder Probleme beim Fahrzeugbetrieb di-
rekt an einem anderen Ort bemerkt und bewertet werden. Dort kann dann von
übergeordneter Stelle die kompetente Entscheidung getroffen werden, inwie-
weit ein Weiterbetrieb bis zum nächsten regulären Service, ein Weiterbetrieb
bis zur nächsten Werkstatt oder ein sofortiger Betriebsstop zweckmäßig ist. Der
Käufer hat somit einen besseren Service durch intensiveren Kontakt zum Her-
steller oder zu einem Serviceanbieter. Dadurch entstehen Zeit- und Kostener-
sparnisse. Dieses Produkt wird auch breakdown-call (b-call) genannt.
14
o.Verf., ,,Volltransparent in die Zukunft", in: DVZ-Future Nr. 150/2000, S. 24 sowie o.Verf.,
,,Telematik", in: Dekra-Zeitschrift trans aktuell im März 2001, S. 15.
15
ABN-Amro Inc. Equity Research, ,,SmallCap plays on telematics Digital horsepower", Lon-
don, 07. November 2000, S. 5.
16
o.Verf., ,,Volltransparent in die Zukunft", in: DVZ-Future Nr. 150/2000, S. 24 sowie o.Verf., in:
nfm NutzFahrzeugMarkt, S. 36 und 37.
17
BMW AG-Pressestelle, Telefonat vom 09. Juli 2001 sowie o.Verf., ,,HiTech fürs Volk", in: Jun-
ge Karriere vom März 2001,", S. 20.
18
ABN-Amro Inc. Equity Research, ,,SmallCap plays on telematics Digital horsepower", Lon-
don, 07. November 2000, S. 5.
Seite 14
2.1.1.1.4 Sicherheitsüberwachung und Notfallsysteme P + G
Das Produkt ,,Sicherheitsüberwachung und Notfallsysteme" ist ähnlich zur Fern-
diagnose und steht ebenfalls für Personen- und Gewerbekraftverkehr zur
Verfügung. Es werden wichtige Fahrzeugsysteme konstant überwacht. Im Falle
eines Systemausfalles wird der Fahrer durch die Zentrale gewarnt.
Das Notfallsystem funktioniert invers. Im Notfall sendet das Fahrzeugsystem
ohne Zutun des Fahrers ein Signal an die Zentrale. Von dort werden automa-
tisch erste Hilfemaßnahmen sowie die Polizei informiert. Weiterhin kann im
Diebstahlsfall die Position des Fahrzeugs kontinuierlich gemeldet werden. So-
mit besteht die Möglichkeit, das Fahrzeug zügig wieder zu finden.
19
Dieses Pro-
dukt wird auch emergency-call (e-call) genannt.
2.1.1.1.5 Abstands- und Geschwindigkeitsbeeinflussung - P
Die Abstands- und Geschwindigkeitsbeeinflussung ist ein seit zwei Jahren etab-
liertes Produkt im Personenwagenbereich. Seit Baujahr 2000 bietet Mercedes
die automatisches Abstandskontrolle und BMW Distronic an. Weitere Hersteller
haben ähnliche Produkte noch nicht im Programm. Dieses System basiert auf
einem Radarsensor im Kühlergrill. Er mißt die aktuelle Entfernung zum Vorder-
mann und ermittelt 10 mal pro Sekunde die Veränderung der Entfernung. In
Verbindung mit einem Tempomat bremst der eigene Wagen nun je nach Reak-
tion des Vordermannes ab oder beschleunigt bis auf eine gewünschte individu-
elle Höchstgeschwindigkeit. Beide Hersteller bieten dieses Produkt für ca.
2.500,-- DEM an. Aufgrund der verhältnismäßig geringen Anteile dieser beiden
Fahrzeuge am Gesamtbestand und der relativ hohen Kosten ist nur mit einer
langsamen Verbreitung zu rechnen.
2.1.1.1.6 Abstandswarnung - P
Die Abstandswarnung basiert auf obiger Regeltechnik, greift jedoch nicht selbst
ein, sondern warnt vielmehr lediglich mittels Signals den Fahrer. Bedingt durch
die rasch voranschreitenden Entwicklungen bei automatischen Systemen sowie
19
ABN-Amro Inc. Equity Research, ,,SmallCap plays on telematics Digital horsepower", Lon-
don, 07. November 2000, S. 5.
Seite 15
dem im Vergleich zum automatischen System nur geringen Nutzen ist in jüngs-
ter Zeit die Markteinführung fraglich geworden.
2.1.1.1.7 Abbiege- und Spurwechselassistent P + G
Das Produkt ,,Abbiege- und Spurwechselassistent" ist am Markt ebenfalls noch
nicht erhältlich. Hier sieht man jedoch einen Markt für Personen- sowie Gewer-
bekraftwagen. In beiden Fällen prüfen Sensoren im eigenen Fahrzeug, inwie-
fern sich andere Fahrzeuge in kritischer Nähe befinden. Bspw. wird ein Fahr-
zeug im toten Winkel dann mittels eines roten Lichtes im linken Außenspiegel
signalisiert. Mit einer Markteinführung wird in 2003 gerechnet.
20
2.1.1.1.8 Informationssysteme - P
Speziell für den privaten Nutzer gibt es mehrere Informationsmöglichkeiten im
Fahrzeug. Hier sind die vier wichtigsten kurz skizziert:
-
Zum ersten das position based info: Der Nutzer erhält Informationen zu
Gegebenheiten in der näheren aktuellen Umgebung seines Fahrzeuges.
Dies können Restaurants, Hotels, Einkaufsmöglichkeiten oder touristi-
sche Attraktionen sein.
-
Weiterhin kann der Fahrer position based commerce nutzen. Hierbei
kann er aus seinem Fahrzeug einkaufen oder bspw. Essen bestellen.
-
Als Drittes kann der Fahrer sich über die Wettervorhersage oder aktuelle
Nachrichten informieren.
-
Letztlich kann der Fahrer im Internet surfen.
21
Alle vier dargestellten Produkte werden heute noch nicht angeboten. Jüngste
Entwicklungen der Verknüpfung von Mobilfunkgeräten, GPS-Sensoren sowie
PDA´s oder Laptops lassen einen Einführungszeitpunkt jedoch in nicht weiter
Ferne erscheinen. Diese Produkte werden auch als Content bezeichnet.
20
Mercedes-Benz AG Pressestelle, Telefonat vom 09. Juli 2001.
21
ABN-Amro Inc. Equity Research, ,,SmallCap plays on telematics Digital horsepower", Lon-
don, 07. November 2000, S. 5.
Seite 16
2.1.1.1.9 Kommunikation P + G
Produkt zur Kommunikation werden sowohl für den privaten als auch den ge-
werblichen Nutzer angboten. Dem Fahrer werden mehrere Möglichkeiten gebo-
ten, mit sich außerhalb des Fahrzeugs befindlichen Menschen zu kommunizie-
ren. Es wird zukünftig nach der Art der Unterhaltung unterschieden:
a) persönlich und zeitgleich = Sprache
b) persönlich, visuell und zeitgleich = Video
c) persönlich und zeitversetzt = e-Mail und SMS
22
Neben der Nutzung von Mobilfunkgeräten zur sprachlichen Kommunikation gibt
es aktuell noch keine marktreifen Produkte für die Varianten b) und c). Unter
Bezugnahme auf die stationäre Nutzung von Kommunikationswegen muß man
jedoch der Variante c) ganz eindeutig die größeren Zukunftschancen zuspre-
chen. Das Videotelefon hat sich nicht durchgesetzt. Hingegen gehören e-Mail
und SMS heute schon zum Alltag.
2.1.1.1.10 Unterhaltung P + G
Die Unterhaltung ist das letzte darzustellende Individualprodukt. Es ist
vornehmlich für den privaten Nutzer vorgesehen. Der Fahrer erhält auf
Bestellung in sein Fahrzeug Audio- oder Videodateien zum Hören und Sehen
sowie Spiele zur Unterhaltung gesandt.
23
Aufgrund der aktuell noch sehr
langsamen Übertragungsfrequenzen in den Mobilfunknetzten von 9,6 kBit/sek
ist erst nach Einführung von GRTS sowie UMTS insbesondere mit diesen
Produkten zu rechnen. Diese Produkte werden auch als Content bezeichnet.
2.1.1.2 Kollektive Telematiksysteme
Es handelt sich hier zumeist um Produkte, die allen Verkehrsteilnehmern u-
nentgeltich zur Verfügung gestellt werden. Diese Systeme werden in den meis-
ten Fällen durch staatliche Investitionen ermöglicht. Zielsetzung ist die Verbes-
serung der Verkehrssituation durch weniger Unfälle, besseren Verkehrsfluß,
bessere Parkplatzausnutzung oder weniger Umweltbelastung. Der entschei-
22
ABN-Amro Inc. Equity Research, ,,SmallCap plays on telematics Digital horsepower", Lon-
don, 07. November 2000, S. 5.
23
ABN-Amro Inc. Equity Research, ,,SmallCap plays on telematics Digital horsepower", Lon-
don, 07. November 2000, S. 5.
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Originalausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2001
- ISBN (eBook)
- 9783832449520
- ISBN (Paperback)
- 9783838649528
- DOI
- 10.3239/9783832449520
- Dateigröße
- 1.2 MB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- Universität zu Köln – Wirtschafts- und Sozialwissenschaften
- Erscheinungsdatum
- 2002 (Januar)
- Note
- 1,7
- Schlagworte
- telematik verkehr volkswirtschaft straße mobilität
- Produktsicherheit
- Diplom.de