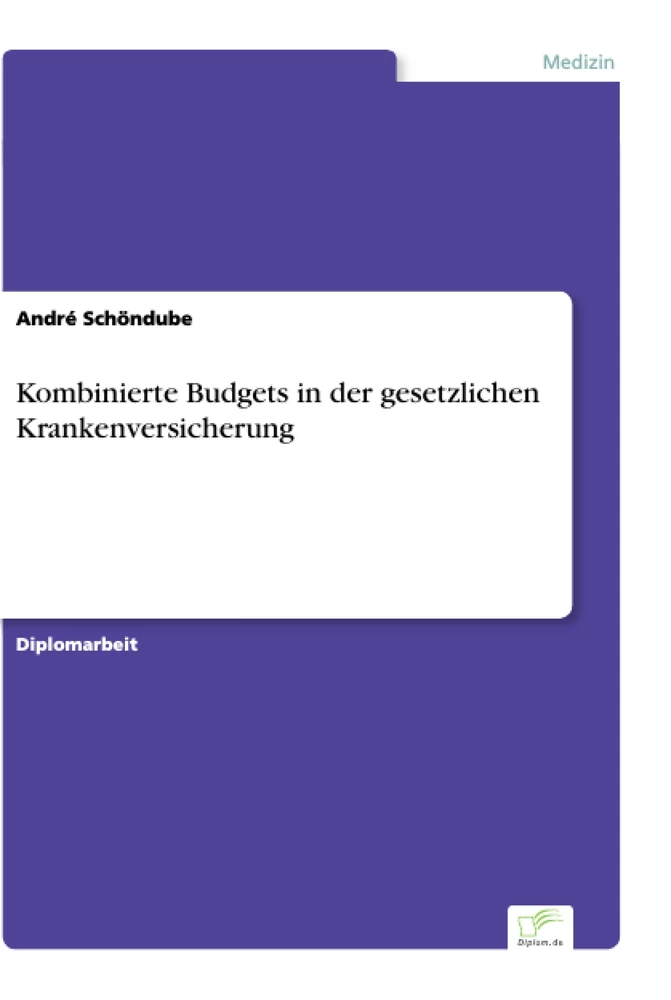Kombinierte Budgets in der gesetzlichen Krankenversicherung
Zusammenfassung
Mit dem Beginn der Industrialisierung wurden dem Menschen immer mehr Aufgaben und Pflichten übertragen, die ihn auf Dauer aus dem Gleichgewicht der Gesundheit warfen. Erste Ansätze zur Regelung einfachster Bedingungen im Arbeitsleben wurden mit dem Beginn des 19. Jahrhunderts vereinbart. Vor ungefähr 110 Jahren verabschiedete Otto Fürst von Bismarck (1815-1898) die Sozialversicherung in Deutschland. Die gesetzliche Krankenversicherung, als ältester Zweig der Sozialversicherung, wurde durch die Reichsversicherungsordnung (RVO) von 1911 so umfassend spezifiziert, dass sie im wesentlichen die Rechtsgrundlage der gesetzlichen Krankenversicherung bis zum Jahr 1989 bildete.
In den letzten Jahren führten Diskussionen über Kostendämpfung im Gesundheitswesen zum Überdenken der aktuellen Gesetzeslage in Deutschland. Neben dem Ausbau der Leistung forciert die Entwicklung der Rechtsprechung in der GKV einen stetigen Anstieg der Aufwendungen im Gesundheitswesen. Getragen werden die Kosten von den Krankenkassen, die wiederum ihrem Grundsatz der Beitragssatzstabilität für die Finanzierung der Krankenkassen gerecht werden wollen. Beide Argumente stehen im Widerspruch zueinander. Damit aber weiterhin die Finanzierung der Krankenkassen gewährleistet werden kann und den Mitgliedern keine Beitragserhöhungen auferlegt werden müssen, wurden in den vergangenen Jahren einige Gesetzesänderungen in der GKV durchgeführt. Hier sind die Aufnahme der GKV in das fünfte Buch des Sozialgesetzbuches (1989), das Gesundheits-Strukturgesetz von 1993, das GKV-Neuordnungsgesetz (1996) und die Gesundheitsreform 2000 zu nennen.
Gang der Untersuchung:
Das Kapitel 2 meiner Diplomarbeit erläutert ausgiebig die gesetzliche Krankenversicherung in Deutschland. Auch die Probleme und Notwendigkeiten zur Veränderung mit Blick auf die Gesundheitsreform 2000 fließen hier ebenfalls mit ein. Die neuen Organisationsformen medizinischer Leistungen werden im Abschnitt 2.3. näher erläutert. Hier ist vor allem auf die HMO zu verweisen. Auch alternative Vergütungsformen in der Schweiz werden angesprochen. Das zweite Kapitel wird durch den Punkt 2.4. abgerundet. Er beschäftigt sich mit dem Gesundheits-Reformgesetz 2000 und ihren neuen rechtlichen Möglichkeiten in Bezug auf die Durchführung alternativer Vergütungsformen.
Die ambulante Versorgung in Vertragsarztpraxen und die stationäre Behandlung in Krankenhäusern bilden den Kern im traditionellen deutschen Gesundheitswesen. […]
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
1. Einleitung
2. Die gesetzliche Krankenversicherung in Deutschland
2.1. Historische Darstellung der gesetzlichen Krankenversicherung
2.2. Rechtsgrundlagen der gesetzlichen Krankenversicherung
2.2.1. Die GKV im Sozialgesetzbuch (SGB V) und ihre Probleme während der Reformen
2.2.2. Wettbewerbsorientierte Neuausrichtung im Gesundheitswesen
2.3. Die neuen Organisationsformen medizinischer Leistungen als Vorreiter des Wettbewerbsgedankens in Deutschland
2.3.1. Health Maintenance Organization (HMO) in den USA
2.3.2. Alternative Vergütungsformen medizinischer Leistungen in der Schweiz
2.4. Die GKV nach dem Gesundheits-Reformgesetz
3. Die bisherigen Vergütungssysteme vs. Kombiniertes Budget in der gesetzlichen Krankenversicherung
3.1. Anwendung der bisherigen Vergütungsformen
3.2. Darstellung der einzelnen Versorgungssektoren
3.2.1. Die ambulante ärztliche Versorgung
3.2.1.1. Grundlagen in der ambulanten ärztlichen Versorgung
3.2.1.2. Ökonomische Analyse der ambulanten ärztlichen Versorgung
3.2.2. Die stationäre ärztliche Versorgung
3.2.2.1. Grundlagen in der stationären ärztlichen Versorgung
Inhaltsverzeichnis
3.2.2.2. Ökonomische Analyse der stationären ärztlichen Versorgung
3.2.3. Die Arznei- und Heilmittelbudgets
3.3. Das kombinierte Budget als alternative Form der Budgetierung
3.3.1. Ökonomische Aspekte für eine Zusammenführung der bisherigen Versorgungsbereiche
3.3.2. Das Konzept der integrierten Versorgung
4. Die Anwendung des kombinierten Budgets im Praxisnetz Berlin
4.1. Darstellung der Idee
4.2. Die Budgetform im Netzwerk
4.2.1. Allgemeines zum kombinierten Budget
4.2.2. Die Berechnung des kombinierten Budgets
4.3. Schlussfolgerung
4.4. Andere Modelle der integrierten Versorgung
5. Zusammenfassung
6. Literaturverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildungsverzeichnis
Abb. 1 Ausgaben der gesetzlichen Krankenversicherung 1960 bis 1996
Abb. 2 Jährliche Veränderungsraten der Ausgaben der GKV für Gesundheit und der beitragspflichtigen Einnahmen (Grundlohnsumme)
Abb. 3 Rechtsgrundlagen in der GKV 1996
Abb. 4 Die Finanzierung der Leistungsanbieter
Abb. 5 Entwicklung der HMO-Gruppenpraxen und Hausarztsysteme
Abb. 6 Rechtsgrundlagen in der GKV 2000
Abb. 7 Analytischer Blickwinkel auf die Gesundheitsversorgung
Abb. 8 Grafische Darstellung der Rechtsbeziehungen in der vertrags- ärtzlichen Versorgung
Abb. 9 Fallpunktzahlen (Praxisbudget), je Behandlungsfall
Abb. 10 Vergütung der Krankenhausbehandlung
Abb. 11 Entgeltsystem für stationäre Leistungen zum 1.1.1996
Abb. 12 Ermittlung des Budgets nach § 12 BPflV
Abb. 13 Gefangenen-Dilemma-Matrix
Abb. 14 Regionale Verteilung der Ärzteteams im Praxisnetz (insgesamt 570 Ärzte in 453 Praxen)
Abb. 15 Schematische Darstellung: Aufgaben der Netzärzte
Abb. 16 Entwicklung der Versichertenzahlen gesamt (BKK und TK-Versicherte bis 1. Oktober 1999)
Abb. 17 Wichtigste Vertragsbestandteile im Praxisnetz Berlin
Abb. 18 Gesamtverantwortung durch das Kombinierte Budget
Abb. 19 Patientenbezogene Sonderleistungen
Abb. 20 Zeitbezogene Sonderleistungen
Abb. 21 Die Abrechnung im Kombinierten Budget 1998
Abb. 22 Kombiniertes Budget BKK und TK 1998, Einsparungen und Ausgabenverteilung
1. Einleitung
Immer wieder ist zu hören, dass dem Menschen zu feierlichen Anlässen Wünsche übermittelt werden, die sagen: „Alles Gute und viel Gesundheit!“. Was ist mit dieser Aussage gemeint? Wahrscheinlich setzen sich die wenigsten Menschen mit dem Kern dieser Botschaft auseinander. Viel eher werden die Gedanken darüber verdrängt und es als selbstverständlich angesehen, dass ein Mensch über genügend Gesundheit verfügt, damit die schönsten Augenblicke im Leben, z.B. der Urlaub im Sommer, nicht zur Qual werden.
Was bedeutet nun Gesundheit, was zeichnet es aus, dass wir uns damit immer intensiver auseinander setzen? Gesundheit wird als das höchste Gut des Menschen angesehen, das es zu wahren und zu verteidigen gilt. Physische, psychische und soziale Komponenten bilden vereint das menschliche Wohlbefinden. Daraus lässt sich ableiten, dass Gesundheit nur dann vorliegt, wenn alle drei Aspekte zusammen auftreten. Jeder weiß, es ist nicht immer möglich, allen Anforderungen gerecht zu werden. Täglich bedrohen ökologische, ökonomische und politische Entscheidungen die menschliche Gesundheit. Sobald eine Komponente verändert wird, gerät das Gleichgewicht der drei Säulen der Gesundheit ins Wanken. Trotzdem gelingt es dem Menschen, Veränderungen und Einflüsse aufzufangen, um die Stabilität wiederherzustellen.
Die im letzten Abschnitt angerissenen Probleme sind aber keine Auswirkungen des zu Ende gehenden 20. Jahrhunderts, sondern liegen viel weiter in der Vergangenheit zurück. Mit dem Beginn der Industrialisierung wurden dem Menschen immer mehr Aufgaben und Pflichten übertragen, die ihn auf Dauer aus dem Gleichgewicht der Gesundheit warfen. Erste Ansätze zur Regelung einfachster Bedingungen im Arbeitsleben wurden mit dem Beginn des 19. Jahrhunderts vereinbart. Vor ungefähr 110 Jahren verabschiedete Otto Fürst von Bismarck (1815-1898) im Reichstag die Sozialversicherung mit den Worten: „Geben Sie dem Arbeiter das Recht auf Arbeit, solange er gesund ist, sichern Sie ihm Pflege, wenn er krank ist, sichern Sie ihm Versorgung, wenn er alt ist.“[1] Die gesetzliche Krankenversicherung, als ältester Zweig der Sozialversicherung, wurde durch die Reichsversicherungsordnung (RVO) von 1911 so umfassend spezifiziert, dass sie im wesentlichen die Rechtsgrundlage der gesetzlichen Krankenversicherung bis zum Jahr 1989 bildete. In den letzten Jahren führten Diskussionen über Kostendämpfung im Gesundheitswesen zum Überdenken der aktuellen Gesetzeslage in Deutschland. Einen weiteren Kritikpunkt sieht man in dem Verhältnis der Wirtschaftlichkeit zur Qualität von medizinischen Leistungen. Würde der Trend zur Kostensenkung weitergehen, so ist die Schieflage zum Nachteil der Qualität nicht mehr aufzuhalten.
Bevor über Kosteneinsparungen und Gesetzesnovellierungen nachgedacht wurde, musste man sich erst mit den Grundprinzipien der GKV auseinandersetzen. Vorallem geht es um das Solidaritätsprinzip und das Sozialstaatsprinzip (Art. 28 Abs. 1 GG). In erster Linie fordert das Sozialstaatsprinzip, dass sich der Staat um die Bereit- stellung erträglicher Lebensbedingungen für in Not geratene Personen bemüht.[2]
Diese Interpretation impliziert eine Ausdehnung der Leistungsbereitstellung und damit einen Anstieg der für die Finanzierung aufzuwendenden Ausgaben.
In der Abbildung 1 wird die Ausgabenentwicklung in der gesetzlichen Krankenversicherung zwischen 1960 und 1996 dargestellt. Es ist festzustellen, dass sie in diesem Zeitraum ca. um das 25-fache gestiegen ist.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 1: Ausgaben der gesetzlichen Krankenversicherung 1960 bis 1996
(Quelle: Bundesministerium für Gesundheit)[3]
Neben dem Ausbau der Leistung forciert die Entwicklung der Rechtsprechung in der GKV einen stetigen Anstieg der Aufwendungen im Gesundheitswesen. Getragen werden die Kosten von den Krankenkassen, die wiederum ihrem Grundsatz der Beitragssatzstabilität für die Finanzierung der Krankenkassen gerecht werden wollen. Beide Argumente stehen im Widerspruch zueinander. Damit aber weiterhin die Finanzierung der Krankenkassen gewährleistet werden kann und den Mitgliedern keine Beitragserhöhungen auferlegt werden müssen, wurden in den vergangenen Jahren einige Gesetzesänderungen in der GKV durchgeführt. Hier sind die Aufnahme der GKV in das fünfte Buch des Sozialgesetzbuches (1989), das Gesundheits-Strukturgesetz von 1993, das GKV-Neuordnungsgesetz (1996) und die Gesundheitsreform 2000 zu nennen.
Das Kapitel 2 meiner Diplomarbeit erläutert noch einmal ausgiebig die gesetzliche Krankenversicherung in Deutschland. Zu den Ursprüngen der Sozialversicherung mit der GKV als ältester Bestandteil befasst sich der Punkt 2.1. Unter dem Aspekt 2.2. werden die Rechtsgrundlagen der GKV beschrieben. Auch die Probleme und Notwendigkeiten zur Veränderung mit Blick auf die Gesundheitsreform 2000 fließen unter diesem Punkt mit ein. Die neuen Organisationsformen medizinischer Leistungen werden im Abschnitt 2.3. näher erläutert. Hier ist vor allem auf die HMO zu verweisen. Auch alternative Vergütungsformen in der Schweiz werden an- gesprochen. Das zweite Kapitel wird durch den Punkt 2.4. abgerundet. Er beschäftigt sich mit dem Gesundheits-Reformgesetz 2000 und ihren neuen rechtlichen Möglichkeiten in Bezug auf die Durchführung alternativer Vergütungsformen.
Unser Gesundheitswesen ist bisher in drei Sektoren eingeteilt. Die ambulante Versorgung in Vertragsarztpraxen und die stationäre Behandlung in Krankenhäusern bilden den Kern im traditionellen deutschen Gesundheitswesen. Ergänzt werden sie durch den Arznei- und Heilmittelsektor. Mit den Beziehungen der Vertragspartner untereinander und der Darstellung der Vergütungsformen in den einzelnen Bereichen beschäftigen sich im dritten Kapitel die Punkte 3.1. und 3.2. Den Gegenpol bildet eine gemeinsame Vergütung in Form eines kombinierten Budgets. Damit soll die Schnittstellenproblematik der angesprochenen Einzelsektoren beseitigt werden. Die Idee ist eine integrierte Versorgung zwischen vor- und nachgelagerten Ebenen. Hiermit und mit der Motivation für die Einführung neuer Vergütungsmodelle beschäftigt sich der Abschnitt 3.3.
Die Vergütungsform des kombinierten Budgets wird im Praxisnetz Berlin angewendet. Grundlegende Aspekte über den Aufbau und die Arbeitsweise in diesem Netzwerk werden vorgestellt. Mit der Zusammensetzung der Budgetform beschäftigt sich das vierte Kapitel. Ob mit dieser alternativen Vergütungsregel die Ursache des Kostenanstiegs im Gesundheitswesen gelöst wird, zeigt sich noch. Die Idee ansich ist unstrittig, eine effiziente Lösung unter bestimmten Voraussetzungen nach dem Wettbewerbsgedanken zu erreichen.
Am Ende der Diplomarbeit werden die wesentlichen Punkte im Gesundheitswesen kurz wiederholt. Darüber hinaus verdeutlichen Ausblicke die Chancen des kombinierten Budgets oder anderer Vergütungsformen in der Zukunft.
2. Die gesetzliche Krankenversicherung in Deutschland
2.1. Historische Darstellung der GKV
Wenn wir in der Geschichte der GKV in Deutschland zurückgehen, dann stoßen wir auf die ersten Ansätze in der Zeit der Zünfte und Gilden. Zwar waren es nur ver- einzelte lokale Leitlinien, die einen Versicherungszwang für ihre Gesellen regelten, aber der Bias zur flächendeckenden Ausstattung mit Sozialleistungen in Deutschland war schon erkennbar. Im Jahre 1845 trat die Gewerbeordnung und –freiheit in Kraft, welche die Strukturen der alten Kaufmanns- und Handwerksformen beseitigten, wobei die bestehenden Versicherungskassen trotz erster Bedenken fortgeführt wurden.[4] In den folgenden Jahren trat dagegen die Industrialisierung immer mehr in den Vordergrund. Versuche, die Zwangsversicherung auch auf das Handwerk zu übertragen, schlugen fehl. Die Städte und Gemeinden machten sich in den kommenden Jahren stark, die Missstände zu beseitigen. Als Reaktion darauf ist auf die Thronrede Kaiser Wilhelms I. vom 17.11.1881 (Kaiserliche Botschaft) zu verweisen, die als Geburt der Sozialversicherung in die Geschichte einging.[5]
Der älteste Teil war das „Gesetz betreffend die Krankenversicherung der Arbeiter“, das ab 01.12.1884 die allgemeine Versicherungspflicht für Arbeiter und Angestellte in Industrie und Handwerk im gesamten Deutschen Reich darstellte.[6] Die Idee des Gesetzes bestand darin, eine Regelung zu finden, die neben dem Versicherungs- prinzip auch eine soziale Komponente beinhaltet, um die Kranken in der Erwerbs- welt gegenüber den Gesunden nicht zu benachteiligen. Mit diesem Gesetz wurde erstmals festgelegt, dass Patienten bzw. Solidargemeinschaften eigenständig die Kosten der Krankenhäuser übernehmen sollten. Das Ziel des Staates war es, ein Gegenstück zur organisierten Arbeiterbewegung aufzubauen, um durch gesetzlich „positive“ Regelungen das Wohl des Arbeiters zu fördern. Das Versicherungsprinzip, gegen eine prozentuale Abgabe vom Einkommen, eine Unterstützung für das wirtschaftliche Wohlergehen zu garantieren, wird in seinen Urformen noch heute angewendet.
Ein nächster Schritt in der Entwicklung der GKV bestand in der Reichsversicherungsordnung (RVO) vom 19.07.1911. Sie fasste die Gesetze über Kranken-, Unfall-, Alters- und Invaliditätsversicherung zusammen. Nachdem sie 1914 in Kraft trat, stellte sie bis 1989 im wesentlichen unsere Rechtsgrundlage für die Krankenversicherung dar. Auch Veränderungen, die sich durch die zwei Weltkriege und die Spaltung Deutschlands ergaben, zerstörten die RVO nicht in ihren Wurzeln. Das Versicherungsprinzip und die soziale Verantwortung des Staates für seine Bevölkerung wurden davon nicht betroffen. Lediglich die Beziehungen zwischen den Akteuren in der Krankenversicherung unterzogen sich einer Erneuerung. Außerdem wurden die Rentner, also die aus dem aktiven Erwerbsleben ausgeschiedenen ehemaligen Arbeiter, in das Krankenversicherungsrecht aufgenommen. In den Anfangsjahren der BRD erkannte die Regierung, dass das bisherige Finanzierungsmodell der GKV in naher Zukunft nicht mehr tragbar sein würde. Die Reform im Krankenversicherungsrecht scheiterte dagegen am Veto der Gewerkschaften und der Ärzte.[7] Das Problem der gesetzlichen Krankenversicherung bestand in der Explosion der Kosten im Gesundheitswesen. Verantwortlich dafür waren die Zunahme der Versicherungsleistungen, z.B. Kostenerstattung bei Prävention, Rehabilitation oder Schwangerschaftsabbrüchen. Ein weiterer Aspekt lag in der Reform der Krankenhausfinanzierung mit dem Selbstkostendeckungsprinzip. Dem Anstieg der Ausgaben in der Krankenversicherung stand die politische Forderung nach Beitragssatzstabilität für Versicherungsnehmer entgegen. Trotz mehrerer Kostendämpfungsgesetze in den 70er und 80er Jahren gelang es dem Gesetzgeber nicht, die Kostenexplosion durch geeignete Mittel aufzuhalten. Die Beitragssätze hielt man dafür relativ konstant.
Mit dem Jahr 1989 endete die RVO als Rechtsgrundlage für unsere GKV in Deutschland. Das Gesundheits-Reformgesetz (GRG) vom 20.12.1988 übernahm die Vorschriften der RVO und fasste sie in das fünfte Buch des SGB zusammen. Mit dem 01.01.1989 begann ein neues Zeitalter der Versorgungspolitik im deutschen Gesundheitswesen. Nachdem bisher humanitäre und soziale Kriterien im Vordergrund standen, treten jetzt ökonomische Aspekte in Erscheinung. Die Aufgaben der Krankenversicherung werden jetzt viel weiter gefasst. Nicht nur die Versicherung, als Verantwortlicher für die Gewährung von Leistung und Vergütung, sondern auch der Versicherte steht in der Pflicht, durch Eigenverantwortung zum Erhalt der Gesundheit beizutragen. Dieses findet sich im § 1 SGB V als Solidarität und Eigenverantwortung wieder. Mit Hilfe des GRG werden Über- und Unterversorgungen vermieden und die Beitragsstabilität gesetzlich dokumentiert. Obwohl das GRG eine wesentliche Veränderung des Gesundheitswesens darstellt, verdrängt es einige Punkte scheinbar bewusst, die sich aus der Erneuerung im Krankenversicherungsmarkt ergeben.
Ab 1993 entwickelte das Gesundheits-Strukturgesetz (GSG) vom 20.11.1992 die Krankenversicherungslandschaft weiter, wobei es sich im wesentlichen um die Kritikpunkte am GRG handelte.
Die Änderungen bezogen sich auf:
- die Begrenzung des Preisanstiegs bei Arzneimitteln
- die Begrenzung der Zulassung von Vertragsärzten
- die Strukturreform im Krankenhauswesen
- die Aufhebung des Selbstdeckungsprinzips mit der Einführung von leistungsorientierten Fallpauschalen in der Krankenhausfinanzierung
- die Ansätze zur Verzahnung des ambulanten und stationären Sektors
- die Ansätze zur Neuordnung der Vergütungssysteme.
Mittels der an Einnahmen gekoppelten Ausgabenpolitik (Budgetierung) wurde die Bezahlung der medizinischen Leistung gebremst, um damit den Beitragssatz zu stabilisieren.
Das 2. GKV-Neuordnungsgesetz (2. GKV-NOG) bildete ab 01.01.1997 die Voraussetzung für neue Versorgungsmodelle. Mit den §§ 73ff SGB V Strukturverträgen und dem § 63a Modellvorhaben wurde das erste Mal ein größerer Handlungsspielraum für die Möglichkeiten einer Selbstverwaltung in Form neuer Versorgungsstrukturen geschaffen. Insbesondere sind hier die integrierte Versorgung, die Modelle vernetzter Praxen oder sektorübergreifende Budgets (kombinierte Budgets) zu nennen. An dieser Stelle taucht erstmals der Begriff „Kombinierte Budgets“ auf, womit sich diese Arbeit noch näher befassen wird. Diese Ansätze mussten aber noch konkretisiert werden, um dem zunehmenden Wettbewerb von Wirtschaftlichkeit und Qualität im Gesundheitswesen gerecht zu werden.
Mit der Gesundheitsreform 2000 wurden Eckpunkte kreiert, die eine vollständige Verschmelzung von stationärem und ambulantem Sektor gewährleisten. Dieses Gesetz wird bestimmt nicht das letzte einer langen Kette von Modifikationen im Gesundheitssektor sein. Um dem rasanten Fortschritt im Gesundheitswesen wettbewerblich gerecht zu werden, ist eine permanente Begleitung seitens des Gesetzgebers erforderlich. Hinsichtlich der Standortfrage Deutschlands in der Weltwirtschaft ist die Problematik der Krankenversicherung nicht zu vernachlässigen. Hier werden in Zukunft weitere Gesetze das deutsche GKV-System international wettbewerbsfähig halten, auch in Bezug auf die Europäische Union.
2.2. Rechtsgrundlagen in der gesetzlichen Krankenversicherung
2.2.1. Die GKV im Sozialgesetzbuch (SGB V) und ihre Probleme während der
Reformen
Mit dem Gesundheits-Reformgesetz ab 1989 wurden die Rechtsgrundlagen der GKV in das Sozialgesetzbuch (SGB V) aufgenommen. Hiermit wurde die soziale Komponente als eine Grundlage für die eigene Gesundheit aufgewertet. Der Mensch wird erstmals gezwungen, selbständig an der Erhaltung und am Ausbau der eigenen Vitalität mitzuwirken. Weitere Neuerungen betrafen die Einführung von Festbeträgen für Arznei- und Hilfsmittel, aber ohne Zuzahlung des Versicherten, bzw. die Einführung der Bonusregel beim Zahnarzt. Weitere Ansätze, wie die Verzahnung der Versorgungsbereiche, scheiterten dagegen an der Blockade der Kassenärztlichen Vereinigung.
Trotz der rechtlichen Fixierung der Krankenversicherung in eine deutsche Sozialordnung, stand man bisher ökonomischen Aspekten eher negativ gegenüber. Gerade der Trend zum Wettbewerb im Gesundheitswesen, wo mit Qualität und Wirtschaftlichkeit zusammen effizient und effektiv umgegangen werden soll, wurde nicht erkannt. Die Kosten stiegen in den letzten Jahren ins Uferlose.
Abbildung 2 beschreibt die jährlichen Defizite zwischen den Ausgaben der GKV und den beitragspflichtigen Einnahmen. Nur die kurzfristigen positiven Salden sind auf die jeweiligen Einführungen neuer Gesetze zurückzuführen. Leider ist nur zu deutlich erkennbar, dass diese Effekte sehr schnell wieder aufgehoben wurden.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 2: Jährliche Veränderungsraten der Ausgaben der GKV für Gesundheit und der beitragspflichtigen Einnahmen (Grundlohnsumme)[8]
Auch die Ausdehnung der Leistung konnte nicht gestoppt werden. Als ein erster Versuch hier einzuschreiten, ist das Gesundheits-Strukturgesetz (1992) zu verstehen.
Die Ergebnisse dieser Reform waren:
- Aufhebung der Selbstkostendeckung im stationären Sektor, Weg zur leistungsorientierten Vergütung mit Fallpauschalen und Sonderentgelten war frei (§ 17 Abs. 2a KHG)
- Stärkung der Qualitätsverantwortung, d.h. alle Ausgabenbereiche sind an den Einnahmeentwicklungen gekoppelt (Budgetierung)
- Kündigungsmöglichkeiten von Krankenhäusern für Krankenkassen sind vereinfacht, aber Widerspruchsrecht seitens der Landesbehörde liegt vor, wenn Krankenhäuser unverzichtbar sind (§ 110 Abs. 2 SGB V), z.B. in ländlichen Regionen
- und die Öffnung des Krankenhauses für ambulante Eingriffe, insbesondere für das ambulante Operieren und die prä- bzw. poststationäre Behandlung (§ 115a,b SGB V).
Kritik gibt es aber beim Übergang zur leistungsorientierten Vergütung durch den Mix aus Fallpauschalen und Sonderentgelten. Das Problem der Finanzierung im Krankenhaus wurde zwar erkannt, trotzdem erfolgt sie im wesentlichen noch nach dem KHG von 1972.
Die Strukturdefizite wurden ebenfalls diskutiert, Lösungsvorschläge zielten auf folgende Punkte hin:
(i) Rahmenbedingungen für größere tagesklinische Einrichtungen und Gruppenpraxen schaffen
(ii) den Grundsatz: „ambulant vor stationär“ aufrechterhalten
(iii) Einführung eines „kombinierten Budgets“ als eine sektorübergreifende Vergütungsform.
Gerade durch die Veränderung der Finanzierung im stationären Bereich, indem neben Individualbudget auch Fallpauschalen und Sonderentgelte gewährt werden, ist eine Abkehr des Grundsatzes: „ambulant vor stationär“ erkennbar. Die prospektive Form der Bezahlung für einzelne Maßnahmen führt zu einer progressiv steigenden Anzahl von Einweisungen bzw. Behandlungen in das Krankenhaus. Dieses Defizit in der GKV wird noch durch eine monopolartige Stellung der Kassenärztlichen Vereinigung untermalt, indem sie für mögliche Modellvorhaben ein Einspruchsrecht besitzt. Hier ist schon einmal auf die Gesundheitsreform 2000 hinzuweisen, welche die Monopolstellung der KV beschneiden wird.
Das GSG hat den Wettbewerb im Gesundheitswesen in den Vordergrund gebracht. Obwohl jetzt ein Krankenkassenwahlrecht für Versicherungsnehmer vorlag, gab es keine Gestaltungsmöglichkeiten der Kassen und damit ein einheitliches Leistungsangebot. Dieser Aspekt hemmte dagegen den Wettbewerb der Krankenkassen. Die bisher praktizierte sektorale Budgetierung behinderte ebenfalls den Wettbewerb zwischen den Sektoren. Daher soll ein „kombiniertes Budget“ Anreize liefern, bei denen Erträge internalisiert und Kosten externalisiert werden (z.B. durch den Wegfall überflüssiger Überweisungen). Der Anreiz kann sich in einem Globalbudget widerspiegeln, das nach außen homogen ist und nach innen eine Kombination der einzelnen Sektoren darstellt, die flexibel zu handhaben sind. Leider kommt man aber zur Einsicht, dass gerade das Festhalten an gesetzlichen Regelungen der im GSG fixierten Forderung nach Wettbewerb widerstrebt. Die Notwendigkeit zu einer weiteren Reform, wie sie sich dann später in der Gesundheitsreform 2000 zeigte, war nicht zu verschweigen. Zwar lagen bisher brauchbare Ansätze vor, aber die vielen Einzelregelungen kamen sich in die Quere.
Bevor die Gesundheitsreform 2000 aber zur Diskussion stand, verabschiedete das Bundesgesundheitsministerium 1997 das 2. GKV-Neuordnungsgesetz. Man erkannte in den §§ 115ff SGB V ein gravierendes Problem in der Gesundheitsbranche, und zwar die bisher strikte Trennung des ambulanten vom stationären Sektor. Die ambulante Behandlung wurde durch Vertragsärzte in Arztpraxen durchgeführt. Die Sicherung nach außen gewährte die Kassenärztliche Vereinigung. Sie stellt eine Art Monopolunternehmung auf der Anbieterseite ärztlicher Leistungen dar. Die stationäre Versorgung liefert im Gegenzug das Krankenhaus.
Bisher wurde nur an der Sicherungsfunktion festgehalten, Wettbewerbsorientierung dagegen vernachlässigt. Die Möglichkeit, Einsparungen zu erzielen, Synergien auszunutzen und gleichzeitig wettbewerbsorientierende Formen zu schaffen, gab den Ausschlag für eine Vernetzung der bisherigen zweigleisigen Schiene, wobei die ambulante und stationäre Leistungsvergütung durch die Einführung eines einheitlichen Preissystems gekoppelt sind.
Vorgeschlagen wurde eine Vernetzung in Form von Praxiskliniken mit Vertragsärzten oder Fachambulanzen am Krankenhaus. Fachambulanzen müssen mit dem Widerstand der KV rechnen. Eine Ausnahme stellt das ambulante Operieren nach § 115b SGB V dar.
Netzpläne sind Methoden zur optimalen Planung und Überwachung der Ausführung von Projekten als Summe vieler einzelner arbeitsteiliger Prozesse unter Anwendung mathematischer und graphischer Hilfsmittel. Als Ergebnisse ergeben sich höhere Sicherheit der Planungsprozesse und geringere Verluste im Projekt.[9]
Bisher behandelte man die „leichten“ Fälle in den Praxen, die „schweren“ Fälle dagegen im Krankenhaus. Bei einer möglichen Praxisklinik würden trotzdem die schweren Fälle nur grundversorgt, dann aber in das Krankenhaus überwiesen.
Ziel der Vernetzung ist der Erhalt des in Gefahr geratenen Grundsatzes: „ambulant vor stationär“ (§ 39 SGBV), nicht „Praxis vor Krankenhaus“. Aktuelle Modelle bewirken eine Verbesserung der ambulanten Versorgung und das Abstellen unnötiger Krankenhauseinweisungen (Gatekeeperfunktion an Krankenhäusern). Entscheidende Voraussetzungen zur Verbesserung der Verhältnisse ist die Aufwertung des Verhältnisses von ambulanter zu stationärer Leistung, gerade unter dem Aspekt der Gatekeeperfunktion und des entsprechenden Vergütungssystems.[10]
Mit §§ 63ff SGB V Modellvorhaben und § 73a SGB V Strukturverträge sind die Möglichkeiten für die Selbstverwaltung neuer Versorgungsmodelle gegeben. Diese neuen Organisationsformen haben ihren Ursprung in den HMO´s der Vereinigten Amerikanischen Staaten. Beide Paragraphen bieten jetzt einen größeren Handlungsspielraum an, der für eine effizientere und effektivere Behandlung des Leistungsspektrums von Nöten ist.
Als Erstes setzen wir uns mit den Modellvorhaben auseinander. Hier sind zwei Formen zu unterscheiden:
a) Krankenkassen können Modelle durchführen oder nur vereinbaren, um die Wirtschaftlichkeit und die Qualität zu steigern. Im Mittelpunkt stehen die Strukturmodelle. (§ 63 Abs. 1 SGB V)
b) Krankenkassen können Modelle zur Leistung und zur Krankenhausbehandlung sowohl selber durchführen als auch vereinbaren (§ 63 Abs. 2 SGB V Leistungsmodelle).
Die KV sollen aber nicht bei den Modellvorhaben ausgeklammert werden. Auch sie können mit den Krankenkassen gemeinsam Modelle initiieren (§ 63 Abs. 6 SGB V). Dabei müssen aber folgende Bedingungen eingehalten werden:
- Inhalte der Modelle müssen durch die Krankenkasse geregelt sein (§ 63 Abs. 5 S. 1 SGB V)
- eine zeitliche Befristung auf acht Jahre wird vorgeschrieben (§ 63 Abs. 5 S. 2 SGB V)
- sie bedürfen einer wissenschaftlichen Begleitung (§ 65 SGB V)
- auf Vorschriften des 4. Kapitels SGB V und KHG (§ 64 Abs. 1 SGB V) wird verzichtet, vertragsärztliche Aspekte werden von der KV mitgetragen
- Beitragssatzstabilität (§ 63 Abs. 3 S.1 SGB V), wobei Kosten für Strukturmodelle nicht in das Honorar- oder Krankenhausbudget integriert werden dürfen (§ 64 Abs. 3 SGB V)
- Einsparungen können an Versicherte weitergeleitet werden (§ 63 Abs. 3 S.1 SGB V), aber Beiträge dürfen nicht gesenkt werden.
Neben den zeitlich befristeten Modellen wurden jetzt Strukturverträge geschaffen, welche die Möglichkeiten besitzen, neue Versorgungsformen auf Dauer in Verträgen zu vereinbaren (§ 83 SGB V).
Die Strukturverträge (§ 73a SGB V) werden nach Hausarztmodellen oder nach dem Modell vernetzter Praxen (Verbund von Haus- und Fachärzten) differenziert. Als entsprechender finanzieller Anreiz soll ein sektorübergreifendes Budget (Kombiniertes Budget) dienen. Die neuen Versorgungsstrukturen in Form vernetzter Gebilde werden vom Gesetzgeber anerkannt, wobei die folgenden Bedingungen beachtet werden müssen:
- Freiwilligkeit der Vertragsärzte und der Versicherten in der neuen Versorgungsform
- keine wissenschaftliche Begleitung
- Beitragssatzermäßigungen oder Rückzahlungen an die Versicherten dürfen zugesagt werden
- Beitragssatzstabilität
- Abrechnung ärztlicher Leistung nicht mehr nach dem einheitlichen Bewertungsmaßstab (EBM).[11]
Die ersten neuen Versorgungsformen traten durch das AOK-Hausarztmodell in Hessen und das BKK-Praxisnetz Berlin in Erscheinung. Obwohl einige Schritte zur Reformierung eingeleitet wurden, gab es noch immer rechtliche und administrative Hemmnisse, die nach einer weiteren Modifikation in der GKV riefen und später dann in der Gesundheitsreform 2000 wesentlich abgeschafft wurden. Konventionelle Vertragsgestaltungen sahen weiterhin Behandlungen im ambulanten und stationären Sektor vor.
Im ambulanten Bereich erfolgt die Honorierung der einzelnen Ärzte nach Einzel- leistung, bei gegebener Gesamtvergütung der Vertragsärzte innerhalb einer geogra-phischen Region (§ 85 Abs. 1 SGB V). Die Krankenkasse teilt das Gesamthonorar auf die Kassenärzte auf. Der einzelne Arzt befindet sich nach dieser Beurteilung in einem Gefangenen-Dilemma. Es ist für ihn individuell rational, seine Leistungen auszudehnen, um sein eigenes Honorar zu maximieren. Dagegen spricht aber die strikte Einhaltung des Gesamtbudgets. Diese kollektive Rationalität steht dem indivi-
duellen Gedanken entgegen. Alle Ärzte dehnen als Ergebnis daraus ihre Leistung aus, um nicht ihren Anteil am „Gesamtkuchen“ zu verlieren. Alle Mitwirkenden an der ärztlichen Vergütung verpflichten sich, die Beitragssatzstabilität (§ 71 SGB V) und die Budgetierungsvorschriften (§ 85 Abs. 3a SGB V) einzuhalten.
Die Budgetüberschreitung geht zu Lasten der Vertragsärzte. Die Kosten pro Leistungseinheit steigen und verursachen einen Kostenanstieg im ambulanten Sektor. Dafür ist die Entlohnung nach Punktwerten verantwortlich. Deshalb hat man 1996 den einheitlichen Bemessungsmaßstab (EBM) eingeführt, um den Punkteverfall zu stoppen. Tatsächlich erfolgte nur eine Substitution von „billiger“ Leistung zur besser honorierten. Trotzdem ist die Einführung des EBM nicht zu verurteilen, da er die Einkommensschere zwischen den einzelnen Vertragsärzten reduziert, obwohl es vermutlich einige Betroffene anders sehen. Mit der Einführung der arztgruppen- spezifisch fallzahlabhängigen Praxisbewertung bzw. der Zusammenfassung von Einzelleistungen zu Gruppenleistungen hielt sich der Punktwert seit ca. drei Jahren wesentlich konstant.
Die Vergütung im stationären Bereich erfolgt ab 1995 aus einem Mix von Fallpauschalen, leistungsorientierten Sonderentgeltformen und einem Restbudget. Alle einzelnen Formen besitzen für sich Vor- und Nachteile, aber eine einzelne Form dominiert nicht die anderen. Mit der Bundespflegesatzverordnung von 1995 gab es 40 Fallpauschalen für 26 verschiedene Krankheitsfälle und zusätzlich 104 Sonder- entgelte, die nur als Honorar für operative Eingriffe zu verstehen sind.[12] Mit dem GSG fiel das bisher praktizierte Selbstkostendeckungsprinzip weg, dass eine Erstattung der tatsächlichen Kosten übernahm. Da es aber keine Anreize zur Wirtschaftlichkeit gab, d.h. das Leistungsangebot wurde maximiert bei einem gleichzeitigen Gewinn von Null, wurde die weitere Entlohnung nach dem Selbstkostendeckungsprinzip abgelehnt. Vielmehr orientierte man sich an vorher festgelegte administrative Preise je Leistungseinheit. Leistungsorientierte Vergütung ist nicht an den Einnahmen gebunden. Gewinne oder Verluste können auftreten. Bei festem Budget wird eine geringere Menge von Einzelleistungen als bei Fallpauschalen erbracht. Wird nach Einzelleistungen entlohnt, so werden größere Mengen an Leistungen erbracht[13] als für die gegebene medizinische Behandlung notwendig ist.
Am Ende des Abschnittes 2.2. folgt noch eine kurze Auflistung der wichtigsten Grundlagen in der GKV:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 3: Rechtsgrundlagen in der GKV 1996
2.2.2. Wettbewerbsorientierte Neuausrichtung im Gesundheitswesen
In den 80er Jahren unseres Jahrhunderts waren die Ausgaben im Gesundheitswesen an einem Punkt angekommen, bei dem in absehbarer Zeit die Krankenversicherung in Deutschland zu Grabe getragen werden müsste. Alle Versicherungsnehmer wurden mit kompakten Leistungspaketen ausgestattet. Das Verhalten der Kostenfaktoren sah man als sekundär an. Entscheidende Faktoren des Kostenanstieges waren die medizinisch-technische Entwicklung im Operations- und Therapiebereich, der Preisanstieg im Arzneimittelsektor, demographische Entwicklungen in der Bevölkerung, die von staatlicher Seite ignoriert worden sind, und ein anderer Umgang mit dem Begriff Gesundheit bzw. Krankheit.[14] Aber auch andere Aspekte, wie die zunehmende Arbeitslosigkeit, der Arbeitsplatzabbau und das gestiegene Interesse der Aktionäre am kurzfristigen Unternehmenserfolg (Shareholder Value), hatten ihren Einfluss auf die Sozialpolitik. Deutschland sollte seine Stellung in der Welt als Standort für eine funktionierende und blühende Wirtschaft nicht verlieren. Man wurde gezwungen, die Wirtschaftlichkeit in der Sozialpolitik, insbesondere im Gesundheitswesen, neu zu überdenken. Das rationale Entscheiden über die Verwendung knapper Ressourcen wurde in das Gesundheitswesen transportiert. Die Sozialpolitik stand damit in Konkurrenz zu anderen Teilbereichen der Wirtschaftswissenschaften, so dass erstmals über Gesundheitsökonomie gesprochen wurde.[15]
Der Übergang zum Dienstleistungsbetrieb vollzieht sich nicht von allein. Ohne Regeländerungen im Sozialgesetzbuch sind kaum Möglichkeiten vorhanden, die ökonomischen Gedanken im Gesundheitswesen zu implementieren. Der Zielkonflikt zwischen ökonomischer und medizinischer Kompetenz spiegelte sich immer in der Qualitätssicherung und in der Kostenreduzierung wider. Auch wettbewerbs- orientierte Krankenkassen lagen bisher nicht vor. Dafür ist mit Fehlanreizen zu kämpfen, die anstatt einer Verzahnung der Versorgungsbereiche, sie gegeneinander konkurrieren zu lassen. Forderungen nach Effektivität, Effizienz und Qualität in Verbindung mit der Verbesserung der Patientenorientierung in der GKV haben einen wesentlichen Einfluss auf die Standortfrage Deutschlands im globalen Wettbewerb. Modelle sind zu überdenken, die Deutschland im internationalen Bereich wieder stärken, anstatt sie durch die ausschließliche Orientierung an Gesundheitszielen zu schwächen.
Ob neue Modelle einen neuen Wettbewerb im Gesundheitswesen schaffen, lässt sich kaum feststellen. Vielmehr müssen die Argumente der einzelnen Akteure im Markt für Krankenversicherungsleistungen differenziert betrachtet werden.
Nach Breyer und Zweifel sind hier die Versicherten / Patienten, die Politiker und die Ärzte miteinander zu vergleichen.
a) Versicherte: Aufgrund des Wettbewerbes zwischen den Verbänden ist für diese Gruppe, die Möglichkeit neue Organisationsformen zu schaffen, nur positiv zu bewerten.
b) Politiker: Der Wettbewerb wird von ihnen eher kritisch betrachtet. Der Informationsvorsprung der Verbände (Informations- asymmetrien) wird möglicherweise im Wettbewerb ausgenutzt. Die Politiker beharren auf ihre Meinung, wobei die Verbände die Interessen ihrer Mitglieder verteidigen.
c) Ärzte: Sie erzielen bisher zu hohe Preise für ihre Leistungen, unter- stützt durch die KV als Monopolist auf der Anbieterseite. Würde der Wettbewerb zwischen den Verbänden auf der Anbieterseite zugelassen, so könnten diese Preise nicht mehr erzielt werden. Neue Organisationsformen ermöglichen dafür neue Beschäftigungschancen für neu in den Markt eindringende Ärzte.[16]
Sollte der Wettbewerb für neue Modelle zugelassen werden, so ist damit zu rechnen, dass nicht alle Akteure im Gesundheitsmarkt sofort von den Modifikationen begeistert sind. Ein wichtiger Schritt in diese Richtung würde ein gemeinsames Herangehen an das Problem sein. Schließlich wurde die HMO auch nicht von seiten des Arbeitgebers initiiert. (s.2.3.1.)
In Deutschland stand es jedem Versicherten frei, beliebig viele Ärzte aufzusuchen. Der Patient konnte sich sogar selber ins Krankenhaus einweisen, indem er dort ohne Überweisung direkt einen Facharzt aufsuchte, der ihn behandeln musste. Im Ausland dagegen wurde nach dem Managed Care-Ansatz verfahren, wobei das wichtigste Kriterium im Hausarzt als sogenannter Gatekeeper bestand.
In den Niederlanden, Großbritannien und Skandinavien verfährt man nach dem Primärarztsystem. Versicherte schreiben sich bei einem Hausarzt ihrer Wahl ein, der alle Untersuchungen und Behandlungen durchführt. Notwendige Eingriffe im Krankenhaus erfolgen nur per Überweisung durch den Hausarzt.
In den USA und in der Schweiz entstanden neue Versorgungskonzepte in Form von Netzwerken, die besser unter dem Namen Health Maintenance Organizations (HMO´s) bekannt sind. Hier besteht zwischen den Leistungserbringern und den Patienten eine bilaterale Verbindung in Form von Versicherungsverträgen.
Mit zunehmender Zeit stieg auch in Deutschland das Interesse an neuen Organisationsformen im Krankenversicherungsmarkt. Vor allem die HMO´s, die in der medizinischen Versorgung zu Kostensenkungen beitrugen, gestalteten die Modifikationen der GKV mit. HMO´s werden als Versicherungsunternehmen angesehen, die eine Versorgung der Versicherungsnehmer durch eigene Einrichtungen oder durch Verträge mit unabhängigen Anbietern bereitstellen.[17] Die vertikale Integration vom ambulanten und stationären Sektor orientiert sich an der gesamten Wertschöpfungskette des Patienten. Die negativen Auswirkungen der HMO‘s, wie eine Risikoselektion durch prospektive und budgetorientierte Finanzierungsformen, bremsen den Aufstieg im Gesundheitswesen. Ob tatsächlich Selektion zwischen „guten“ und „schlechten“ Risiken auf die Existenz von HMO´s zurückzuführen ist, bleibt zum gegenwärtigen Zeitpunkt unbeantwortet.
In Deutschland verzeichnete man bis Mitte der 90er Jahre kaum Wettbewerb zwischen den Sektoren. Nur eingeschränkt durch die staatliche Krankenhausplanung, das Selbstkostendeckungsprinzip und den tagesgleichen Pflegesätzen, ist bisher Wettbewerb zu erkennen. Das Fehlen von freien Marktzugängen und -transparenzen unterstützt das traditionelle Ziel, eine bedarfsgerechte flächendeckende Versorgung durch den Gesetzgeber zu garantieren. Bei der Selbstkostendeckung wird das Risiko den Krankenkassen zugeschoben. Auch prospektive Budgetierung auf der Grundlage tagesgleicher Pflegesätze wirkt für einen Wettbewerb anreizhemmend. Die Krankenhäuser verlängern den Aufenthalt künstlich bis zur Restriktionsgrenze, um in den Genuss von zusätzlichen Pflegesätzen zu kommen.
Schon Ende der 80er Jahre erhielt der Krankenhausbereich den größten Anteil der Leistungsausgaben, wie es die Abbildung 4 zeigt.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Quelle: Sachverständigenrat für die Konzentrierte Aktion im Gesundheitswesen,
Das Gesundheitswesen im vereinigten Deutschland, Jahresgutachten 1991,
Baden-Baden, Tabelle T-465
Abb.4: Die Finanzierung der Leistungsanbieter[18]
Daher lässt sich zusammenfassen, dass bisher das Gesundheitswesen in Deutschland durch zu hohe Markteintrittsschranken und Innovationsunfreundlichkeit mehr staatlich verwaltet wird als der wettbewerblich ausgestaltete Markt.[19]
Erste Ansätze in Richtung neuer Organisationsformen lieferte das GSG. So ist hier das Hausarzt-Modell der AOK im Frankfurter Raum (ab 01.01.1997) und das BKK-Modell vernetzter Praxen mit kombiniertem Budget zu nennen.
Wettbewerbs- und Gesundheitsziele wurden traditionell getrennt voneinander behandelt. Beide Gesichtspunkte sollten jetzt in das Entscheidungskalkül der Versicherungsnehmer aufgenommen werden. Die Rechte der gesetzlich Krankenversicherten regelt das SGB V. Die HMO´s werden eher als privat- wirtschaftlich angesehen. Auch die Rechtfertigung von Wirtschaftlichkeits- argumenten für eine zweigleisige Betrachtung der ärztlichen Versorgung hält kaum Untersuchungen stand. Ob ein niedergelassener Arzt tatsächlich effizient arbeitet, ist fraglich. Vielmehr spricht für dieses Argument der Standort der Praxis. Ebenfalls ist die Kostensenkung kein ausschließliches Ergebnis der Substitution von stationärer zu ambulanter Leistung. Eher sollen beide Sektoren zur Kostendämpfung veranlasst werden. Der Staat beharrt zwar auf seine Einstellung, doch die Notwendigkeit zur Gesetzesänderung sieht er nur, wenn Gesundheit als öffentliches Gut[20] die Funktionsfähigkeit im Gesundheitswesen beeinträchtigt, und man daher von Marktversagen ausgehen muss.[21]
Mit der Orientierung am Care-Management erzielte man auf Seiten der Versicherten eine bessere Versorgung. Überkapazitäten, mangelnde Kooperation und Koordination wurden durch die Vernetzung von Praxen beseitigt. Der Versicherte ist nicht mehr als Spielball zwischen den Sektoren zu sehen. Im Vordergrund steht die Leistung, erst dann erfolgt die Vergütung in Form einer Art Globalbudget. Unter dieser Glocke werden die ärztliche Gesamtvergütung, das Krankenhausbudget und die Arznei- und Heilmittel abgedeckt.
Zurück zum HMO, das ab der 70er Jahre in den USA ein Konkurrent zu den konventionellen Leistungsanbietern war. Schon nach kurzer Sicht gelang es den Betreibern, die Kosten tatsächlich zu verringern. Man wollte auch die Versicherungs- nehmer an diesen Einsparungen beteiligen. Statt aber die Prämienzahlung zu reduzieren, erfolgten Gewinnausschüttungen oder der Ausbau der eigenen Reputation durch Unternehmensexpansionen. Ein Mix verschiedener Instrumente führte zu medizinisch effektiveren und ökonomisch effizienteren Leistungserbringern als bei traditionellen Organisationsformen. Dafür verzichtete der Vertragspartner auf sein Recht zur freien Arztwahl. Prinzipiell ließe sich dieses Konzept auch in Deutschland integrieren. Da aber bisher an anderen Leitlinien festgehalten wurde, müssten sie auf den Markt in Deutschland genau zugeschnitten werden. Als erstes wäre es erforderlich, die Formen der Vergütung zu klären. Zu- und Abschläge oder Vergütung von Ergebnissen könnten alternativ in Frage kommen.
Zu beachten ist aber, dass negative Ausprägungen möglich sind. Die Frage, wie finanzielle Anreize auf die Versicherungsnehmer übertragen werden könnten, obwohl Beitragssatzstabilität vorgeschrieben ist, muss noch zu klären sein. Eine mögliche neue Vergütungsform kann aber nicht einzeln als Heilmittel verstanden werden. Vielmehr sollte die neue Variante in das bisherige System implementiert werden, um als interne Bereicherung den Konkurrenzkampf anzukurbeln. Als Ziel wird die Verbesserung der Schnittstelle zwischen ambulanter und stationärer Versorgung angesehen. Bei größerer Versicherungsfreiheit ließe sich dann die Qualität steigern und die Kosten bei gleichzeitiger Patientenorientierung verringern.
In den nächsten 2 Abschnitten werden die Entstehung der HMO in den USA und die Einführung dieser neuen Organisationsformen in der Schweiz, die damit als Vorreiter in Europa in Erscheinung trat, erläutert.
2.3. Die neuen Organisationsformen medizinischer Leistungen als Vorreiter des Wettbewerbsgedankens in Deutschland
2.3.1. Health Maintenance Organization (HMO) in den USA
Die USA sagen von sich, dass sie das am besten ausgestattete Gesundheitssystem der Welt besitzen. Tatsächlich ist ihre Versorgung die teuerste der Welt, obwohl nicht alle Bewohner den Versicherungsschutz einer Krankenversicherung in Anspruch nehmen können. Die Kompetenzen der medizinischen Versorgung unterscheiden sich sehr stark in einigen Ländern. In Europa trägt überwiegend der Staat die Verantwortung für eine Bereitstellung von Krankenversicherungsleistungen. Ein arbeitsplatzgebundenes Krankenversicherungssystem herrscht dagegen in den USA. Als Grund ist eine stabile Finanzierungsbasis anzusehen, da das Einkommen als Berechnungsgrundlage für die Prämienzahlungen dient. Der Arbeitgeber leistet die Versorgungszahlungen an die entsprechenden Kassen. Wem kein Arbeitsplatz zur Verfügung steht, hat auch keinen Arbeitgeber, der das Einkommen um die Prämien kürzen kann. Für mögliche Lücken in der Finanzierung soll der Staat herhalten, was er auch im Rahmen eines staatlichen Krankenhauses für Personen ohne Krankenversicherung im wesentlichen umzusetzen versucht. Die traditionellen Organisationsformen bestimmten über Jahre hinweg die Durchführung medizinischer Leistungen. Trotzdem entstand aus der Not geboren eine Alternativform, die Health Maintenance Organization. HMO´s stehen für Modelle der Pauschalhonorierung.
Die Anfänge gehen auf die Vorläufer der HMO´s, die sogenannten „Prepaid Group Practices“, zurück. 1928 schlossen sich die ersten Ärzte zu einer pauschalhonorierten Praxis in Oklahoma zusammen, und 1929 folgte die erste pauschalhonorierte Gruppenpraxis, wobei beide mit dem starken Widerstand ihrer Berufskollegen und Verbände kämpfen mussten.[22] Ärzteverbände versuchten mit allen Mitteln diese Erneuerungen aufzuhalten. So ist es nicht verwunderlich, dass die Idee von seiten der Arbeitgeber aufgegriffen wurde. Henry J. Kaiser gründete in den 30er Jahren in Kalifornien die Kaiser-Foundation als erste Urform der HMO in den USA, gleichzusetzen mit einer Betriebskrankenkasse der Kaiser-Stahlwerke.[23] Zu diesem Zeitpunkt tauchte der Name HMO aber noch nicht in der Literatur auf. Kaiser wollte allen seinen Mitarbeitern, die weit voneinander entfernt arbeiteten, die gleichen guten medizinischen Versorgungsbedingungen bereitstellen, damit sein Unternehmen ökonomisch effektiv und effizient arbeiten konnte. Sie sollten alle zu jedem Zeitpunkt arbeitsbereit sein, um damit eine hohe Auslastungsquote seiner Maschinen zu erreichen. Das war gerade in der Zeit des 2. Weltkrieges und seiner Rüstungsproduktion von großer Bedeutung.
Der Kern der Idee bestand in der Verbindung der traditionell getrennten Funktionen: Versicherung und Versorgung mit medizinischen Leistungen. Mit der Verschmelzung war es der HMO erlaubt, für eine ex-ante fixe Prämie, medizinische Versorgung durch eigene Einrichtungen zu garantieren. Dafür musste der Patient auf freie Arztwahl verzichten, da er exklusiv nur von HMO-Ärzten behandelt wird.[24] Weitere Instrumente im Wettbewerbsverhalten sind die Einschränkung der freien Arztwahl, standardisierte Behandlungsleitfäden, eine Gewinnbeteiligung der Ärzte und selektive Verträge mit den verschiedenen Anbietern medizinischer Leistungen, insbesondere mit den Ärzten, den Krankenhäusern und der Pharmaindustrie.[25]
Health Maintenance Organizations lassen sich nach der Höhe der von Leistungs- anbietern zu zahlenden optimalen Kostenbeteiligung in drei Gruppen einteilen.[26]
(1) Unternehmenstyp: Die HMO tritt als Trägergesellschaft mehrerer Arzt- praxen auf. Die Ärzte arbeiten auf Basis einer Erfolgs- beteiligung für die HMO. Halten sie die Budget- vorgaben ein, können sie am Gewinn partizipieren.
(2) Vertragsnetztyp: Hier sind die Ärzte die Besitzer und mit der HMO zusammen die Betreiber der Gruppenpraxen. Deshalb steht es ihnen frei, auch Versicherte anderer Organisationsformen zu behandeln.
(3) Typ „Vereinigung eigenständiger Praxen“ (IPA): Bei diesem Typ gehen HMO und lokale Ärztegemeinschaften Vertragsbeziehungen ein. Alle Versicherten verpflichten sich, eine Primärärzte- beziehung einzugehen, d.h. der erste Schritt bei einer medizinischen Untersuchung ist der Hausarzt. Sollte es ihm nicht möglich sein, eine umfassende Versorgung zu gewährleisten, so überweist er ihn zur näheren Untersuchung in ein Krankenhaus.
Gegenüber anderen Ländern war es hier ein Arbeitgeber, der die Funktion des Gatekeeper übernahm. Daher ist es schon erstaunlich, dass sich dieses Format durchsetzte, da man sonst vom Staat erwartet, Maßnahmen bei Marktversagen durchzuführen, um diese zu internalisieren.
Nach dem Krieg wurde das entstandene Versorgungssystem nicht zurückgebaut, sondern ihre Entwicklung sogar forciert. Kaiser baute vor allem in Industriegebieten Netzwerke und Gruppenpraxen als Formen mit pauschalhonorierter Vergütung auf und damit wurde Kaiser-Foundation zur größten Versorgungsform der USA.[27] Der Begriff HMO tauchte erst in den 70er Jahren durch den amerikanischen Gesundheitspolitiker Paul Ellwood jr. auf.[28] Der amerikanische Forscher Alain Enthoven verglich den Begriff der HMO mit einem „Alternative Delivery System“, wobei der Schwerpunkt eines wettbewerbsorientierten Gesundheitssystem das Fundament der Health Maintenance Organizations darstellt.[29]
Am Anfang bestand für die HMO nur das Interesse, seine Mitglieder gesund zu halten, damit sie arbeiten konnten. Erst Jahre später ließen sich Effizienzsteigerungen erkennen. Das vorhandene feste Budget erforderte vom Leistungsanbieter, Wege zu finden, um die Versorgung sicher zu stellen und dabei das Budget nicht zu überschreiten. Die Budgetobergrenze ist als Randoptimum zu verstehen, d.h. bis zur Obergrenze ist die medizinische Versorgung noch effizient. Mit dem Konzept für die Wettbewerbsstrategie: „Survival of the fitest“ (soziales Überleben)[30] ist es erstmals gelungen, der Einzelleistungsvergütung Paroli zu bieten.
Trotz aller Vorteile hatten die HMO-Formen mit starkem politischen Widerstand zu kämpfen. Gerade die traditionellen Anbieter medizinischer Leistungen verweisen auf die negativen Folgen der HMO, um damit die steigende Popularität einzudämmen. Von seiten der Nachfrager ist auf den Verzicht der freien Arztwahl zu verweisen. Sie können nur noch Leistungen innerhalb der Organisation nachfragen. Ob dieser Verzicht kosteneffizient ist, scheint kaum nachweisbar zu sein. Auch die Konkurrenten argumentieren, dass die Kostendämpfung nicht ausschließlich auf eine effiziente Versorgung zurückzuführen ist. Vielmehr könnte hierfür die Risiko- selektion von „schlechten“ und „guten“ Risiken im Gesundheitswesen verantwortlich sein. HMO´s weisen zwar geringere Kostenniveaus als traditionelle Organisations- formen auf, aber einen Anstieg der Kosten können sie nicht vermeiden. Aufgrund struktureller Probleme gibt es im ländlichen Raum zu wenig Nachfrager für ein HMO-Konzept. Hier muss die herkömmliche Versorgung greifen, um den Patienten in dieser Region abzusichern. Trotz aller Nachteile ist aber das positive Ergebnis nicht zu leugnen, dass es gelungen ist, eine Verzahnung der Versicherungsfunktion mit der Versorgungsfunktion zu erreichen. Positiv ist die vom Arbeitgeber und nicht vom Staat ausgehende Initiative zu bewerten.
Es ist ersichtlich, nur eine Form der Organisation ist allein der Garant für verbesserte medizinische Leistungen. Die Politik gestattete in den letzten Jahren beide Konzepte, HMO´s und herkömmliche Versorgungsformen, nebeneinander zuzulassen. Beide Varianten sind nicht als Konkurrenten anzusehen. Vielmehr sollen sie sich ergänzen, denn Wettbewerb besaß bisher nur ideellen Charakter. Wobei zu bemerken ist, dass die Gesamtmitgliederzahl in allen amerikanischen HMO´s von 5,5 Millionen 1970 auf ca. 21 Millionen im Jahre 1985 angestiegen ist.[31] Hier ist deutlich zu sehen, wie populär diese Versorgungsformen wurden.
2.3.2. Alternative Vergütungsformen medizinischer Leistungen in der Schweiz
Die Schweiz besitzt eines der teuersten Gesundheitssysteme der Welt. Mit einer nahezu hundertprozentigen freiwilligen Krankenversicherung liegt die Verantwortung für eine Bereitstellung, anders als in anderen europäischen Ländern, im wesentlichen auf Seiten der Leistungserbringer. Erst ab 1996 gibt es die gesetzlich fixierte Krankenversicherung. Eine Besonderheit im Schweizer Gesundheitswesen besteht in der individuellen Bestimmung von Tarifen und Verträgen zwischen Krankenkassen und Leistungserbringern pro Kanton statt einer bundesweiten einheitlichen Regelung. Die stationäre Behandlung im Krankenhaus wird durch eine Subventionierungspolitik geprägt. Da in den vergangenen Jahren die Kostenexplosion auch in der Schweiz nicht zu stoppen war, wurden verschiedene Veränderungen im nationalen Gesundheitsmarkt registriert.
Ein Konzentrationsprozess der Krankenkassen und eine Vermehrung der Leistungs- anbieter sollte zur effizienten Versorgung führen. Dabei wurde aber nicht auf die obligatorische Grundversorgung verzichtet. Per Gesetz räumte man den Versicherten, genau wie in Deutschland, die freie Krankenkassenwahl ein. Zur Verbesserung der Position der Patienten wurde der Umfang medizinischer Leistungen weiter ausgebaut, um Versorgungslücken zu schließen, die sich durch den Konzentrationsprozess ergaben. Leider gelang es dafür nicht, den Kostenanstieg zu begrenzen.
Um den Wettbewerb zwischen den Versorgungsgemeinschaften zu fokussieren, verbot man sämtliche Absprachen innerhalb des Krankenversicherungsmarktes zwischen den Leistungseinkäufern und –erbringern. Leider griffen die Reformen nur in Teilbereiche des Gesundheitswesens, so dass der bestehende Interessenkonflikt zwischen ökonomischen und sozialen Zielen nur partiell ausgeräumt werden konnte. Das Übergewicht in der stationären Behandlungsintensität sticht als ein gravierender Punkt hervor. Hier müssen Ideen umgesetzt werden, die beide Versorgungs- alternativen ökonomisch und sozial gleichstellen. Einen Ansatz, diesen Zwiespalt zu lösen, bietet das Managed Care-Konzept, dass die Krankenkassen nicht mehr als Verwaltungseinheit und gleichzeitige Zahlstelle ansehen, sondern als zukünftiger Dienstleistungsbetrieb.
Mehrere Konzepte stehen hier zur Auswahl, wobei aufgrund ihrer zunehmenden Gewichtung, nur 2 Modelle in Frage kommen.
- Hausarztmodelle[32]: Der Patient wählt für einen bestimmten Zeitraum einen bestimmten Arzt als seinen Hausarzt für die medizinische Grundversorgung aus. Er erhält nach der persönlichen Risikoeinstellung des Patienten eine pauschale Vergütung. Über den Aspekt der Gesundheitsversorgung hinaus getätigte Untersuchungen erfolgen nur durch die Überweisung des Hausarztes in ein Krankenhaus seiner Wahl. Für den Verzicht auf sein Wahlrecht eines freien Arztes erhält der Patient eine Prämienermäßigung.
- HMO[33]: HMO´s sind räumliche Gebilde, die mit Gruppenpraxen zu vergleichen sind. Bei einer HMO wird ex-ante per Vertrag eine exogene Prämie festgelegt, die der Versicherungsnehmer zu leisten hat. Da eine ex-post Beteiligung an den tatsächlich entstandenen Kosten ausgeschlossen werden kann, ist es aus Sicht der HMO vorteilhaft, die Gesamtkosten so gering wie möglich zu halten. HMO´s sind nicht Leistungserbringer, sondern auch Versicherungsgeber. Deshalb befinden sich in ihrem Katalog neben Versorgungs- und Behandlungsmaß- nahmen auch präventive Leistungen. Ebenfalls wie beim Haus- arztmodell verzichten die Patienten auf ihre freie Arztwahl, um dafür in den Genuss der geringeren Prämien zu kommen.
Als Finanzierungsgrundlage dient ein Globalbudget für die zu betreuenden Mitglieder, aus dem die Aufwendungen für das Personal, die Praxisunkosten, den Zukauf fremder ärztlicher Leistungen und die Reserven oder Gewinnausschüttungen bezogen werden.[34]
Gegenüber Deutschland setzten sich diese beiden Konzepte im schweizerischen Gesundheitssystem frühzeitig durch. Ihr Marktanteil ist in den letzten Jahren permanent gestiegen. Wie kam es eigentlich zu dem Siegeszug der MC-Konzepte in der Schweiz?
1984 beschäftigte sich eine Studiengruppe der Schweizerischen Gesellschaft für Gesundheitspolitik (SGGP) mit dem amerikanischen Modell der HMO. Sie waren von dem Gedanken begeistert, dass als Anreiz für die Entlohnung medizinischer Leistungen nicht mehr ausschließlich die Behandlung der Krankheit, sondern die Bewahrung der Gesundheit bei Gewährung von qualitativ guter medizinischer Versorgung immer mehr in Frage kam.[35] Das Vertragssystem beinhaltete Anreize und Kooperationsformen, um die Leistungserbringer und –einkäufer gemeinsam in Verantwortung zu nehmen. Die Krankenkasse KFW-Winterthur gründete mit der Trägergesellschaft Konkordia Luzern 1985 die Interessengemeinschaft für alternative Krankenversicherungsmodelle (IGAK). Ihre Aufgabe war es, eine Definition zu finden, die es ermöglicht, eine HMO in die Schweiz zu überführen. Die Idee bestand darin, eine medizinische Gemeinschaft zu finden, die finanziell für die gesamte Gesundheitsversorgung eines geographischen Raumes zuständig ist, und dabei unabhängig vom Gesundheitsbild des Versicherungsnehmers.[36]
Nachdem 1987 einzelne kantonale Ärztegemeinschaften einer Durchführung neuer Modelle zugestimmt hatten und 1988 die Rahmenbedingungen für die Modelle festgelegt wurden, konnte dank des Einsatzes der SPPG am 01.01.1990 die erste Health Maintenance Organization in Zürich eröffnet werden. Trotz Anlaufschwierigkeiten ging der forcierte Ausbau neuer Modelle voran. Andere Krankenkassen zogen mit neuen Ideen nach.
Die Swisscar als Dachorganisation drei schweizer Krankenversicherungen startete zum 01.04.1994 in Winterthur das Hausarztmodell Wintimed, ein Konglomerat von ca. 20 Ärzten. Hier schlossen sich unabhängige Arztpraxen zusammen, die mit Versicherungen Behandlungsverträge vereinbarten. Der Arzt fungiert als Gatekeeper. Im Krankheitsfall soll er immer als erste Anlaufstation dienen. Für den Verzicht auf freie Arztwahl erstattete man den Versicherungsnehmern einen Teil ihrer Prämien zurück. Im Versicherungsvertrag wurde das Einsparziel gegenüber den herkömmlichen Krankenversicherungen in der gleichen Region definiert, wobei die Ärzte am finanziellen Risiko bei Gewinn oder Verlust mit bis zu 10.000 sFr beteiligt sind, wenn sie 15% Einsparung nicht erreichen.[37] Als Folge dieser neuen Modelle steigt die Bedeutung der ambulanten Behandlung im Hausarztmodell. Der Arzt selektiert durch seine Entscheidung, wann und wohin er Patienten überweist, das Krankenhaus, welches von der ambulanten Behandlungsintensität partizipieren soll.[38]
Erste Erfahrungen mit dem Betrieb von HMO´s machten deutlich, dass nur der Einsatz in Ballungsgebieten aufgrund von Synergien rentabel ist. 3.000 bis 10.000 Versicherte sind notwendig, um Gesamtkosten zwischen 10 und 40% und den Krankenhausaufenthalt um durchschnittlich drei Tage, gegenüber den traditionellen Formen, zu senken.[39] Die Optimierung der Gesamtkosten in der HMO lieferte ein „gesundes“ Verhältnis von ambulanter und stationärer Behandlung.
Die Patienten sind zufrieden, da sie eine ganzheitliche Versorgung genießen und an der Kostenreduzierung partizipieren dürfen. Die Betreiber der HMO´s beziehen positive Einkommen, wenn sie ihr festgelegtes Einsparvolumen realisieren. Die Politik verzeichnet Neubildungen von Krankenkassen, um Einkaufsmacht und Eigen- verantwortlichkeit zu stärken. Es entstehen ebenfalls in Spitälern und im Pharma- bereich, unabhängig von der Krankenkasse, neue Gruppen von Einkäufern. Die Folge der Entwicklung im Gesundheitswesen ergab eine neue Definition des Begriffs Gesundheit und eine Orientierung an den Interessen der Patienten. Der Normalfall medizinischer Versorgungssysteme wird immer mehr von MC-Konzepten getragen.
Wie die Abbildung 5 zeigt, ist in wenigen Jahren der Marktanteil neuer Organisationsformen in der Schweiz am gesamten Katalog ärztlicher Leistungen rapide gestiegen.
[...]
[1] Vgl. Meyer (1994), S. 49
[2] Vgl. Merkens/von Birgelen (1998), S. 14
[3] Abbildung aus: Beske/Hallauer (1999), S. 96
[4] Vgl. Herder-Dorneich (1966), S. 352
[5] Vgl. Merkens/von Birgelen (1998), S. 13
[6] Vgl. Bundesministerium für Arbeit und Sozialversicherung (1995), S. 114
[7] Vgl. Bundesministerium für Arbeit und Sozialversicherung (1995), S. 117
[8] Abbildung aus: Wille (1998), S. 18
[9] Vgl. Hillier/Liebermann (1988), S. 378ff
[10] Vgl. Düllings (1997), S. 65f
[11] Vgl. Schönbach (1997), S. 67
[12] Vgl. Bundesministerium für Arbeit und Sozialversicherung (1995), S. 191
[13] Vgl. Breyer/Zweifel (1997), S. 356
[14] Vgl. Adam (1996), S. 8
[15] Vgl. Gäfgen (1990), S. 12
[16] Vgl. Breyer/Zweifel (1997), S. 316f
[17] Vgl. Busse/Wismar (1997), S. 31
[18] Abbildung aus: Henke (1992), S. 145
[19] Vgl. Neubauer/Zelle (1996), S. 342
[20] Vgl. Breyer/Zweifel (1997), S. 151ff
[21] Vgl. Wiedemann (1998), S. 17
[22] Vgl. Buxbaum (1988), S. 345f
[23] Vgl. Griesewell (1994), S. 34
[24] Vgl. Breyer/Zweifel (1997), S. 300
[25] Vgl. Busse/Wismar (1997), S. 31
[26] Vgl. Hauser (1988), S. 21f
[27] Vgl. Buxbaum (1988), S. 346
[28] Vgl. Ellwood jr. (1971), S. 53ff
[29] Vgl. Enthoven (1980)
[30] Vgl. Griesewell (1994), S. 34
[31] Vgl. Reinhardt (1988), S. 166
[32] Vgl. Morra (1996), S. 67
[33] Vgl. Morra (1996), S. 68f
[34] Vgl. Sommer (1988), S. 383
[35] Vgl. Baumberger (1996), S. 28
[36] Vgl. Baumberger (1996), S. 29
[37] Vgl. Baumberger (1996), S. 31
[38] Vgl. Morra (1996), S. 70f
[39] Vgl. Geser (1995), S. 33
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Originalausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2000
- ISBN (eBook)
- 9783832449063
- ISBN (Paperback)
- 9783838649061
- DOI
- 10.3239/9783832449063
- Dateigröße
- 4.5 MB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg – Wirtschaftswissenschaften
- Erscheinungsdatum
- 2002 (Januar)
- Note
- 3,0
- Schlagworte
- health maintenance organization vergütungsformen gesundheitswesen reformgesetz heilmittelbudgets
- Produktsicherheit
- Diplom.de