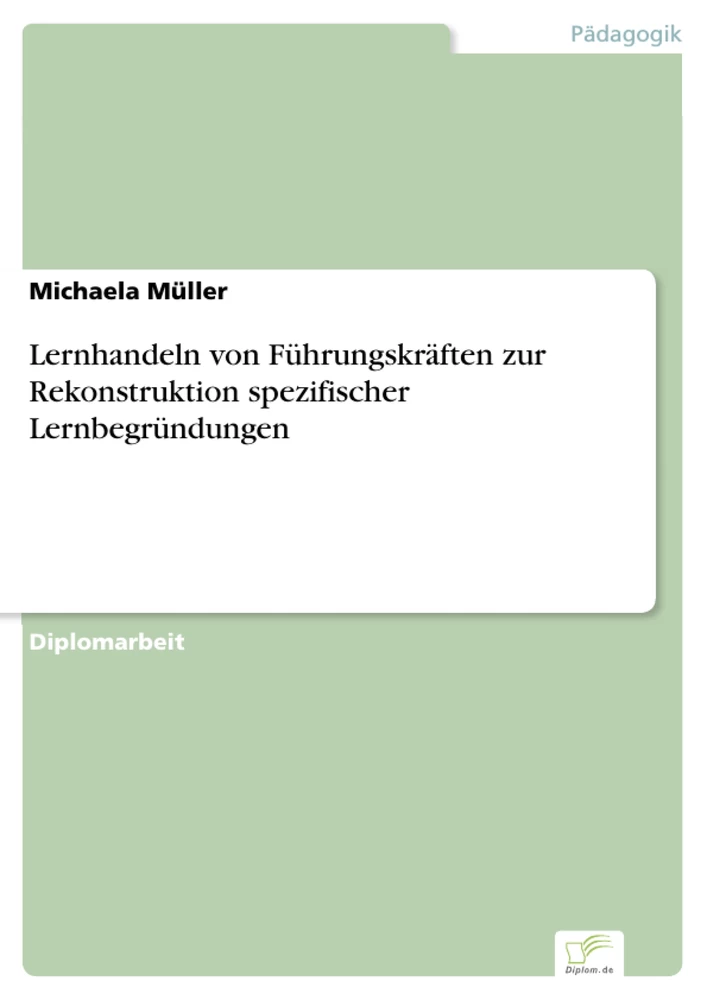Lernhandeln von Führungskräften zur Rekonstruktion spezifischer Lernbegründungen
©1999
Diplomarbeit
176 Seiten
Zusammenfassung
Inhaltsangabe:Einleitung:
Komplexe Forschungsfragen dieser Art können in einer Diplomarbeit nicht sehr umfänglich und damit auch in keinster Weise abschließend beantwortet werden. Da hier kein quantitativer Zugang zum Forschungsfeld gewählt wird und nicht hypothesenprüfend vorgegangen wird, wird kein Ergebnis in Form von Die Teilnehmer von Führungskräftefortbildungen lernen größtenteils defensiv erreicht werden, sondern es soll - dem zeitlichen und inhaltlichen Umfang einer Diplomarbeit entsprechend - lediglich im Rahmen einer Vorstudie ein Fall rekonstruiert werden, wobei ein weiterer Fall als Vergleichshorizont hinzugezogen wird. Dies ergibt sich aus der Logik des gewählten Auswertungsverfahrens.. Damit soll u.a. auch geprüft werden, inwieweit Holzkamps Lerntheorie, die ja bisher nur von wenigen Autoren für die Erwachsenenpädagogik rezipiert worden ist, geeignet erscheint, das Lernen von Erwachsenen theoretisch angemessener verstehen zu können.
Das empirische Datenmaterial liegt in Form von transkribierten Interviewtexten vor, wobei als Erhebungsinstrument das problemzentrierte Interview gewählt wurde. Interviewt wurden Führungskräfte - in diesem Fall Ingenieure - eines Betriebes der Stromwirtschaft, welche an der Weiterbildungsmaßnahme Team-Management-Training an fünf Tagen teilgenommen hatten. Das Training umfaßte die Themen Mitarbeitergesprächsführung, Führung und Motivation. Als Auswertungsverfahren wird die Dokumentarische Methode herangezogen. Genaue Ausführungen zum Forschungsverfahren sind in Kapitel 4 zu finden.
Ausgeklammert wird eine Auseinandersetzung mit der subjektwissenschaftlichen Lerntheorie Holzkamps selbst. Diese wird, als heuristischer Rahmen, der Arbeit vorausgesetzt. Sie gestattet in dieser Form die theoretische Rekonstruktion von empirisch erhobenem Forschungsmaterial (Interviewtexte). Diese Leistung, dies wurde im Zugang auf diese Lerntheorie, quasi in einem groben Zugriff, definiert, kann sie erbringen. Mehr wird von ihr nicht erwartet. Diese Voraussetzung schließt deshalb auch ein, den gesellschaftstheoretischen Hintergrund der subjektwissenschaftlichen Lerntheorie, die sog. Kritische Psychologie, nicht zu thematisieren. Dies wäre ein Thema eigener Art.
Gang der Untersuchung:
Zunächst wird der aktuelle Forschungsstand zum Thema dargestellt.
Anschließend wird der heuristische Rahmen für die Rekonstruktion des Lernhandelns von Führungskräften entwickelt, insbesondere die Teile der Holzkampschen Lerntheorie, […]
Komplexe Forschungsfragen dieser Art können in einer Diplomarbeit nicht sehr umfänglich und damit auch in keinster Weise abschließend beantwortet werden. Da hier kein quantitativer Zugang zum Forschungsfeld gewählt wird und nicht hypothesenprüfend vorgegangen wird, wird kein Ergebnis in Form von Die Teilnehmer von Führungskräftefortbildungen lernen größtenteils defensiv erreicht werden, sondern es soll - dem zeitlichen und inhaltlichen Umfang einer Diplomarbeit entsprechend - lediglich im Rahmen einer Vorstudie ein Fall rekonstruiert werden, wobei ein weiterer Fall als Vergleichshorizont hinzugezogen wird. Dies ergibt sich aus der Logik des gewählten Auswertungsverfahrens.. Damit soll u.a. auch geprüft werden, inwieweit Holzkamps Lerntheorie, die ja bisher nur von wenigen Autoren für die Erwachsenenpädagogik rezipiert worden ist, geeignet erscheint, das Lernen von Erwachsenen theoretisch angemessener verstehen zu können.
Das empirische Datenmaterial liegt in Form von transkribierten Interviewtexten vor, wobei als Erhebungsinstrument das problemzentrierte Interview gewählt wurde. Interviewt wurden Führungskräfte - in diesem Fall Ingenieure - eines Betriebes der Stromwirtschaft, welche an der Weiterbildungsmaßnahme Team-Management-Training an fünf Tagen teilgenommen hatten. Das Training umfaßte die Themen Mitarbeitergesprächsführung, Führung und Motivation. Als Auswertungsverfahren wird die Dokumentarische Methode herangezogen. Genaue Ausführungen zum Forschungsverfahren sind in Kapitel 4 zu finden.
Ausgeklammert wird eine Auseinandersetzung mit der subjektwissenschaftlichen Lerntheorie Holzkamps selbst. Diese wird, als heuristischer Rahmen, der Arbeit vorausgesetzt. Sie gestattet in dieser Form die theoretische Rekonstruktion von empirisch erhobenem Forschungsmaterial (Interviewtexte). Diese Leistung, dies wurde im Zugang auf diese Lerntheorie, quasi in einem groben Zugriff, definiert, kann sie erbringen. Mehr wird von ihr nicht erwartet. Diese Voraussetzung schließt deshalb auch ein, den gesellschaftstheoretischen Hintergrund der subjektwissenschaftlichen Lerntheorie, die sog. Kritische Psychologie, nicht zu thematisieren. Dies wäre ein Thema eigener Art.
Gang der Untersuchung:
Zunächst wird der aktuelle Forschungsstand zum Thema dargestellt.
Anschließend wird der heuristische Rahmen für die Rekonstruktion des Lernhandelns von Führungskräften entwickelt, insbesondere die Teile der Holzkampschen Lerntheorie, […]
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
ID 4894
Müller, Michaela: Lernhandeln von Führungskräften zur Rekonstruktion spezifischer
Lernbegründungen / Michaela Müller - Hamburg: Diplomica GmbH, 2002
Zugl.: Augsburg, Universität, Diplom, 1999
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte, insbesondere die
der Übersetzung, des Nachdrucks, des Vortrags, der Entnahme von Abbildungen und Tabellen,
der Funksendung, der Mikroverfilmung oder der Vervielfältigung auf anderen Wegen und der
Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen, bleiben, auch bei nur auszugsweiser Verwertung,
vorbehalten. Eine Vervielfältigung dieses Werkes oder von Teilen dieses Werkes ist auch im
Einzelfall nur in den Grenzen der gesetzlichen Bestimmungen des Urheberrechtsgesetzes der
Bundesrepublik Deutschland in der jeweils geltenden Fassung zulässig. Sie ist grundsätzlich
vergütungspflichtig. Zuwiderhandlungen unterliegen den Strafbestimmungen des
Urheberrechtes.
Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in diesem
Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme, dass solche
Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei zu betrachten
wären und daher von jedermann benutzt werden dürften.
Die Informationen in diesem Werk wurden mit Sorgfalt erarbeitet. Dennoch können Fehler nicht
vollständig ausgeschlossen werden, und die Diplomarbeiten Agentur, die Autoren oder
Übersetzer übernehmen keine juristische Verantwortung oder irgendeine Haftung für evtl.
verbliebene fehlerhafte Angaben und deren Folgen.
Diplomica GmbH
http://www.diplom.de, Hamburg 2002
Printed in Germany
Wissensquellen gewinnbringend nutzen
Qualität, Praxisrelevanz und Aktualität zeichnen unsere Studien aus. Wir
bieten Ihnen im Auftrag unserer Autorinnen und Autoren Wirtschafts-
studien und wissenschaftliche Abschlussarbeiten Dissertationen,
Diplomarbeiten, Magisterarbeiten, Staatsexamensarbeiten und Studien-
arbeiten zum Kauf. Sie wurden an deutschen Universitäten, Fachhoch-
schulen, Akademien oder vergleichbaren Institutionen der Europäischen
Union geschrieben. Der Notendurchschnitt liegt bei 1,5.
Wettbewerbsvorteile verschaffen Vergleichen Sie den Preis unserer
Studien mit den Honoraren externer Berater. Um dieses Wissen selbst
zusammenzutragen, müssten Sie viel Zeit und Geld aufbringen.
http://www.diplom.de bietet Ihnen unser vollständiges Lieferprogramm
mit mehreren tausend Studien im Internet. Neben dem Online-Katalog und
der Online-Suchmaschine für Ihre Recherche steht Ihnen auch eine Online-
Bestellfunktion zur Verfügung. Inhaltliche Zusammenfassungen und
Inhaltsverzeichnisse zu jeder Studie sind im Internet einsehbar.
Individueller Service
Gerne senden wir Ihnen auch unseren Papier-
katalog zu. Bitte fordern Sie Ihr individuelles Exemplar bei uns an. Für
Fragen, Anregungen und individuelle Anfragen stehen wir Ihnen gerne zur
Verfügung. Wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit.
Ihr Team der Diplomarbeiten Agentur
Inhaltsverzeichnis
1.
Einführung
in
die
Themenstellung
3
1.1
Vorbemerkungen
3
1.2
Thema
und
Zielsetzung
5
1.3
Methodisches Vorgehen und Anspruch der Arbeit
13
2.
Überblick
über
den
Forschungsstand
15
2.1
Empirische Erforschung des Lernhandelns von Führungskräften
15
2.2
Bedeutung der subjektwissenschaftlichen Lerntheorie in Untersuchungen
18
zum Erwachsenenlernen
3.
Der heuristische Rahmen für die Rekonstruktion des Lernhandelns
21
von Führungskräften: die subjektwissenschaftliche Lerntheorie Klaus
Holzkamps
3.1
Zum Subjektstandpunkt als Diskursebene individueller Handlungsgründe
21
3.2
Überlegungen zum Lernhandeln des Subjekts
26
3.2.1 Ausgliederung einer Lernproblematik aus einer Handlungs-
26
problematik Optionen für das Subjekt
3.2.2 Thematische Lernbegründung für das Subjekt
33
Exkurs:
Thematische Lernbegründung und das Konzept der
38
extrinsischen / intrinsischen Motivation
3.2.3 Lebenspraktische Bedeutungszusammenhänge als Prämissen für die
40
Begründung von Lernhandlungen
4.
Überlegungen
zum
Forschungsverfahren
43
4.1
Einleitende
Bemerkungen
43
4.2
Erhebungsdesign
45
4.2.1 Auswahl geeigneter Untersuchungsmethoden und Darstellung des
45
Forschungsmethodischen Vorgehens
4.2.2 Festlegung der Stichprobe und des Untersuchungsdesigns
49
4.2.2.1
Festlegung
der
Stichprobe
49
4.2.2.2
Festlegung
des
Untersuchungsdesigns 50
4.2.3
Durchführung
der
Datenerhebung
55
4.3
Aufbereitungsverfahren
55
4.4
Auswertungsdesign
56
4.4.1
Formulierende
Interpretation
58
4.4.2
Reflektierende
Interpretation
59
4.4.3
Fallbeschreibung
60
4.4.4
Typenbildung
61
5.
Darstellung und Interpretation der Ergebnisse: die Rekonstruktion des
62
Lernhandelns von Herrn Steiner
5.1
Formulierende Interpretation der Interviewtexte von
62
Herrn Steiner und Herrn Meier
5.1.1 Überblick über das Interview mit Herrn Steiner
62
5.1.2 Detaillierte Formulierende Interpretation des Interviews
63
mit Herrn Steiner
5.1.3 Überblick über das Interview mit Herrn Meier
77
5.1.4 Detaillierte Formulierende Interpretation des Interviews
78
mit Herrn Meier
5.2
Reflektierende Interpretation des Interviewtextes von Herrn Steiner
89
5.3
Fallbeschreibung
105
5.3.1 Die personale Situiertheit von Herrn Steiner als Chance und Grenze
106
seiner Lernmöglichkeiten
5.3.2 Herrn Steiners Umgang mit den Lernanforderungen des Betriebes
112
5.4
Typenbildung
116
6.
Zusammenfassung und Ausblick
Literaturverzeichnis
Anhang 1: Interviewtext von Herrn Steiner
Anhang 2: Interviewtext von Herrn Meier
1. Einführung
3
1. Einführung in die Themenstellung
Im ersten Abschnitt dieser Arbeit wird eine allgemein gehaltene Einführung in die
Themenstellung gegeben. Dabei wird anhand einiger Vorbemerkungen auf das Thema
hingeführt, im weiteren die Zielsetzung der Arbeit und das methodische Vorgehen dar-
stellt sowie auf einige Einschränkungen hingewiesen. Außerdem soll der Zugang zum
Thema erläutert werden, also aus welchen Gründen das Thema und diese Art der Bear-
beitung gewählt wird. Eine kurze Übersicht über den Aufbau und die Gliederung der
Arbeit schließt die Einführung ab.
1.1 Vorbemerkungen
Im Zuge moderner Unternehmensführung und Personalentwicklung werden heutzutage
vielfältige Anforderungen an die Beschäftigten, in besonderem Maße auch an Füh-
rungskräfte, gestellt. ,,Beschleunigter Wandel, der Einsatz neuer Technologien, die
Entwicklung der Informationsgesellschaft, zunehmende Internationalität haben tiefgrei-
fende Auswirkungen auf Struktur und Organisation unternehmerischer Tätigkeit, damit
auch auf Anforderungen an fachliche, insbesondere aber persönliche Voraussetzungen
der Mitarbeiter."
1
Diese Anforderungen werden in Qualifikations- und Kompetenzer-
fordernisse überführt und sind Ziele entsprechender Weiterbildungsmaßnahmen, die
dann die Herstellung, Sicherung und Verbesserung der betrieblichen Handlungsfähig-
keit aller Mitarbeiter
2
und Führungskräfte gewährleisten sollen.
Die Kompetenzerwartungen, mit welchen die Beschäftigten konfrontiert werden, rich-
ten sich zum einen an die Erweiterung und Ergänzung betrieblich relevanter Fähigkeiten
1
HÄRTEL, P., 1995; in: Grundlagen der Weiterbildung, Heft 2, 1995; S. 99
2
Die maskuline Form wird in dieser Arbeit der besseren Lesbarkeit wegen gewählt. Gemeint sind im
Einzelfall immer Frauen und Männer, hier also Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, weibliche und männli-
che Führungskräfte.
1. Einführung
4
und Kenntnisse, zum anderen an die Neu- und / oder Umdefinition bestimmter Einstel-
lungen und Haltungen, Orientierungen, (Wert-) Überzeugungen, Deutungsmuster u.ä..
3
Diese Anforderungen stellen sich den Beschäftigten als Lernanforderungen dar: von
betrieblicher Seite wird erwartet, daß sie sich mit den in dieser Weise definierten Quali-
fikations- und Kompetenzerfordernissen auseinandersetzen, sie akzeptieren und über
spezifische Lernanstrengungen realisieren. Mit anderen Worten: Betriebe erwarten von
ihren Beschäftigten, daß diese lernen.
Vor dem Hintergrund dieser betrieblichen Aufgaben-, Kompetenz- und Lernlogik stel-
len sich betrachtet man die Lernanforderungen aus pädagogischer Perspektive in be-
zug auf Lernen - eine Reihe von Fragen, wie zum Beispiel:
1. Wie stellen sich die Lernanforderungen aus der Perspektive der Subjekte
4
dar, wel-
che Schwierigkeiten und Probleme bzw. Möglichkeiten und Chancen sehen diese in
der Auseinandersetzung mit den Anforderungen?
2. Führt allein die Tatsache, daß Lernanforderungen gestellt werden, quasi direkt zum
Lernen bei den Beschäftigten oder entwickeln die Subjekte eigene Begründungen für
ihr Lernen und wenn ja, welche?
Die in der pädagogischen Praxis und Theorie vielfach unterstellte Annahme, daß Lern-
anforderungen von den jeweiligen Adressaten in entsprechende Lernanstrengungen ü-
berführt werden, daß also im Prinzip das gelernt wird, was gelehrt wird (Lehrlern-
kurzschluß
5
), wird in dieser Arbeit suspendiert, sie wird einer empirischen Untersu-
3
Hinter diesen Kompetenzbeschreibungen stehen jeweils unterschiedliche theoretische Konzepte. Auf der
Ebene betrieblichen Handelns werden sie in je spezifischer Weise festgelegt. Beide Aspekte werden an
dieser Stelle der Arbeit nur genannt, nicht näher diskutiert.
4
In dieser Arbeit werden die Beschäftigten im folgenden als ,,Subjekte" bezeichnet. Dies erfolgt in An-
lehnung an die hier herangezogene Lerntheorie Klaus Holzkamps, in der die Lernenden als ,,Subjekte"
oder ,,Lernsubjekte" aufscheinen.
5
Zum Begriff und zur Begründung des Lehrlernkurzschlusses vgl. HOLZKAMP, K., 1993, S. 408ff.,
417ff., 420ff.
1. Einführung
5
chung unterworfen. Die Idee zu dieser Aufgabenstellung entstand über die Auseinan-
dersetzung mit der subjektwissenschaftlichen Lerntheorie Klaus Holzkamps. Dort ist zu
lesen: ,,Lernen kommt nicht einfach dadurch von selbst in Gang, daß von dritter Seite
entsprechende Lernanforderungen an mich gestellt werden; mein Lernen kann keines-
wegs durch irgendwelche dafür zuständigen Instanzen über meinen Kopf hinweg ge-
plant werden. Lernanforderungen sind nicht eo ipso schon Lernhandlungen, sondern
werden nur dann zu solchen, wenn ich sie bewußt als Lernproblematiken übernehmen
kann, was wiederum mindestens voraussetzt, daß ich einsehe, wo es hier für mich etwas
zu lernen gibt ."
6
Die Auseinandersetzung mit dem Lehrlernkurzschluß hat für diese Arbeit zentrale Be-
deutung. Dies wird in der Festlegung des Untersuchungsgegenstandes und der Zielset-
zung der Arbeit deutlich.
1.2 Thema und Zielsetzung
Von der Annahme des Psychologen Klaus Holzkamp ausgehend, daß Lernende gegen-
über den ihnen entgegengestellten Lernanforderungen eigene Zugangsweisen entwi-
ckeln, werden im folgenden Lernhandlungen
7
von Führungskräften untersucht, an die
im Rahmen betrieblicher Fortbildungsmaßnahmen Lernanforderungen herangetragen
werden. Im besonderen soll auf die Frage eingegangen werden, wie Führungskräfte aus
ihrer Perspektive mit diesen Lernanforderungen umgehen: Wie werden die ihnen im
Rahmen betrieblicher Weiterbildung
8
auf der Kursebene entgegengesetzten Lernanfor-
6
HOLZKAMP, K., 1993, S. 184 f. (Hervorhebungen im Original, Anm. d. Verf.)
7
Der Begriff der ,,Lernhandlung" bzw. des ,,Lernhandelns" wird in Kapitel genauer erläutert, wenn
HOLZKAMPS Lerntheorie soweit dargestellt wird, als es für diese Arbeit notwendig erscheint.
8
Mit dem Begriff der ,,betrieblichen Weiterbildung" wird die ,,Gesamtheit der Maßnahmen und Aktivitä-
ten, die die Unternehmen zur kontinuierlichen Qualifizierung ihrer Mitarbeiter im Anschluß an die Erst-
ausbildung vorsehen" (KAISER, F.-J., PÄTZOLD, G., 1999, S. 139) bezeichnet. ,,Die betriebliche Wei-
terbildung steht zudem in einem engen Wechselverhältnis zur Personalentwicklung, da ein großer Teil der
Personalentwicklungsmaßnahmen Bildungsmaßnahmen sind. Während man traditionellerweise zwischen
den Formen ,Anpassungs-, Aufstiegs- und Umschulungsfortbildung` unterschied und damit auch deutlich
unterscheidbare didaktische Formen betrieblichen Lernens bezeichnete, sind die Maßnahmen der b. W.
1. Einführung
6
derungen wahrgenommen und verarbeitet? Genauer formuliert: inwieweit gibt es für die
Führungskräfte Gründe, zu lernen oder nicht zu lernen? Welche der Lernanforderungen
des Betriebes von den Führungskräften als begründet übernommen und in eigene Lern-
bemühungen überführt, welche werden offen oder latent verworfen mit der Folge
von Lernverweigerung bzw. Lernwiderstand?
In dieser Arbeit wird sich also den betrieblichen Lernanforderungen nicht aus dem
Blickwinkel des Betriebes bzw. des stellvertretend für diesen auf Kursebene handelnden
Lehrenden angenähert, und somit Lernen als Bezugspunkt für didaktisches Handeln des
Lehrenden betrachtet, sondern es soll die Perspektive des Lernsubjekts eingenommen
werden. Meines Erachtens wird die Subjektperspektive in der theoretischen Auseinan-
dersetzung über das Lernen Erwachsener in der Erwachsenenpädagogik bislang nicht
ausreichend berücksichtigt.
9
Deshalb wird die Auseinandersetzung dieser Subjekte, de-
ren Akzeptanz oder Ablehnung, deren Aneignung oder Verweigerung der von seiten des
Betriebes definierten Lernanforderungen in Form von Kompetenzen, Fähigkeiten und
Einstellungen, empirisch untersucht.
Als ,,theoretische Brille", oder heuristischer Rahmen, mit dessen Hilfe dieser Frage
nachgegangen werden soll, wird in dieser Arbeit die subjektwissenschaftliche Lerntheo-
rie von Klaus Holzkamp herangezogen, denn Lernen, widerständiges Lernen und Lern-
widerstand
10
werden hier aus der Lernerperspektive theoretisch gefaßt. Im Gegensatz zu
heute in einem breiteren Rahmen zu sehen. Zwar ist die b. W. heute mehr denn je vornehmlich eine ,An-
passungsfortbildung`, doch umfaßt diese kontinuierliche Anpassung nicht mehr nur eng funktionsbezoge-
nes Lernen. Man kann vielmehr in diesem Bereich eine deutliche Zunahme der Bedeutung ,außerfachli-
cher Inhalte` und verhaltensbezogener Themenstellungen feststellen" (KAISER, F.-J., PÄTZOLD, G.,
1999, S. 139 f.
9
Vgl. zu dieser Einschätzung vor allem LUDWIG, J., 1999, S. 60-73: Lernende werden vornehmlich aus
der Kursleiterperspektive und damit als Adressaten des Kursleiterhandelns, damit als ,didaktische Variab-
le` theoretisiert. Dabei wird unterstellt, daß Kursleiter das Lernen ,steuern` (vgl. GEIßLER, Kh. A.,
1995), Lernende ,motivieren` im weitesten Sinne Lernen ,herstellen` können. Demgegenüber wird in
dieser Arbeit in substantieller Weise die Kursleiterperspektive verlassen und die Sicht der Lernenden
eingenommen.
10
Der Begriff Lernwiderstand stammt aus dem Umfeld handlungspsychologischer Lernforschung (vgl.
WINNEFELD, F., 1960, S. 96f.). Ich beziehe mich hier auf die aktuelle Diskussion, in der die Thematik
durch Beiträge zu einer subjektwissenschaftlichen Lerntheorie unter anderem Blickwinkel neu gedeutet
1. Einführung
7
den vorherrschenden Lerntheorien wird Lernen hier nicht als automatische ,,Folge äuße-
rer Einwirkungen auf die Lernenden"
11
konzipiert (wie dies z.B. im Behaviorismus der
Fall ist), sondern Lernen wird vom Standpunkt des Lernsubjekts aus betrachtet, welches
im Rahmen seiner interessensspezifischen Intentionalität individuelle Begründungsmus-
ter für sein Handeln und damit auch für sein Lernhandeln hat. Es wird davon ausgegan-
gen, daß das Subjekt nicht z.B. aufgrund von Stimulus-Response-Schemata lernt, son-
dern aufgrund von spezifischen Begründungsmustern für das Lernhandeln
12
.
Lerntheorie vom Standpunkt des Subjekts bedeutet, nach dessen in seinen Lebensinte-
ressen fundierten Lerngründen als Handlungsgründen zu fragen. Handlungsgründe sind
immer erster Person, ,,je meine Gründe". Dem ,,Bedingtheitsdiskurs" der traditionellen
Psychologie, wo angenommen wird, der Mensch lerne mechanistisch aufgrund von Rei-
zen, die von außen gegeben sind und Lernen als von außen beeinflußbare abhängige
Variable gesehen wird,
13
stellt Holzkamp einen ,,Begründungsdiskurs" gegenüber. Es
gilt hier, Prämissen aufzudecken, unter denen Menschen interessenfundierte Gründe
haben, Lernanforderungen (z.B. in der Schule, in der betrieblichen Weiterbildung)
durch angemessene Lernhandlungen nachzukommen. Dies schließt auch die Frage nach
den Prämissen ein, unter denen für Menschen solche Gründe nicht bestehen.
Holzkamp unterscheidet zwei Arten von thematischen Lernbegründungen, eine expan-
sive und eine defensive Begründung von Lernen. Bei der expansiven Lernbegründung
antizipiert das Subjekt, daß durch Lernen eine Erweiterung seiner Weltverfügung und
und spezifiziert wird: Der Lernende muß beim Lernen einen Bezug zu seinen Lebensinteressen herstellen
können, ,,der über bloße Bewältigung der Lernsituation, das Entsprechen einer Fremderwartung oder die
Abwehr drohender Nachteile hinausgeht. Im anderen Fall wird die Lernsituation zu einem Bewältigungs-
problem, dem sich das Subjekt ggf. ohne die Mühen einer als sinnlos empfundenen Lernanstrengung
schadlos zu entziehen sucht oder dem es Widerstand entgegensetzt" (DREES, G., 1999, in: KAISER, F.-
J., PÄTZOLD, G., 1999, S. 292). Vgl. dazu auch Kapitel 3 in dieser Arbeit.
11
MÜLLER, K.R., 1995 (a), S. 285
12
Vgl. zu dieser Einschätzung HOLZKAMP, K., 1993, Kapitel 2, der die ,gängigen` Lerntheorien rekon-
struiert, sie als Lehrtheorien identifiziert und ihnen deshalb einen je spezifischen (marginalen) Stellenwert
bei der Erklärung menschlichen Handelns zuweist.
13
Wobei mit der Ablösung des Behaviorismus als dominierendes Paradigma durch den Kognitivismus die
Gleichsetzung von Lernen mit fremdkontrolliertem Lernen keineswegs überwunden ist. Vgl. HOLZ-
KAMP, K., 1993, S. 13
1. Einführung
8
Lebensqualität möglich ist. Das Lernen zeichnet sich durch ein tiefes Eindringen in den
Lerngegenstand aus. Bei der defensiven Begründung von Lernen steht die Abwendung
von Bedrohung von Weltverfügung im Vordergrund, weil eine Verweigerung des Ler-
nens eine Beeinträchtigung der Weltverfügung und der Lebensqualität zur Folge hätte,
d.h. das Subjekt sieht sich zum Lernen gezwungen. Bei defensiv begründetem Lernen
wird sowohl eine Lernanforderung übernommen, als auch zurückgewiesen somit
bleibt das Lernen auf eine charakteristische Weise widersprüchlich, in sich gebrochen,
halbherzig, ineffektiv und wird deswegen von Holzkamp auch als ,,widerständiges Ler-
nen" bezeichnet.
14
Diese Begründungsmuster sind für diese Arbeit die wichtigsten theoretischen Annah-
men, um die Lernbegründungen von Führungskräften rekonstruieren zu können. Eine
ausführlichere Darstellung ist in Kapitel 3 zu finden.
Daß in dieser Arbeit gerade auf Holzkamps subjektwissenschaftliche Lerntheorie zu-
rückgegriffen wird, um der Frage nachzugehen, wie Führungskräfte im Rahmen betrieb-
licher Weiterbildung mit Lernanforderungen
15
umgehen, liegt erstens daran, daß es the-
oretisch ertragreich ist, Lernen auch aus der Perspektive der Lernenden zu betrachten
und nicht - wie hauptsächlich in der Erwachsenenpädagogik üblich
16
- aus Sicht der
Lehrenden. Dies gilt insbesondere auch für den Bereich der betrieblichen Weiterbil-
dung, der insgesamt bisher kaum Gegenstand erwachsenenpädagogisch motivierter em-
pirischer Untersuchungen war. Eine Rezeption des Subjektstandpunkts in betrieblichen
Lernkontexten stellt somit sowohl eine theoretische Bereicherung für die Erwachsenen-
pädagogik als auch eine Erweiterung ihres Untersuchungsfeldes dar.
Der zweite Grund, gerade mit dieser Lerntheorie arbeiten zu wollen, besteht darin, daß
sich das Phänomen des Lernwiderstandes mit den bisherigen Theorien nicht abbilden
läßt. Im Bedingtheitsmodell der Stimulus-Response-theoretischen Reinforcement-
Konzeptionen sind Menschen nur als unter Bedingungen stehend, nicht aber als mögli-
che Produzenten ihrer Lebensbedingungen theoretisch abbildbar. Lernen wird also
14
Vgl. HOLZKAMP, K., 1997, S. 200
15
in der Form von betrieblichen Weiterbildungsangeboten
16
Vgl. dazu die Ausführungen zum theoretischen Forschungsstand in Kap. 2.
1. Einführung
9
gleichgesetzt mit der ,,Fremdsteuerung des Menschen durch von außen vorgegebene
Ziele, die aufgrund der Kenntnis des Effektes jeweils einschlägiger Verstärkungskon-
tingenzen im Verhalten durchgesetzt werden. Damit ist aber von vornherein nur das
,fremde` Interesse an der Verhaltensänderung von Individuen ,zugelassen`, ein irgend-
wie geartetes ,Eigeninteresse` des Subjekts am Vollzug eines bestimmten inhaltlichen
Lernprozesses dagegen nicht einmal denkbar. Daraus folgt, daß auch der mögliche Wi-
derspruch zwischen eigenen und aufgezwungenen Lerninteressen in seiner spontanen
Reproduktion als ,widerständiges Lernen` in diesem theoretischen Kontext grundsätz-
lich nicht abbildbar ist".
17
Auch in der kognitiven Psychologie, die in Anlehnung an Termini der Informatik Lern-
prozesse darstellt, wirkt das Bedingtheitsmodell implizit weiter. Anstatt Subjekte mit je
eigenen Begründungsmustern anzuerkennen, werden verschiedene Leistungen von ver-
schiedenen Gedächtnisspeichern als Ursache für Behaltensleistungen der Individuen
gesehen. Damit wird ausgeblendet, daß ein Individuum statt automatisch nur begründe-
terweise lernt und behält, um das Gelernte später einmal in bestimmten Situationen ver-
nünftigerweise erinnern zu können.
18
Das inhaltlich eigeninteressierte Lernen, dessen
mögliche Widersprüche mit dem Lernen im herrschenden Interesse, also das Phänomen
des widerständigen Lernens, ist damit theoretisch nicht faßbar.
19
Ein drittes Beispiel für Theorien, in denen Lernwiderstand nicht abzubilden ist, bezieht
sich auf das Konzept des Lernens im pädagogischen / didaktischen Kontext (Lehrler-
nen), insbesondere auf den institutionellen Rahmen der Schule und des Schulunter-
richts. In diesem Konzept finden sich Einflüsse aus der traditionellen Lernpsychologie,
aus der Entwicklungspsychologie, der Sozialisationsforschung sowie aus der erzie-
hungswissenschaftlichen Didaktik. Auch hier ist die Dimension des inhaltlich selbstin-
teressierten Lernens und somit das Phänomen der Lernwiderständigkeit nicht repräsen-
tierbar, da als primäres Subjekt des Lernvorgangs nicht die Lernenden, sondern die In-
stitution Schule, die durch die Lehrer als deren Funktionäre repräsentiert wird, angese-
hen wird: ,,`Lernen` findet dieser Vorannahme gemäß in einem irgendwie relevanten
Sinne nur so weit statt, wie die Voraussetzungen dazu von den Lehrenden im ,Unter-
17
HOLZKAMP, K., 1997, S. 200
18
Vgl. HOLZKAMP, K., 1993, S. 143
19
Vgl. HOLZKAMP, K., 1997, S. 163
1. Einführung
10
richt` organisiert worden sind".
20
Die Subjektivität und Persönlichkeit der Schüler und
Schülerinnen wird hier nur mehr oder weniger als ,,Rohmaterial" betrachtet, das man zu
berücksichtigen hat, wenn die Lehrenden gelingende Lernprozesse gestalten wollen; die
Beschaffenheit dieses ,,Rohmaterials" sollte in angemessenen Theorien und Methoden
des schulischen Lehrens und Lernens berücksichtigt werden. Das genuine Eigeninteres-
se der Schülerinnen und Schüler am Lernen bleibt jedoch ausgeklammert. Ob nun ge-
lernt wird oder nicht liegt allein in der Verantwortung der Lehrenden, nämlich inwie-
weit sie in der Lage sind, einen Unterricht zu gestalten, der bei den Schülern und Schü-
lerinnen ,,Lernen" hervorruft. Schwierigkeiten des Lernens werden umgedeutet in
Schwierigkeiten des Lehrens. Somit ist Lernwiderstand als Thema des Subjektes nicht
repräsentierbar.
Schließlich möchte ich noch auf meine persönlichen Erfahrungen mit der Art, wie Teil-
nehmer von Weiterbildungsveranstaltungen mit Bildungsangeboten umgehen, verwei-
sen, um meine Entscheidung zu begründen, hier die subjektwissenschaftliche Lerntheo-
rie zu wählen, die auch Lernwiderstände abbilden läßt. Geht man von objektivistischen
Lernkonzepten aus, müßte eigentlich das gelernt werden, was gelehrt wird: ,,Didaktik ist
so gesehen ein linearer Vermittlungsprozeß: Die Lehrenden repräsentieren als Experten
Ausschnitte der Wirklichkeit und der Wahrheit, die Lernenden eignen sich diese Infor-
mationen an, sie ,verinnerlichen` die Außenwelt. Aufgabe der Lehrenden ist es, diese
Lerngegenstände verständlich, anschaulich, alters- und zielgruppenspezifisch darzubie-
ten".
21
Im Rahmen eines Praktikums in der Weiterbildungsabteilung eines Betriebes
führte ich telefonische Befragungen mit Teilnehmern von Bildungsveranstaltungen
durch und machte die Erfahrung, daß keineswegs immer das gelernt wurde, was zuvor
gelehrt worden war. Teilweise stieß ich auf offenen Widerstand gegen diese Bildungs-
inhalte. Einige Teilnehmer sahen für sich offensichtlich keine Gründe, den Lernanforde-
rungen des Betriebes durch Lernhandlungen nachzukommen. Während Referent und
Seminarmethoden zumeist kaum negativ bewertet wurden, kam es in bezug auf die Bil-
dungsinhalte häufig zu Kritik. Die Teilnehmer begründeten ihren Widerstand gegen die
Bildungsangebote z.B. mit Aussagen wie: ,,Ich habe meine Arbeit seit 30 Jahren in die-
20
HOLZKAMP, K., 1997, S. 165
21
SIEBERT, H., in: NUISSL, E., SIEBERT, H., WEINBERG, J., TIETGENS, H. (Hrsg.), 1991, S. 75
1. Einführung
11
ser und jenen Art und Weise gemacht, die sich bewährt hat, und plötzlich sagt mir der
Betrieb, wie ich es anders machen soll das lasse ich nicht zu", oder: ,,Man hat doch
schon sein eigenes Denken". Bei Aussagen wie diesen erwuchs bei mir die Neugier, wie
solche Widerstände theoretisch zu fassen seien, denn ginge man mit einer Alltagstheorie
an diese Frage heran, würde man vielleicht schließen, daß die Teilnehmer einfach ,,zu
faul" sind, ihre Arbeitsweise umzustrukturieren bzw. sich neue Verhaltensweisen anzu-
eignen. Wenn man jedoch den Blickwinkel der Lernenden mit wissenschaftlich-
theoretischem Anspruch, wie dies die Holzkamp'sche Lerntheorie ermöglicht, ein-
nimmt, dann können deren Lernbegründungen rekonstruiert werden. Der eher moralisie-
rende, alltagstheoretisch fundierte Umgang mit den Widerständen der erwachsenen
Lernenden wird dann überwindbar als Voraussetzung für einen kompetenteren Um-
gang mit Lernwiderständen in der betrieblichen Weiterbildung.
Diese Arbeit beschäftigt sich ausschließlich mit dem Lernhandeln von Führungskräften,
weil dies zum einen das Feld ist, das für die empirische Untersuchung der Arbeit zu-
gänglich war. Zum anderen führen Betriebe - differenziert man die Zielgruppen nach
Hierarchie - am häufigsten Weiterbildungsmaßnahmen für ihre Führungskräfte durch
22
und fordern von ihnen nicht nur fachliche Fähigkeiten. Oft stehen gerade ,,Trainings"
zur Einstellungs-, Verhaltens- und Persönlichkeitsänderung im Mittelpunkt der Weiter-
bildungsmaßnahmen für Führungskräfte. Derartige Lernanforderungen, die sich auf
Einstellung / Verhalten / Persönlichkeit beziehen sind z.B. Offenheit, Kritikfähigkeit,
Flexibilität, und Teamwork.
23
Viele Betriebe erwarten von ihren Führungskräften, daß
diese ,,teamfähiger" werden. Die Realisierung von Teamwork könnte aber von Füh-
rungskräften auch so gesehen werden, daß sie einen gewissen Machtverlust und eine
Einbuße an Statuszurechnungen akzeptieren müssen und ihre persönlichen Einstellun-
gen und Verhaltensweisen dementsprechend ändern müßten. Im Sinne plausibler Vor-
annahmen gehe ich deshalb davon aus, daß Führungskräfte gerade bei solchen Lernan-
forderungen - im Gegensatz zu Lernanforderungen, die sich rein auf Wissensaneignung
beziehen - in besonderem Maße Gründe haben müssen, um diesen Forderungen mit
22
Vgl. KRAUS, H., KAILER, N., SANDNER, K., 1990, S. 191
23
Vgl. DECKER, F., 1995, S. 375
1. Einführung
12
einer Lernhandlung nachzukommen, oder - um mit Holzkamps Worten zu sprechen -
eine ,,Lernschleife"
24
einzulegen.
Die Betrachtung von Lernanforderungen im Rahmen betrieblicher Weiterbildung - ver-
glichen mit der Weiterbildung beispielsweise an Volkshochschulen ist insofern inte-
ressant, weil hier erstens sehr eindeutige Lernanforderungen in Form von ,,Lernzielen"
gestellt werden (was bei der VHS weniger der Fall ist), und zweitens dort oft nicht von
einer freiwilligen Teilnahme ausgegangen werden kann. Hier wird also von seiten des
Managements erwartet, daß die Lernnotwendigkeiten des Betriebes ohne Umschweife
auch zu Lernbegründungen der Beschäftigten werden, mit allen Konsequenzen, wenn
dies nicht der Fall ist (z.B. einer eventuellen Gefährdung des Arbeitsplatzes).
Nach diesen einleitenden Bemerkungen kann die Zielsetzung dieser Arbeit folgender-
maßen formuliert werden: Es sollen, unter Rückgriff auf die Holzkamp`sche Lerntheo-
rie, Begründungsmuster von Führungskräften, die an einer Weiterbildungsveranstaltung
teilgenommen haben, rekonstruiert werden. Dabei wird sich von der Subjektseite her an
die Lernanforderungen seitens des Betriebes bzw. die bei deren Realisierung (oder
Nicht-Realisierung) auftretenden Schwierigkeiten und Probleme, aber auch Möglichkei-
ten und Chancen für die Subjekte, angenähert. Im besonderen soll auf die Fragen einge-
gangen werden, auf welche Lernbehinderungen die Subjekte möglicherweise stoßen,
inwieweit sie meinen, sich zwanghaft Wissen aneignen zu müssen, um somit Bedro-
hungen ihrer Lebensqualität, die aus einer Lernverweigerung resultieren würden, abzu-
wehren. Umgekehrt wird untersucht, in welcher Weise sie für sich eine Chance erken-
nen können, durch Lernen ihre betrieblich-gesellschaftlichen Teilhabemöglichkeiten
fortzuentwickeln. Dies soll im Rahmen eines hermeneutisch-sinnverstehenden Zugangs
zum Forschungsfeld herausgearbeitet werden.
24
Vgl. Kapitel 3
1. Einführung
13
1.3 Methodisches Vorgehen und Anspruch der Arbeit
Komplexe Forschungsfragen dieser Art können in einer Diplomarbeit nicht sehr um-
fänglich und damit auch in keinster Weise abschließend beantwortet werden. Da hier
kein quantitativer Zugang zum Forschungsfeld gewählt wird und nicht hypothesenprü-
fend vorgegangen wird, wird kein Ergebnis in Form von ,,Die Teilnehmer von Füh-
rungskräftefortbildungen lernen größtenteils defensiv" erreicht werden, sondern es soll -
dem zeitlichen und inhaltlichen Umfang einer Diplomarbeit entsprechend - lediglich im
Rahmen einer Vorstudie ein Fall rekonstruiert werden, wobei ein weiterer Fall als Ver-
gleichshorizont hinzugezogen wird. Dies ergibt sich aus der Logik des gewählten Aus-
wertungsverfahrens.
25
. Damit soll u.a. auch geprüft werden, inwieweit Holzkamps Lern-
theorie, die ja bisher nur von wenigen Autoren
26
für die Erwachsenenpädagogik rezi-
piert worden ist, geeignet erscheint, das Lernen von Erwachsenen theoretisch angemes-
sener verstehen zu können.
Das empirische Datenmaterial liegt in Form von transkribierten Interviewtexten vor,
wobei als Erhebungsinstrument das problemzentrierte Interview gewählt wurde. Inter-
viewt wurden Führungskräfte in diesem Fall Ingenieure - eines Betriebes der Strom-
wirtschaft, welche an der Weiterbildungsmaßnahme ,,Team-Management-Training" an
fünf Tagen teilgenommen hatten. Das Training umfaßte die Themen Mitarbeiterge-
sprächsführung, Führung und Motivation. Als Auswertungsverfahren wird die Doku-
mentarische Methode
27
herangezogen. Genaue Ausführungen zum Forschungsverfahren
sind in Kapitel 4 zu finden.
Ausgeklammert wird eine Auseinandersetzung mit der subjektwissenschaftlichen Lern-
theorie Holzkamps selbst. Diese wird, als heuristischer Rahmen, der Arbeit vorausge-
setzt. Sie gestattet in dieser Form die theoretische Rekonstruktion von empirisch erho-
benem Forschungsmaterial (Interviewtexte). Diese Leistung, dies wurde im Zugang auf
25
Vgl. Kapitel 4
26
Vgl. MÜLLER, K.R., 1995; LUDWIG, J., 1999 KÜNZEL, K., 1996; vgl. dazu auch Kapitel 2
27
Vgl. BOHNSACK, R., 1999
1. Einführung
14
diese Lerntheorie, quasi in einem groben Zugriff, definiert, kann sie erbringen. Mehr
wird von ihr nicht erwartet. Diese Voraussetzung schließt deshalb auch ein, den gesell-
schaftstheoretischen Hintergrund der ,,subjektwissenschaftlichen Lerntheorie", die sog.
,,Kritische Psychologie", nicht zu thematisieren. Dies wäre ein Thema eigener Art.
Der Aufbau dieser Arbeit gestaltet sich folgendermaßen: Zunächst wird der aktuelle
Forschungsstand zum Thema dargestellt.
Anschließend wird der heuristische Rahmen für die Rekonstruktion des Lernhandelns
von Führungskräften entwickelt, insbesondere die Teile der Holzkamp`schen Lerntheo-
rie, die für diese Arbeit bedeutsam sind.
Nachfolgend werden Überlegungen zum Forschungsverfahren angestellt, um dann ab-
schließend die Ergebnisse der Forschung darzustellen und zu interpretieren.
Zum Schluß dieser Einleitung möchte ich eine persönliche Anmerkung machen. Die
thematischen, die subjektwissenschaftlich-lerntheoretischen und auch die methodologi-
schen Basisentscheidungen für diese Arbeit stellen für mich am Ende meines Studi-
ums Neuland dar. D.h. während meines bisherigen Studiums habe ich mich weder
intensiv mit betrieblich-beruflicher Weiterbildung, noch mit der Holzkamp'schen Lern-
theorie auseinandersetzen können sie waren nicht Teil des Studienangebotes. Diese
Diplomarbeit stellt sich für mich deshalb wie eine Entdeckungsreise dar, bei der ich
immer wieder Neuland betrete, wo ich mich in bis dato unbekannte Theorien und For-
schungsmethoden einarbeite und dabei erfahre, wie sich das Neue zum Alten fügt, es
aber auch in Frage stellt und zum Teil überwindet. Mein Bemühen, eine empirische
Arbeit als Fallrekonstruktion zu schreiben, habe ich als größte Herausforderung erlebt.
Das Organisieren eines Forschungsfeldes, das Entwerfen von Interviewleittexten, das
Gestalten der Interviewsituationen, das methodologisch reflektierte Auswerten der
transkribierten Texte sowie der Versuch einer Verdichtung (neuer) wissenschaftlicher
Erkenntnisse hat mich außerordentlich gefordert damit auch gefördert.
Die Entdeckungsreise, so mein persönliches Fazit, war schwierig, anstrengend und auf-
regend, aber auch weiterführend und ertragreich für meine Fähigkeit, pädagogische
Praxis mit wissenschaftlichem Anspruch zu erkennen.
2. Überblick über den Forschungsstand
15
2. Überblick über den Forschungsstand
In diesem Kapitel erfolgt eine knappe Darstellung der für die Fragestellung dieser Ar-
beit relevanten Literatur. Zunächst wird ein Überblick über den aktuellen Forschungs-
stand gegeben, wobei vor allem die wichtigsten Ergebnisse mit Blick auf die Fragestel-
lung vorgestellt werden. Von besonderer Relevanz sind dabei Studien zum Thema
,,Führungskräftetraining". Des weiteren wird untersucht, inwieweit eine Einbeziehung
der Holzkamp'schen Lerntheorie in die Untersuchungen zum Erwachsenenlernen statt-
gefunden hat.
2.1 Empirische Erforschung des Lernhandelns von Führungskräften
Über ,,Führungskräftetrainings" liegt eine Fülle von Literatur vor, die insbesondere aus
dem betriebswirtschaftlichen Bereich stammt. Hier wird zum einen der Frage nachge-
gangen, welches die spezifischen Erfordernisse der Weiterbildung von Führungskräften
sind. Die Autoren legen Lehrinhalte von Führungstrainings fest, d.h. sie arbeiten die
Lernanforderungen von Betrieben, welche diese an ihre Führungskräfte stellen bzw.
stellen sollten, heraus. Dies sind beispielsweise, was die funktionalen Aufgaben betrifft,
Planungs-, Entscheidungs- und Organisationstechnik, EDV-Wissen usw. Für die perso-
nalen Führungsaufgaben stellen Motivations- und Kommunikationsfähigkeiten, Kompe-
tenz in Mitarbeiterbeurteilung, Gesprächsführung, Konfliktbearbeitung, Teambildung
etc. mögliche Lernanforderungen dar. In der neueren Diskussion werden erforderliche
Fähigkeiten für Führungskräfte als sog. Schlüsselqualifikationen definiert: ,,Das Anfor-
derungsprofil einer Führungskraft erfordert idealtypisch ein Bündel von Qualifikati-
onskomponenten, die ihn zur Bewältigung gegenwärtiger Herausforderungen wie zu-
künftiger Probleme befähigen soll. Dabei reicht das Spektrum an Schlüsselqualifikatio-
nen vom Erkennen und Diagnostizieren über strategisches Handeln mit Kommunikati-
ons- und Motivationsfähigkeit über hierarchische Ebenen hinweg, bis hin zu einer
Lernkompetenz, Konfliktfähigkeit und Innovationsbereitschaft bei sozialer Verantwort-
lichkeit um nur einige zu nennen."
1
1
RUMMLER, H.-J., 1991, S. 64
2. Überblick über den Forschungsstand
16
Insbesondere wird hier auch gefragt, inwieweit sich die qualifikatorischen Anforderun-
gen an Führungskräfte ändern und welche Kompetenzen zukünftig erforderlich sind.
Zum anderen werden in der Literatur die möglichen Trainingsinhalte besprochen, die
sich aus diesen Anforderungsprofilen ergeben, sowie deren Vermittlung im konkreten
Trainingsgeschehen. Hier geht es beispielsweise um Führungsgrundsätze, oder um die
Wirkung und die Veränderung von Führungsverhalten durch Trainings.
2
Einerseits wird
hier der Frage nachgegangen, wie Führungstrainings optimal zu gestalten sind
3
, ande-
rerseits werden Untersuchungen über die Effizienz von Trainings durchgeführt.
Viele Autoren gehen mit einer ,,ökonomischen Brille" an das Thema Lernen heran. In
diesen Ansätzen steht insbesondere die Ermittlung des Weiterbildungsbedarfs, das Bil-
dungscontrolling, welches nach betriebswirtschaftlichen Effizienzkriterien gestaltet
wird, und die Evaluation von Trainingsmaßnahmen im Mittelpunkt des Interesses.
4
Insgesamt wird das Thema ,,Lernen in Führungstrainings" ausschließlich über einen
empirsch-quantitativen, hypothesenprüfenden Zugang zum Forschungsgegenstand un-
tersucht. Von den zahlreichen Evaluationen über Führungstrainings werden im folgen-
den einige exemplarisch dargestellt:
Von Gülpen
5
stammt eine hypthesenprüfende Arbeit. Im Rahmen ihrer empirischen
Untersuchungen untersucht sie mögliche Einflußfaktoren auf den Trainingserfolg der
Teilnehmer eines Führungskräftetrainings. Dazu prüft sie unter anderem die Variablen
,,Trainerbewertung" und ,,Trainingserfolg" auf eine mögliche Korrelation, wobei in der
Evaluation eines Verkaufstrainings die Hypothese ,,Der Trainingserfolg wird signifikant
durch den Trainer beeinflußt.", bestätigt werden konnte. Des weiteren nimmt sie einen
positiven Zusammenhang zwischen den Variablen ,,Trainingserfolg" und ,,Aktualität
2
Vgl. von ROSENSTIEL, L., in: VOSS, B., 1995, S. 34-56, der in seinem Artikel ein Beispiel eines er-
folgreichen Führungstrainings darstellt.
3
vgl. JAEHRLING, D., in: VOSS, B.,1995, S. 3-11
4
Vgl. beispielsweise DECKER, F., 1995
5
Vgl. GÜLPEN, B., 1995
2. Überblick über den Forschungsstand
17
des Themas für die Teilnehmer" an. Diese Hypothese wird nach empirischer Prüfung
abgelehnt.
Ebenso geht Merzenich-Hieker
6
vor, die in ihrer Arbeit beispielsweise folgende Hypo-
these im Rahmen eines Führungstrainings untersucht: ,,Die Trainingsteilnehmer schät-
zen ihre (Führungs-) Kompetenzen nach Teilnahme an den Seminaren signifikant besser
ein". Die Untersuchung ergab, daß die Hypothese verworfen werden mußte, obwohl das
Seminar zwischen ,,überdurchschnittlich bis gut" beurteilt wurde.
Auch bei Nork
7
ist ein quantifizierender Zugang zum Lernen erkennbar: Sie bezieht
sich hinsichtlich ihrer ,,Evaluation auf der Lernebene" auf Kirkpatrick
8
, der einige
Richtlinien für den Zugang zum Lernen von Seminarteilnehmern entwickelt hat:
,,1. The learning of each conferee should be measured so that quantitative results can
be determined.
2.
A before-and-after approach should be used so that any learning can be related to
the program.
3. As far as practical, the learning should be measured on an objective basis.
4.
As far as practical, a control group (not receiving the training) should be used to
compare with the experimental group, which receives the training.
5.
Where practical, the evaluation results should be analysed statistically so that le-
arning can be proven in terms of correlation or level of confidence."
9
Keine der Studien näherte sich dem Gegenstand unter einem qualitativen, rekonstrukti-
ven Blickwinkel, um den subjektiven Bedeutungen, welche die Führungskräfte diesen
Trainings zuschreiben, Rechnung zu tragen. Auf Lernen und mögliche Lernwiderstände
wird in dieser Literatur nur am Rande eingegangen. Die in diesen Untersuchungen ver-
tretene Perspektive läßt nicht zu, die subjektiven Begründungen der Seminarteilnehmer
für Lernen / Nicht-Lernen zu erforschen. Sie thematisieren ,,objektive" Faktoren bei der
6
Vgl. MERZENICH-HIEKER, 1996
7
Vgl. NORK, M. E., 1989
8
Vgl. KIRKPATRICK, 1979
9
KIRKPATRICK, 1979, zitiert nach NORK, M. E., 1989
2. Überblick über den Forschungsstand
18
Entstehung von Lernschwierigkeiten, wie z.B. Konzentrationsschwierigkeiten, spezielle
Gedächtnisprobleme, Probleme beim zeitgerechten Erfassen von Information usw. .
Diese (betriebswirtschaftlich motivierten) Forschungen zur Führungskräfteweiterbil-
dung stehen in der Mainstreamtradition quantitativ orientierter Lehr-Lernforschung der
letzten 30 Jahre, die vom Außenstandpunkt des Lehrenden bzw. des Forschers durchge-
führt werden. Sie sind in der Regel motiviert über das Interesse an der Steuerung des
Weiterbildungsprozesses, damit auch des Lernens der Führungskräfte vom Außenstand-
punkt des Lehrenden bzw. des Betriebes als Weiterbildungsträger, der seine Lernanfor-
derungen in den Lernanstrengungen seiner Führungskräfte umgesetzt wissen will. Diese
Forschungen erhellen die Weiterbildungswirklichkeit in den thematischen und metho-
dologischen Grenzen, die sie sich selbst auferlegen.
Weil aber Lernhandlungen nicht einfach die Kehrseite von Lehrhandlungen sind und
das Definieren von Lernanforderungen nicht gleichbedeutend mit der Erfüllung dieser
Anforderungen durch die Führungskräfte ist, stellen diese Forschungen im Konzert der
Forschungskonzepte nur eine mögliche Variante der Auseinandersetzung mit dem Ler-
nen von Führungskräften dar sowohl thematisch als auch forschungsmethodisch. Mich
interessiert, wie ich in der Einleitung schon dargelegt habe, eine Alternative zu den
gängigen Konzepten. Deshalb geht es in dieser Arbeit thematisch vor allem um die sub-
jektiven Lernbegründungen der Führungskräfte, methodisch um einen qualitativen Zu-
gang zu von den Subjekten ,,erstellten" Interviewtexten, aus denen der Lernbegrün-
dungszusammenhang rekonstruiert werden kann.
2.2
Bedeutung der subjektwissenschaftlichen Lerntheorie in Untersuchungen
zum Erwachsenenlernen
Wie in der Einleitung bereits angesprochen, wurden bisher nur wenige Versuche unter-
nommen, die subjektwissenschaftliche Lerntheorie für die Erwachsenenpädagogik
fruchtbar zu machen: ,,Empirische Untersuchungen aus dieser subjektorientierten For-
schungsperspektive heraus auf die Kursrealität sind bislang noch selten."
10
Im folgen-
10
LUDWIG, J., 1999 (c), S. 2
2. Überblick über den Forschungsstand
19
den wird diejenige Literatur, die sich mit der Subjektperspektive befaßt, knapp beleuch-
tet.
Ein Beitrag stammt von Müller
11
, der sich unter Einbeziehung der Holzkamp'schen
Begründungsmuster von Lernen kritisch mit der betrieblichen Weiterbildung ausei-
nandersetzt und zu der Einschätzung gelangt, daß Lernen größtenteils nicht aus der Per-
spektive des Lernsubjekts, sondern aus der der Lehrenden definiert wird. Dem liegt das
Interesse zugrunde, ,,die in den verschiedenen Bezugsfeldern von den ,Qualifikations-
nutzern` definierten Lernanforderungen, meist als zu erwerbende Qualifikationen defi-
niert, in speziell arrangierten Lernsettings ,herzustellen`"
12
Dem gegenüber betrachtet
Müller Lernen zum einen aus der Perspektive der Lehrenden in der beruflichen Weiter-
bildung, zum anderen aus dem Blickwinkel des Lernsubjektes, ,,das in Wahrung sei-
ner Lebensinteressen (ständig) gefordert ist zu prüfen, ob es sich der sachlich-sozialen
Bedeutung der beruflichen Welt lernend zuwenden will oder muß, um auf diese Weise
die eigenen Möglichkeiten der Verfügung über diese Welt zu erweitern oder die aus der
beruflich-betrieblichen Welt resultierenden Bedrohungen abzuwehren".
13
Künzel
14
bezieht sich in seinem Beitrag über die Implikationen und pädagogischen Fol-
gerungen einer Hinwendung zur ,kognitiven Gesellschaft` aus mikroperspektivischer
Sicht auf Holzkamps Begriff des ,,expansiven Lernens", indem er die Entwicklung der
Fähigkeit zum expansiven Lernen als zentralen Aspekt seines Lernverständnisses an-
sieht. Die mikroperspektivische Sicht ist gekennzeichnet durch ein Lernverständnis, das
sich von der Betrachtung von Lernen als ,,organisierte Reaktion auf die Erwartungen
einer Aufgaben stellenden Umwelt"
15
differenziert. Mit Bezug auf ein solches Lernver-
ständnis entwickelt Künzel Folgerungen für ein Programm lebensbegleitenden Lernens.
11
Vgl. MÜLLER, K.R., 1995 (a) und (b)
12
MÜLLER, K.R., 1995 (a), S. 284
13
MÜLLER, K.R., 1995 (a), S. 283 (Hervorhebungen im Original, Anm. d. Verf.)
14
Vgl. KÜNZEL, K., 1996
15
KÜNZEL, K., 1996, S. 98
2. Überblick über den Forschungsstand
20
Die elaboriertesten Zugänge zur subjektiven Lerntheorie aus erwachsenenpädagogischer
Sicht hat Ludwig
16
gefunden. Die Feststellung, daß Lernen traditionell vom Außen-
standpunkt der Lehrenden betrachtet wird, daß also der Kursleiterstandpunkt die domi-
nante Perspektive auf die Kursrealität darstellt, veranlaßte ihn, den Blickwinkel um die
Perspektive der Lernenden zu erweitern und in einem Forschungsprojekt die subjekti-
ven Lernbegründungen von Teilnehmern betrieblicher EDV-Einführungskurse zu unter-
suchen. Dies geschah unter Rückgriff auf ein ,,spezifisches subjektwissenschaftliches
Verständnis von Handlung und Lernen als Bedeutungs-Begründungs-
Zusammenhang"
17
. Dabei wird in dieser Untersuchung gefragt,
,,in welcher Weise es den Lernenden gelingt, ihre betrieblich-gesellschaftliche Teilhabe
in betrieblichen Modernisierungsprozessen zu erweitern, d.h. in gesellschaftlich-
betriebliche Bedeutungskonstellationen / Sinnstrukturen des Modernisierungsprojekts
einzudringen und darüber eine Selbst- und Weltverständigung im betrieblichen Verge-
sellschaftungsprozeß herzustellen; mit andern Worten: Gelingt es ihnen, einen Bil-
dungsprozeß im betrieblichen Kontext zu konstituieren? Das Projekt zielt also auf die
Untersuchung der Möglichkeiten und Grenzen von Bildungsprozessen in betrieblichen
Modernisierungsprojekten aus der Sicht der Lernenden und ihrer Lernhandlungen. Die
Untersuchung will damit die ,Realanalyse` (Giesecke 1992, S. 11) einer erwachsenen-
pädagogischen Situation vollziehen, d.h. sie will Lernen als erwachsenenpädagogische
Wirklichkeit beschreibbar machen und so zu einer Differenzierung bestehender Begriff-
lichkeit beitragen."
18
Diese Untersuchung sieht sich als ,,ein erster und noch unvollständiger Versuch"
19
, aus
dieser spezifischen Forschungsperspektive heraus zu Typisierungen von Lernhaltungen
zu gelangen.
16
Vgl. LUDWIG, J., 1999 (a), (b), (c)
17
LUDWIG, J., 1999 (c), S. 2
18
LUDWIG, J., 1999 (a), S. 7
19
LUDWIG, J., 1999 (c), S. 3
3. Der heuristische Rahmen zur Rekonstruktion des Lernhandelns
21
3. Der heuristische Rahmen für die Rekonstruktion des Lernhandelns von Füh-
rungskräften: die subjektwissenschaftliche Lerntheorie Klaus Holzkamps
Wie in der Einleitung schon angesprochen, hat Holzkamp eine Lerntheorie entwickelt,
die Lernen vom Subjektstandpunkt aus theoretisch faßt. Diese Theorie liefert Annah-
men zur Begründung von Lernhandeln und stellt für diese Arbeit den heuristischen
Rahmen dar, anhand dessen spezifische Begründungsmuster von Führungskräften für
deren Lernhandeln rekonstruiert werden. Die Theorie liefert also die erkenntnisleiten-
den Annahmen, mit deren Hilfe das empirische Datenmaterial, welches in Form trans-
kribierter Interviews vorliegt, rekonstruiert wird.
In diesem Kapitel werden die für diese Arbeit wichtigen theoretischen Annahmen Holz-
kamps genauer dargestellt, welche im wesentlichen in seinem Hauptwerk ,,Lernen
subjektwissenschaftliche Grundlegung" (1993) zu finden sind. Zunächst wird knapp
erläutert, was es heißt, Wissenschaft vom Subjektstandpunkt aus zu betreiben, um so
Grundvoraussetzungen, die für die Entwicklung von Holzkamps Lerntheorie relevant
sind, darzustellen. Diese Ausführungen stellen den Ausgangspunkt für die weitere Ent-
faltung der subjektwissenschaftlichen Lerntheorie dar. In einem zweiten Schritt werden
die wesentlichen theoretischen Annahmen zum Lernhandeln aufgezeigt.
3.1
Zum Subjektstandpunkt als Diskursebene individueller
Handlungsgründe
Gegenstand der Subjektwissenschaft ist die subjektive Erfahrungsweise objektiver ge-
sellschaftlicher Handlungsmöglichkeiten und beschränkungen, wie das Subjekt sie
erlebt. Hierbei wird das Subjekt nicht als Gegenstand, sondern als Standpunkt der Ana-
lyse gewählt. Dies bedeutet keinesfalls, sich lediglich in die Subjekte hineinzuversetzen,
denn ,,dies ist bekanntlich kaum so richtig möglich; ich bleibe letztlich immer auf mei-
nem Standpunkt"
1
. Erst wenn nach den in ihren Lebensinteressen fundierten Hand-
1
HOLZKAMP, K., 1997, S.198
3. Der heuristische Rahmen zur Rekonstruktion des Lernhandelns
22
lungsgründen gefragt wird, ist es möglich, den Standpunkt der Subjekte einzunehmen,
da Handlungsgründe immer erster Person, ,,je meine" Gründe sind.
Diese Art, Wissenschaft zu definieren, impliziert auch eine andere Art wissenschaftli-
cher Kommunikation, also eine andere Diskursform
2
. Wie in der Einleitung bereits an-
gesprochen, stellt Holzkamp dem Variablenmodell der traditionellen Psychologie, dem
sogenannten Bedingtheitsdiskurs, einen Begründungsdiskurs gegenüber:
,,Dieser ,Begründungsdiskurs` ist notwendig immer ,erster Person`, impliziert also den
,Subjektstandpunkt`: Gründe für mein interessegeleitetes Handeln kann immer nur ,ich`
haben, aber niemals jemand anders. Oder anders herum: Wenn ich von den Gründen
eines anderen rede, dann rede ich immer von seinen Gründen für sein Handeln, also
nehme ich dabei seinen Subjektstandpunkt ein. Der ,Subjektstandpunkt` ist entspre-
chend nicht einfach mein Standpunkt, sondern ,je mein` Standpunkt, also als ,verallge-
meinerter Standpunkt` eine spezielle Modalität des sozialen und sachlichen Wirklich-
keitsaufschlusses."
3
Die Weltgegebenheiten stellen sich dem Subjekt als ,,Bedeutungen im Sinne verallge-
meinerter, gesellschaftlich vergegenständlichter Handlungsmöglichkeiten"
4
dar, nicht
nur als Bedingungen, die irgendwelche Ereignisse zur Folge haben. Diese Bedeutungen
als gesellschaftlich verallgemeinerte Handlungsmöglichkeiten / und -beschränkungen
gehen als ,,Prämissen" in die subjektiven Handlungsgründe des Individuums ein, als
2
Die Einnahme des Subjektstandpunkts impliziert nach HOLZKAMP zwingend eine andere Diskurs-
form. HOLZKAMP selbst bietet jedoch keine methodologische Unterstützung zu der Frage, wie diese
Diskursform bei der Interpretation von Interviewtexten gestaltet werden könnte. Deshalb kann dieser
Aspekt hier nicht mit Bezug zu subjektwissenschaftlichen Beispielen umgesetzt werden. Zurückgegriffen
wird bei der Interviewauswertung auf das Verfahren der ,Dokumentarischen Methode' nach BOHN-
SACK; dessen Diskursform wird übernommen. In der Darstellung der Ergebnisse wird deshalb über die
Befragten geschrieben. Dadurch wird - was die Diskursform betrifft - ein Außenstandpunkt eingenom-
men, die Subjektperspektive wird so auf der Diskursebene nicht durchgehalten. Wesentlicher als die Dis-
kursform erscheint mir jedoch, daß die Subjektperspektive auf der Gegenstandsebene dieser Arbeit kon-
sequent verfolgt wird, indem nach den in den Lebensinteressen der Führungskräfte fundierten Handlungs-
und Lernbegründungen gefragt wird.
3
HOLZKAMP, K., 1997, S. 261 (Hervorhebungen im Original, Anm. d. Verf.)
4
Vgl. HOLZKAMP, K., 1997, S. 261 (Hervorhebung im Original, Anm. d. Verf.)
3. Der heuristische Rahmen zur Rekonstruktion des Lernhandelns
23
Aspekte der Realität, die für das Subjekt handlungsrelevant sind, und aus denen es seine
Handlungen als in seinem Interesse liegend begründet. Die Bedeutungen von Weltgege-
benheiten stellen Handlungsmöglichkeiten für das Subjekt dar, determinieren aber seine
Handlungen nicht. Mit dem Konzept des Begründungsdiskurses wird deutlich gemacht,
daß Menschen von ihrem Standpunkt aus nur intentional handeln können, wenn sie für
ihr Handeln Gründe haben, die sich aus ihrer spezifischen Lebenslage ergeben, bzw.
wenn ihnen ihr Handeln als vernünftig erscheint. Lernen als eine besondere Art von
Handeln
5
ist damit in derselben Weise begründungsbedürftig. Für diese Arbeit folgt
daraus, daß auch Führungskräfte als Teilnehmer betrieblicher Weiterbildungsveranstal-
tungen Gründe haben, zu lernen oder nicht zu lernen.
Holzkamp kennzeichnet das Subjekt als ,,eine Art von Intentionalitätszentrum"
6
, wel-
ches nicht neutral in der Welt steht, sondern welches Absichten, Pläne, Interessen hat.
Diese sind ,,inhaltliche Stellungnahmen und Handlungsentwürfe vom Standpunkt mei-
ner (des Lernsubjektes, Anm. d. Verf.) Lebensinteressen"
7
. Ausgangspunkt für die
Entwicklung einer Lerntheorie vom Standpunkt des Subjekts ist für Holzkamp also, das
Subjekt als aktives Wesen zu begreifen, welches in handelndem Weltzugriff seine Le-
bensbedingungen aktiv umgestalten kann und sich im Rahmen subjektiver Handlungs-
begründungen verhält. Äußere Ereignisse gehen als Prämissen für die Begründung von
Handlungvorsätzen mit ein:
,,Die (mit Bezug auf den Begündungszusammenhang) äußeren Bedingungen, die zu
Begründungsprämissen gemacht werden können, sind Aspekte eben jener sachlich-
sozial bedeutungsvollen Welt, wie wir sie gerade charakterisiert haben: Bedingungen
als Begründungsprämissen akzentuieren an den Weltgegebenheiten deren Bedeutungen,
d.h. die durch gegenständliche gesellschaftliche Praxis geschaffenen Handlungsmög-
lichkeiten, durch deren Realisierung ich Verfügung über individuell relevante gesell-
schaftliche Lebensbedingungen erreichen kann."
8
5
Vgl. HOLZKAMP, K., 1993, S. 21
6
HOLZKAMP, K., 1993, S. 21
7
HOLZKAMP, K., 1993, S. 21 (Hervorhebungen im Original, Anm. d. Verf.)
8
HOLZKAMP, K., 1993, S. 24
3. Der heuristische Rahmen zur Rekonstruktion des Lernhandelns
24
Die Verfügungsmöglichkeiten des Subjekts über seine Lebensbedingungen stellen den
Rahmen dar, auf den Holzkamp bei der Konzeption der Begründungsmuster von Lern-
handeln zurückgreift
9
:
Lernen wird über Verfügungen über Lebensbedingungen begrün-
det. Holzkamp expliziert Lernen als einen Aspekt des aus den Lebensinteressen des
Subjekts begründeten Handelns. Vor dem Hintergrund seines Lebensinteresses ist das
Subjekt an der Wahrung und Entwicklung seiner subjektiven Lebensqualität interessiert,
die es durch Weltverfügung erreichen kann. Begründungsmuster für Handeln (und für
Lernhandeln) können unter diesen Voraussetzungen so konzipiert werden, daß ein
Handlungsvorsatz nicht schon begründet ist, wenn er sich ,,logisch" aus bestimmten
Prämissen ergibt, sondern erst, wenn für das Subjekt zu erkennen ist, daß es angesichts
der gegebenen Prämissenlage zur Wahrung seiner Lebensinteressen diesem Vorsatz
gemäß handeln muß.
10
Ein Handlungsvorsatz ist also für das Subjekt begründet, wenn es
in seinem eigenen Interesse vernünftigerweise beabsichtigt, in bestimmter Weise zu
handeln.
11
Holzkamp nimmt als Grundpostulat an, daß ein Subjekt von seinem Stand-
punkt aus nicht ,,begründet" gegen seine eigenen Lebensinteressen (so, wie das Subjekt
sie wahrnimmt) verstoßen kann.
12
9
Vgl. Kap. 3.2.2
10
Vgl. HOLZKAMP, K., 1993, S. 25
11
Mit dem Konzept der ,,subjektiven Handlungsgründe" ist weder gemeint, menschliche Handlungsvor-
sätze seien immer ,,vernünftig" oder ,,gut begründet", noch sind damit ,,normative" Forderungen verbun-
den, daß das Subjekt ,,vernünftig" handeln soll. Vgl. dazu HOLZKAMP, K., 1993, S. 25 f.
12
,,Auch diese Voraussetzung könnte natürlich angezweifelt werden, nur hätte man sich dadurch die
Grundlage entzogen, von der aus allein begreiflich wird, daß ich meine eigenen Handlungsvorsätze be-
gründen, damit anderen verständlich machen kann und daß Handlungsvorsätze anderer für mich als be-
gründet verständlich werden können: Ein Mensch, dem ich unterstelle, daß er bewußt seine eigenen Le-
bensinteressen verletzen, also ,grundlos` handeln kann, ist damit - indem sein Tun und Lassen absolut
beliebig ist für sich selbst und andere notwendigerweise ,unfaßbar` in der gleichen Weise, wie auf
dem kausalen Niveau der Bedingungs-Ereignis-Zusammenhänge ursachenlose Ereignisse nicht faßbar, ja
nicht einmal ,denkbar` sind. So gesehen kann man die Voraussetzung, daß niemand bewußt seinen eige-
nen Interessen zuwiderhandelt, als einziges ,materiales Apriori` des intersubjektiven Beziehungsmodus
bezeichnen: ein Grundpostulat, das obzwar selbst nicht weiter zurückführbar und ableitbar als not-
wendige Voraussetzung der Möglichkeit intersubjektiver Kommunikation / Interaktion nur bei Ableug-
3. Der heuristische Rahmen zur Rekonstruktion des Lernhandelns
25
Vor diesem Hintergrund kann Lernen nun spezifiziert werden als
,,Realisierung gesellschaftlicher Handlungsmöglichkeiten (,Bedeutungsstrukturen`) in
stets wachsender personaler ,Handlungsfähigkeit`, d.h. Teilhabe an der Verfügung über
individuell relevante gesellschaftliche Lebensbedingungen als Erhöhung der subjektiven
Lebensqualität. Die so gefaßten menschlichen Handlungen bzw. die ,Handlungsfähig-
keit` als deren ,Funktionsgrundlage` sind da Realisierungen gesellschaftlicher Mög-
lichkeiten nicht einfach durch die Umwelteinflüsse ,bedingt`, sondern aus dem sub-
jektiven ,Verfügungsinteresse` der Individuen mit den gesellschaftlichen Handlungs-
möglichkeiten als ,Prämissen` ,begründet`. Da derartige Handlungsgründe notwendig
,je meine` Gründe, also in ihrem Gegebenheitsmodus ,erster Person` sind, kann nach
Holzkamp Entwicklung/Lernen in seiner menschlichen Spezifik nur vom ,Standpunkt
des (sich entwickelnden bzw. lernenden) Subjekts` erfahren und wissenschaftlich er-
forscht werden."
13
Nachdem nun wesentliche Voraussetzungen zur Entwicklung einer subjektwissenschaft-
lichen Lerntheorie dargestellt wurden, sollen im folgenden Holzkamps Annahmen über
Lernhandeln entwickelt werden.
nung dieser Möglichkeit selbst aufgegeben werden kann (vgl. GdP, S. 359)". HOLZKAMP, K., 1993,
S. 26 f.
13
HOLZKAMP, K., 1997, S. 170
3. Der heuristische Rahmen zur Rekonstruktion des Lernhandelns
26
3.2
Überlegungen zum Lernhandeln des Subjekts
3.2.1 Ausgliederung einer Lernproblematik aus einer Handlungsproblematik
Optionen
14
:
für das Subjekt
In diesem Abschnitt werden die spezifischen Annahmen Holzkamps über Lernhandeln
genauer dargestellt, damit die spätere Rekonstruktion des Datenmaterials nachvollzogen
werden kann. Dabei wird die Holzkamp'sche Lerntheorie an einigen Stellen bereits in
Beziehung zu dem Untersuchungsfeld der betrieblichen Weiterbildung / der Führungs-
kräfteweiterbildung gestellt. Heuristischer Rahmen und die Focussierung des Untersu-
chungsgegenstandes werden damit in einem ersten Schritt einander angenähert.
14
An dieser Stelle geht es um den Aufweis von Handlungsoptionen, die Teilnehmer an Weiterbildungs-
veranstaltungen prinzipiell hinsichtlich der Entscheidung: Lernen Nicht-Lernen, haben, nicht um Empi-
rie. Wie Teilnehmer an Weiterbildungsveranstaltungen solche Optionen ,ausleben`, läßt sich bei MÜL-
LER erkennen: ,,Teilnehmer kultivieren ihre Enttäuschung bzw. Verbitterung über ihr ungerechtes
Schicksal, gegen das sie sich nicht haben wehren können (besser gesagt: nicht haben wehren wollen, weil
sie Angst vor Sanktionen hatten). Ausgedrückt wird dies entweder in der offenen oder versteckten Kritik
an ,Ersatzobjekten` (Dozent, Teilnehmer, Inhalt), oder in der offenen Verweigerung des Lernens. Der am
Arbeitsplatz nicht ausgetragene Konflikt wird also in die Lernsituation projiziert und dort ausgelebt. Eine
Lernhaltung kann nicht entstehen. Ich habe einen erwachsenen Mann in einer Weiterbildung erlebt, der
aus oben genannten Gründen zehn Tage stumm auf seinem Stuhl saß, ohne an irgendeiner Lernaktivität
teilzunehmen. Alle Versuche, mit ihm ins Gespräch zu kommen, scheiterten kläglich. Den Kurs einfach
abzubrechen erschien ihm zu riskant.
* Sie kultivieren ihre Enttäuschung, agieren diese im Kurs jedoch nicht offen aus. Sie üben sich im Mas-
keraden, lassen sich auf die Lernthematiken zum Schein auch ein (so wie sie dies auch gegenüber ihrem
Vorgesetzten tun), ohne jedoch eine Lernhaltung zu entwickeln. Sie drängen auf Pausen, auf Verkürzung
der Seminarzeiten. Insgesamt strahlen sie eine Indifferenz und Gleichgültigkeit gegenüber den Themen
und den Lernsituationen aus, ohne diese jedoch zum Thema zu machen.
* Sie gewinnen allmählich Zugang zum aktuellen Bildungsprozeß, weil sie Schritt für Schritt dessen
Bedeutung für andere Bereiche ihres beruflichen Handelns (z.B. als Führungskraft) oder ihr privates Han-
deln (z.B. als Erzieher in der Familie) erkennen und eine sinnhafte Verbindung zwischen ihrem Lernen
und ihrem Handeln in diesen Handlungsfeldern herstellen können. Den am Arbeitsplatz nicht ausgetrage-
nen Konflikt können sie für die Zeit der Weiterbildung suspendieren." (MÜLLER, K.R., 1995 (b), S. 12)
3. Der heuristische Rahmen zur Rekonstruktion des Lernhandelns
27
Wenn im folgenden von Lernen die Rede ist, ist damit lediglich intentionales Lernen
gemeint - also Lernen aufgrund einer speziell darauf gerichteten Handlungsvornahme.
Davon abzugrenzen ist das inzidentelle Lernen (von Holzkamp auch als ,,Mitlernen"
bezeichnet), welches ,,mehr oder weniger jeden Handlungsvollzug begleitet und dem-
nach auch bei der Bewältigung jeder Handlungsproblematik auf die eine oder andere
Weise involviert ist"
15
mit anderen Worten: man kann kaum etwas tun, ohne dabei
auch etwas zu lernen.
Des weiteren kann von Lernen nach Holzkamp sinnvollerweise nur dann gesprochen
werden, wenn das erworbene Wissen nicht sofort wieder verlorengeht, sondern transsi-
tuational erhalten bleibt, so daß im weiteren an diesem neuen Niveau angesetzt werden
kann.
Holzkamp bezeichnet diesen Aspekt als ,,Permanenz und Kumulation des Gelern-
ten"
16
.
Wenn Holzkamp von Lernen als ,,Lernhandeln" spricht, meint er damit, daß Lernen
eine Art von Handeln ist, die eine besondere Begründungsstruktur besitzt. Lernen hebt
sich als von den übrigen Handlungen unterscheidbare, spezielle Form von Handlungen
heraus, und zwar als eine, die das Ausführen anderer zukünftiger Handlungen (,,Be-
zugshandlung
17
- der Lernhandlung") ermöglichen bzw. verbessern soll. Durch Lernen
können also Handlungsvoraussetzungen verbessert bzw. Handlungsbehinderungen ü-
berwunden werden für Führungskräfte stellen diese Handlungsvoraussetzungen Vo-
raussetzungen für ihr Führungshandeln dar, die lernende Auseinandersetzung mit Hand-
lungsbehinderungen zielt auf die Überwindung von Behinderungen beim Führungshan-
deln. Damit ist Lernen Handeln in zweiter Dimension.
Zunächst soll Lernhandeln gegenüber allgemeinem Handeln spezifiziert werden, indem
die Begriffe ,,Handlungsproblematik
"
und ,,Lernproblematik
"
eingeführt werden.
Nicht jede Problematik, mit der ein Individuum konfrontiert wird, stellt sich als Lern-
problematik dar. Es gibt viele Problematiken, auch für Führungskräfte, die ohne Lernen
15
HOLZKAMP, K., 1993, S. 183
16
HOLZKAMP, K., 1993, S. 183
17
HOLZKAMP adaptiert den Begriff sinngemäß von DULISCH (vgl. HOLZKAMP, K., 1993, S. 183).
3. Der heuristische Rahmen zur Rekonstruktion des Lernhandelns
28
durch direktes (Führungs-) Handeln lösbar sind, welche Holzkamp ,,unspezifische
Handlungs- oder Bewältigungsproblematiken" nennt. Eine Handlungsproblematik wird
erst zu einer Lernproblematik, wenn das Subjekt zu keiner Lösung des Problems durch
direktes Handeln gekommen ist und antizipiert, daß die Handlungsproblematik nur da-
durch zu lösen ist, indem eine Lernphase begonnen wird: ,,Demnach sind Lernprozesse
aus primären Bewältigungsaktivitäten ausgegliedert, stellen quasi einen Umweg oder
eine Lernschleife dar, und der Lernprozeß hätte dann das intendierte Resultat, wenn die
Handlungsproblematik, die ohne Lernen nicht überwindbar war, nunmehr bewältigt
werden kann".
18
Eine Handlungsproblematik besteht also für ein Subjekt, wenn sich Handlungssituatio-
nen ergeben, in denen das Subjekt einerseits gute Gründe hat, auf eine bestimmte Art zu
handeln, jedoch nicht in der Lage ist, die Situation zu bewältigen. Zum Beispiel wenn
eine Führungskraft nachhaltig erfährt, daß sich ein bestimmter Mitarbeiter, trotz wie-
derholter Anweisungen, Zurechtweisungen u.ä. nicht an spezifische Arbeitsnormen hält,
für deren Einhaltung die Führungskraft indes zuständig ist wenn also die Führungs-
kraft ,,mit ihrem Latein am Ende ist", also nicht mehr weiß, wie sie auf diesen Mitarbei-
ter einwirken könnte, um ihn zu normgerechtem Arbeiten zu veranlassen. Mit einer Si-
tuation wie dieser läßt sich, aus der Sicht der Führungskraft, in unterschiedlicher Weise
umgehen:
(1) Die Führungskraft deutet die Situation nicht als Problemsituation, sie läßt für sich
selbst kein Problem zu, erkennt deshalb auch keine Handlungsproblematik. Innerpsy-
chische Mechanismen, wie sie im Kontext psychoanalytischer Herangehensweisen an
solche subjektiven Definitionsprozesse bekannt sind, kommen dabei ins Spiel: Rationa-
lisierungen, Verleugnungen, Verdrängungen, Problemverschiebungen sind denkbar.
Diese Seite der Thematik wird hier nicht weiter verfolgt.
18
HOLZKAMP, K., 1997, S. 223
3. Der heuristische Rahmen zur Rekonstruktion des Lernhandelns
29
(2) Die Führungskraft erfährt in dieser Situation eine Handlungsproblematik, z.B. ihre
Unfähigkeit, einen Mitarbeiter zu einer Verhaltensänderung im Sinne der dauerhaften
Befolgung betrieblicher Normen zu bringen. Sie beläßt es allerdings bei diesem Zu-
stand, d.h. sie erkennt darin für sich selbst keine Lernproblematik. Vielmehr richtet
sie sich darauf ein, diese Situation immer wieder einfach bewältigen zu müssen (als
bloße Bewältigungshandlungen), jedoch nicht über das eigene Lernen. Die Gründe für
diese Situationsdefinition können vielfältig sein im empirischen Teil der Arbeit wird
darauf näher abgehoben werden sofern dies die Erhebungsdaten erlauben.
(3) Eine dritte Möglichkeit besteht in dem Versuch der Führungskraft, die Handlungs-
problematik durch Lernen zu überwinden und eine ,,Lernschleife"
19
einzulegen. Sie
sucht nach Lernsituationen und gelegenheiten, um an ihren eigenen Defiziten zu arbei-
ten, sie ist also zum Lernen motiviert. In diesem Fall hat also das Subjekt aus seinen
Handlungsproblematiken Lernproblematiken ausgegliedert. Die vom Subjekt erfahrenen
Schwierigkeiten und Irritationen führen zu der Entscheidung, nicht so weiterzumachen
wie bisher, weil eben dies zu keiner Lösung geführt hat. Vielmehr versucht das Subjekt,
sich Orientierung zu verschaffen und zu überlegen, wie es das Problem lernend über-
winden könnte. Die Handlungsproblematik wird so bewußt als Lernproblematik über-
nommen. Lernhandlungen zeichnen sich somit, im Gegensatz zu sonstigen Handlungen,
dadurch aus, daß sie durch eine besondere Art von Zielgerichtetheit von den Bezugs-
handlungen (z.B. Führungshandeln) zu unterscheiden sind, nämlich durch ihre Gerich-
tetheit auf die Herstellung bzw. Verbesserung der eigenen Handlungsvoraussetzungen.
20
Der Übergang von bloßen Bewältigungshandlungen (Fall 2) zu intendierten Lernhand-
lungen (Fall 3) ist gekennzeichnet durch ein Innehalten, durch die Einnahme einer Dis-
tanzhaltung zu den bisherigen Handlungen, durch die das Subjekt nicht weitergekom-
men ist. Es muß dazu bereit sein, Standpunktwechsel und gedankliche Variationen zu-
19
Vgl. HOLZKAMP, K., 1993, S. 183
20
Vgl. HOLZKAMP, K., 1993, S. 184
3. Der heuristische Rahmen zur Rekonstruktion des Lernhandelns
30
zulassen, damit ihm deutlich wird, wie seine Schwierigkeiten lernend überwunden wer-
den können.
21
Nimmt man mit Holzkamp an, daß Lernen nicht einfach durch Lehren in Gang kommt
22
,
stellt sich die Frage, wodurch ein Bedeutungskomplex (angesichts einer Welt von Be-
deutungen als potentiellen Lerngegenständen) für das Subjekt zum aktuellen Lernge-
genstand wird. Holzkamp grenzt sich von denjenigen Konzepten des Lehrlernens ab, an
denen er kritisiert, daß eine derartige Frage innerhalb dieser Konzepte überhaupt nicht
auftreten könnte, da von vornherein klar sei, daß Lernhandlungen grundsätzlich von
Lehrenden initiiert würden. Dabei ist der aktuelle Lerngegenstand die Lernanforderung,
die vom Lehrenden an die Lernenden gestellt wird. Lehraufgabe und Lernintention
werden also in diesen Konzepten vermengt.
Die subjektwissenschaftliche Lerntheorie, die diese Annahme suspendiert, sieht ihre
Aufgabe hingegen darin, herauszuarbeiten, aus welchen Gründen ein Subjekt mit Ler-
nen beginnt und sich damit aus dem Gesamt der potentiellen Lerngegenstände einen
bestimmten als Gegenstand seiner aktuellen Lernbemühungen herausgreift.
23
Ziel ist es
,
theoretisch zu explizieren, auf welche Weise das Subjekt ,,von sich aus" zu lernen be-
ginnt, denn so kann auch ein möglicher Widerspruch zwischen den eigenen Lerninteres-
sen des Subjekts und den von außen gesetzten Anforderungen abgebildet werden.
Wie bereits angesprochen gliedert das Subjekt beim Lernen aus einer primären Hand-
lungsproblematik eine spezifische Lernproblematik aus. Es stellt sich die Frage, woher
das Subjekt wissen kann, wo und in welcher Weise es etwas zu lernen gibt? Holzkamp
schreibt hierzu, daß vom Subjekt ein bestimmter Lerngegenstand zunächst nur ,,unvoll-
ständig, oberflächlich, undifferenziert"
24
ausgegliedert wird, so daß der lernende Zugang
dem Subjekt gleichzeitig problematisch ist. Es gibt also eine Diskrepanz zwischen dem,
was das Subjekt vorher schon gelernt hat und dem, was das Subjekt lernen will, wobei
21
HOLZKAMP, K., 1993, S. 184
22
Für HOLZKAMP der sogenannte ,,Lehrlernkurzschluß"
23
Vgl. HOLZKAMP, K., 1993, S. 211
24
HOLZKAMP, K., 1993, S. 212
3. Der heuristische Rahmen zur Rekonstruktion des Lernhandelns
31
diese Diskrepanz dem Subjekt auch zugänglich sein muß: ,,Ich muß also bemerken, daß
es mit Bezug auf den jeweiligen Gegenstand mehr zu lernen gibt, als mir jetzt schon
zugänglich ist".
25
Damit eine Lernhandlung begonnen wird, muß zudem noch eine ,,in
der Bewältigungshandlung unmittelbar erfahrene Unzulänglichkeit des erreichten Ge-
genstandsaufschlusses"
26
hinzukommen. Das Subjekt muß erkennen, daß die Beein-
trächtigungen im Handeln nur durch Lernhandlungen aufhebbar sind, so daß die Be-
schränkungen der Verfügungs/-lebensmöglichkeiten nur durch lernenden Weltaufschluß
überwindbar sind.
Soweit zunächst zur Differenzierung des heuristischen Rahmens vor dem Hintergrund
vom Subjekt erfahrener Handlungsproblematiken aus denen unter Umständen Lern-
problematiken ausgegliedert werden. Es gibt in diesem Kontext jedoch noch einen
zweiten Zugang, der vor allem mit Blick auf die betriebliche Führungskräfteweiterbil-
dung wichtig ist: der Sachverhalt, daß dem Subjekt gegenüber von außen, von dritter
Seite, d.h. von betrieblicher Seite, Lernnotwendigkeiten definiert werden, also Lernan-
forderungen gesetzt werden. Hier stellt sich die Frage, wie sich der Zusammenhang von
Handlungsproblematik - Ausgliederung einer Lernproblematik für das Subjekt gestaltet.
Das Subjekt hat also zunächst keine Handlungsproblematik, sieht sich jedoch mit den
Lernnotwendigkeiten, z.B. durch die betriebliche Weiterbildungsabteilung definiert,
konfrontiert. Das Subjekt steht in diesem Zusammenhang vor der Frage, welche Gründe
kann es haben kann, eine drittseitige Lernanforderung gerade als seine subjektive Lern-
problematik zu übernehmen, bzw. welche Gründe es haben kann, eine Lernanforderung
25
HOLZKAMP, K., 1993, S. 212 (Hervorhebungen im Original, Anm. d. Verf.) Mit Verweis auf das
eingeführte Beispiel: Die Führungskraft muß die Vorstellung haben, daß es möglich ist, auch widerstän-
dige Mitarbeiter zur Änderung ihres Verhaltens zu bringen wenn man es als Führungskraft nur ,richtig`
anstellt. Dies zu lernen mag sie motivieren, eine Lernproblematik auszugliedern.
26
HOLZKAMP, K., 1993, S. 214. Die ,,Unzulänglichkeit" ist im Beispiel, wie eben schon angedeutet, die
Diskrepanz zwischen gewollter Verhaltensänderung und erfahrender Wirkungslosigkeit des eigenen Füh-
rungshandelns.
3. Der heuristische Rahmen zur Rekonstruktion des Lernhandelns
32
nicht als Lernproblematik zu übernehmen, sondern in eine bloße Handlungsproblematik
umzudeuten und als solche überwinden zu wollen?
27
Allein die Tatsache, daß Lernanforderungen gestellt werden, führt, wie schon erwähnt,
nicht automatisch zum Lernen. Die Lernintentionen stecken nicht schon in den Lernan-
forderungen, sondern das Subjekt muß sich selbständig entscheiden, wenn aus Lernan-
forderungen auch Lernaktivitäten werden sollen. Für das Subjekt müssen also Gründe
erkennbar sein, die Lernanforderung als seine Lernintention bzw. Lernproblematik zu
übernehmen.
Auch hier eröffnen sich dem Subjekt wieder verschiedene Optionen:
(1) Eine Möglichkeit, mit diesen Lernanforderungen umzugehen, besteht für das Sub-
jekt darin, sich ihnen gegenüber strategisch zu verhalten, d.h. sie z.B. offen zu ignorie-
ren, sie verdeckt zu unterlaufen, oder Lernen gegenüber Kontrollinstanzen nur vorzu-
täuschen. Dies ist dann erwartbar, wenn das Subjekt bei sich keine Gründe für Lernen
erkennen kann, wenn es also die Begründungen Dritter für sein Lernen nicht überneh-
men kann. Das Subjekt reagiert mit Nicht-Lernen.
(2) Eine andere Möglichkeit ist, sich auf die Lernanforderungen einzulassen und sie als
eigene Lernproblematik zu definieren. Diese Option eröffnet sich das Subjekt, wenn
es, ohne daß es zuvor eine Handlungsproblematik erfahren oder eine Diskrepanzerfah-
rung gemacht hat, in Auseinandersetzung mit dem Lehrgegenstand, der von dritter Seite
definiert wurde, individuelle Handlungsdefizite erkennt, die in Handlungssituationen
eingelagert sind und die es als Lernproblematik ausgliedern kann, um die erkannte
Problematik lernend zu überwinden.
(3) Schließlich hat das Subjekt auch die Option, sich den von Dritten gestellten Lern-
notwendigkeiten obwohl es keine Handlungsproblematik erkennt deshalb lernend
zuzuwenden, weil es sich mit der Vermutung oder Tatsache konfrontiert sieht, daß aus
27
Vgl.
HOLZKAMP, K., 1997, S. 224
3. Der heuristische Rahmen zur Rekonstruktion des Lernhandelns
33
einer Verweigerung des Lernens erhebliche Bedrohungen seiner Weltverfügung und
Lebensqualität resultieren würden. Das Subjekt sieht sich hier zum Lernen gezwungen,
weil Nicht-Lernen seinen Lebensinteressen schaden würde.
28
In diesem Abschnitt wurde dargestellt, daß es ein Spektrum von Handlungsoptionen im
Kontext von Lernen / Nicht-Lernen für ein Subjekt gibt, wenn es sich Handlungsprob-
lematiken oder drittseitigen Lernanforderungen gegenübergestellt sieht. Diese Optionen
stellen einen Teil des heuristischen Rahmens dar, mit dem das empirische Datenmaterial
untersucht wird. Es wird also in diesem Teil der Arbeit z.B. zu untersuchen sein, ob und
ggfs. in welcher Weise die Teilnehmer des Team-Management-Trainings schon vor
dem Seminar Handlungsproblematiken hatten und diese durch Lernen überwinden woll-
ten oder eventuell erst im Verlauf des Seminars und in Auseinandersetzung mit dem
Stoff Handlungsproblematiken erkannten.
Nachdem deutlich gemacht wurde, daß ein Subjekt nicht einfach zu lernen beginnt,
nachdem Lernanforderungen gestellt wurden, sondern gute Gründe für die Initiierung
einer Lernhandlung haben muß, wird im folgenden Kapitel der Aspekt der thematischen
Lernbegründungen dargestellt.
3.2.2 Thematische Lernbegründung für das Subjekt
Das Verhältnis von Handlungsproblematik und Lernbegründung wird in diesem Teil der
Arbeit nochmals von seiner thematischen Seite her bedacht, um den heuristischen Rah-
men noch weiter auszudehnen.
Eine der zentralen Fragen, die Holzkamp an den Anfang seiner subjektwissenschaftli-
chen Lerntheorie stellt ist, wie theoretisch verständlich zu machen ist, daß das Subjekt
selbst von seinem Standpunkt aus Gründe haben kann, sachlich-soziale Bedeutungszu-
sammenhänge durch Lernen in seinen Handlungen zu realisieren. Für ihn ist zur Beant-
28
Vgl. dazu die Ausführungen zum ,,defensiven Lernen" in Kapitel 3.2.2
3. Der heuristische Rahmen zur Rekonstruktion des Lernhandelns
34
wortung dieser Frage der Rückgriff auf die oben erwähnten Lebensinteressen notwen-
dig, welche als emotional-motivationale Qualität von Handlungsbegründungen zu be-
schreiben sind:
,,Die subjektiven Lebensinteressen, in welchen die Gründe des Individuums für die
handelnde Realisierung von Bedeutungen / Handlungsmöglichkeiten fundiert sind, las-
sen sich kategorial in ihren allgemeinsten Zügen als elementare subjektive Notwendig-
keit, Verfügung über individuell relevante gesellschaftliche Lebensbedingungen zu ge-
winnen bzw. zu bewahren, bestimmen. Dabei sind die Gewinnung der Weltverfügung
bzw. Abwehr von deren Bedrohung nicht als Selbstzweck zu betrachten, sondern ma-
chen die allgemeine Lebensqualität subjektiver Befindlichkeit in ihren vielfältigen kon-
kreten Erscheinungsformen aus. In diesem Kontext wurde von uns auf der Basis des
Begriffspaars ,verallgemeinerte /- restriktive Handlungsfähigkeit` der emotionale As-
pekt meiner Befindlichkeit als Erfahrung der jeweiligen Bedeutungen als ,Bedeutungen
für mich` im Spannungsfeld zwischen emotionalen Handlungsengagement und emotio-
naler ,Innerlichkeit` gekennzeichnet. Auf dieser Grundlage charakterisierten wir die
motivationale Qualität meiner Handlungsgründe als Verhältnis zwischen den mit einem
Handlungsresultat antizipierbaren Verfügungsmöglichkeiten (in ihrer emotionalen Wer-
tigkeit) und den zu seiner Realisierung aufzubringenden Anstrengungen bzw. in Kauf
zu nehmenden Risiken im Spannungsfeld zwischen echter Motivation und (verinner-
licht-motivationsförmigem) Zwang".
29
Für Holzkamp gibt es im Rückgriff auf das kategoriale Begriffspaar Motivation / (in-
nerer) Zwang prinzipiell zwei Arten der Lernbegründung, und zwar abhängig davon,
inwieweit für das Subjekt durch Lernen eine Erweiterung / Erhöhung seiner Weltverfü-
gung / Lebensqualität oder lediglich die durch Lernen zu erreichende Abwehr von deren
Beeinträchtigung und Bedrohung antizipierbar ist. Lernen kann also auf zweierlei Arten
begründet sein: Einmal aus der Verfügungserweiterung durch das Eindringen in den
Lerngegenstand (expansives Lernen), ein anderes Mal aus der Bedrohtheit der beste-
henden Handlungsfähigkeit (defensives Lernen). Im zweiten Fall ist Lernen für das Sub-
jekt unerläßlich, weil aus Nicht-Lernen Bedrohungen seiner Weltverfügung / Lebens-
qualität resultieren würden. Das Lernen ist also gewissermaßen ,,erzwungen" - das Sub-
jekt tendiert allerdings in diesem Fall dazu, das Lernen zugunsten direkter Bezugshand-
lungen aufzugeben.
29
HOLZKAMP, K., 1993, S. 189f. (Hervorhebungen im Original, Anm. d. Verf.)
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Originalausgabe
- Erscheinungsjahr
- 1999
- ISBN (eBook)
- 9783832448943
- ISBN (Paperback)
- 9783838648941
- DOI
- 10.3239/9783832448943
- Dateigröße
- 1.5 MB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- Universität Augsburg – Philosophische Fakultät I
- Erscheinungsdatum
- 2002 (Januar)
- Note
- 1,3
- Schlagworte
- weiterbildung lernmotivation führungskräftetraining evaluation
- Produktsicherheit
- Diplom.de