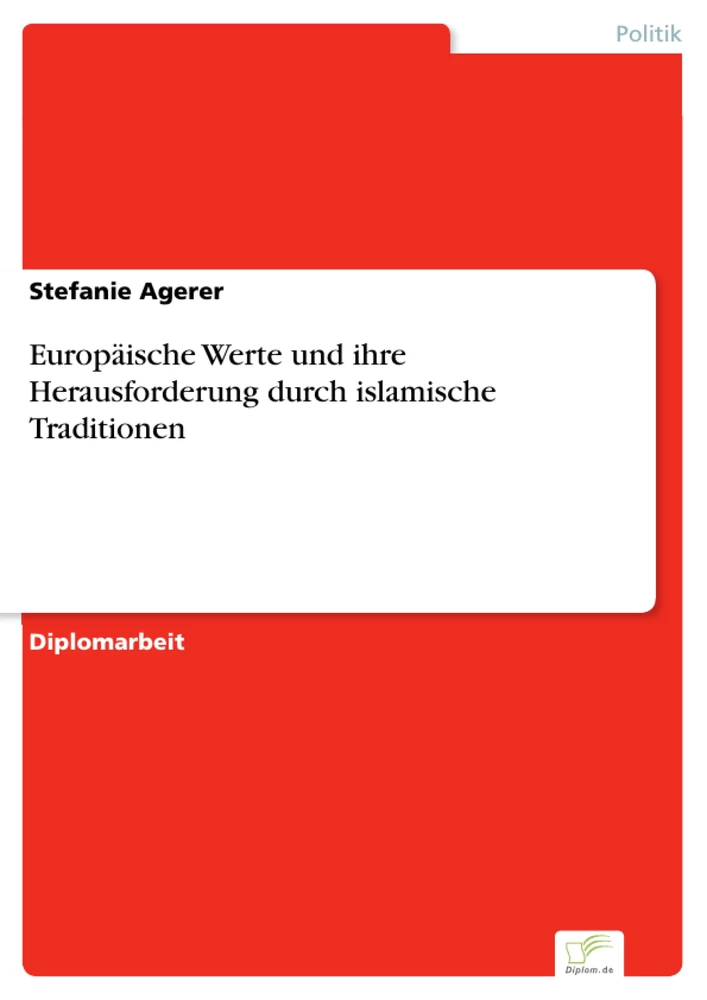Europäische Werte und ihre Herausforderung durch islamische Traditionen
©2001
Diplomarbeit
60 Seiten
Zusammenfassung
Inhaltsangabe:Zusammenfassung:
Die Arbeit behandelt die Frage, ob europäisch-westliche Werte prinzipiell mit islamischen Traditionen vereinbar sind. Ausgangspunkt dabei ist die schwierige Aufgabe, "europäische" Werte zu definieren, wobei zunächst geklärt wird, ob die europäische Gesellschaft abseits von formal-politischer und wirtschaftlicher Einheit auch eine einheitliche kulturelle Identität besitzt und wie diese charakterisiert werden kann. Worüber definiert sich "Europa", und speziell: Über welche Werte definiert sich Europa? Welches sind typische Merkmale der europäischen Kultur und wie sehr machen diese Merkmale, zu denen z.B. auch das Christentum gehört, heute Europa überhaupt noch aus.
Um den angepeilten Vergleich zwischen islamischen und europäisch-westlichen Werten einzuleiten, wird anschließend auf die islamische Geschichte eingegangen, die von islamischer Dominanz über mehr oder weniger gleichberechtigte Koexistenz mit Europa bis hin zu einem erdrückenden Übergewicht der westlichen Welt reicht. Hieran wird geschildert, wie Differenzen aus der Geschichte die heutigen Spannungen entstehen lassen konnten bzw. sie immer noch beeinflussen.
Das Hauptkapitel besteht in einem konkreten Vergleich der identifizierten europäischen Werte mit islamischen Traditionen und Wertvorstellungen. Inwiefern und in welcher Form sind Konzepte wie der Nationalstaat, die Demokratie oder die Rechtsstaatlichkeit in islamischen Traditionen verankert, inwieweit könnten sie sich heute auch in islamisch geprägten Gesellschaften festsetzen, wo liegen Probleme, oder ist diese Perspektive gar völlig illusorisch?
Die Arbeit versucht nicht zuletzt, sich anhand des gewählten Themas mit den Thesen aus Samuel P. Huntingtons "Clash of Civilizations" auseinander zu setzen, der in seinem Buch immerhin die Konfliktpotentiale zwischen dem Westen und der islamischen Welt als besonders gefährlich einstuft. Deshalb widmet sich die Arbeit in einem abschließenden Teil auch realpolitischen Aspekten, z.B. der Migrationsproblematik in Europa und nicht zuletzt den Gefahren des islamischen Fundamentalismus, die der Welt gerade mal wenige Monate nach Fertigstellung der vorliegenden Arbeit deutlich vor Augen geführt wurden.
Inhaltsverzeichnis:Inhaltsverzeichnis:
I.EINLEITUNG3
II.HAUPTTEIL3
1.Europäische Werte?4
1.1Europäische Identität5
1.2Historische Wurzeln6
1.3Rationale und kulturelle Wertegemeinschaft7
2.Historische Beziehungen zwischen Europa und dem Islam10
2.1Arabische […]
Die Arbeit behandelt die Frage, ob europäisch-westliche Werte prinzipiell mit islamischen Traditionen vereinbar sind. Ausgangspunkt dabei ist die schwierige Aufgabe, "europäische" Werte zu definieren, wobei zunächst geklärt wird, ob die europäische Gesellschaft abseits von formal-politischer und wirtschaftlicher Einheit auch eine einheitliche kulturelle Identität besitzt und wie diese charakterisiert werden kann. Worüber definiert sich "Europa", und speziell: Über welche Werte definiert sich Europa? Welches sind typische Merkmale der europäischen Kultur und wie sehr machen diese Merkmale, zu denen z.B. auch das Christentum gehört, heute Europa überhaupt noch aus.
Um den angepeilten Vergleich zwischen islamischen und europäisch-westlichen Werten einzuleiten, wird anschließend auf die islamische Geschichte eingegangen, die von islamischer Dominanz über mehr oder weniger gleichberechtigte Koexistenz mit Europa bis hin zu einem erdrückenden Übergewicht der westlichen Welt reicht. Hieran wird geschildert, wie Differenzen aus der Geschichte die heutigen Spannungen entstehen lassen konnten bzw. sie immer noch beeinflussen.
Das Hauptkapitel besteht in einem konkreten Vergleich der identifizierten europäischen Werte mit islamischen Traditionen und Wertvorstellungen. Inwiefern und in welcher Form sind Konzepte wie der Nationalstaat, die Demokratie oder die Rechtsstaatlichkeit in islamischen Traditionen verankert, inwieweit könnten sie sich heute auch in islamisch geprägten Gesellschaften festsetzen, wo liegen Probleme, oder ist diese Perspektive gar völlig illusorisch?
Die Arbeit versucht nicht zuletzt, sich anhand des gewählten Themas mit den Thesen aus Samuel P. Huntingtons "Clash of Civilizations" auseinander zu setzen, der in seinem Buch immerhin die Konfliktpotentiale zwischen dem Westen und der islamischen Welt als besonders gefährlich einstuft. Deshalb widmet sich die Arbeit in einem abschließenden Teil auch realpolitischen Aspekten, z.B. der Migrationsproblematik in Europa und nicht zuletzt den Gefahren des islamischen Fundamentalismus, die der Welt gerade mal wenige Monate nach Fertigstellung der vorliegenden Arbeit deutlich vor Augen geführt wurden.
Inhaltsverzeichnis:Inhaltsverzeichnis:
I.EINLEITUNG3
II.HAUPTTEIL3
1.Europäische Werte?4
1.1Europäische Identität5
1.2Historische Wurzeln6
1.3Rationale und kulturelle Wertegemeinschaft7
2.Historische Beziehungen zwischen Europa und dem Islam10
2.1Arabische […]
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
ID 4843
Agerer, Stefanie: Europäische Werte und ihre Herausforderung durch islamische Traditionen /
Stefanie Agerer - Hamburg: Diplomica GmbH, 2001
Zugl.: Passau, Universität, Diplom, 2001
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte, insbesondere die
der Übersetzung, des Nachdrucks, des Vortrags, der Entnahme von Abbildungen und Tabellen,
der Funksendung, der Mikroverfilmung oder der Vervielfältigung auf anderen Wegen und der
Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen, bleiben, auch bei nur auszugsweiser Verwertung,
vorbehalten. Eine Vervielfältigung dieses Werkes oder von Teilen dieses Werkes ist auch im
Einzelfall nur in den Grenzen der gesetzlichen Bestimmungen des Urheberrechtsgesetzes der
Bundesrepublik Deutschland in der jeweils geltenden Fassung zulässig. Sie ist grundsätzlich
vergütungspflichtig. Zuwiderhandlungen unterliegen den Strafbestimmungen des
Urheberrechtes.
Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in diesem
Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme, dass solche
Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei zu betrachten
wären und daher von jedermann benutzt werden dürften.
Die Informationen in diesem Werk wurden mit Sorgfalt erarbeitet. Dennoch können Fehler nicht
vollständig ausgeschlossen werden, und die Diplomarbeiten Agentur, die Autoren oder
Übersetzer übernehmen keine juristische Verantwortung oder irgendeine Haftung für evtl.
verbliebene fehlerhafte Angaben und deren Folgen.
Diplomica GmbH
http://www.diplom.de, Hamburg 2001
Printed in Germany
Wissensquellen gewinnbringend nutzen
Qualität, Praxisrelevanz und Aktualität zeichnen unsere Studien aus. Wir
bieten Ihnen im Auftrag unserer Autorinnen und Autoren Wirtschafts-
studien und wissenschaftliche Abschlussarbeiten Dissertationen,
Diplomarbeiten, Magisterarbeiten, Staatsexamensarbeiten und Studien-
arbeiten zum Kauf. Sie wurden an deutschen Universitäten, Fachhoch-
schulen, Akademien oder vergleichbaren Institutionen der Europäischen
Union geschrieben. Der Notendurchschnitt liegt bei 1,5.
Wettbewerbsvorteile verschaffen Vergleichen Sie den Preis unserer
Studien mit den Honoraren externer Berater. Um dieses Wissen selbst
zusammenzutragen, müssten Sie viel Zeit und Geld aufbringen.
http://www.diplom.de bietet Ihnen unser vollständiges Lieferprogramm
mit mehreren tausend Studien im Internet. Neben dem Online-Katalog und
der Online-Suchmaschine für Ihre Recherche steht Ihnen auch eine Online-
Bestellfunktion zur Verfügung. Inhaltliche Zusammenfassungen und
Inhaltsverzeichnisse zu jeder Studie sind im Internet einsehbar.
Individueller Service
Gerne senden wir Ihnen auch unseren Papier-
katalog zu. Bitte fordern Sie Ihr individuelles Exemplar bei uns an. Für
Fragen, Anregungen und individuelle Anfragen stehen wir Ihnen gerne zur
Verfügung. Wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit.
Ihr Team der Diplomarbeiten Agentur
2
Gliederung
I. EINLEITUNG ... 3
II. HAUPTTEIL ... 3
1. E
UROPÄISCHE
W
ERTE
?... 4
1.1 Europäische Identität ... 5
1.2 Historische Wurzeln ... 6
1.3 Rationale und kulturelle Wertegemeinschaft ... 7
2. H
ISTORISCHE
B
EZIEHUNGEN ZWISCHEN
E
UROPA UND DEM
I
SLAM
...10
2.1 Arabische >Dominanz ...10
2.2 Euro-arabische Geschichte...16
2.3 Europäische Dominanz...19
3. E
UROPÄISCHE UND ISLAMISCHE
W
ERTE IM
V
ERGLEICH
...23
3.1 Europa und Islam Grundlagen ...24
3.2 Der Islam und der Nationalstaat...28
3.3. Der Islam und der Krieg ...31
3.4 Der Islam und die Demokratie...32
3.5 Der Islam und das Recht ...37
3.6 Der Islam und die Menschenrechte...41
4. R
EALPOLITISCHE
I
MPLIKATIONEN
...44
4.1 Islamischer Fundamentalismus im 20. Jahrhundert ...45
4.2 Entwestlichung der Welt ...46
4.3 Probleme der Migration in Europa ...47
4.3 Die Probleme der EU mit dem Beitrittskandidat Türkei...50
III. SCHLUSSBETRACHTUNG ...52
3
Europäische Werte und ihre Herausforderung durch islamische
Traditionen
I. Einleitung
Nachdem das Zusammenwachsen der europäischen Länder zu einer europäischen Ge-
sellschaft unaufhaltsam voranzuschreiten scheint, stellt sich heute immer dringender die
Frage, ob diese europäische Gesellschaft abseits von formal-politischer und wirtschaftlicher
Einheit auch eine einheitliche kulturelle Identität besitzt oder in Zukunft besitzen kann. Wor-
über definiert sich >Europa, und speziell: Über welche Werte definiert sich Europa? Gibt es
so etwas wie eine europäische Leitkultur? Und wenn ja: Wie integriert die Europäische Union
solche europäischen Werte?
Seit Samuel P. Huntingtons aufsehenserregendem Artikel in Foreign Affairs ist das Thema
des >Zusammenpralls der Kulturen in aller Munde. Er greift Konzepte auf, wie sie Oswald
Spengler, Arnold Toynbee und andere bereits seit Beginn des 20. Jahrhunderts vertreten
und rückt damit die Frage nach kulturellen Wertvorstellungen in der internationalen Politik in
den Mittelpunkt der Betrachtung. Diese Arbeit widmet sich im ersten Teil der Frage nach den
möglichen Inhalten einer europäischen Identität, nach europäischen Werten. Sind solche
Werte definierbar? Worin könnten sie bestehen? Im folgenden zweiten Teil sollen dann diese
europäischen Werte den traditionellen islamischen Werten, Normen und Bestimmungen, wie
sie aus der Geschichte erwachsen sind, gegenübergestellt werden. Inwiefern sind europäi-
sche Werte mit islamischen Werten vereinbar, in welchen Punkten sind sie unvereinbar, wel-
che Kompromisse sind von Nöten, um Huntingtons Schreckenszenario entgegen zu wirken?
Die Arbeit schließt mit der Bewertung einiger realpolitischer Aspekten der Konfrontation zwi-
schen europäisch-westlicher und islamischer Zivilisation.
Literatur zum Islam findet sich zuhauf, wobei natürlich vor allem die Werke Bassam Tibis
und Bernhard Lewis als Standardliteratur anzusehen sind. Zu europäischen Werten und eu-
ropäischer Identität ist die Literatur spärlicher. Auch Studien über die historischen und aktuel-
len Beziehungen zwischen Europa und dem Islam wurden für diese Arbeit herangezogen.
II. Hauptteil
Das Hauptproblem, das zwischen zwei unterschiedlichen Zivilisationen besteht, ist das
Verständigungsproblem. Oswald Spengler weist hierauf insbesondere hin, wenn er behaup-
tet, man könne eine fremde Kultur niemals begreifen oder verstehen. Bassam Tibi gibt in
diesem Zusammenhang klar zu bedenken, dass »Menschen aus unterschiedlichen Zivilisati-
onen dieselben Begriffe mit jeweils eigenen spezifischen Inhalten [füllen], so dass jede Zivili-
4
sation ihre eigene Wissenstradition hat«
2
. So können Vertreter zweier Kulturen sich auf Vo-
kabeln einigen und dennoch von völlig unterschiedlichen Dingen sprechen. Tibi führt weiter
aus:
»Das Dilemma besteht also darin, dass Globalisierungsprozesse auf allen strukturellen Ebe-
nen im Gange sind, jedoch den Bereich der kulturell bedingten Weltanschauungen, das heißt
der Normen und Werte, nicht erfassen. Jede Zivilisation behält ihre entsprechende Welt-
sicht«
3
.
Diese verschiedenen, gegenseitig nicht verstandenen Weltsichten führen dann im Extremfall
zum >Clash of Civilizations, und hier liegen auch die größten Probleme, wenn man sich um
Vermittlung bemüht. Im Folgenden wird wiederholt auf die islamische bzw. europäisch-
westliche Weltsicht hingewiesen werden. Es wird sich dabei zeigen, dass das Problem auch
darin liegt, dass jede dieser Weltsichten für sich legitim und schlüssig ist. Die Frage ist: Gibt
es eine objektive Wahrheit jenseits der subjektiven Weltsicht einer Kultur? Sind gar europäi-
sche Werte universale Werte?
1. Europäische Werte?
Um diese Thematiken jedoch später wieder aufgreifen zu können, ist es nötig, sich zu-
nächst mit der Frage nach spezifisch europäischen Werten auseinander zu setzen. Diese
Betrachtungsweise von Europa bzw. der Europäischen Union als neue konstitutionelle und
politische Einheit Europas ist bislang eher vernachlässigt worden und wenig in den Köpfen
der Menschen präsent. Nach wie vor ist die Identifikation der Bürger mit der eigenen Nation
weitaus stärker und ausgeprägter als die mit der Europäischen Union.
4
Man spricht vielleicht
von deutscher oder französischer Tradition, englischer Geschichte und spanischen Bräu-
chen; dass über dem ganzen aber eine europäische Wertegemeinschaft existiert, ist nur
marginal in den Köpfen der Bürger verankert. Die EU dagegen wird in erster Linie als Beam-
tenapparat, als politische Institution gesehen, die sich Dingen wie Währungsunion und Ag-
rarsubventionen widmet. Die Europäische Union scheint auf den ersten Blick abgehoben von
allen Wertvorstellungen, sie scheint auf rein materiellen Fakten und Faktoren zu basieren.
Dass hinter dieser Europäischen Union ein historisch-kulturelles Europa stehen muss, dringt
gegenwärtig nur langsam in die Köpfe von Bürgern, Politikern und Wissenschaftlern vor.
Wie aber steht es um solche europäischen Werte und Traditionen? Diese Frage soll in den
folgenden drei Punkten schritt für schritt geklärt werden.
2
Tibi, Bassam: Krieg der Zivilisationen. Politik und Religion zwischen Vernunft und Fundamentalismus. Hamburg
1995. S.243.
3
Krieg der Zivilisationen, S.142.
4
vgl. z.B. Mintzel, Alf: Multikulturelle Gesellschaften in Europa und Nordamerika. Konzepte, Streitfragen, Analy-
sen. Passau 1997, S.338.
5
1.1 Europäische Identität
Europa ist auf der Suche nach seiner Identität. Je mehr Zeit vergeht, je weiter sich die Eu-
ropäische Union einer supranationalen Organisation annähert, umso dringender wird die
Frage nach dieser europäischen Identität, einer Identität, wie sie für Nationalstaaten schon
lange selbstverständlich ist. Weidenfeld wagt sogar die Behauptung, »die schwache Identi-
tät« sei die »eigentliche Achillesferse der Europäischen Union«
5
. Das »Identitätsdefizit« der
EU, wie Jacques Lenoble in einem Aufsatz ausführt, bedeutet, dass die fehlende politische
Identität Europas das Problem mangelnder Einheit innerhalb des Gemeinwesens und unge-
nügender Loyalitäten aufwirft.
6
Identität, die sich in der Regel auf gemeinsame Werte als
»Grundstein einer jeden politischen Gemeinschaft«
7
beruft, müsste diesen Problemen ent-
gegenwirken. Fehlt diese Identität, wird es schwer, Solidarität unter den Bürgern herzustel-
len, die sich nur zusammengehörig fühlen, solange sie ein gemeinsames Identifikationsob-
jekt haben. Pfetsch führt weiterhin aus:
»Europa ist und muss mehr sein als ein Konsumenten- und Produzentenmarkt, will es von den
Bürgern akzeptiert und damit legitimiert werden, die europäische Identität müsste als eine kol-
lektive Identität entstehen, die die identitätsstiftenden Kräfte des Nationalismus und Rassis-
mus überwindet ohne in puren Konsumismus oder in anonymen Institutionalismus zu verfal-
len«
8
.
Die Frage nach der Identität führt uns schließlich zur Frage nach einem »europäischen
Kulturbewusstsein«. Dies, so meint José Ortega Y Gasset, müsse existieren, schließlich ha-
be »Europa als Gesellschaft zu einem früheren Datum bestanden [...], als die europäischen
Nationen existierten«
9
. Allerdings gibt Weidenfeld in diesem Zusammenhang zu bedenken,
dass Europa sich im Gegensatz zu den einzelnen Nationalstaaten nicht auf nationale Mythen
stützen kann, die ein gewisses Zusammengehörigkeitsgefühl erzeugen. Somit stellt sich für
ihn die Suche nach einer europäischen Identität als die Suche »nach der geistigen und kultu-
rellen Gestalt Europas« dar.
10
Zunächst ist für Weidenfeld die europäische Identität nichts anderes als die »Herkunftsein-
heit Europas aus gemeinsamer Geschichte«. Wichtig dabei ist nicht nur die Vergangenheit,
sondern auch Geschehnisse in der Gegenwart sowie ein Ziel in der Zukunft. Darüber hinaus
dürfe man Europa nicht allein von der Geographie her betrachten; es sei vielmehr auch eine
normative Größe.
11
Dieses Normative an Europa offenbart sich beispielsweise in »europäi-
5
Weidenfeld, Werner: Europa-Handbuch. Bonn 1999, S.20
6
vgl. Dewandre, Nicole / Lenoble, Jacques (Hg.): Projekt Europa. Postnationale Identität: Grundlage für eine
europäische Demokratie? Berlin 1994, S.184.
7
Pfetsch, Frank R.: Die Problematik der europäischen Identität. In: Aus Politik und Zeitgeschichte. Bonn 1998,
S.8.
8
Pfetsch, S.4.
9
Ortega Y Gasset, José: Europäische Kultur und europäische Völker. Stuttgart 1954, S.11.
10
vgl. Weidenfeld, S.20.
11
vgl. Weidenfeld, S.21f.
6
sche[n] Sitten, europäische[n] Bräuchen, öffentliche[r] europäische[r] Meinung, europäi-
sche[m] Recht, europäische[r] öffentliche[r] Gewalt«
12
.
Aber auch von offizieller Seite, d.h. von Seiten der EU selbst kommen Aussagen zu einer
europäischen Identität. Bereits 1973 verabschiedeten die damaligen EG-Außenminister ein
>Dokument über die europäische Identität, die u.a. »das gemeinsame Erbe« als ein Kern-
stück solch einer Identität hervorhoben.
13
1.2 Historische Wurzeln
Nachdem wir nun gesehen haben, dass die >gemeinsam erlebte europäische Geschichte
durchaus als prägend und für ein Konzept von europäischer Identität inhärent vorgestellt
wird, sollten wir nun kurz zusammenfassen, was denn dieses gemeinsame Erbe alles um-
fasst. Dabei können natürlich immer nur beispielhafte Ausschnitte aus der Fülle an histori-
schen Begebenheiten herausgegriffen werden, die symbolisch für >europäische Geschichte
stehen.
Wir können weit zurück gehen, bis in die Antike, um an die Wurzeln und den Beginn der
europäischen Geschichte zu stoßen. Egal ob man sich Spenglers Meinung anschließt, der
sagt, die antike Zivilisation sei eine völlig eigenständige Kultur, die mit dem europäischen
Abendland lediglich historische Berührungspunkte, sonst aber praktisch nichts mit ihm ge-
meinsam hat, so muss man doch berücksichtigen, dass Europa sich in vielfacher Hinsicht
auf antike Philosophie und Tradition beruft und sich ein Stück weit mit ihr identifiziert. Lipp
führt aus:
»Auf dem Boden teils des griechischen philosophischen Denkens, teils des römischen Rechts
und des römischen organisatorischen Erbes hat es sich gespeist von Einflüssen auch aus
dem überlebenden byzantinisch-christlichen Ostreich unter Karl dem Großen, dem König
der Franken, im germanischen Norden zu einem Amalgam zusammengefunden, das, wie man
sagte, zur >Seele Europas wurde und von jenem ersten, konkret so benannten >imperium eu-
ropaeum, das Karl geschaffen hatte, über Mittelalter und Neuzeit kulturell hereinwirkt bis in
die Gegenwart«
14
.
Die eigentliche Geburt Europas könnte man nach Weidenfeld im vierten Jahrhundert
ansetzen, als »das Lateinische Liturgiesprache« wird und »Europa [...] sich als lateinische
Christenheit« konstituiert.
15
In religiöser Hinsicht einscheidend ist dann ein Jahrtausend spä-
ter das Schisma der christlichen Kirche in einen römisch-katholischen und einen protestanti-
schen Teil. Darauf folgen wichtige Ereignisse wie der Augsburger Religionsfriede, der Drei-
ßigjährige Krieg oder der Westfälische Friede. Überall spielt die Religion noch eine große
Rolle, ehe der biblische Glaube allmählich von »Humanismus und Renaissance [...] ent-
12
Ortega Y Gasset, S.10f.
13
vgl. Pfetsch, S.3.
14
Lipp, Wolfgang: Heimat Nation Europa. Wohin trägt uns der Stier? Würzburg 1999, S.171.
15
vgl. Weidenfeld, S.23.
7
thront« wird. Diese Entwicklung mündet in der Aufklärung, wo zum ersten Mal Werte wie
Demokratie und Menschenrechte eine tiefere Reflexion erfahren. Europa schwingt sich
schritt für schritt zur größten Macht auf dem Globus, es entstehen die Nationalstaaten; doch
in Folge zweier Weltkriege verliert Europa diese Vormachtstellung wieder und ist nur mehr
eine mittlere Macht inmitten der zwei Blöcke des Kalten Krieges. Bis heute konnte Europa
die einzige überragende Stellung in der Welt nicht wieder erreichen
16
.
Interessant ist Weidenfelds Betrachtungsweise des wie er es nennt »Wunders Euro-
pa«. Er versteht darunter die Tatsache, dass Europa auf seinem Weg in die Moderne Ideen
hervorgebracht hat, die es in keiner anderen Hochkultur bisher gab. Er zählt darunter:
·
den demokratischen Verfassungsstaat als politische Ordnungsform;
·
die Nationalstaaten als territoriale Ordnungssysteme;
·
die autonome Wissenschaft mit dem methodischen Prinzip der intersubjektiven
Kontrollierbarkeit und dem regulativen Ziel der rationale Wahrheitssuche;
·
den Kapitalismus als zentrale Schubkraft der industriellen Entwicklung.
17
Diese Entwicklung führt er letztlich auf das zufällige Zusammentreffen günstiger Faktoren
zurück, die keine frühere Hochkultur erfahren durfte.
Aus diesem mehr als zweitausendjährigen Prozess heraus müssten nun also die Grundla-
gen für eine europäische Identität und für heute gültige europäische Werte herauszulesen
sein. Nun stellt sich allerdings die Frage, ob denn »Hintergründe wie das Erbe Roms, A-
thens, des Christentums, die Prinzipien von Freiheit, Demokratie und Menschenrechten, [...]
Perspektiven wie die Aufklärung, der Fortschritt der Wissenschaften, der Prozess der Ratio-
nalisierung [...] überhaupt [ein] schlüssiges Bild« ergeben, das wir heute als >europäische
Identität verorten können
18
.
1.3 Rationale und kulturelle Wertegemeinschaft
Zunächst ein Wort zur Bedeutung von >Kultur an sich. Lipp macht deutlich und freilich
beruht diese Arbeit auf der Voraussetzung der Wahrheit seiner These , dass Kultur keines-
wegs nur ein >luftiger Überbau ist, »der im Kräftespiel letztwirksamer >materieller Verhältnis-
se eine unmaßgebliche, allenfalls verschleiernde Funktion erfüllt«.
19
Vielmehr ist Kultur ein
wichtiger Bestandteil nicht nur des Alltags der Menschen, sondern auch beispielsweise ihrer
Institutionen und sie bestimmt wesentlich die »Strukturen [ihres] Daseins«.
20
Wenn wir also
nach der Identität und den Werten eines politischen Gemeinwesens fragen, so kommen wir
nicht umhin, auch gleichzeitig nach den kulturellen Bestimmungen dieses Gemeinwesens zu
fragen.
16
vgl. Weidenfeld, S.24f.
17
nach: Weidenfeld, S.25.
18
Lipp, S.176.
19
Lipp, S.167.
8
Da wäre zunächst die Frage zu stellen, ob es in der Realität überhaupt etwas wie eine ho-
mogene europäische Kultur gibt, die sich wiederum von anderen Kulturen wie dem Islam
abgrenzen lässt.
21
Sicher ist dies nur in Grenzen der Fall. Gleichzeitig wird >Europa als Wer-
tegemeinschaft immer ein Konstrukt bleiben, das sich jederzeit verändern und relativieren
kann; es ist nichts Festes und nichts, was sich eindeutig festmachen lässt. Dies muss stets
im Hinterkopf bleiben, wenn im Folgenden versucht wird, einige europäische Grundwerte
und Charakteristika zu identifizieren.
Ich wähle dafür ein Modell, das Europa als >kulturelle Wertegemeinschaft einem Europa
als >rationale Wertegemeinschaft gegenüberstellt. Dabei sind beide Dimensionen keines-
wegs voneinander zu trennen, vielmehr resultieren rationale Werte wie Demokratie und
Menschenrechte aus europäischer kultureller Geschichte, genauer gesagt aus dem kultur-
historischen Prozess der Aufklärung. Trotzdem werden nicht-aufklärerische Werte (die in
Europa über Jahrhunderte maßgebend waren) wie beispielsweise Christentum
22
oder spe-
zielle Denkströmungen aus der Vergangenheit heutzutage nicht mehr ernsthaft als moderne
europäische Werte angesehen. Die Argumentation ist, dass sich diese Werte im Zuge des
allgemeinen Fortschritts als überholt erwiesen haben. Nun allerdings und das wurde schon
angekündigt wird ein Schluss ganz anderer Art gezogen: Wenn sich Europa im Anschluss
an die Aufklärung von >niederen Werten wie Religiosität und Inhumanität lösen konnte, so
sollten die modernen Werte, die nun gleichsam als rational und letztgültig angesehen wer-
den, doch universellen Charakter haben.
Als kulturelle, historische Werte Europas lassen sich Dinge verorten wie
»kulturelle Stile und Ausdrucksformen in der Architektur, in der Musik, in der Literatur, in den
Bildenden Künsten, [...] die romanische, gotische, barocke, klassizistische und moderne Kul-
tur, [...] die gemeinsamen philosophisch-politischen Ideen, Strömungen und politische Rich-
tungen [...]: Renaissance und Humanismus, Klassizismus und Aufklärung, Romantik, Libera-
lismus und Sozialismus«
23
.
Und Pfetsch hebt hervor, dass jede politische Gemeinschaft sich aus »gemeinsamen Ur-
sprungsmythen« definiert, welche »historische Fixpunkte« darstellen.
»Zu den gemeinsamen Symbolen Europas sind die Bauwerke der Römer [...] oder der Sieg
über den Islam bei Tours und Poitiers zu zählen. Auch die Kreuzritter [...]. Die italienische Re-
naissance mit Malerei, Skulpturen, Schriften, Musik und die französische Revolution mit Men-
schenrechten, später aber auch mit der Guillotine und dem Code Napoléon«.
24
20
vgl. Lipp, S.168.
21
vgl. Mintzel, S.324.
22
Mintzel erwähnt das Christentum ausdrücklich als immer noch genannte Quelle europäischer Identität, wenn-
gleich es genügend Gegenpositionen gibt. Siehe: Mintzel, S.330. Auch Wolfgang Huber bezeichnet in einem
Artikel in der Süddeutschen Zeitung das Christentum als eine der wichtigsten Quellen einer europäischen Werte-
gemeinschaft. Siehe: Huber, Wolfgang: Der Traum von den >schönen glänzenden Zeiten. In: Süddeutsche Zei-
tung vom 12./13. April 2001.
23
Mintzel, S.324.
24
vgl. Pfetsch, S.6.
9
Dieser Position entgegen stehen Stimmen wie die von Habermas. Für ihn sind Konzepte,
die Einheit aus »gemeinsamer Tradition, gemeinsamer Kultur und gemeinsamer Sprache«
heraus definieren, heute überholt; sie sind nicht mehr nützlich, um das heutige Europa zu
definieren. Europa sollte sich nur mehr nach Konzepten konstituieren, die auf »bestimmten
moralischen und politischen Prinzipien, wie dem Grundsatz der Demokratie, des Rechts
usw.« ausgeben.
25
Dieser Meinung schließen sich die meisten Autoren an, die zwar oftmals
nicht leugnen, dass Werte wie Demokratie und Rechtsstaatlichkeit aus einem historisch-
kulturellen Prozess hervorgegangen sind, diesen geschichtlichen Hintergrund aber als abge-
legt und in keiner Weise mehr als bedeutsam sehen. Mintzel nennt einen umfassenden Kata-
log, welcher Freiheit, Demokratie, den modernen Nationalstaat, Individualität des Menschen,
Menschenrechte, freie Meinungsäußerung, das Primat der Vernunft, die politische Republik
(mit Verfassung, Gewaltenteilung, Rechtsstaatlichkeit und Grundrechten) sowie die Tren-
nung von Staat und Kirche beinhaltet.
26
Wenn wir uns nun aber fragen, welche Relevanz das Gesagte für das heutige Erschei-
nungsbild Europas in Form der Europäischen Union hat, dürfte in diesem Zusammenhang
die Selbstdefinition der EU am entscheidendsten sein. Bereits 1990 ist in der KSZE-Charta
von Paris zum ersten Mal von einem Wertesystem des Westens die Rede. Es fallen Begriffe
wie Demokratie, Menschenrechte und Marktwirtschaft.
27
Diese Werte finden auch im Vertrag
von Maastricht ihre Entsprechung, und zwar in Art. 6 EUV
28
, der ausdrücklich Freiheit, De-
mokratie, Achtung der Menschenrechte und Grundfreiheit sowie Rechtsstaatlichkeit als eu-
ropäische Grundwerte festschreibt. Somit schließen sich auch die Verantwortlichen innerhalb
der EU der These an, Europa sei heute eine rationale Wertegemeinschaft. Die Frage dabei
ist natürlich, inwieweit die EU für >Europa steht. Wie bereits gesagt, identifiziert sich die
Mehrzahl der Bürger nicht in erster Linie mit ihr, sondern viel mehr mit ihrem jeweiligen Nati-
onalstaat. Darüber hinaus sind natürlich auch regionale Identität weiterhin von Bedeutung.
Es ist die Frage, inwieweit für die Gesamtheit der Bürger jene >rationalen Kriterien die aus-
schlaggebenden sind, beispielsweise wenn es um die Bewertung von Migration und die In-
tegration von Ausländern geht.
Diese Arbeit setzt europäische Werte zunächst gleich mit den oben definierten >rationalen
Werten und diskutiert ihre Vereinbarkeit mit islamischen Ansätzen und Traditionen. Dennoch
bleibt die >kulturelle Dimension nicht völlig unbeachtet, wohl auch deshalb, weil der heutige
Islam eher eine >kulturelle Wertegemeinschaft darstellt; ob er Werte wie Demokratie,
25
vgl. Dewandre, Nicole / Lenoble, Jacques (Hg.): Projekt Europa. Postnationale Identität: Grundlage für eine
europäische Demokratie? Berlin 1994, S.42.
26
vgl. Mintzel, S.325f. Eine ähnlich Liste findet sich in: Tibi, Bassam: Europa ohne Identität? Die Krise der
multikulturellen Gesellschaft. München 2000, S.56.
27
vgl. Pfetsch, S.8.
10
Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechte annehmen und integrieren kann, ist eine andere
Frage.
2. Historische Beziehungen zwischen Europa und dem Islam
Um in die Diskussion um islamische und europäische Werte einzusteigen, sollten wir uns
zunächst die Geschichte der wechselseitigen Beziehungen ansehen. Denn aus dieser Ge-
schichte resultieren etliche Spannungen und Differenzen zwischen dem Islam und dem Wes-
ten. Darüber hinaus eröffnet uns die islamische Geschichte seit Mohammed bereits einen
guten ersten Einblick in das Wesen der islamischen Tradition. Interessant ist wie wir im
Folgenden sehen werden , dass wir einen quasi fließenden Übergang vorfinden von isla-
misch dominierter Geschichte über eine Phase der Gleichberechtigung mit der europäischen
Zivilisation hin zum Stadium der europäisch-westlichen Dominanz, wie sie heute noch anhält.
Dieser Verlauf soll nun dargestellt werden.
2.1 Arabische >Dominanz
Die islamische Geschichte beginnt in der Überlieferung mit einem exakten Datum: mit dem
Jahr der islamischen Offenbarung durch den Propheten Mohammed, 610 v.Chr. Zuvor hatte
es auf dem Gebiet der heutigen Arabischen Halbinsel zahlreiche Beduinenstämme gegeben,
die gegeneinander kämpften und keine ordnende Instanz über sich hatten.
29
Diese streiten-
den Stämme schließt Mohammed zur Umma zusammen, der islamischen Gemeinschaft,
welche alle rechtsgläubigen Muslime unter sich vereinigt. Insofern ist die Offenbarung »nicht
nur eine Religionsstiftung, sondern auch die Geburt einer neuen transtribalen, d.h. über die
Stämme hinaus staatlich organisierte neue Zivilisation«
30
. Mohammed verkündet seine neue
Botschaft zunächst in der Stadt Mekka dem polytheistischen arabischen Stamm der Qurai-
schis, welcher dieser neuen Religion, in der es nur einen Allah gab, äußerst misstrauisch
gegenübersteht
31
. Also stützt Mohammed sich zunächst auf einige Mitglieder seiner Familie
und näheren Umgebung, die er zu seinem neuen Glauben bekehrt
32
, bevor er aus Mekka vor
den Anfeindungen der Quraisch nach Medina fliehen muss. Doch es gelingt ihm allmählich,
andere Stämme von seiner Lehre zu überzeugen, und er errichtet in Medina schließlich jene
»bis heute vorbildliche Ordnung« der islamischen Umma. Dieses Modell einer alle Muslime
umfassenden Gemeinde gilt auch heute noch als das »vorbildliche Modell« und soll dies
auch bis in alle Zukunft tun.
33
Bis heute sehnen sich die Muslime in jene Zeit zurück, als die
28
Art. 6, Abs. 1 EUV: »Die Union beruht auf den Grundsätzen der Freiheit, der Demokratie, der Achtung der
Menschenrechte und Grundfreiheiten sowie der Rechtsstaatlichkeit; diese Grundsätze sind allen Mitgliedstaaten
gemeinsam.«
29
vgl. Tibi, Bassam: Der wahre Imam. Der Islam von Mohammed bis zur Gegenwart. München 1996, S.23, 59.
30
Der wahre Imam, S.24.
31
vgl. Der wahre Imam, S.59ff.
32
vgl. Der wahre Imam, S.72.
33
vgl. Der wahre Imam, S.59f.
11
islamische Umma noch eine echte Einheit darstellte; dementsprechend beginnt die Zeitrech-
nung der Muslime im Jahre 622
34
.
Es folgt die rasche Ausbreitung des Islams im Vorderen Orient und Nordafrika, die natür-
lich nicht nur friedlich vor sich geht, sondern »mit vielen militärischen Eroberungen und der
damit zusammenhängenden gewaltsamen Befriedung der benachbarten arabischen und
jüdischen Stämme verbunden« ist
35
. Bassam Tibi spricht in diesem 7. Jahrhundert von einer
»Pax islamica«
36
. Im Jahre 630, zwei Jahre vor dem Tod des Propheten, gelingt die gewalt-
lose Einnahme Mekkas; die islamische Umma ist auf ihrem vorläufigen Höhepunkt, aller-
dings auch dem endgültigen Höhepunkt als echte Einheit. Nach dem Tode Mohammeds 632
bricht ein Streit um seine Nachfolge aus; zwei Stämme können sich nicht einigen, welcher
den ersten Kalifen stellen soll.
37
Dies ist der erste, wenn auch noch nicht ganz eindeutige,
Bruch in der islamischen Umma. Er wird mit der ersten Fitna vollzogen sein. Zunächst aber
einigen sich die Muslime auf Abu Bakr, der ab sofort der erste Kalif in der islamischen Ge-
schichte ist. Während seiner Regierungszeit (632 bis 634) gelingt ihm die Konsolidierung der
Gemeinde nach innen. Ihm folgt Umar nach; unter ihm breitet sich der Islam weiter aus, nun
auch auf zuvor nicht-islamischem Gebiet.
38
Umars Regentschaft war ein erster Glanzpunkt in
der islamischen Geschichte; »er war nicht nur in der Lage, die Einheit zu bewahren, er schuf
auch die Anfänge eines funktionierenden imperialen Regierungssystems«.
39
Die Zeit von
Abu Bakr und Umar (bis 644) ist auch militärisch eine Geschichte des Aufbaus: Es entsteht
eine reguläre Armee, welche das Potential besitzt, die bisherigen Großmächte, das persi-
sche Sassaniden-Reich und Byzanz, herauszufordern; gleichzeitig gilt Umar als der Begrün-
der des islamischen Imperiums
40
.
Unter Umars Nachfolger Uthman setzen sich die Eroberungen fort, bald sind Syrien und
Ägypten im Westen und der Irak und große Teile des Irans im Osten in muslimischer Hand.
41
Doch gleichzeitig machen sich erste Anzeichen von Korruption und Vetternwirtschaft be-
merkbar, die auch der Bevölkerung auf lange Sicht nicht verborgen bleiben können. Demzu-
folge kommt es zu einer Revolte gegen den Kalifen. Er wird 656 von Muslimen ermordet und
Ali wird zu seinem Nachfolger ausgerufen.
42
Dieses Datum bezeichnet den Beginn der gro-
ßen Fitna im Islam. Das Problem nämlich bei der Ermordung Uthmans war, dass er durch
die Hand gläubiger Muslime gestorben war, was dem Gesetz des Koran widerspricht, nach
dem Muslime sich gegenseitig nicht töten dürfen. Hier war aber genau dies der Fall: die Auf-
34
vgl. Der wahr Imam, S.101.
35
Der wahre Imam, S.60.
36
Der wahre Imam, S.104.
37
vgl. Der wahre Imam, S.62.
38
vgl. Der wahre Imam, S. 62f., 67ff.
39
Lewis, Bernard: Stern, Kreuz und Halbmond. 2000 Jahre Geschichte des Nahen Ostens. München 1997, S.85.
40
vgl. Der wahre Imam, S.63, 68.
41
vgl. Stern, Kreuz und Halbmond, S.86.
42
vgl. Der wahre Imam, S.68f. Sowie: Stern, Kreuz und Halbmond, S.86.
12
ständischen hatten dem Kalifen die Legitimität abgesprochen, eine Tat, die nicht hätte statt-
finden dürfen, denn der islamischen Überlieferung zufolge ist der Kalif der Imam, d.h. der
Führer der islamischen Umma, der direkte Nachfolger Mohammeds, dessen Autorität von
Gott kommt und deshalb nicht in Frage gestellt werden darf.
43
»Mit jener Tat«, so führt Hi-
cham Djaït aus, »war der erste Akt der Spaltung der islamischen Umma vollzogen, eine
Spaltung, die nicht mehr behoben werden kann«.
44
Das Ende der Fitna fällt auf das Jahr
661, jenes Jahr, in dem auch Kalif Ali ermordet wird; was bleibt, ist eine Spaltung der islami-
schen Umma, die »für den Rest der islamischen Geschichte nicht mehr zu kitten ist«.
45
Bas-
sam Tibi weist darauf hin, dass hierin das große Thema der islamischen Zivilisation liegt: Seit
dem Tod Mohammeds streiten die Muslime darüber, wer sein Nachfolger, wer der >wahre
Imam sei. Die Streitigkeiten gipfeln in der koranwidrigen Ermordung zweier Imame und dau-
ern seitdem an: »Die Suche beginnt im Früh-Islam mit dem Tod des Propheten im Jahre
632, wird im Mittelalter fortgesetzt und reicht bis in unsere Gegenwart«.
46
Die >Große Fitna
»ist der Beginn und die Verkörperung der Symbolik des gewaltsamen innerislamischen Kamp-
fes um die Macht zur Bestimmung des Imam. Er dauert bis heute an. Auch in unserer Gegen-
wart wird der Machtkampf niemals politisch, sondern stets religiös begründet«
47
.
Im Jahre 661 bedeutet es, dass die islamische Gemeinde von nun an »von heftigen Mei-
nungsverschiedenheiten gespalten« und der Staat des Propheten Mohammeds entgültig
zerbrochen ist. Der Streit ist bezeichnenderweise nicht zwischen Arabern und Fremden oder
ihren Feinden ausgebrochen, sondern zwischen Muslimen, eine Tatsache, die dem Konzept
der allumfassenden islamischen Umma fundamental widerspricht.
48
Das Jahr 661 besiegelt dann die erste Phase in der islamischen Geschichte, die der recht-
geleiteten Kalifen. Im selben Jahr reißt Mu'awiyya die Herrschaft an sich und begründet da-
mit die Dynastie der Umaiyyaden. Ihm folgen Yazid und Marwan nach, wobei es unter letzte-
rem zur zweiten Fitna kommt, die im Kampf des Umaiyyaden-Kalifats in Syrien gegen Ibn
Zubair, der sich im arabischen Hidjaz zum Gegenkalifen ausgerufen hatte, einerseits und Ibn
al-Hanafiyya, einem Sohn Alis, der im Irak zum Kalifen ausgerufen worden war, andererseits
besteht.
49
Auch diese Fitna, die von 683 bis 690 dauert, ist »kein abgeschlossenes histori-
sches Ereignis«
50
. Sie findet gleichwohl ihr Ende, als die beiden Herausforderer niederge-
schlagen werden und mit ihrem Anhängern den Tod finden.
51
Die Dynastie der Umaiyyaden, die »nicht mal ein Jahrhundert« überdauert, wird oftmals als
Zwischenspiel betrachtet, in dem die islamische Geschichte »vom rechten Weg« abgekom-
43
vgl. Der wahre Imam, S.65, 69.
44
Zitiert nach: Der wahre Imam, S.73.
45
vgl. Der wahre Imam, S.79.
46
vgl. Der wahre Imam, S.23, 54.
47
Der wahre Imam, S.30.
48
vgl. Stern, Kreuz und Halbmond, S.84.
49
vgl. Der wahre Imam, S.79ff.
50
Der wahre Imam, S.70.
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Originalausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2001
- ISBN (eBook)
- 9783832448431
- ISBN (Paperback)
- 9783838648439
- Dateigröße
- 778 KB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- Universität Passau – Politikwissenschaften
- Note
- 1,0
- Schlagworte
- islam kultur europa westen verwestlichung
- Produktsicherheit
- Diplom.de