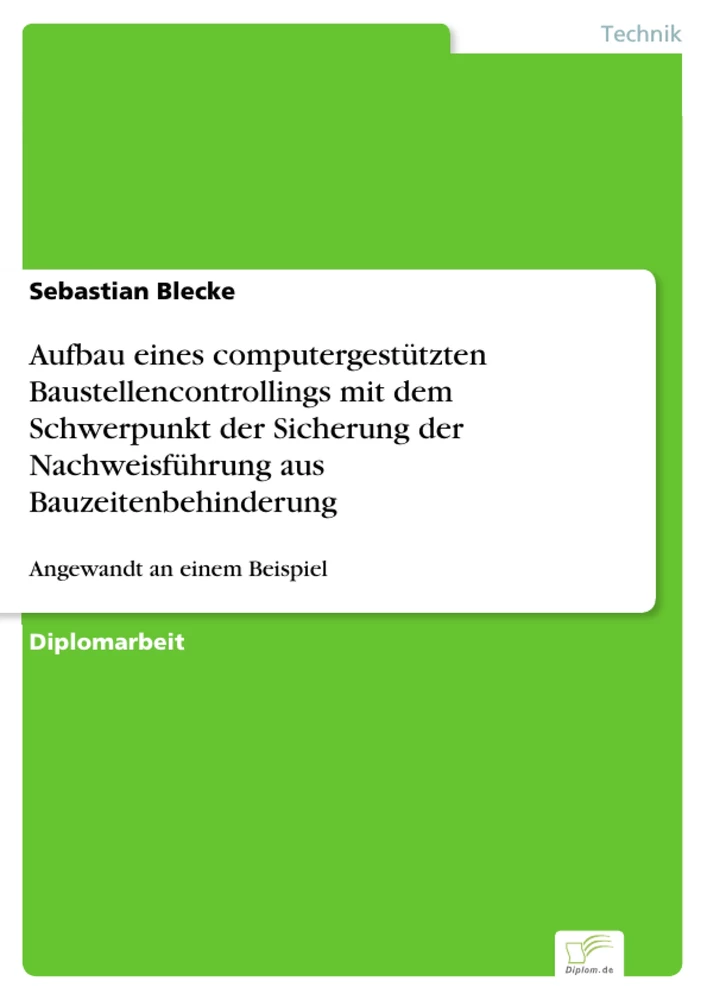Aufbau eines computergestützten Baustellencontrollings mit dem Schwerpunkt der Sicherung der Nachweisführung aus Bauzeitenbehinderung
Angewandt an einem Beispiel
©2001
Diplomarbeit
172 Seiten
Zusammenfassung
Inhaltsangabe:Gang der Untersuchung:
Die Arbeit beschäftigt sich zunächst mit dem Begriff der Kosten-Leistungsrechnung. Hier werden kurz die wichtigsten Begriffe der Kostenrechnung erläutert, da sie im weiteren Verlauf dieser Arbeit die Grundlage für das Verständnis der Zusammenhänge darstellen. Im nächsten Schritt soll die Aufgabe der Arbeitsvorbereitung erläutert werden, bevor der wichtige Aspekt der Bauzeit und abschließend das Baustellencontrolling selbst näher betrachtet werden. Diese Gliederung soll den allgemeinen Teil der Diplomarbeit abschließen.
Im weiteren Verlauf wird auf die konkrete Baumaßnahme eingegangen. Es erfolgt eine Vorstellung der Baustelle und der Bauvertragspartner, sowie eine kurze Beschreibung des Bauvertrages. Des weiteren wird die bestehende Baustellendokumentation beschrieben, bevor diese vom Verfasser beurteilt wird. Als Resultat dieser Bewertung, wird in den folgenden Gliederungspunkten auf die Grundzüge und Funktionsweise des zu entwickelnden Baustellencontrollings eingegangen. Zudem wird ein Verfahren zur Erfassung der monetären Folgen infolge von Bauverzögerungen vorgestellt, welches auch ein Bestandteil des Baustellencontrollings darstellt. Zuletzt wird in einer Bewertung der erarbeiteten Ergebnisse, einer Zusammenfassung und in einem Ausblick auf die weitere Handhabung der gegebenen Problematik die Diplomarbeit abgeschlossen.
Die Darstellung der einzelnen EDV-Controlling-Module sowie die Ergebnisdarstellung des Nachweisverfahrens zur Bewertung der monetären Folgen ist in dieser Diplomarbeit nur schwer in Papierform darzustellen. Lediglich die wichtigsten Elemente sind als Bildschirmansichten in diese Arbeit eingefügt. Die genauen Programmstrukturen und Entwicklungen der Ergebnisse sind der beiliegenden CD-ROM zu entnehmen.
Inhaltsverzeichnis:Inhaltsverzeichnis:
1.Einleitung7
1.1Einführung7
1.2Zielsetzung8
1.3Aufbau der Arbeit9
2.Kosten im Baubetrieb11
2.1Kosten-Leistungsrechnung12
2.1.1Bauauftragsrechnung12
2.1.2Baubetriebsrechnung13
2.2Arbeitsvorbereitung15
3.Begriff der Bauzeit17
3.1Bedeutung der Bauzeit17
3.1.1Rechtliche Bedeutung der Bauzeit18
3.1.2Baubetriebliche Bedeutung der Bauzeit19
3.2Bedeutung der Bauzeit aus der Sicht der Vertragsparteien20
3.2.1Die Bedeutung der Bauzeit für den Auftraggeber20
3.2.2Die Bedeutung der Bauzeit für den Auftragnehmer20
3.3Der Bauzeitenplan21
3.4Gestörter Bauablauf22
3.4.1Ursachen für Bauverzögerungen23
3.4.2Rechtliche Folgen aus […]
Die Arbeit beschäftigt sich zunächst mit dem Begriff der Kosten-Leistungsrechnung. Hier werden kurz die wichtigsten Begriffe der Kostenrechnung erläutert, da sie im weiteren Verlauf dieser Arbeit die Grundlage für das Verständnis der Zusammenhänge darstellen. Im nächsten Schritt soll die Aufgabe der Arbeitsvorbereitung erläutert werden, bevor der wichtige Aspekt der Bauzeit und abschließend das Baustellencontrolling selbst näher betrachtet werden. Diese Gliederung soll den allgemeinen Teil der Diplomarbeit abschließen.
Im weiteren Verlauf wird auf die konkrete Baumaßnahme eingegangen. Es erfolgt eine Vorstellung der Baustelle und der Bauvertragspartner, sowie eine kurze Beschreibung des Bauvertrages. Des weiteren wird die bestehende Baustellendokumentation beschrieben, bevor diese vom Verfasser beurteilt wird. Als Resultat dieser Bewertung, wird in den folgenden Gliederungspunkten auf die Grundzüge und Funktionsweise des zu entwickelnden Baustellencontrollings eingegangen. Zudem wird ein Verfahren zur Erfassung der monetären Folgen infolge von Bauverzögerungen vorgestellt, welches auch ein Bestandteil des Baustellencontrollings darstellt. Zuletzt wird in einer Bewertung der erarbeiteten Ergebnisse, einer Zusammenfassung und in einem Ausblick auf die weitere Handhabung der gegebenen Problematik die Diplomarbeit abgeschlossen.
Die Darstellung der einzelnen EDV-Controlling-Module sowie die Ergebnisdarstellung des Nachweisverfahrens zur Bewertung der monetären Folgen ist in dieser Diplomarbeit nur schwer in Papierform darzustellen. Lediglich die wichtigsten Elemente sind als Bildschirmansichten in diese Arbeit eingefügt. Die genauen Programmstrukturen und Entwicklungen der Ergebnisse sind der beiliegenden CD-ROM zu entnehmen.
Inhaltsverzeichnis:Inhaltsverzeichnis:
1.Einleitung7
1.1Einführung7
1.2Zielsetzung8
1.3Aufbau der Arbeit9
2.Kosten im Baubetrieb11
2.1Kosten-Leistungsrechnung12
2.1.1Bauauftragsrechnung12
2.1.2Baubetriebsrechnung13
2.2Arbeitsvorbereitung15
3.Begriff der Bauzeit17
3.1Bedeutung der Bauzeit17
3.1.1Rechtliche Bedeutung der Bauzeit18
3.1.2Baubetriebliche Bedeutung der Bauzeit19
3.2Bedeutung der Bauzeit aus der Sicht der Vertragsparteien20
3.2.1Die Bedeutung der Bauzeit für den Auftraggeber20
3.2.2Die Bedeutung der Bauzeit für den Auftragnehmer20
3.3Der Bauzeitenplan21
3.4Gestörter Bauablauf22
3.4.1Ursachen für Bauverzögerungen23
3.4.2Rechtliche Folgen aus […]
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
ID 4820
Blecke, Sebastian: Aufbau eines computergestützten Baustellencontrollings mit dem
Schwerpunkt der Sicherung der Nachweisführung aus Bauzeitenbehinderung: Angewandt an
einem Beispiel / Sebastian Blecke - Hamburg: Diplomica GmbH, 2001
Zugl.: Berlin, Technische Fachhochschule, Diplom, 2001
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte, insbesondere die
der Übersetzung, des Nachdrucks, des Vortrags, der Entnahme von Abbildungen und Tabellen,
der Funksendung, der Mikroverfilmung oder der Vervielfältigung auf anderen Wegen und der
Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen, bleiben, auch bei nur auszugsweiser Verwertung,
vorbehalten. Eine Vervielfältigung dieses Werkes oder von Teilen dieses Werkes ist auch im
Einzelfall nur in den Grenzen der gesetzlichen Bestimmungen des Urheberrechtsgesetzes der
Bundesrepublik Deutschland in der jeweils geltenden Fassung zulässig. Sie ist grundsätzlich
vergütungspflichtig. Zuwiderhandlungen unterliegen den Strafbestimmungen des
Urheberrechtes.
Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in diesem
Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme, dass solche
Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei zu betrachten
wären und daher von jedermann benutzt werden dürften.
Die Informationen in diesem Werk wurden mit Sorgfalt erarbeitet. Dennoch können Fehler nicht
vollständig ausgeschlossen werden, und die Diplomarbeiten Agentur, die Autoren oder
Übersetzer übernehmen keine juristische Verantwortung oder irgendeine Haftung für evtl.
verbliebene fehlerhafte Angaben und deren Folgen.
Diplomica GmbH
http://www.diplom.de, Hamburg 2001
Printed in Germany
Wissensquellen gewinnbringend nutzen
Qualität, Praxisrelevanz und Aktualität zeichnen unsere Studien aus. Wir
bieten Ihnen im Auftrag unserer Autorinnen und Autoren Wirtschafts-
studien und wissenschaftliche Abschlussarbeiten Dissertationen,
Diplomarbeiten, Magisterarbeiten, Staatsexamensarbeiten und Studien-
arbeiten zum Kauf. Sie wurden an deutschen Universitäten, Fachhoch-
schulen, Akademien oder vergleichbaren Institutionen der Europäischen
Union geschrieben. Der Notendurchschnitt liegt bei 1,5.
Wettbewerbsvorteile verschaffen Vergleichen Sie den Preis unserer
Studien mit den Honoraren externer Berater. Um dieses Wissen selbst
zusammenzutragen, müssten Sie viel Zeit und Geld aufbringen.
http://www.diplom.de bietet Ihnen unser vollständiges Lieferprogramm
mit mehreren tausend Studien im Internet. Neben dem Online-Katalog und
der Online-Suchmaschine für Ihre Recherche steht Ihnen auch eine Online-
Bestellfunktion zur Verfügung. Inhaltliche Zusammenfassungen und
Inhaltsverzeichnisse zu jeder Studie sind im Internet einsehbar.
Individueller Service
Gerne senden wir Ihnen auch unseren Papier-
katalog zu. Bitte fordern Sie Ihr individuelles Exemplar bei uns an. Für
Fragen, Anregungen und individuelle Anfragen stehen wir Ihnen gerne zur
Verfügung. Wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit.
Ihr Team der Diplomarbeiten Agentur
Einführung
Inhaltsverzeichnis
1
Einleitung ...7
1.1
Einführung ...7
1.2
Zielsetzung ...8
1.3
Aufbau der Arbeit...9
2
Kosten im Baubetrieb...11
2.1
Kosten-Leistungsrechnung ...12
2.1.1
Bauauftragsrechnung ...12
2.1.2
Baubetriebsrechnung ...13
2.2
Arbeitsvorbereitung...15
3
Begriff der Bauzeit...17
3.1
Bedeutung der Bauzeit ...17
3.1.1
Rechtliche Bedeutung der Bauzeit ...18
3.1.2
Baubetriebliche Bedeutung der Bauzeit ...19
3.2
Bedeutung der Bauzeit aus der Sicht der Vertragsparteien...20
3.2.1
Die Bedeutung der Bauzeit für den Auftraggeber ...20
3.2.2
Die Bedeutung der Bauzeit für den Auftragnehmer ...20
3.3
Der Bauzeitenplan ...21
3.4
Gestörter Bauablauf...22
3.4.1
Ursachen für Bauverzögerungen...23
3.4.2
Rechtliche Folgen aus Bauverzögerungen ...24
4
Baustellencontrolling ...27
4.1
Definition des Begriffs Baustellencontrolling...27
5
Die Baumaßnahme ...31
5.1
Historie ...31
5.2
Das Bauvorhaben ...32
5.2.1
Herstellung von Stahlbetonbodenplatten...32
5.2.2
Erneuerung von Kellerdecken in Teilbereichen ...33
5.2.3
Verstärkung von Deckensystemen durch Spritzbeton ...33
- 1 -
Einführung
5.2.4
Verstärkung von Wänden und Stützen ...34
5.3
Die Vertragsparteien...34
5.3.1
Der Bauherr ...34
5.3.2
Der Auftragnehmer ...34
5.4
Vertragsunterlagen ...35
5.4.1
Allgemeines ...36
5.4.2
Vertragsbedingungen ...36
5.5
Auftretende Störungen auf der Baustelle...37
5.5.1
Behinderungen ...38
5.5.2
Unterbrechungen...41
5.5.3
Umstellen des Bauablaufes ...42
6
Instrumente der Baustellendokumentation...44
6.1
Vorstellen der vorhandenen Baustellendokumentation...44
6.1.1
Bautagebuch ...45
6.1.2
Fotodokumentation...45
6.1.3
Planeingansverzeichnis ...45
6.1.4
Schriftverkehr ...46
6.1.5
Protokolle...46
6.2
Bewertung der vorhandenen Baustellendokumentation ...47
6.2.1
Bautagebuch ...47
6.2.2
Fotodokumentation...48
6.2.3
Planeingangsverzeichnis ...48
6.2.4
Schriftverkehr ...49
6.2.5
Protokolle...50
6.3
Vorstellen des computergestützten Baustellencontrollings...51
6.3.1
Grundüberlegungen zum Entwurf eines computergestützten
Baustellencontrollings...51
6.3.2
Bearbeitungstiefe...52
6.3.3
Vorstellen der einzelnen Module des Baustellencontrollings ...53
7
System zur Bewertung von Behinderungen aus § 6 VOB/B ...92
7.1
Berechnungsverfahren von Pawlik ...93
7.1.1
Voruntersuchung ...93
- 2 -
Einführung
7.1.2
Hauptuntersuchung ...94
7.2
Anwendung des Verfahrens am konkreten Beispiel ...96
7.2.1
Behinderungsursachen...97
7.2.2
Berechnung der Soll-Umsätze pro Arbeitstag der Baustelle...97
7.2.3
Berechnung der Ist-Umsätze pro Arbeitstag...99
7.2.4
Bestimmung der gesamten Ist-Verzögerung ...100
7.2.5
Ermittlung des tatsächlichen Mittellohns...102
7.2.6
Ermittlung der zusätzlichen Lohnkosten aus Behinderung ...104
7.2.7
Berechnung der Behinderungskosten aus Vorhaltekosten ...111
7.2.8
Behinderungskosten aus Veränderung der Kosten der
örtlichen Bauleitung ...113
7.2.9
Ermittlung der Veränderung der Allgemeinen
Geschäftskosten infolge AG-seitiger Behinderung ...115
7.2.10
Kritische Punkte und Bewertung des vorgestellten
Verfahrens ...118
8
Zusammenfassung...122
8.1
Zusammenfassung ...122
9
Ausblick...125
9.1
Ausblick ...125
10 Literaturverzeichnis ...126
11 Anlagen ...129
11.1
Anlage A: Bauvertragsunterlagen ...129
11.2
Anlage B: Bauablaufpläne...146
11.3
Anlage C: Baustellendokumentation ...150
11.4
Anlage D: Struktur des computergestützten Baustellencontrol-
lings... .............................................................................................155
11.5
Anlage E: relevante Behinderungsschreiben ...162
11.6
Anlage F: Kalkulationsschlussblatt...168
- 3 -
Einführung
Abbildungsverzeichnis
Abbildung 1: Arten der Kalkulation...13
Abbildung 2: Vorgaben für die Arbeitskalkulation...16
Abbildung 3: Controlling-Dreieck...28
Abbildung 4: Anforderungen an Dokumentationssysteme ...29
Abbildung 5: Übersichtsplan Bauvorhaben Staatsbibliothek ...35
Abbildung 6: geplanter Baufortschritt (nur BT D/E bis U/L) ...42
Abbildung 7: tatsächlicher Baufortschritt (nur BT D/E bis U/L)...43
Abbildung 8: Aufbau des Hauptmenüs im Baustellencontrolling in ,,MS
Access" ...54
Abbildung 9: Datenblatt zur Erstellung von Briefen bei Behinderung nach §
6 VOB/B aus Baustellencontrolling unter ,,MS Access" ...56
Abbildung 10: Behinderungsanzeige in ,,MS Word" als Resultat der
Formulareingabe in ,,MS Access" ...58
Abbildung 11: Behinderungsaufhebung in ,,MS Word" als Resultat der
Formulareingabe in ,,MS Access" ...59
Abbildung 12: Datenblatt zur Erstellung von Briefen bei geändertem
Bauentwurf nach § 2, Nr. 5 VOB/B aus Baustellencontrolling
unter ,,MS Access"...61
Abbildung 13: Anzeige zum geänderten Bauentwurf in ,,MS Word" als
Resultat der Formulareingabe in ,,MS Access"...63
Abbildung 14: Datenblatt zur Erstellung von Briefen bei zusätzlicher
Leistung nach § 2, Nr. 6 VOB/B aus Baustellencontrolling mit
,,MS Access"...65
Abbildung 15: Anzeige zum geänderten Bauentwurf in ,,MS Word" als
Resultat der Formulareingabe in ,,MS Access"...67
Abbildung 16: Datenblatt zur Erstellung von Anmeldung von Bedenken
nach § 3, Nr. 3 VOB/B und § 4, Nr. 1 und 3 VOB/B aus
Baustellencontrolling unter ,,MS Access"...68
Abbildung 17: Anmeldung von Bedenken in ,,MS Word" als Resultat der
Formulareingabe in ,,MS Access" ...70
- 4 -
Einführung
Abbildung 18: Formular zur Erfassung der täglichen Arbeitszeiten in ,,MS
Access" ...73
Abbildung 19: Diagramm zur grafischen Darstellung der Anzahl der
Arbeitnehmer über die Zeit (quartalsweise) in ,,MS Access"
(analog der Stundenverteilung) ...74
Abbildung 20: Formular für die Eingabe der Bautagebucheinträge in ,,MS
Access" ...77
Abbildung 21: Ansicht der Bautagesberichte in der Berichtsansicht zur
Vorlage beim Auftraggeber in ,,MS Access" ...78
Abbildung 22: Ansicht des Abrechnungsdatenblattes / Hauptdatenblattes
zur weiteren Erstellung von Abschlagsrechnungen in ,,MS
Access" ...80
Abbildung 23: Darstellung eines Abrechnungsformulars (hier 3.
Abschlagsrechnung) in ,,MS Access" ...81
Abbildung 24: Struktur-Darstellung des Abrechnungsmoduls ...82
Abbildung 25: Darstellung des Abschlagrechnungsformulars mit dem
Registerblatt ,,intern" im Vordergrund mit ,,MS Access" ...85
Abbildung 26: Stundenerfassungszettel für die Ermittlung der
Arbeitsstundenverteilung...88
Abbildung 27: Formular zur Eingabe der Planeingangsdaten in ,,MS
Access" ...90
Abbildung 28: Bildschirmansicht zur Bearbeitung der Daten für die
Ermittlung der Soll-Umsätze pro Arbeitstag in ,,MS Access" ...98
Abbildung 29: Ermittlung der Ist-Umsätze pro Arbeitstag auf der Grundlage
der Abschlagsrechnungen in ,,MS Access" ...100
Abbildung 30: Ermittlung der gesamten Ist-Verzögerung in DM bzw. Euro
in ,,MS Access" ...101
Abbildung 31: Ermittlung des Ist-Mittellohns mit ,,MS Access" ...103
Abbildung 32: Ermittlung der zusätzlich entstandenen Lohnkosten infolge
AG-seitiger Behinderung...110
Abbildung 33: Ermittlung der Behinderungskosten aus Abschreibung und
Verzinsung in ,,MS Access" ...112
- 5 -
Einführung
Abbildung 34: Ermittlung der Behinderungskosten aus Kosten der
örtlichen Bauleitung in ,,MS Access"...114
Abbildung 35: Zusammenstellung der Kostenanteile für die Ermittlung der
Behinderungskosten mit Berücksichtigung der AGK-
Berechnung in ,,MS Access"...117
Abbildung 36: Darstellung der Zusammenhänge des computergestützten
Baustellencontrollings ...123
- 6 -
Einführung
I. TEIL
1 Einleitung
1.1 Einführung
Vor der Durchführung einer Baumaßnahme wird zwischen Auftraggeber und
Auftragnehmer ein Vertrag geschlossen, der die gegenseitigen Leistungsver-
pflichtungen regelt. Hierzu gehören neben der Verpflichtung der ordnungsge-
mäßen Herstellung eines Bauwerkes und der korrespondierenden Vergütung
vor allem der zeitliche Rahmen, in der die Leistung vom Auftragnehmer er-
bracht werden soll. In den letzten Jahren sind verstärkt streitige Auseinander-
setzungen zwischen den Bauvertragsparteien über Ansprüche aus Leistungs-
änderungen und Bauzeitbehinderungen zu beobachten. Die Ursachen hierfür
liegen zum einen an den schlechteren konjunkturellen Verhältnissen, zum an-
deren aber vor allem an den verfeinerten Bauablaufplanungen, die in den letz-
ten Jahren durch den Einsatz von moderner Netzplansoftware optimiert wer-
den konnten. Die Bauzeiten konnten dadurch erheblich verkürzt werden, was
zur Folge hat, dass viele Bauabläufe auf dem sogenannten ,,kritischen Weg"
liegen. Die Flexibilität der Kosten gegenüber auftretenden Störungen ist auf-
grund dieser detaillierteren Bauzeitplanung stark eingeschränkt. Dies hat zur
Folge, dass nahezu jede Einwirkung auf die geplante Bauzeit zusätzliche Kos-
ten verursacht.
Eine Baufirma muss daher Kontrollmechanismen zum Einsatz bringen, die
rasche Ergebnisse im Sinne eines Soll-Ist-Vergleiches liefern, um schnell ge-
eignete Gegenmaßnahmen einleiten zu können. Dies ist die Aufgabe des
Baustellencontrollings. Das Baustellencontrolling stellt damit sozusagen das
,,Navigationssystem" für die Baustelle dar, um jederzeit die Position und den
Kurs des Baufortschrittes bestimmen zu können. Ein solches Controlling kann
- 7 -
Zielsetzung
jedoch nur dann zum Erfolg führen, wenn eine lückenlose Dokumentation
sämtlicher Vorgänge und Geschehnisse durchgeführt wird, damit im Nachhi-
nein eine genaue Ursachenzuweisung für die vom Soll-Ablauf abweichenden
Vorgänge dem Bauherrn gegenüber erfolgen kann.
1.2 Zielsetzung
Ein solches computergestütztes Baustellencontrolling zu entwickeln ist Ziel
dieser Arbeit. Hierbei soll im Besonderen der Einfluss von Bauzeitverzögerun-
gen an einem konkreten Beispiel berücksichtigt werden. Es soll ein Nachweis-
und Dokumentationssystem mittels EDV-Einsatz entstehen, welches transpa-
rent die Ursachen für die aus Bauzeitbehinderungen entstehenden Mehrkos-
ten festhält. Da die Bearbeitung für sämtliche am Bau beteiligten Gewerke zu
umfangreich wäre, wird im Rahmen dieser Arbeit nur ein Gewerk (Beton- und
Stahlbetonarbeiten) exemplarisch in dieser Hinsicht untersucht.
- 8 -
Aufbau der Arbeit
1.3 Aufbau der Arbeit
Die Arbeit beschäftigt sich zunächst mit dem Begriff der Kosten-
Leistungsrechnung. Hier werden kurz die wichtigsten Begriffe der Kostenrech-
nung erläutert, da sie im weiteren Verlauf dieser Arbeit die Grundlage für das
Verständnis der Zusammenhänge darstellen. Im nächsten Schritt soll die Auf-
gabe der Arbeitsvorbereitung erläutert werden, bevor der wichtige Aspekt der
Bauzeit und abschließend das Baustellencontrolling selbst näher betrachtet
werden. Diese Gliederung soll den allgemeinen Teil der Diplomarbeit ab-
schließen. Im weiteren Verlauf wird auf die konkrete Baumaßnahme einge-
gangen. Es erfolgt eine Vorstellung der Baustelle und der Bauvertragspartner,
sowie eine kurze Beschreibung des Bauvertrages. Des weiteren wird die be-
stehende Baustellendokumentation beschrieben, bevor diese vom Verfasser
beurteilt wird. Als Resultat dieser Bewertung, wird in den folgenden Gliede-
rungspunkten auf die Grundzüge und Funktionsweise des zu entwickelnden
Baustellencontrollings eingegangen. Zudem wird ein Verfahren zur Erfassung
der monetären Folgen infolge von Bauverzögerungen vorgestellt, welches
auch ein Bestandteil des Baustellencontrollings darstellt. Zuletzt wird in einer
Bewertung der erarbeiteten Ergebnisse, einer Zusammenfassung und in ei-
nem Ausblick auf die weitere Handhabung der gegebenen Problematik die
Diplomarbeit abgeschlossen.
Die Darstellung der einzelnen EDV-Controlling-Module sowie die Ergebnisdar-
stellung des Nachweisverfahrens zur Bewertung der monetären Folgen ist in
dieser Diplomarbeit nur schwer in Papierform darzustellen. Lediglich die wich-
tigsten Elemente sind als Bildschirmansichten in diese Arbeit eingefügt. Die
genauen Programmstrukturen und Entwicklungen der Ergebnisse sind der bei-
liegenden CD-ROM zu entnehmen. Dieses Symbol
weist den Leser
auf die Betrachtung des jeweiligen Moduls auf der CD-ROM hin.
i
l
l
Systemvoraussetzungen:
Optimiert für: ,,MS Access 2000" und ,,MS Word 2000"
Mind. 64 MB Arbeitsspeicher
- 9 -
Aufbau der Arbeit
Mind. Pentium II-Prozessor mit 350 MHz
Es wird empfohlen, die Daten des beiliegenden Datenträgers auf die Festplat-
te zu kopieren, um die Zugriffszeiten zu beschleunigen.
- 10 -
Aufbau der Arbeit
2 Kosten im Baubetrieb
Auf den Baustellen wird für jede Ursache, die mit finanziellen Ausgaben für
den Auftragnehmer verbunden ist im allgemeinen von Kosten gesprochen.
Aus der betriebswirtschaftlichen Sicht ist die Verwendung des Begriffes Kos-
ten so jedoch nicht richtig. Betriebswirte definieren den Begriff wie folgt: Kos-
ten sind der wertmäßige, betriebsnotwendige Normalverbrauch an Gütern und
Leistung zur Erstellung eines Betriebsproduktes.
1
Auf den Bauunternehmer bezogen, bedeutet ferner der Begriff ,,Güter" die
Menge an z. B. Schalung, Beton, Wasser, Einbauteile oder Zeiten, z. B. Lohn-
stunden, Gerätestunden, etc. Damit nun diese Güter Kosten darstellen, müs-
sen sie noch mit einem Wert multipliziert werden (z. B. DM/m² oder DM/Std.).
Kosten = Mengen
oder Zeit x
Wert
Den Kosten steht das Ergebnis des betrieblichen Geschehens, die Leistung,
gegenüber. Dies sind also z. B. erstellte Bauwerke. Eine Leistung ist immer
die Vorrausetzung für das Entstehen von Kosten.
2
Bei dem Gegenüberstellen
von Kosten und Leistung, spricht man von der Kosten-Leistungsrechnung
(KLR).
1
vgl. Woll, S. 415
2
vgl. Lang, S. 22.
- 11 -
Kosten-Leistungsrechnung
2.1 Kosten-Leistungsrechnung
Die Kosten-Leistungsrechnung ist die Voraussetzung zur Schaffung firmenin-
ternen Unterlagen, die zur Kontrolle und Steuerung des betrieblichen Gesche-
hens sowie zur Preisermittlung dienen. Sie besteht aus der:
Bauauftragsrechnung
Baubetriebsrechnung
Im Folgenden werden diese beiden Punkte näher betrachtet.
3
2.1.1 Bauauftragsrechnung
Die Bauauftragsrechnung befasst sich mit der Ermittlung der Kosten für eine
Baumaßnahme. Dabei dient die Bauauftragsrechnung der Preisgestaltung, der
Verfahrenswahl, der Kostenvorgabe und der Kostenkontrolle. D. h. sie verfolgt
die Kostenentwicklung von den kalkulierten Kosten aus der Angebotserstel-
lung über die nach der Auftragserteilung und vor allem während der Bauaus-
führung immer präziser werdenden tatsächlichen Kosten, bis hin zu den effek-
tiven Ist-Kosten am Bauende. Je nach Zeitpunkt und Verwendungszweck un-
terscheidet man folgende Kalkulationen:
3
vgl. Lang, S. 22 23.
- 12 -
Kosten-Leistungsrechnung
Abbildung 1: Arten der Kalkulation
4
2.1.2 Baubetriebsrechnung
Die Baubetriebsrechnung dient dazu, alle innerbetrieblichen Wertbewegungen
getrennt nach Kostenarten und Kostenstellen festzuhalten. Sie soll feststellen,
ob das wirtschaftliche Ergebnis einer Baumaßnahme oder eines Betriebsteils
entsprechend den geplanten Werten erreicht werden kann und wird je nach
Bedarf monatlich, quartalsweise oder jährlich durchgeführt. Sind die Abrech-
nungsperioden kleiner als ein Jahr, spricht man auch von kurzfristigen
Ergebnisrechnungen. Je kleiner die Abrechnungszeiträume gewählt werden,
desto eher können mögliche Verlustquellen erkannt werden. Daher sollte in
der Praxis eine monatliche Ergebnisfeststellung angestrebt werden.
Um zum Ergebnis der Baubetriebsrechnung zu gelangen, müssen die Leis-
tungen den Kosten gegenübergestellt werden. Daher wird ein Teil der Baube-
triebsrechnung auch als Leistungsrechnung bezeichnet, welche zur Feststel-
lung des Wertes der erbrachten Bauleistung dient. Hierbei wird unterschieden
4
aus: Brecheler/Friedrich/Hilmer/Weiß, S.14.
- 13 -
Kosten-Leistungsrechnung
zwischen der Rechnungsstellung an den Auftraggeber und der internen Leis-
tungsermittlung.
Bei der Rechnungsstellung an den Auftraggeber wird die jeweilige erbrachte
Leistung (belegt durch Aufmasse) mit dem dazugehörigen Einheitspreis mul-
tipliziert. Somit ergibt sich der Rechnungsbetrag.
Bei der internen Auswertung der Leistung müssen alle Einflüsse, die zur Ent-
stehung von Kosten beitragen erfasst werden; also auch teilfertige Leistungen,
die dem Bauherrn noch nicht in Rechnung gestellt werden können. Als Grund-
lage für die Ermittlung der Kosten zum Stichtag dient nicht wie bei der Rech-
nungslegung an den Auftraggeber die Auftragskalkulation, sondern die Ar-
beitskalkulation.
Durch die stichtagsbezogenen Leistungsmeldungen an die Geschäftsleitung,
können frühzeitig wichtige Erkenntnisse über den Erfolg einer Baumaßnahme
gewonnen werden. Durch einen Soll-Ist-Vergleich auf der Grundlage der Ar-
beitskalkulation, können Schwachstellen in der Kalkulation ausfindig gemacht
werden und geeignete Gegenmaßnahmen eingeleitet werden. Die Vorausset-
zung für diese Vergleiche ist jedoch eine ständig auf dem neusten Stand ge-
brachte Arbeitskalkulation.
Die Kosten-Leistungsrechnung stellt mit den o. g. Merkmalen im Grunde ein
Controlling-Verfahren dar, was es der Bauunternehmung erlaubt, die aktuel-
len, stichtagsbezogenen Leistungsstände zu beurteilen. Die grundsätzlichen
Inhalte und Merkmale der Kosten-Leistungsrechnung werden später im Ab-
schnitt ,,Baustellencontrolling" weiter verfolgt.
- 14 -
Arbeitsvorbereitung
2.2 Arbeitsvorbereitung
Damit die Kosten im Rahmen einer Baumaßnahme genauer im Vorfeld be-
stimmt werden können, erarbeitet die Arbeitsvorbereitung detaillierte Vorga-
ben, die sich vor allem in der Arbeitskalkulation wiederfinden. Der genaue
Zeitpunkt des Beginns der Arbeitsvorbereitung ist nur schwer festzulegen. Im
Grunde genommen wird Arbeitsvorbereitung immer betrieben.
5
Bereits in der
Phase der Angebotsbearbeitung wird die Arbeitsvorbereitung oftmals mit hin-
zugezogen. Der Schwerpunkt liegt jedoch deutlich in der Vorbereitung der ei-
gentlichen Baudurchführung. Aber auch nach dem Abschluss einer Baumaß-
nahme können beim nachträglichen Durchdenken und Aufarbeiten der Bau-
prozesse wichtige Erkenntnisse für bevorstehende Bauobjekte gewonnen
werden. Das Ziel einer Arbeitsvorbereitung ist es, eine reibungsfreie Ferti-
gungsplanung für die Herstellung eines Bauobjektes zu erstellen. Wobei die
vertraglich geschuldeten Leistungen mit den betrieblichen Möglichkeiten so zu
planen sind, dass das Bauobjekt mit den geringst möglichen Kosten herge-
stellt werden kann. Dabei hat in den letzten Jahren der Einsatz von EDV die
Effizienz dieser Bearbeitung enorm gesteigert. Für die Arbeitsvorbereitung
sind die Vorgaben ihrer Planung durch den Bauvertrag und das Leistungsver-
zeichnis, aber auch durch die Konstellation der eigenen Firma schon vorgege-
ben. Dies wird durch folgendes Bild verdeutlicht:
5
vgl. Kühn, S. 49
- 15 -
Arbeitsvorbereitung
Abbildung 2: Vorgaben für die Arbeitskalkulation
6
In Abbildung 2 erkennt man deutlich, wie die verschiedenen Produktionsfakto-
ren nach den Gesichtspunkten der Menge, Qualität und Terminen geplant
werden müssen. Dabei kann die Arbeitsvorbereitung auf fünf Planungsinstru-
mente zurückgreifen:
Ablaufplanung
Einrichtungsplanung
Verfahrensplanung
Bereitstellungsplanung
Einsatzplanung
Auf diese Begriffe wird im Einzelnen nicht näher eingegangen.
6
aus: Brecheler/Friedrich/Hilmer/Weiß, S. 100
- 16 -
Bedeutung der Bauzeit
3 Begriff der Bauzeit
Nachdem in den vorangegangenen Kapiteln auf die Kosten im Baubetrieb und
die Planung einer Baustelle eingegangen wurde, soll nun im diesem Abschnitt
der wichtigen Thematik der Bauzeit Rechnung getragen werden. Die Bauzeit
steht in enger Verbindung zu den o. g. Themeninhalten. Denn das alte
Sprichwort: ,,Zeit ist Geld" kann für die Bauzeit ohne Einschränkungen über-
nommen werden. Aus diesem Grunde ergeben sich nicht selten Streitigkeiten
zwischen den Vertragsparteien.
Als Bauzeit wird die Zeitspanne bezeichnet, in der der / die Auftragnehmer
einer Baumassnahme ihrer Erfüllung der Leistungspflicht nachkommen.
Die Vorgabe einer solchen Zeitspanne obliegt dem Bauherrn, der konkrete
Vorstellung bezüglich des Fertigstellungstermins hat. Für den Bauherrn ist in
der Regel der früheste Beginn und Fertigstellungstermin einer Baumassnah-
me bei seiner geforderter Terminvorgabe von zentraler Bedeutung.
3.1 Bedeutung der Bauzeit
Der Bauzeit wird aufgrund immer schneller werdender Bauabläufe eine immer
größere Bedeutung zuteil. Durch neue Technologien und optimiertere Bauver-
fahren wird der Baufortschritt immer schneller. Diese Entwicklung bringt je-
doch nicht nur Vorteile mit sich, denn bereits kleine Störungen im Bauablauf
können weitreichende Auswirkungen mit sich bringen. Daher sollten Auftrag-
geber und Auftragnehmer die Bedeutung der Bauzeit nicht unterschätzen.
Die Bedeutung der Bauzeit lässt sich aus zwei Blickwinkeln betrachten:
die rechtliche Bedeutung der Bauzeit
die baubetriebliche Bedeutung der Bauzeit
- 17 -
Bedeutung der Bauzeit
3.1.1 Rechtliche Bedeutung der Bauzeit
Da der Bauherr meistens nur geringe Kenntnisse in der zeitlichen Planung
einer Baumassnahme besitzt und die zeitintensiven Abläufe im Bereich der
Bauvorbereitung, der Planungszeit, der Baugenehmigung, der Ausschreibung
und Vergabe nicht ausreichend berücksichtigen kann, werden die zeitlichen
Vorgaben häufig von Fachkundigen festgelegt. Es entsteht ein grober, vorläu-
figer Terminplan, der die Grundlage für die Ausschreibung bildet. Außerdem
werden aus diesem ersten Terminplan Ausführungsfristen und Termine für
den Bieter ersichtlich. Bei der Ausschreibung wird der Bieter oftmals aufgefor-
dert, den Ablauf des Terminplanes ausdrücklich anzuerkennen, bzw. einen
Baufristen- oder Bauzeitenplan für das betreffende Bauvorhaben abzugeben.
Im weiteren Verlauf der Vergabe wird dieser Bauzeitenplan Vertragsbestand.
Nach der Auftragserteilung schuldet der Auftragnehmer dem Bauherrn auf der
Vertragsgrundlage nicht nur die einwandfreie Fertigstellung der Baumass-
nahme, sondern gleichrangig auch die fristgerechte Fertigstellung des Bau-
vorhabens. Der Auftraggeber ist gemäß der VOB/B verpflichtet, die im Bauver-
trag enthaltenen, abgeschlossenen Bauleistungen abzunehmen und die ver-
einbarte Vergütung zu zahlen, wenn die beiden gleichrangigen Leistungsver-
pflichtungen des Bauausführenden (mangelfreie und fristgerechte Herstellung
des Bauwerks) erfüllt sind.
Die gleichrangige Leistungsverpflichtung des Auftragnehmers spiegelt sich in
§ 4 Nr. 7 VOB/B (mangelhafte Ausführung) und in § 5 Nr. 4 VOB/B (verzöger-
te Bauausführung) wieder, da bei beiden Paragraphen ein Schadensersatzan-
spruch und ein Kündigungsrecht seitens des Auftraggebers gegenüber dem
Auftragnehmer besteht.
- 18 -
Bedeutung der Bauzeit
3.1.2 Baubetriebliche Bedeutung der Bauzeit
Die baubetriebliche Bedeutung der Bauzeit ist aus der Sicht des Unterneh-
mers mindestens von gleicher Signifikanz, wie die Betrachtung der rechtlichen
Aspekte.
Da jedes Bauwerk in der Regel eine Einzelanfertigung, bzw. etwas Einmaliges
in Hinblick auf den Leistungsumfang, den Baustoffen, den Standortverhältnis-
sen, den allgemeinen Randbedingungen und den Vertragsbedingungen dar-
stellt und in diesen Punkten vom Unternehmer nur schwer zu beeinflussen ist,
muss der Auftragnehmer ein bis ins letzte Detail überlegtes Fertigungsverfah-
ren in Bezug auf Geräte und Personal erarbeiten, um für ihn die ökonomisch
günstigste Herstellung des Bauvorhabens realisieren zu können. Diesen opti-
malen Bauablaufplan zu entwerfen ist Aufgabe der Arbeitsvorbereitung. Ob-
wohl in den letzten Jahren viele Arbeiten durch neue Technologien zu rationel-
leren Bauabläufen geführt hat, ist die Baubranche nach wie vor ein sehr per-
sonalintensiver Industriezweig. Beides, die technischen Geräte und das Per-
sonal, verursacht hohe zeitabhängige Kosten, selbst dann, wenn der Einsatz
weitgehend störungsfrei verläuft. Eine gegenüber dem geplanten Bauablauf
veränderte Arbeitsgeschwindigkeit muss also zwangsläufig zu Mehrkosten
führen.
Gerade in der heutigen wirtschaftlichen Situation im bauausführenden Be-
reich, müssen Arbeitskräfte und Maschinen aufgrund der knapp kalkulierten
Einheitspreise weitgehend ungestört eingesetzt werden, damit sie produzieren
können und keine Mehrkosten verursachen.
- 19 -
Bedeutung der Bauzeit aus der Sicht der Vertragsparteien
3.2 Bedeutung der Bauzeit aus der Sicht der Vertragsparteien
Für beide Vertragsparteien hat die Bauzeit eine wesentliche Bedeutung. Die
Interessen, eine Baumaßnahme nach Möglichkeit im vorgegebenen Zeitrah-
men abzuschließen, sind sicherlich auf der Auftraggeberseite genauso vor-
handen wie auf der Auftragnehmerseite. Die Gründe dafür sind jedoch völlig
verschiedenen Ursprungs.
Im Folgenden wird versucht, diesen Umstand näher zu beschreiben.
3.2.1 Die Bedeutung der Bauzeit für den Auftraggeber
Das Einhalten der Bauzeit und damit verbunden die Fertigstellung des Bau-
werkes zu einem festgelegten Zeitpunkt, ist für den Auftraggeber von zentraler
Bedeutung. Viele Bauvorhaben z. B. im Bereich des Gewerbebaus müssen zu
einem bestimmten Zeitpunkt fertiggestellt sein, da sonst zum Teil hohe Ver-
tragsstrafen oder Schadensersatzansprüche seitens des Bauherren / Mieters
gegenüber dem Auftraggeber geltend gemacht werden können. Daher ist der
Auftraggeber daran interessiert, das Bauvorhaben innerhalb seiner vorgege-
benen Zeitspanne fertig zu stellen.
3.2.2 Die Bedeutung der Bauzeit für den Auftragnehmer
Für den Auftragnehmer ist die Bauzeit ein maßgebender Faktor, da seine ge-
samte Kalkulation, seine Einteilung der Maschinen und Geräte und nicht zu-
letzt auch die Einplanung seines Personals davon abhängen.
Außerdem ist die geplante Bauzeit ein Maß für die Beschaffung entsprechen-
der Folgeaufträge.
Die vom Bauherrn bzw. von seinen Beratern vorgegebene Bauzeit wird von
dem Auftragnehmer als wesentliche Vorgabe in die Kalkulation einbezogen.
- 20 -
Der Bauzeitenplan
Aus dieser Vorgabe resultierend, werden z. B. die Einsatzzeiten für Bauma-
schinen und Geräte in die Einheitspreise der dazugehörigen Leistungspositio-
nen ermittelt. Damit handelt es sich bei diesen Kosten um zeitabhängige Kos-
ten, so dass eine Bauzeitverlängerung sich unmittelbar auf die Kosten aus-
wirkt.
Gleiches gilt auch für die aus Baustellenvorhaltung, Bauleitungspersonal, Vor-
halten von Schalung und Rüstung und Lohnkosten resultierenden Kosten ei-
ner Baumaßnahme.
3.3 Der
Bauzeitenplan
Um Bauleistungen kostengünstig anbieten und durchführen zu können und um
zeitabhängige Kosten einer Baustelle möglichst gering zu halten, muss die
Abfolge der Teilleistungen der Gesamtbauleistung genau festgelegt und koor-
diniert werden. Nur ein in Hinsicht auf Rationalität und Kosten optimierter
Bauablauf ermöglicht es dem Auftragnehmer ein Bauvorhaben in der vorge-
gebenen Zeit zu erstellen und dabei einen Gewinn zu erwirtschaften.
Aus diesen genannten Gründen ist es von entscheidender Bedeutung einen
bis ins Detail gehenden Bauablaufplan zu erstellen. Dieser Bauablaufplan
kann in mehreren Stufen bzw. unterschiedliche Grade der Verfeinerung auf-
gestellt werden. Während der Angebotsphase steht oftmals nur ein grober Ab-
laufplan zur Kalkulation der Preise zur Verfügung. Bei der Arbeitsvorbereitung
muss jedoch ein exakter und umfassender Bauzeitenplan erstellt werden.
Hierbei bietet sich aufgrund des weitverbreiteten Gebrauchs von entsprechen-
der Software bei der Arbeitsvorbereitung eine Bauablaufplanung mittels einer
Netzplanberechnung an, die wegen der besseren Übersicht einem Balkenplan
zugeordnet sein sollte.
- 21 -
Durch eine sorgfältige Terminplanung wird die Einhaltung der vorgegebenen
Bauzeit und die wirtschaftliche Absicht des Auftragnehmers gewährleistet.
Somit kann der Unternehmer seiner vertragsgemäßen Erfüllung seiner Leis-
Gestörter Bauablauf
tungspflicht zur fristgerechten Fertigstellung der Baumaßnahme nachkommen,
was auch im Interesse des Auftraggebers steht.
Eine detaillierte Bauablaufplanung vereinfacht dem Auftragnehmer des weite-
ren die Nachweisführung, falls im Falle einer Behinderung durch den Auftrag-
geber Bauverzögerungen und dadurch verbundene Mehrkosten entstanden
sind.
Neben der Verpflichtung zur mangelfreien Herstellung eines Bauwerkes, stellt
die Bauzeit eine besondere Bedeutung dar. Beide Vertragsparteien sollten bei
Vertragsabschluss, aber auch bei der Ausführung der Bauleistung und bei der
Vertragsabwicklung ihre besondere Aufmerksamkeit auf die Aspekte der Bau-
zeit richten.
7
3.4 Gestörter
Bauablauf
Im Laufe der Bauausführungen ist es nicht selten, dass es bei der Ausführung
der Leistung zu Behinderungen oder Störungen kommt, die bei Vertragsab-
schluss nicht absehbar waren. Diese Störungen des Bauablaufes haben oft-
mals Auswirkungen auf den gesamten Bauablauf und somit auf die vereinbar-
ten Termine. Die rechtlichen Folgen, die durch diese Behinderungen entste-
hen, werden in § 6 VOB/B (Behinderung und Unterbrechung der Ausführung)
geregelt. Dabei ist § 6 VOB/B im Zusammenhang mit § 5 (Ausführungsfristen)
sowie §§ 8 (Kündigung durch den Auftraggeber), 9 (Kündigung durch den Auf-
tragnehmer) und 11 (Vertragsstrafe) VOB/B zu betrachten.
Die baubetrieblichen Folgen eines gestörten Bauablaufs sind im wesentlichen
von der Schwere der Behinderung abhängig. Eine Störung im Bauablauf ver-
ursacht aber i. d. R. fast immer zusätzliche Kosten. Ursachen für die hindern-
den Umstände sollen im Folgenden erläutert werden.
7
vgl. Vygen/Schubert/Lang, S. 4-6.
- 22 -
Gestörter Bauablauf
3.4.1 Ursachen für Bauverzögerungen
Man kann die Verzögerungsursachen in vier Verursachungsgruppen unter-
scheiden, die sich klar gegenseitig abgrenzen. Je nach Ursache entstehen
dadurch unterschiedliche Rechtsfolgen im Hinblick auf die Fristverlängerung
und Schadensersatz.
8
Im Folgenden soll auf die Ursachen kurz eingegangen
werden.
3.4.1.1 Verzögerungen durch Leistungsänderungen
Die Verzögerungen, die aus der Mengen- oder Leistungsänderung resultieren,
sind klar dem Auftraggeber zuzuordnen. Die VOB lässt es jedoch zu, nach-
träglich Leistungen zu ändern bzw. zusätzliche Leistungen zu fordern.
3.4.1.2 Verzögerungen durch den Auftraggeber
Verzögerungen, die der Auftraggeber zu verantworten hat, können u. a. durch
die Vernachlässigung seiner Vertragspflichten entstehen. Diese Pflichten sind
z. B.:
Beschaffung der benötigten Unterlagen
Bereitstellung des Grundstückes
Koordination der Arbeiten
Einholen der Genehmigungen und Erlaubnisse
8
vgl. Vygen/Schubert/Lang, S. 192 ff.
- 23 -
Gestörter Bauablauf
3.4.1.3 Verzögerungen durch den Auftragnehmer
Auch der Auftragnehmer kann durch das Vernachlässigen seiner vertraglichen
Pflichten zu Verzögerungen des Baufortschrittes beitragen. Beispiele hierfür
sind:
Nicht-Einhaltung der Ausführungsfristen
nicht rechtzeitige Beschaffung eigener Planungsunterlagen
keine Bauausführung nach den Regeln der Technik
3.4.1.4 Verzögerungen durch sonstige Ursachen
Verzögerungen aus sonstigen Ursachen können keiner der beiden Vertrags-
parteien zugewiesen und angelastet werden. Zu diesen Ursachen gehören u.
a.:
Streik und Aussperrung
Höhere Gewalt
außergewöhnliche Witterungseinflüsse
3.4.2 Rechtliche Folgen aus Bauverzögerungen
Je nach Ursachenzuweisung entstehen nach der VOB/B unterschiedliche
Rechtsansprüche für Auftraggeber und Auftragnehmer.
3.4.2.1 Behinderungen durch den Auftraggeber
Liegen die Behinderungen im Verantwortungsbereich des Bauherren, so er-
geben sich folgende Ansprüche für den Auftragnehmer:
- 24 -
Gestörter Bauablauf
Der Unternehmer muss zunächst den Auftraggeber auf die hindernden Um-
stände hinweisen. Dies geschieht durch die schriftliche Behinderungsanzeige,
zu der er nach § 6 Nr. 1 VOB/B verpflichtet ist. Damit ist der Auftraggeber über
den Sachverhalt informiert und kann u. U. Maßnahmen, zu der er nach § 4 Nr.
1 Satz 1 VOB/B verpflichtet ist, ergreifen, die den Baubetrieb reibungslos
fortlaufen lassen. Können die behindernden Umstände für den Auftragnehmer
jedoch nicht beseitigt werden, so können Ansprüche gegenüber dem Auftrag-
geber gelten gemacht werden. Diese Ansprüche können zum einen Fristver-
längerungen nach § 6 Nr. 2 VOB/B, aber auch Schadensersatzforderungen
nach § 6 Nr. 6 VOB/B beinhalten.
Müssen die Bauarbeiten sogar unterbrochen werden, so verlängert sich die
Ausführungsfrist für den Unternehmer um den Zeitraum in dem die Arbeiten
nicht ausgeführt werden konnten mit einem Zuschlag für die Wiederaufnahme
der Arbeiten. Gleiches gilt ähnlich für Behinderungen, bei denen keine Unter-
brechung des Baufortschrittes vorliegt. Liegt eine Unterbrechung länger als 3
Monate vor, so kann der Auftragnehmer den bestehenden Bauvertrag schrift-
lich kündigen.
- 25 -
Gestörter Bauablauf
3.4.2.2 Behinderungen durch den Auftragnehmer
Sind die Ursachen für ein gestörten Bauablauf beim Auftragnehmer zu finden,
so hat dieser nach § 5 Nr. 3 und 4 VOB/B auf Verlangen des Auftraggebers
sofort Abhilfe zu schaffen. Kommt der Unternehmer den Forderungen des
Bauherren nicht nach, so kann er für die Schadensersatzforderungen des Auf-
traggebers nach § 6 Nr. 6 VOB/B verantwortlich gemacht werden. Der Auf-
tragnehmer muss daher geeignete Maßnahmen treffen, die den zeitlichen Ver-
lust durch die Behinderung beseitigen. Dies kann nur durch einen beschleu-
nigten Bauablauf realisiert werden. Die Mehrkosten hierfür muss der Unter-
nehmer selber tragen, wenn er für die hindernden Umstände selbst verant-
wortlich ist. Kommt der Auftragnehmer den Anweisungen des Auftraggebers
nicht nach, so kann ihm nach Verstreichen einer angemessenen Frist zur Ver-
tragserfüllung der Auftrag entzogen werden.
- 26 -
Definition des Begriffs Baustellencontrolling
4 Baustellencontrolling
4.1 Definition des Begriffs Baustellencontrolling
Die Aufgaben des Controllings lassen sich aus der Übersetzung des engli-
schen Wortes ,,to control" ableiten. Es bedeutet: ,,leiten, beaufsichtigen, regeln,
steuern, kontrollieren, prüfen". Die Hauptaufgabe des Controllings im Baube-
trieb ist es also, frühzeitig Informationen über Abweichungen vom Soll-Ablauf
zu erhalten, um Gegensteuerungen einleiten zu können, wobei ein einfaches
Handling und eine hohe Transparenz der Controllinginstrumente gegeben sein
sollte. Das Controlling stellt quasi das Navigationssystem für die Baustelle und
letztlich auch für das Unternehmen dar.
9
Es bestimmt zu jedem Zeitpunkt die
Position und den Kurs des Baufortschrittes. Dadurch ergeben sich folgende
Aufgaben:
Kursplanung (Soll)
Laufende Positionsbestimmung (Ist)
Bestimmung der Abweichung vom Kurs (Soll-Ist-Vergleich)
Analyse der Ursache
Gegensteuerung, um die Soll-Ist-Differenz zu beseitigen
Diese o. g. Merkmale machen das Baustellencontrolling somit auch zu einem
wichtigen Werkzeug der Kosten-Leistungsrechnung. Die gewonnen Informati-
onen aus dem Baustellencontrolling stellen die Grundlage für die interne Leis-
tungsmeldung dar.
Um ein Controlling jedoch effektiv einsetzen zu können, müssen die Faktoren
,,Planung", ,,Kontrolle" und ,,Information" miteinander verschmelzen.
9
vgl. Brecheler/Friedrich/Hilmer/Weiß, S. 141.
- 27 -
Definition des Begriffs Baustellencontrolling
Abbildung 3: Controlling-Dreieck
10
Beim Controlling muss die Frage gestellt werden, ob die Ziele laut ,,Planung"
erreicht wurden. Es muss weiterhin erkennbar sein, wo die Abweichungen
sind und in welcher Art und Größe sie vorliegen. Dies sind gewonnene Er-
kenntnisse durch die ,,Informationsversorgung" aus der Bauausführung. Es
muss die Ursache für die Abweichungen von der Planung gefunden werden.
Dies geschieht durch die ,,Kontrolle". Dabei dient die ,,Kontrolle" nicht dem
Nachweis von Schuld oder Unschuld. ,,Kontrolle" soll auch nicht zur Vergan-
genheitsbewältigung dienen, sondern Hilfe für die Zukunft darstellen. Control-
ling ist somit zukunftsorientiert und das Mittel zur Durchsetzung der eigenen
Ansprüche und zur Abwehr der Ansprüche Dritter.
Um eine solche Symbiose dieser Faktoren zu erreichen, bedarf es einem
transparenten und vor allem einfach zu bedienendem Controllinginstrument.
Heute wird dieses Instrument i. d. R. durch den Einsatz von geeigneter Soft-
ware realisiert. Dabei kommen häufig Datenbank-Programme zum Einsatz,
um die Fülle von Informationen sinnvoll erfassbar zu machen. Die lückenlose
Dokumentation sämtlicher relevanten Geschehnisse stellt hierbei einen
Schwerpunkt dar, da dies im weiteren Verlauf für die Nachweisführung von z.
B. Bauzeitverzögerungen unentbehrlich ist. Die Komplexität dieses Dokumen-
tationssystems geht aus folgendem Bild hervor:
10
aus: Wirth, S. 2.
- 28 -
Definition des Begriffs Baustellencontrolling
Abbildung 4: Anforderungen an Dokumentationssysteme
11
Die Stärken eines Dokumentationssystems sind demnach in folgenden Punk-
ten zu sehen:
12
Möglichst lückenlose, realitätsnahe Dokumentation des Bauablaufes
Beschränkung der Ist-Daten auf das Wesentliche
Überschaubarkeit der Datenlage und Aktualisierungsmöglichkeiten
Möglichkeit der frühen Entscheidungsfindung
Überwachungsmöglichkeit der umgesetzten Entscheidungen
Monetäre Bewertung von Bauablaufstörungen
11
aus: Dorn, S. 60
12
vgl. Dorn, S. 56.
- 29 -
Definition des Begriffs Baustellencontrolling
Die Problematik dieser Dokumentationstechnik liegt in der zu bearbeitenden
Informationsflut des tatsächlichen Bauablauf und die bedarfs- und situations-
gerechte Erfassung dieser Daten. Daher muss die Erfassung, Überwachung
und Steuerung vor Ort in einer Hand liegen, damit ein globaler Überblick über
den Bauablauf ermöglicht wird. Im II. Teil dieser Diplomarbeit wird die Entwick-
lung eines solchen Dokumentationssystems mit der Unterstützung von EDV
für ein konkretes Beispiel erarbeitet.
- 30 -
Historie
II. TEIL
5 Die
Baumaßnahme
Nachdem in den vorangegangenen Kapiteln die theoretischen Grundlagen für
die weitere Bearbeitung an einem konkreten Beispiel erläutert wurden, soll
nun der Einstieg in die eigentliche zu bearbeitende Aufgabenstellung erfolgen.
Dazu wird zunächst das Bauvorhaben, welches hierbei näher untersucht wird,
kurz vorgestellt.
5.1 Historie
Bei dem Bauvorhaben, was innerhalb dieser Diplomarbeit als konkretes Bei-
spiel für die Untersuchungen dient, handelt es sich um die ,,Staatsbibliothek zu
Berlin, Haus 1". Der neobarocke Sandsteinbau befindet sich ,,Unter den Lin-
den" in Berlin-Mitte und umspannt zwei Straßenblöcke in den Abmessungen
Nord / Süd von 170 m x Ost / West von 107 m. Das von dem Architekten Ernst
von Ihne entworfene Gebäude wurde von 1903 bis 1914 erbaut und trug da-
mals den Namen ,,Preußische Staatsbibliothek". Bekannt war das Gebäude für
seinen kuppelbekrönten Lesesaal, der damals zu den schönsten Lesesälen
Europas zählte. Er wurde im Zweiten Weltkrieg zerstört. Statt dessen wurde in
den 70er Jahren ein nüchterner Magazinturm von der DDR errichtet. Die
Staatsbibliothek bildet mit ihren immensen Beständen von mehr als zwölf Mil-
lionen Bänden eine der größten Bibliothek weltweit.
- 31 -
Das Bauvorhaben
5.2 Das
Bauvorhaben
Bei den Baumaßnahmen, die derzeit in der Staatsbibliothek stattfinden, han-
delt es sich um die Grund- bzw. Erstinstandsetzung des Kellergeschosses.
Die vorhandenen Gründungen wurden je nach Bodenbeschaffenheit durch
Holzpfähle, gemauerte Senkkästen oder flachgegründete gemauerte Funda-
mente realisiert.
Da die weiteren Untersuchungen in dieser Arbeit nur an einem ausgewählten
Gewerken (Stahlbetonarbeiten) und Bauabschnitten (D, E, S und T) erfolgt,
werden im Folgenden nur die wesentlichen Bauaufgaben beschrieben. Die
Arbeiten sind jedoch in allen Bereichen des Gebäudes ähnlich, so dass auf
eine weitere Spezifizierung der Arbeitsbeschreibung verzichtet werden kann.
5.2.1 Herstellung von Stahlbetonbodenplatten
Sämtliche vorhandenen Bodenplatten werden in Zuge der Grundinstandset-
zung abgebrochen und nach erforderlichen Gründungsarbeiten (HDI) aus WU-
Beton neu errichtet. Dabei werden Bodenkanäle u. ä. für die Aufnahme von
Haustechnik mit erstellt. Dazu ist es erforderlich, sämtliche haustechnischen
Installationen während der Baumaßnahme durch Provisorien zu ersetzen, um
die Nutzung der Gebäudes über die gesamte Bauzeit zu gewährleisten.
- 32 -
Das Bauvorhaben
5.2.2 Erneuerung von Kellerdecken in Teilbereichen
Ein weiterer Schwerpunkt der Instandsetzung bildet die Erneuerung von Kel-
lerdecken in Teilbereichen, da sich die Raumnutzungen und die damit verbun-
denen Lasterhöhung gegenüber der ursprünglichen Nutzung verändert hat.
Dabei sind die vorhandenen Deckenfelder und die dazugehörenden Stahlbe-
ton Haupt- und Nebenträger abschnittsweise abzubrechen, bevor die neuen
Deckenfelder aus Stahlbeton errichtet werden können.
5.2.3 Verstärkung von Deckensystemen durch Spritzbeton
Deckenfelder, bei denen durch Untersuchungen eine ausreichende Tragfähig-
keit nachgewiesen werden konnte, die aber durch Nutzungsänderungen höhe-
re Verkehrslasten erhalten, werden durch Spritzbeton verstärkt. Dies ge-
schieht durch das Aufbringen einer längsbewehrten Spritzbetonschale mit bis
zu 10 cm Dicke und einer Zusatzbewehrung unterhalb der Balken / Unterzüge.
Die zusätzliche Zugbewehrung wird im verstärkten Bereich im Auflagerbereich
durch das Schaffen von Auflagertaschen erreicht. Während dieser Bauphase
müssen die örtlich auftretenden Gebäudelasten vollständig durch temporäre
Abfangekonstruktionen aufgenommen werden. Die zusätzliche Bewehrung die
in die bestehenden Haupt- und Nebenbalken eingebaut wird, muss durch das
Herstellen von Kernbohrungen durch die Betonbalken (Unterzüge) und die
darüber liegende Decke in dem statisch erforderlichen Abstand geschehen.
Nach dem Einbau von U-förmigen Bügeln, werden an der Deckenoberseite die
jeweiligen Schenkelenden durch ein Quereisen verschweißt, bevor die Kern-
bohrungen kraftschlüssig vergossen werden.
- 33 -
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Originalausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2001
- ISBN (eBook)
- 9783832448202
- ISBN (Paperback)
- 9783838648200
- DOI
- 10.3239/9783832448202
- Dateigröße
- 7.2 MB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- Beuth Hochschule für Technik Berlin – III - Bauingenieurwesen und Geowissenschaften
- Erscheinungsdatum
- 2001 (Dezember)
- Note
- 1,3
- Schlagworte
- baubetrieb bauzeitverzögerung
- Produktsicherheit
- Diplom.de