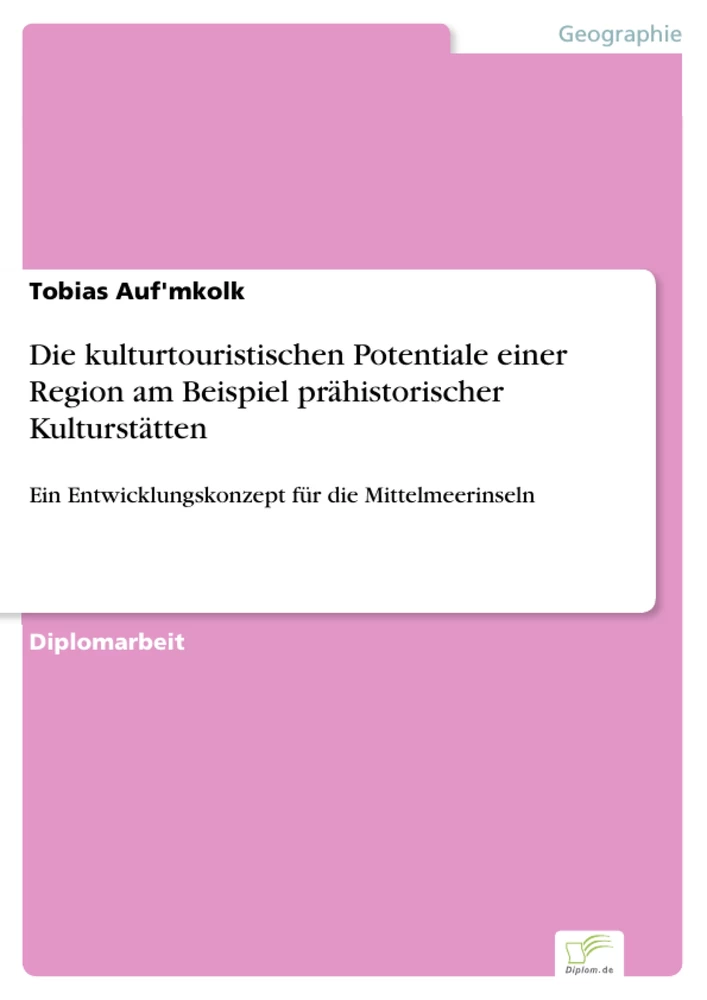Die kulturtouristischen Potentiale einer Region am Beispiel prähistorischer Kulturstätten
Ein Entwicklungskonzept für die Mittelmeerinseln
Zusammenfassung
Spätestens seit den 60er Jahren des 20. Jahrhunderts strömt jedes Jahr in den Sommermonaten eine große Zahl von Urlaubern nach Mallorca und Korsika, die zu einer weitreichenden Veränderung der ursprünglichen Gestalt beider Inseln führen. Welche Strategien können hauptsächlich touristisch orientierte Regionen wie Mallorca und Korsika anwenden, um den Menschenmassen während der Reisezeit Herr zu werden und dabei nicht den Weg der kulturellen Selbstaufgabe zu gehen?
Mallorca hat nach dem Zweiten Weltkrieg eine Tourismusmaschinerie aufgebaut, die in allen Bereichen der Öffentlichkeit als negatives Paradebeispiel der Branche dargestellt wird. Erst in den letzten 10-15 Jahren findet ein Umdenken statt, das aufgrund von Identitäts- und Imageproblemen bei Urlaubern wie der einheimischen Bevölkerung hervorgerufen wird. Die Slums der Freizeitarchitektur erfreuen sich nicht mehr gleichbleibender Beliebtheit bei Besuchern und Tourismusmanagern. Verschönerungen, Renovierungen und Restaurierungen, die bis hin zur Sprengung von alten Anlagen führen, sollen das Image der Insel aufpolieren. Eine Diversifizierung des touristischen Angebots ist in Ansätzen zu erkennen, wie z. B. in der 1995 errichteten ersten Berghütte Mallorcas. Doch eine grundlegende Strategie zur Erarbeitung touristischer Alternativen ist nicht zu erkennen.
Korsika ist seit dem Beginn seiner touristischen Entwicklung einen anderen Weg als Mallorca gegangen. Obwohl schon in den fünfziger Jahren vom französischen Zentralstaat als Tourismusregion deklariert, hat die Furcht weiter Bevölkerungsteile vor einer Balearisierung der Insel durch internationale Tourismuskonzerne eine Dominanz des massenorientierten Fremdenverkehrs verhindert. Der politische Widerstand gegen den französischen Staat wirkte sich daher auch auf den Tourismussektor aus. Aus diesem Grunde bestehen auf Korsika schon seit einem längeren Zeitraum Ideen und Konzepte, den hauptsächlich küstenorientierten Fremdenverkehr zu diversifizieren. Die Einrichtung des Parc Naturel Regional de la Corse mit zahlreichen Wanderrouten, Klettersteigen, Berghütten und Unterkünften in Dörfern des Hinterlandes oder die Revitalisierung des Bergdorfes Lama als Ort eines bevölkerungsnahen und partizipativen Tourismus sind erste Ansätze zur Stärkung der Binnenregionen. Bisher wurden diese Anstrengungen aber überwiegend im Bereich von Natur, Erholung und Sport unternommen. Kulturspezifische Einrichtungen sind für den […]
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis
Verzeichnis der Abbildungen
Verzeichnis der Tabellen
Verzeichnis der Bilder
1. Einleitung
2. Die touristische Entwicklung auf Mallorca und Korsika
2.1 Historische Dimensionen
2.2 Strukturelle Entwicklung
2.3 Auswirkungen und Konfliktpotentiale des Tourismus
2.3.1. Ökonomische, demographische und ökologische Folgen auf Mallorca
2.3.2. Politische Konflikte auf Korsika
2.4. Touristikpolitik
3. Theoretische Grundlagen zum Kulturtourismus
3.1. Definition
3.2. Systematisierung
3.3. Der kulturtouristische Markt
3.4. Chancen, Risiken und Auswirkungen
3.5. Kulturtourismus in Europa, Spanien und Frankreich
3.5.1. EU
3.5.2. Spanien
3.5.3. Frankreich
4. Kulturtouristische Konzepte zur Inwertsetzung der prähistorischen Kulturstätten auf Mallorca und Korsika
4.1. Konzept 1: „Auf den Spuren der ersten Bewohner der
Balearen – Ein achttägiger Fahrradrundweg
entlang prähistorischer Kulturstätten“
4.1.1. Die prähistorische Geschichte Mallorcas
4.1.2. Prähistorische Bauformen auf Mallorca
4.1.3. Regionale Abgrenzung
4.1.4. Zielsetzungen
4.1.5. Strukturelle Maßnahmen
4.1.6. Routenverlauf
4.2. Konzept 2: „ Zu Fuß auf den Spuren der ersten Bewohner
Korsikas – Ein dreizehntägiger Weitwanderweg
entlang der prähistorischen Kulturdenkmäler
der Insel“
4.1.1. Die prähistorische Geschichte Korsikas
4.1.2. Prähistorische Bauformen auf Korsika
4.1.3. Regionale Abgrenzung
4.1.4. Zielsetzungen
4.1.5. Strukturelle Maßnahmen
4.1.6. Routenverlauf
5. Fazit
6. Literaturverzeichnis
Verzeichnis der Abbildungen
Abb. 1: Karte der auf Mallorca aufgenommenen Bilder S. XI mit exakter Ortsangabe
Abb. 2: Karte der auf Korsika aufgenommenen Bilder S. XII mit exakter Ortsangabe
Abb. 3: Entwicklung der Einwohner- und Touristenzahl auf Mallorca zwischen 1960 und 1991 (Angaben in Tausend)
Abb. 4: Anstieg der jährlichen Besucher auf Korsika
Abb. 5: Prozentualer Anteil der ausländischen Einreisenden S. 10 am Flughafen von Palma nach Herkunftsländern 1990/91
Abb. 6: Monatliche Verteilung der ausländischen Einreisenden S. 11 am Flughafen von Palma 1990/91
Abb. 7: Mallorca: Hotelkapazität (Stand 1992)
Abb. 8: Der touristische Druck auf den Inseln des Mittelmeerraumes S. 15 im Jahr 1995
Abb. 9: Verteilung der jährlichen Touristenzahlen auf Korsika S. 16 nach Nationalitäten
Abb. 10: Die touristische Erschließung und Beherbergungskapazität S. 17 Korsikas
Abb. 11: Beherbergungsarten und deren Anteil auf Korsika 1997
Abb. 12: Anschläge auf touristische Einrichtungen auf Korsika
Abb. 13: Gliederung der Kulturtourismusformen
Abb. 14: Regionale Verteilung der kulturellen Reiseziele S. 44 in Spanien
Abb. 15: Lageplan der Höhlen von Cala Sant Vicenç
Abb. 16: Schnitt und Grundriss der Doppelnaveta von Es Rafal
Abb. 17: Rekonstruktion eines Talayot mit Steinplatten S. 55 als Deckenkonstruktion
Abb. 18: Rekonstruktion des Talayot von Son Mas
Abb. 19: Rekonstruktion eines Santuarios
Abb. 20: Grundriss und Schnitt der Taula am Stausee von Gorg Blau
Abb. 21: Grundriss der talayotischen Siedlung Ses Paisses bei Artà
Abb. 22: Grundriss der talayotischen Siedlung von Capocorb Vell
Abb. 23: Grundriss der Nekropole von Son Real
Abb. 24: Abgrenzung der prähistorisch relevanten Regionen S. 61 auf Mallorca
Abb. 25: Übersicht über die kulturelle Fahrradroute und deren S. 65 Etappenorte
Abb. 26: Etappe 1: Alaró – Pollensa
Abb. 27: Etappe 2: Pollensa – Muro
Abb. 28: Etappe 3: Muro – Artà
Abb. 29: Etappe 4 (Teil 1): Artà – Felanitx
Abb. 30: Etappe 4 (Teil 2): Artà – Felanitx
Abb. 31: Etappe 5: Felanitx – Ses Salines
Abb. 32: Etappe 6: Ses Salines – Llucmajor
Abb. 33: Etappe 7: Llucmajor – Sineu
Abb. 34: Etappe 8: Sineu – Alaró
Abb. 35: Zeittafel der Vor- und Frühgeschichte Korsikas
Abb. 36: Grundriss und Querschnitt des Kistengrabes von S. 94 Tivolaggiu
Abb. 37: Verteilung der Coffres und Dolmen auf Korsika
Abb. 38: Größe und Gestalt der korsischen Menhirstatuen der S. 97 letzten vier Perioden des Megalithikum III
Abb. 39: Anordnung des Alignement von Pagliaju
Abb. 40: Symbolische Felszeichnungen von Petra Frisgiata (Cambia)
Abb. 41: Schematische Felszeichnungen in der Grotta Scritta S. 98 am Cap Corse
Abb. 42: Rekonstruktion des Zentralmonumentes von Tappa
Abb. 43: Plan der befestigten Fundstätte von Filitosa
Abb. 44: Abgrenzung der prähistorisch relevanten Regionen S. 103 auf Korsika
Abb. 45: Übersicht über den kulturellen Weitwanderweg und S. 107 dessen Etappenorte
Abb. 46: Etappe 1: Sartène – Campomoro
Abb. 47: Etappe 2: Campomoro – Tizzano
Abb. 48: Etappe 3: Tizzano – Giannuccio
Abb. 49: Etappe 4: Giannuccio – Sotta
Abb. 50: Etappe 5: Sotta – Arraggio
Abb. 51: Etappe 6: Arraggio – Cartalavono
Abb. 52: Etappe 7: Cartalavono – Levie
Abb. 53: Etappe 8: Levie – Aullène
Abb. 54: Etappe 9: Aullène – Argiusta-Moriccio
Abb. 55: Graphische Rekonstruktion des torreanischen S. 123 Kultmonumentes von Balestra
Abb. 56: Etappe 10: Argiusta-Moriccio – Petreto-Bicchisano
Abb. 57: Etappe 11: Petreto-Bicchisano – Filitosa
Abb. 58: Etappe 12: Filitosa – Abbartello
Abb. 59: Etappe 13: Abbartello – Sartène
Verzeichnis der Tabellen
Tab. 1: Entwicklung der Besucherzahlen auf Korsika S. 7 von 1960-1995
Tab. 2: Die touristische Entwicklung auf Mallorca S. 9 (Angaben in Tausend)
Tab. 3: Strukturdaten des Fremdenverkehrs von Korsika S. 14 und Mallorca aus dem Jahr 1992
Tab. 4: Beschäftigung auf Mallorca nach Wirtschafts- S. 19 sektoren im Jahresvergleich
Tab. 5: Prozentuale Veränderung der Reisemotive S. 35 zwischen 1987 und 1992
Tab. 6: Prozentuale Veränderung der Urlaubsaktivitäten S. 35 zwischen 1981 und 1992
Verzeichnis der Bilder
Titelbild: Menhirstatue Filitosa XIII
Bild 1: Eingang zur Höhle 2 in Cala Sant Vicenç
Bild 2: Modell der Doppelnaveta von Es Rafal im Stadtmuseum S. 54 von Palma
Bild 3: Talayot Son Fred nördlich von Sencelles
Bild 4: Talayot Son Serra de Marina
Bild 5: Das Santuario Talayótico de Son Corró
Bild 6: Taula am Stausee von Gorg Blau
Bild 7: Eingangsportal der talayotischen Siedlung Ses Paisses S. 57 bei Artà
Bild 8: Wohngebäude und Talayot in Capocorb Vell
Bild 9: Gräber der Nekropole von Son Real
Bild 10: Wegweiser für prähistorische Kulturdenkmäler in Artà
Bild 11: Erklärungstafel für prähistorische Kulturdenkmäler an S. 63 der Nekropole von Son Real
Bild 12: Eingang der Höhle 3 von Cala Sant Vicenç
Bild 13: Inneres der Höhle 1 von Cala Sant Vicenç
Bild 14: Übersicht über die Nekropole von Son Real
Bild 15: Gräber der Nekropole von Son Real
Bild 16: Talayot von Sa Canova de Morell
Bild 17: Eingang des Talayot von Sa Canova de Morell
Bild 18: Zentralmonument von Ses Paisses
Bild 19: Blick über die Anlage von S’Heretat
Bild 20: Innenansicht der Halle von Hospitalet Vell
Bild 21: Deckenkonstruktion des Talayot von Hospitalet Vell
Bild 22: Talayot von Can Jordi
Bild 23: Innenansicht des Talayot von Can Jordi
Bild 24: Eingestürzter Talayot in Ets Antigors
Bild 25: Talayot und Wohnbebauung in Ets Antigors
Bild 26: Quadratischer Talayot und Wohnbebauung S. 81 in Capocorb Vell
Bild 27: Runder Talayot und Wohnbebauung in Capocorb Vell
Bild 28: Mittelsäule des Talayot von Son Fornés
Bild 29: Eingangsportal des Talayot von Son Fornés
Bild 30: Talayot 1 von Es Racons
Bild 31: Talayot 2 von Es Racons
Bild 32: Das Heiligtum von Son Corró
Bild 33: Ausblick vom Talayot Son Fred
Bild 34: Überreste des Coffre de Caleca
Bild 35: Der Dolmen von Fontanaccia
Bild 36: Menhirstatue Filitosa III
Bild 37: Alignement de Stantari
Bild 38: Das Zentralmonument von Tappa
Bild 39: Blick auf die befestigte Fundstätte von Filitosa
Bild 40: Aussichtsplattform der torreanischen Festung S. 110 von Castiddacciu
Bild 41: Teilansicht des Alignement von Pagliaju
Bild 42: Menhire des Alignement von Stantari
Bild 43: Ausgrabungen am Alignement von Renaju
Bild 44: Blick über die torreanische Anlage von Tappa
Bild 45: Eingang des torreanischen Kultmonuments von Torre
Bild 46: Die torreanische Festung Castellu d’Arragiu
Bild 47: Innenansicht der torreanischen Festung S. 117 Castellu d’Arragiu
Bild 48: Torreanische Festung Castellu di Cucuruzzu
Bild 49: Festungsmauer der torreanischen Festung S. 120 Castellu di Capula
Bild 50: Torreanisches Kultmonument von Foce
Bild 51: Zentralmonument von Filitosa mit Menhirstatuen
Bild 52: Gang im Westmonument von Filitosa
Abb. 1: Karte der auf Mallorca aufgenommenen Bilder[1] mit exakter Ortsangabe
(Quelle: Turespaña 1999, S. 48; Maßstab 1:1.100.000[2] / Bearbeitung: Auf’mkolk 2000)
Abb. 2: Karte der auf Korsika aufgenommenen Bilder[3] mit exakter Ortsangabe
(Quelle: Rother/ Rother 1988, Umschlagklappe; Maßstab 1:750.000[4] / Bearbeitung: Auf’mkolk 2000)
1.Einleitung
„ [ ] Ach Mallorca, du entzückst mein Herz,
Mit dem so schönen Blau deines Himmels,
Mit deinen rauschenden Ufern,
Welche die leichte Brise bewegt,
Mit den Blumen deiner Wiesen,
Mit dem Gesang deiner Vögel;
Des Himmels und des Paradieses
Abbild bist du für mich! [... ] “
Tomas Forteza, 1869[5]
„Bäume wachsen die Hänge hinauf. Oliven gibt es, Eichen und Ulmen. Größere Ortschaften schieben helle Häuserreihen übereinander. [... ] Eine Kapelle wird von dunklen Koniferen umfasst. Herden schwarzer und weißer Bergschafe ziehen die Hügel hinauf. [... ] Alte Grabmale schlafen in der Sonne. Hohe Zypressen brennen ihr ernstes Licht.“
Wilhelm-Otto Riedemann, 1930[6]
70 bzw. 130 Jahre sind seit diesen idyllischen Reisebeschreibungen vergangen und im Zeitalter des Massentourismus sind die beiden Mittelmeerinseln Mallorca und Korsika in der Zwischenzeit für jedermann erschwinglich und erreichbar geworden. Spätestens seit den 60er Jahren des 20. Jahrhunderts strömt jedes Jahr in den Sommermonaten eine große Zahl von Urlaubern nach Mallorca und Korsika, die zu einer weitreichenden Veränderung der ursprünglichen Gestalt beider Inseln führen. Welche Strategien können hauptsächlich touristisch orientierte Regionen wie Mallorca und Korsika anwenden, um den Menschenmassen während der Reisezeit Herr zu werden und dabei nicht den Weg der kulturellen Selbstaufgabe zu gehen?
Mallorca hat nach dem Zweiten Weltkrieg eine Tourismusmaschinerie aufgebaut, die in allen Bereichen der Öffentlichkeit als negatives Paradebeispiel der Branche dargestellt wird. Erst in den letzten 10-15 Jahren findet ein Umdenken statt, das aufgrund von Identitäts- und Imageproblemen bei Urlaubern wie der einheimischen Bevölkerung hervorgerufen wird[7]. Die „Slums der Freizeitarchitektur“[8] erfreuen sich nicht mehr gleichbleibender Beliebtheit bei Besuchern und Tourismusmanagern. Verschönerungen, Renovierungen und Restaurierungen, die bis hin zur Sprengung[9] von alten Anlagen führen, sollen das Image der Insel aufpolieren. Eine Diversifizierung des touristischen Angebots ist in Ansätzen zu erkennen, wie z. B. in der 1995 errichteten ersten Berghütte Mallorcas[10]. Doch eine grundlegende Strategie zur Erarbeitung touristischer Alternativen ist nicht zu erkennen.
Korsika ist seit dem Beginn seiner touristischen Entwicklung einen anderen Weg als Mallorca gegangen. Obwohl schon in den fünfziger Jahren vom französischen Zentralstaat als Tourismusregion deklariert[11], hat die Furcht weiter Bevölkerungsteile vor einer „Balearisierung“[12] der Insel durch internationale Tourismuskonzerne eine Dominanz des massenorientierten Fremdenverkehrs verhindert. Der politische Widerstand gegen den französischen Staat wirkte sich daher auch auf den Tourismussektor aus[13]. Aus diesem Grunde bestehen auf Korsika schon seit einem längeren Zeitraum Ideen und Konzepte, den hauptsächlich küstenorientierten Fremdenverkehr zu diversifizieren. Die Einrichtung des „Parc Naturel Regional de la Corse“[14] mit zahlreichen Wanderrouten, Klettersteigen, Berghütten und Unterkünften in Dörfern des Hinterlandes oder die Revitalisierung des Bergdorfes Lama[15] als Ort eines bevölkerungsnahen und partizipativen Tourismus sind erste Ansätze zur Stärkung der Binnenregionen. Bisher wurden diese Anstrengungen aber überwiegend im Bereich von Natur, Erholung und Sport unternommen. Kulturspezifische Einrichtungen sind für den Fremdenverkehr - bis auf wenige Ausnahmen (z. B. die prähistorischen Ausgrabungen von Filitosa) - nur von untergeordneter Bedeutung.
Diese Arbeit wird sich – wie der Titel bereits sagt – mit den kulturtouristischen Potentialen einer Region anhand prähistorischer Kulturdenkmäler auseinander setzen und ein Entwicklungskonzept für die beiden oben genannten Mittelmeerinseln entwerfen. Dabei liegt die Betonung auf der Realisierung kulturtouristischer Potentiale für den Fremdenverkehr und nicht in der Erarbeitung eines spezifisch regionalen Entwicklungskonzeptes für Mallorca und Korsika. Andere Regionen in Europa, wie z. B. Sardinien, Malta, die Bretagne, Südfrankreich, die Iberische Halbinsel, England und Irland[16], bieten ähnlich günstige prähistorische Voraussetzungen für die Erstellung eines solchen Konzeptes. Mallorca und Korsika wurden für diese Arbeit aus mehreren Gründen ausgewählt. Zum einen war die Kenntnis des Verfassers hinsichtlich der prähistorischen Kultur beider Inseln aufgrund mehrerer Reisen in diese Regionen ausschlaggebend. Zum anderen ist die topographische Lage einer Insel wegen ihrer natürlichen Grenzen sehr gut für ein regional geschlossenes Entwicklungskonzept geeignet. Des weiteren besitzen beide Inseln eine ausgeprägte, in der Literatur gut dokumentierte, prähistorische Vergangenheit, die sich in einer Vielzahl von vorgeschichtlichen Kulturdenkmälern niederschlägt. Zudem besteht auf beiden Inseln eine große Ähnlichkeit in der Architektur und landschaftlichen Lage jener Kulturdenkmäler, so dass – trotz unterschiedlicher Entwicklung des Fremdenverkehrs - eine ähnliche touristische Entwicklung erfolgen kann.
Der erste Teil der Arbeit wird sich mit Gemeinsamkeiten und Unterschieden der touristischen Entwicklung auf Mallorca und Korsika befassen. Zentrale Themen hierbei sind die historischen Dimensionen, die strukturelle Entwicklung, die Auswirkungen bzw. Konfliktpotentiale, die der Fremdenverkehr mit sich bringt, sowie die spezifische Touristikpolitik der beiden Inseln. Dieser Teil dient einerseits zur Beschreibung der touristischen Bedingungen – mit allen positiven und negativen Folgen - in der Gegenwart sowie andererseits zur Darstellung von politischen Zielvorstellungen der zukünftigen Entwicklung des Fremdenverkehrssektors auf Mallorca und Korsika. Diese dienen als Grundlage für die in dieser Arbeit vorgestellten Entwicklungskonzepte.
Im zweiten Teil der Arbeit werden die theoretischen Grundlagen des Kulturtourismus beschrieben. Er soll in kurzer Form die Arten bzw. Konzepte des Kulturtourismus, den kulturtouristischen Markt, die Chancen und Risiken sowie die Bedingungen und Fördermöglichkeiten für den Kulturtourismus in der EU, in Spanien und in Frankreich darstellen. Er dient zur Grundlagenbildung und zur Herleitung für die anschließend ausgearbeiteten kulturtouristischen Konzepte auf Mallorca und Korsika.
Der Hauptteil der Arbeit stellt zwei spezifisch kulturtouristische Entwicklungskonzepte ( Ein Fahrradrundweg auf Mallorca und ein Weitwanderweg auf Korsika) für die prähistorischen Kulturdenkmäler auf beiden Inseln vor. Er gibt genaue Angaben zu der jeweiligen Vorgeschichte und deren Architektur, nimmt eine regionale Abgrenzung vor und stellt die Zielvorstellungen und strukturellen Maßnahmen für die Konzepte vor. Anschließend folgt die Darstellung des geplanten Routenverlaufs mit exakter Beschreibung der einzelnen Etappen und der zu besichtigenden Kulturstätten.
2. Die touristische Entwicklung auf Mallorca und Korsika
2.1. Historische Dimensionen
Die historische Entwicklung des Tourismus auf Mallorca lässt sich in zwei große, weitestgehend voneinander unabhängige Phasen aufteilen:
1. der Sommerfrischetourismus des mallorquinischen städtischen Mittelstandes und der gehobene Wintertourismus im 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts
2. der internationale Massentourismus seit dem Ende der 50er Jahre
Fremdenverkehrsartige Erscheinungen haben auf Mallorca eine lange Tradition. Bereits zu Beginn des 19. Jahrhunderts verbrachten Angehörige der spanischen Oberschicht, vornehmlich Teile des Adels und des landbesitzenden Großbürgertums, die Wintermonate in Palma und Umgebung. Kleinere Gruppen von Künstlern, Schriftstellern und Musikern, denen es an der französischen Riviera bereits zu unruhig geworden war, ergänzten die Schar der ersten Touristen. Zu diesem Zweck entstanden im heutigen Stadtteil El Terreno von Palma die ersten Villen, die ursprünglich nur saisonal genutzt wurden und außerhalb der damaligen Stadt in den Hügeln lagen.[17]
Um die Jahrhundertwende erweiterte sich das Spektrum der Touristen auf Mallorca. Das städtische Bürgertum wurde zunehmend wohlhabender und adaptierte vermehrt die Verhaltensweisen spanischer Adliger. Daraus resultierte die verstärkte Nachfrage nach einem Sommerfrischen-Aufenthalt außerhalb städtischer Siedlungen. Zu diesem Zeitpunkt entstanden die ersten Sommerhäuser des Bürgertums östlich von Palma. Dies waren die ersten Gebäude, die zu einem rein touristischen Zweck errichtet wurden. Auf dem Gebiet jener Sommerhäuser liegt heute der Inbegriff des Massentourismus auf den Balearen: El Arenal.[18]
Ab Mitte der 20er Jahre nahm der Zustrom der Feriengäste immer mehr zu. Besonders die Zahl der englischen Touristen stieg deutlich an, so dass erste fremdsprachige Zeitungen erschienen. Da die Umgebung von Palma mittlerweile zur Befriedigung der touristischen Bedürfnisse nicht mehr ausreichte, wurden weitere Gebiete, wie z. B. Pollensa oder Cala d’Or, für den Fremdenverkehr erschlossen. Der Ausbruch des spanischen Bürgerkrieges verhinderte bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs einen weiteren Ausbau der mallorquinischen Fremdenverkehrs-Infrastruktur.[19]
Die nach dem Krieg einsetzende Entwicklung des Tourismus lässt sich grundlegend von der vorherigen unterscheiden. Die Aufhebung des wirtschaftlichen und politischen Embargos, das die UNO über das faschistische Regime Francos verhängt hatte, ermöglichte Spanien die staatlich organisierte Förderung des Fremdenverkehrs. Europa entdeckte das Mittelmeer wieder als bevorzugte Urlaubsregion, was mehrere Gründe hatte, z. B. den „Kult der Sonnenanbetung“[20], das niedrige Niveau der Lebenshaltungskosten an den mediterranen Küsten und besonders die Entwicklung des Charterflugverkehrs, der die Erreichbarkeit der Balearen wesentlich vereinfachte und den Urlaub kostengünstiger gestaltete. Die Lage des Inselflughafens Son Sant Joan in der Nähe der Hauptstadt Palma ermöglicht zudem die optimale Durchführung eines Transfersystems zu den umliegenden Küstengebieten der Insel, da nie mehr als 70 km zu bewältigen sind.[21] Die touristische Entwicklung auf Mallorca seit 1960 lässt sich verkürzt in fünf verschiedene Phasen einteilen[22]:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 3: Entwicklung der Einwohner- und Touristenzahl auf Mallorca zwischen 1960 und 1991 (Angaben in Tausend)
(Quelle: Schmitt 1993, S. 460)
Abb. 3 verdeutlicht die oben genannten Phasen und zeigt zudem den Kontrast zwischen der enormen Steigerungsrate der Touristenzahlen und der geringfügig steigenden Rate des Bevölkerungszuwachses. Bis zum heutigen Zeitpunkt erfreut sich Mallorca einer steigenden Beliebtheit bei seinen Besuchern, was unter anderem der Ausbau des Flughafens von Palma verdeutlicht. Ein Abflauen des Booms ist in der näheren Zukunft nicht abzusehen.
Die touristische Entwicklung auf Korsika setzte bei weitem nicht zu einem so frühen Zeitpunkt wie auf Mallorca ein. Die Reisenden, die vom 18. Jahrhundert bis Mitte des 20. Jahrhunderts Korsika besucht haben, kann man kaum als Touristen im herkömmlichen Sinne bezeichnen. Ein wenig Bekanntheit erlangte die Insel durch Einzelreisende, wie z. B. durch die Franzosen Balzac und Mérimée[23] oder den deutschen Ferdinand Gregorovius[24], die Korsika in Form von Reisebeschreibungen oder Novellen[25] rühmen. Das Beherbergungsangebot war allerdings noch nicht auf Reisende eingestellt, so dass jene Besucher bei Freunden, Verwandten oder der korsischen Bevölkerung übernachten mußten. Korsika blieb dem Tourismus so lange verborgen, dass sogar noch Mitte dieses Jahrhunderts von der „archaischen Insel“[26] gesprochen wurde.
Erst in den 70er Jahren wurde die Insel von dem internationalen Massentourismus entdeckt. Von Frankreich im Zuge der internationalen Arbeitsteilung als Tourismusregion deklariert[27], greifen zu diesem Zeitpunkt die ersten Maßnahmen zum Ausbau des Fremdenverkehrssektors. Die folgende Tabelle zeigt den Anstieg der Touristenzahlen seit 1960.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Tab. 1: Entwicklung der Besucherzahlen auf Korsika von 1960-1995
(Quelle: nach Culioli 1995, Lücke 1980, Pulver 1988 u. Siegfried-Hagenow 1991)
Die erste sprunghafte Entwicklung zeichnete sich in den 60er Jahren ab als die Insel erstmals in den Interessensbereich ausländischer Feriengäste geriet. In den 70er Jahren vollzog sich der nächste Entwicklungssprung, bis gegen Ende des Jahrzehnts erstmalig die Millionengrenze erreicht wurde. In den folgenden zehn Jahren stiegen die Touristenzahlen zwar stetig an, aber von einem Entwicklungsboom, wie z. B. auf Mallorca, konnte in dieser Zeit nicht gesprochen werden. In den 90er Jahren pendelte sich die Zahl der Urlauber dann auf ca. 1,5-1,8 Millionen ein. Große Wachstumserfolge waren in diesem Zeitraum nicht zu verzeichnen. Die Zahl der Besucher war in den letzten Jahren eher einigen Schwankungen unterworfen, wie die folgende Abbildung verdeutlicht.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 4: Anstieg der jährlichen Besucher auf Korsika
(Quelle: INSEE 1999, S. 211)
Die Stagnation der Touristenzahlen im Verlauf der letzten Jahre ist zum einen auf die politische Situation der Insel[28], zum anderen auf das hohe Preisniveau[29], die relativ teuren Transportkosten, das schlechte Preis-Leistungs-Verhältnis sowie das Währungsgefälle (Starker Franc, schwache Lira)[30] zurückzuführen. Ein Boom des Fremdenverkehrssektors, wie er sich auf Mallorca in den 90er Jahren ereignet hat, ist auf Korsika weder erwünscht, noch abzusehen. Investoren halten sich aufgrund möglicher Sprengstoffanschläge auf touristische Einrichtungen[31] merklich zurück und potentielle Urlauber treten oftmals wegen der „schlechten Presse“ in mitteleuropäischen Zeitungen ihre Reise nicht an. Dadurch besteht für Korsika die große Chance durch die Realisierung selbstständig entwickelter Projekte, Programme und Imagekampagnen die erwünschte Form eines „Qualitätstourismus“[32] zu fördern und somit größere Besucherzahlen auf die Insel zu locken. Der Anstieg der Touristenzahlen, der im Jahre 2000 auf bis zu drei Millionen prognostiziert wird[33], verdeutlicht erste Erfolge dieser Strategie.
2.2. Strukturelle Entwicklung
Der „Sonne-und-Strand-Boom“[34], der in den 60er Jahren in den mitteleuropäischen Ländern einsetzte, bewirkte auf den Balearen eine einzigartige touristische Entwicklung mit einer enormen Quantität an Besucherzahlen. Die folgende Tabelle verdeutlicht den stetigen Zuwachs und die Herkunft der Urlauber auf Mallorca seit 1950.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Tab. 2: Die touristische Entwicklung auf Mallorca (Angaben in Tausend)
(Quelle: nach Bardolet 1992, S. 41)
Charakteristisch für die Gesamtentwicklung der Touristenzahlen auf Mallorca ist die immer noch gewaltig ansteigende Rate ausländischer Besucher. Sie haben das Verhältnis gegenüber inländischen Touristen im Laufe der Jahrzehnte deutlich umgekehrt. Mittlerweile macht der ausländische Tourismus auf den Balearen 83 % und der spanische 17 % des gesamten Fremdenverkehrs aus[35]. In den 90er Jahren hat die jährliche Zahl der Touristen auf Mallorca bereits die 5-Millionen-Grenze[36] überschritten und die Regionalregierung rechnet aufgrund des Ausbaus des Flughafens von Palma offensichtlich mit einem weiteren Anstieg.
Bei der Aufteilung der Touristenzahlen nach Nationalitäten fallen zwei Gruppen besonders auf: die Briten und die Deutschen. Diese beiden Nationalitäten stellten mit Abstand die größten Kontingente an Mallorca-Urlaubern. Im Jahre 1991 ergaben sie zusammen 58 % der gesamten Urlauber auf der Insel[37]. Der Anteil der Deutschen ist seit den 50er Jahren kontinuierlich angestiegen, während der Anteil der Briten aufgrund wirtschaftlicher Krisen im Herkunftsland Ende der 80er Jahre deutlich zurückging. Jener Rückgang der britischen Besucherzahlen löste die touristische Krise zu diesem Zeitpunkt aus, da der Zuwachs anderer Nationalitäten den großen Anteil britischer Touristen nicht vollständig ausgleichen konnte[38]. Aus diesem Grunde besteht für Mallorca stets die Gefahr sich in die Abhängigkeit deutscher und britischer Touristen zu begeben, da Urlauber anderer Nationalitäten nur eine vergleichsweise marginale Rolle in der Fremdenverkehrsstruktur spielen. Die folgende Abbildung verdeutlicht das Ungleichgewicht der ausländischer Besucher Mallorcas.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 5: Prozentualer Anteil der ausländischen Einreisenden am Flughafen von Palma nach Herkunftsländern 1990/91
(Quelle: Schmitt 1993, S. 460)
Die lokale und saisonale Verteilung der gewaltigen Touristenzahlen, die jedes Jahr auf Mallorca steigen (1991 war die Zahl der Touristen bereits um ein Siebenfaches höher als die Einwohnerzahl Mallorcas[39] ), ist besonders interessant und lässt Rückschlüsse auf die Präferenzen der Urlaubsart zu. Die größten Besucherzahlen verbuchen die Sommermonate für sich. Die folgende Abbildung belegt die Bevorzugung der Sommermonate durch ausländische Feriengäste anhand der Flugbewegungen am Flughafen von Palma. Auffällig ist zudem ein relativ hoher Prozentsatz von Einreisen in der Vor- und Nachsaison, respektive in den Monaten Mai, September und Oktober. Lediglich die Wintermonate November bis Februar fallen deutlich heraus bei dieser Betrachtung.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 6: Monatliche Verteilung der ausländische Einreisenden am Flughafen von Palma 1990/91
(Quelle: Schmitt 1993, S. 461)
Die monatliche Verteilung der Einreisen spricht eindeutig für die Ausbildung einer ausgesprochenen Sommersaison, die zum größten Teil auf den Badetourismus entlang der Küstenzonen ausgerichtet ist. Als Indikator hierfür können die Übernachtungsplätze in den einzelnen touristischen Zonen Mallorcas dienen. Die folgende Karte verdeutlicht die einseitige Ausrichtung der Beherbergungsangebote auf die Küstenzonen. Die größte Konzentration ist am Golf von Palma mit den Hochburgen El Arenal, Cala Mayor und Magaluf festzustellen, gefolgt von der Ostküste und dem Nordosten. Das Landesinnere und die Westküste spielen hierbei eine untergeordnete bzw. nahezu keine Rolle, was für eine starke touristische Unterentwicklung hinsichtlich der Übernachtungsmöglichkeiten in diesen Gebieten spricht.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 7: Mallorca: Hotelkapazität (Stand 1992)
(Quelle: Schwede 1999, S. 14)
Zusammenfassend weist der mallorquinische Fremdenverkehr folgende Eigenschaften auf[40]:
- Küstentourismus
Durch Konzentration der Beherbergungsangebote auf die Küstenzonen entsteht eine einseitige Ausrichtung auf bestimmte Gebiete. Das Landesinnere hat bisher keine entscheidenden Impulse für eine Nutzung durch den Fremdenverkehr erhalten. For- men des „ländlichen Tourismus“ sind vom Urlauber noch nicht in einer quantitativ nennenswerten Weise angenommen worden.
- Urlaubstourismus
Die Ansprüche, die Mallorca-Reisende an ihren Urlaub stellen, sind überwiegend einseitiger Natur. Das Bedürfnis nach Sonne, Strand und Meer, und die damit verbundene Erholungsfunktion, steht im Vordergrund. Die kulturellen Sehenswür- digkeiten im Landesinneren finden lediglich in Form von Tagesausflügen, die zu- meist pauschal von Reiseunternehmen angeboten werden, Bedeutung.
- Hotelcharakter
Im Wesentlichen besteht das Angebot Mallorcas aus Hotels, Appartements mit Hotelcharakter und Pensionen. Campingurlaub und Urlaub auf traditionellen Fincas finden zahlenmäßig kaum Beachtung.
- Urlaub über Reiseveranstalter
Ein Großteil der Urlauber bucht eine Pauschalreise bei einem Reisebüro im Her- kunftsland. Somit kommen über 80 % der Touristen unter Mithilfe eines Reisever- anstalters auf die Insel, auch wenn die Tendenz zu „seat only“ bei den Charterflü- gen geht. Individualtourismus steht, auch aufgrund der ungünstigen Reisebedingun- gen für diese Form des Tourismus, absolut im Hintergrund.
- Saisonabhängig
Die monatliche Verteilung der Einreisen wurde bereits weiter oben beschrieben und spiegelt den Saisoncharakter des Fremdenverkehrs eindeutig wieder. Festzustellen bleibt, dass ca. zwei Drittel der Touristen Mallorca während der Hauptsaison besuchen, ein Viertel während der Vor- und Nachsaison und etwas über 10 % außerhalb der Saison.
- Mittlere Qualität
Die Gesamtausstattung des Fremdenverkehrssektors auf Mallorca ist von eher mittlerer Qualität. Ein bedeutendes Angebot an Luxushotels ist, mit Ausnahme eines Bereichs zwischen Illetas und Magaluf[41], nicht vorhanden. Die steigende Zahl der Golfplätze deutet allerdings auf den Wunsch nach zahlungskräftigerem Klientel hin[42].
Ein touristisch und demographisch bedeutsamer Aspekt der Nutzung durch den Fremdenverkehr bleibt noch anzumerken: der Residenzialtourismus. Gerade in Deutschland ist es in vielen gesellschaftlichen Kreisen schick geworden, einen Zweitwohnsitz auf Mallorca zu haben. Negative Folgen dieser Tourismusform, die sich im Gegensatz zum normalen Urlaubstourismus nicht auf die Küstenbereiche beschränkt, sind einer hoher Leerstand jener Wohnungen während des Großteils des Jahres und die Raumbelastung, die daraus entsteht[43].
Auf Korsika stellten sich Tendenzen des internationalen Massentourismus, wie bereits beschrieben, erst 10 Jahre später als auf Mallorca ein. Trotz deutlich geringerer Besucherzahlen hat die Insel mit ähnlichen Problemen wie die Hauptinsel der Balearen zu kämpfen. Die folgende Tabelle gibt Aufschluss über die wichtigsten Strukturdaten des Fremdenverkehrs auf beiden Inseln.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Tab. 3: Strukturdaten des Fremdenverkehrs von Korsika und Mallorca aus dem Jahr 1992
(Quelle: Lücke 1998, S. 138)
Durch die wesentlich geringere Einwohnerzahl ergeben sich für Korsika ähnlich große Belastungen für die Bevölkerung durch den Fremdenverkehr. Im Bereich der Gäste pro Einwohner liegen beide Inseln in etwa gleichauf, doch im Bereich der Betten pro Einwohner liegt Korsika weit vorne. Diese Zahlen mögen, aus Angst vor einer massiven Überfremdung, zu der Verweigerungshaltung der korsischen Bevölkerung gegenüber dem modernen Massentourismus beitragen[44]. Die folgende Abbildung verdeutlicht die Ausnahmestellung beider Inseln im gesamten Mittelmeerraum hinsichtlich des touristischen Drucks[45], der auf sie ausgeübt wird.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 8: Der touristische Druck auf den Inseln des Mittelmeerraumes im Jahr 1995 (Quelle: INSEE 1999, S. 15)
Wenn man die Verteilung der Besucher auf Korsika nach Nationalitäten betrachtet, fallen einige Unterschiede gegenüber Mallorca ins Auge. Während die Baleareninsel hauptsächlich von ausländischen Touristen profitiert, ist auf Korsika der Anteil der inländischen Urlauber, d. h. der der Franzosen, besonders hoch. Dies ist dadurch zu erklären, dass ein großer Teil dieser Besucher korsischer Abstammung ist und die Zeit der Sommermonate bei seinen Familienangehörigen verbringt[46]. Die folgende Abbildung verdeutlicht die große Anzahl französischer Touristen auf Korsika.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 9: Verteilung der jährlichen Touristenzahlen auf Korsika nach Nationalitäten (Quelle: INSEE 1999, S. 211)
Ausländische Touristen machen demnach einen wesentlich geringeren Anteil als inländische aus. Für den Fremdenverkehr relevante Besucherzahlen können nur deutsche und italienische Touristen für sich verbuchen. Übrige Nationalitäten spielen keine große Rolle.
Die hohen Besucherzahlen von mittlerweile über 1,5 Millionen Urlauber pro Jahr[47] weisen einen rein saisonalen Charakter auf. Über 90 % der Feriengäste besuchen die Insel während der vier Sommermonate[48], was erhebliche Beeinträchtigungen für die Auslastung der Fremdenverkehrseinrichtungen während der übrigen Monate mit sich bringt[49] und demzufolge entsprechende Konsequenzen für den Arbeitsmarkt außerhalb der Hochsaison hat[50].
Doch die Struktur des Fremdenverkehrs auf Korsika weist neben der saisonalen Konzentration noch eine räumliche auf. Über 85 % der Touristen konzentrieren sich auf die Küstenbereiche der Insel[51]. Bevorzugte Standorte sind die gesamte Ostküste, der Golf von Ajaccio, der Golf von Valinco sowie der Küstenabschnitt zwischen Calvi und Ile-Rousse. Die Konzentration auf diese Gebiete – wie Abb. 10 deutlich zeigt – ist vorwiegend durch die ungünstige Reliefstruktur der übrigen Insel zu erklären. Große Teile der Westküste und des Landesinneren lassen sich aufgrund fehlender Infrastruktur, unzureichender Siedlungsstruktur und großer Höhenunterschiede auf engem Raum nicht für den Massentourismus im Stile spanischer Fremdenverkehrsurbanisationen erschließen[52].
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 10: Die touristische Erschließung und Beherbergungskapazität Korsikas
(Quelle: Lücke 1998, S. 142)
Die Struktur des Fremdenverkehrs auf Korsika lässt sich wie folgt zusammenfassen[53]:
- Küstentourismus
Durch die einseitige Ausrichtung des Fremdenverkehrs auf bestimmte Küstenab- schnitte steigt die Abhängigkeit jener Gebiete. Alternative Formen des Tourismus sind auf Korsika zwar existent, besitzen aber keine nennenswerte quantitative Be- deutung.
- Urlaubstourismus
Vorwiegende Urlaubsbedürfnisse der Korsika-Reisenden sind - wie auf Mallorca - Sonne, Strand und Meer. Kulturelle Sehenswürdigkeiten und die Sportmöglichkei- ten, die die einzigartige Naturlandschaft der Insel bietet, werden von Touristen zwar vermehrt angenommen, schlagen sich in der Fremdenverkehrsstatistik aber nicht nennenswert nieder.
- Campingcharakter
Im Wesentlichen besteht das Beherbergungsangebot Korsikas aus Campingplätzen und Feriendörfern. Hotels spielen bei den gewerblichen Übernachtungen nur eine untergeordnete Rolle.[54]
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 11: Beherbergungsarten und deren Anteil auf Korsika 1997
(Quelle: INSEE 1999, S. 215)
- Untere bis mittlere Qualität
Der Anteil der Campingplätze lässt auf eine eher geringe Qualität der Gesamtaus- stattung des Fremdenverkehrssektors schließen. Ein bedeutendes Angebot an Lu- xushotels ist bis auf einige Abschnitte im Golf von Ajaccio und auf der Ile Cavallo[55] nicht vorhanden.
Korsika ist auf dem Weg die bestehenden Strukturen der saisonalen und räumlichen Konzentration zu beseitigen[56]. Konzepte zur Stärkung der Binnenregionen sowie der touristischen Nutzung der einzigartigen Naturlandschaft können der Insel zu entscheidenden Impulsen in Richtung eines nachhaltigen, naturnahen und sanften Tourismus geben.
2.3. Auswirkungen und Konfliktpotentiale des Tourismus
2.3.1. Ökonomische, ökologische und demographische Folgen auf Mallorca
Die Baleareninsel Mallorca gilt seit den 60er Jahren als Inbegriff des Massentourismus und spätestens seit den 80er Jahren als Negativbeispiel einer einseitig auf den Fremdenverkehr ausgerichtete Region. Der unkontrollierte Ausbau der touristischen Infrastruktur führte zu zahlreichen negativen Auswirkungen, die unter Schlagwörtern wie „Betonburgen“, Zersiedlung und Zerstörung der Landschaft, Wasserknappheit und Überfremdung treffend charakterisiert werden können.
Die einseitige Ausrichtung auf den Tourismus führte in den letzten 100 Jahren zu einem drastischen Wandel in den Wirtschaftssektoren, wie die folgende Tabelle deutlich herausstellt[57].
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Tab. 4: Beschäftigung auf Mallorca nach Wirtschaftssektoren im Jahresvergleich
(Quelle: Angaben nach Bardolet 1992, S. 38)
Der ursprünglich dominante Sektor der Landwirtschaft spielt Ende dieses Jahrhunderts nur noch eine untergeordnete Rolle. Der starke Anstieg des tertiären Sektors ist mit dem enormen Wachstum des Tourismussektor zu erklären. Davon profitiert auch der sekundäre Sektor in Gestalt des Baugewerbes, das allerdings von den Aufträgen aus der Tourismusbranche abhängig ist. Mittlerweile ist die gesamte Wirtschaft Mallorcas praktisch als „Monokultur“ ausgewiesen, was längerfristig zu einer potentiellen ökonomischen Gefährdung führen kann[58].
Die massive touristische Entwicklung der Insel hat jedoch nicht nur zu ökonomischen Nachteilen geführt. Die Balearen erwirtschaften in Spanien das höchste Regionale Brutto-Produkt (RBP)[59] des gesamten Staates und das durchschnittliche Pro-Kopf-Einkommen lag auf Mallorca 1998 mit ca. 43.000 DM doppelt so hoch wie auf dem Festland[60]. Diese unbestreitbaren Vorteile der touristischen Entwicklung mögen Anlass für die erst relativ spät einsetzende Kritik an der unkontrollierten Bautätigkeit gewesen sein.
Mit dem wirtschaftlichen Aufschwung der Insel vollzog sich auf Mallorca auch ein demographischer Wandel. Seit den 60er Jahren ist die demographische Entwicklung durch ein positives Wanderungssaldo gekennzeichnet. Im Gegensatz zu den hohen Auswanderungsraten früherer Jahrzehnte ist Mallorca derzeit Einwanderungsgebiet für Arbeitssuchende aus Süd- und Zentralspanien[61]. Die Regionen positiver Wanderungssalden sind die größeren Städte, z. B. Palma und Inca, sowie die durch den Tourismus geprägten Küstenzonen. Die ländlichen Gemeinden dagegen sind von einer hohen Abwanderungsrate und Überalterung geprägt[62]. Ein zweiter Faktor der Zuwanderung sind die Zweitwohnsitze der sogenannten „Residenztouristen“. Die hohe Zahl jener ausländischer und festlandspanischer Residenten, die größtenteils ihre Wohnungen und Anwesen nur temporär nutzen, führt in manchen Orten (besonders im Landesinneren) zu einer massiven Überfremdung[63]. Mangelnde Integration und der Aufbau eigener sozio-kultureller und ökonomischer Milieus fördern die Opposition der Einheimischen gegen die „Invasoren“.
Neben den wirtschaftlichen und demographischen Auswirkungen sind die negativen ökologischen Folgeerscheinungen des Tourismusbooms auf Mallorca Inbegriff für eine durch den Fremdenverkehr übermäßig beanspruchte Umwelt. Die hohen Raum- und Nutzungsansprüche der Reisebranche bewirkten im Laufe der letzten Jahrzehnte zahlreiche Zerstörungen der Landschaft. Die Ausdehnung der Urbanisationsflächen hat weder störanfällige Ökosysteme geschont, noch Inselbereiche von landschaftlichem Reiz. Besonders betroffen von der Ausweitung der Siedlungsfläche sind die Ökosysteme, die nahe den Küstenzonen liegen, wie z. B. Stranddünen, Sümpfe und Felsküsten. Da bereits 80 % der mallorquinischen Küstenstreifen zugebaut sind[64], ist der Verlust jener Gebiete aus Umweltgesichtspunkten irreversibel. Beispiele für eine völlige Zerstörung bzw. starke Degradation von Küstenökosystemen sind: Santa Ponsa, Port d’Alcudia, C’an Picafort und Platja de Palma – El Arenal, mit dem ehemals größten Dünengürtel der Insel. Doch auch außerhalb der verdichteten Siedlungsbereiche an der Küste hinterlassen die Belastungen durch den Tourismus Spuren. Reiter, Safari-Jeeps, Motorradfahrer, Fußgänger und Mountainbiker verursachen mechanische Schäden an Boden und Vegetation[65]. Die hohe Anzahl der Leihwagen und der Ausbau des Straßennetzes schädigen direkt oder indirekt die Ökosysteme der ländlichen Gebiete, wie z. b. die Serra de Tramuntana. Ein weiterer kritischer Punkt ist der enorme Wasserverbrauch, der gerade in den Sommermonaten immer wieder zu Engpässen führt[66]. In den letzten Jahren mußte Wasser aus dem Ebrodelta mit Schiffen nach Mallorca transportiert werden[67], da die natürlichen Ressourcen nicht mehr ausreichten, den Wasserverbrauch von Golfplätzen[68] und der Masse der Touristen zu befriedigen.
Die zahlreichen negativen ökologischen Auswirkungen haben jedoch ein Umdenken im Hinblick auf einen Natur- und Landschaftsschutz bewirkt, der den authentischen Charakter der natürlichen Landschaft zumindest in den Gebieten, in denen er noch halbwegs intakt ist, erhalten soll[69].
2.3.2. Politische Konflikte auf Korsika
Der Ausbau des Tourismussektor auf Korsika hat der Insel bei weitem nicht die ökonomischen Vorteile wie auf Mallorca gebracht, dagegen ebenso wenig jene gravierenden ökologischen Folgeerscheinungen. Dies ist auf zwei miteinander verbundene Aspekte zurückzuführen. Zum einen konzentriert sich die Fremdenverkehrsbranche seit Beginn der touristischen Entwicklung zu einem überwiegenden Teil auf ausländische Investoren[70], die die erwirtschafteten Gewinne nicht auf der Insel reinvestieren[71]. Daraus resultieren ein auf französischer Ebene sehr niedriges Pro-Kopf-Einkommen und erhöhte Lebenshaltungskosten, die aufgrund der Einfuhr von Konsumgütern vom Kontinent entstehen[72].
Der wichtigere Aspekt, warum der Tourismus sich auf Korsika nicht so, wie in anderen Regionen des Mittelmeerraums entwickelt hat, spielt sich auf einer anderen Ebene ab. Seit Jahrhunderten wehren sich die Korsen mit einem unbändigen Willen gegen jene wechselnden Okkupatoren, die die Insel im Laufe der Geschichte immer wieder besetzten. Daraus entwickelte sich mit der Zeit eine Mentalität, die sich gegen jedes Fremde und jede Veränderung wehrt. Es besteht auf Korsika eine „tiefverwurzelte Angst vor dem Massenphänomen Tourismus. Eine Angst, überrollt zu werden von einer Invasion, die alljährlich über die Insel hereinbricht, so wie früher die Eroberer vom Meer her eingefallen sind.“[73]
Auf jener psychologischen Ebene beruht die Abneigung der Korsen gegen den Zentralstaat in Paris, der sie seit der Übernahme der Insel von den Genuesen im Jahre 1768 nur ungerecht behandelt habe. Somit lösen Entscheidungen in Paris stets einen Emotionalisierungsprozeß aus, der sich seit Mitte der 70er Jahre in einem gefährlichen politischen Klima ausdrückt. Bevor es jedoch zu jenen politischen Gewalttaten, die Korsika das Image einer Insel des Terrors gaben, kam, bedurfte es einer längeren Vorlaufzeit in diesem Jahrhundert. Wirtschaftlich schon im 19. Jahrhundert von Frankreich ausgeblutet[74], wurde Korsika während der beiden Weltkriege und des Krieges in Indochina von Frankreich als Reservoir für einfache Soldaten, von denen ein Großteil nicht zurückkehrte, genutzt. Daraus resultiert der große Bevölkerungsrückgang, von dem sich das korsische Volk bis heute nicht erholt hat, und der viele Ackerbaugebiete immer noch brachliegen lässt.
Den eigentlichen Grundstein des bewaffneten Kampfes der Korsen legte die Pariser Zentralregierung Ende der 50er Jahre. Zwei wesentliche Faktoren begünstigten den Zulauf der nationalistischen Gruppen. Zum einen wurde ein großangelegter Entwicklungsplan vorgestellt, der den Ausbau der Insel zum reinen Tourismusparadies vorsah. Jener Plan provozierte eine gewaltige Bau- und Immobilienspekulation durch ausländische Investoren, die bereits einen Großteil der Küste in ihre Hände gebracht hatten[75]. Der zweite Faktor war die massenhafte Niederlassung von Algerien-Franzosen, den sogenannten „Pieds-Noir“, an der Ostküste. Der französische Staat förderte jene Bevölkerungsgruppe, die nach dem Zusammenbruch der französischen Herrschaft in Algerien heimatlos geworden war, durch die Bereitstellung großzügiger Kredite und die Urbarmachung der besten landwirtschaftlichen Gebiete der Insel, die seit jeher malaria-verseucht waren. Durch die Bevorzugung der ca. 17 500 Nordafrika-Franzosen fühlte sich ein Teil der Bevölkerung diskriminiert[76]. Bereits Mitte der 60er Jahre formierten sich die ersten nationalistischen Bewegungen, die eine Front gegen den Pariser Zentralismus bilden wollten, sich aber schon nach kurzer Zeit wieder auflösten[77]. Bis Mitte der 70er Jahre funktionierte das Zusammenleben zwischen Korsen und Neuansiedlern aufgrund der wirtschaftlich günstigen Lage. Auftakt zu einer Eskalation der Gewalt war das sogenannte „Drama von Aleria“. Ausgelöst durch einen Weinpansch-Skandal der Algerien-Franzosen besetzten 1975 bewaffnete korsische Nationalisten unter der Führung der Brüder Siméoni das Weingut des Henri Depeille. Der folgende Aufmarsch von 2000 französischen Soldaten endete mit dem Tod von 2 Gendarmen und der Inhaftierung der Nationalisten. Eine bis dahin nicht gekannte Solidaritätswelle ergriff die gesamte Insel. Neue Bewegungen formierten sich und nahmen unter verschiedenen Vorstellungen von Autonomiebestrebungen den bewaffneten oder verbalen Kampf gegen die Pariser Zentralregierung auf. Neben Einrichtungen des französischen Staates wurden in der Folgezeit Tourismuseinrichtungen vermehrt Ziele von Sprengstoffanschlägen[78]. Unter dem Deckmantel, Korsika vor einer „Balearisierung“ zu schützen, genossen jene Anschläge die Sympathie der Bevölkerung[79]. Frankreich reagierte teils mit Repressionen, teils mit Zugeständnissen an das korsische Volk. 1981 wurde die korsische Universität in Corte eröffnet und ein Jahr später das erste Regionalparlament mit begrenztem Autonomiestatus eingerichtet[80]. Doch die korsischen Nationalisten verstanden es aufgrund des vom allgegenwärtigen Clanwesen bestimmten Wahlrecht nicht, ihre Interessen in der Regionalversammlung wahrzunehmen[81].
In den 90er Jahren zerfällt die nationalistische Bewegung zunehmend in Splittergruppen, die durch interne Fehden und mafiöse Strukturen gekennzeichnet sind. Gewalt gegenüber verfeindeten Gruppen prägen den korsischen Nationalismus zur Zeit mehr, als der einst visionäre Kampf um kulturelle Identität. Die Sympathie der Bevölkerung für die Extremisten schwindet zusehend, kaum noch jemand befürwortet die Unabhängigkeit von Frankreich[82]. Frauengruppen, ehemalige bewaffnete Kämpfer, korsische Musiker und die Kirche propagieren mittlerweile öffentlich eine Abkehr von den Gewaltaktionen, die der Insel ein so schlechtes Image verleihen, dass die Touristen ausbleiben[83].
Doch welche Konsequenzen ergeben sich aus dem mittlerweile 25 Jahre dauernden bewaffneten Kampf? Können die erstrittenen Vorteile die ökonomischen Nachteile aufwiegen? Auf Korsika besteht die einhellige Meinung, dass "ohne die Nationalisten gar nichts möglich gewesen wäre. Die Insel wäre genauso zubetoniert wie die Balearen; der Naturschutzpark und die Universität würden nicht existieren, die Sprache wäre tot“[84]. Die Auswirkungen hinsichtlich der touristischen Entwicklung sind enorm. Die großen Konzerne der Reisebranche investieren aus Angst vor Sprengstoffanschlägen nicht mehr auf der Insel und die einfachen Touristen bleiben aufgrund der schlechten Presse im übrigen Europa aus. Hinzu kommen ein extrem hohes Preisniveau im Vergleich zu anderen Mittelmeerregionen und ein schlechtes Preis-Leistungs-Verhältnis, was zu stagnierenden Bettenzahlen führt[85].
Doch gerade durch seine Verweigerung gegenüber dem internationalen Massentourismus hat Korsika eine einmalige touristische Chance, weil die Insel nicht so zugebaut wie andere Regionen des Mittelmeerraums ist und die Fehler Mallorcas vermeiden kann. Die Alternative wäre ein Qualitätstourismus, der große Teile der Bevölkerung mit einbeziehen kann und sich an den Leitthesen der Nachhaltigkeit orientiert. Erste Ansätze sind mit der Einrichtung des Naturschutzparks und den dort angelegten Wanderregionen bereits verwirklicht. Welche Auswirkungen solche Konzepte auf die Insel haben, wird die Zukunft zeigen.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 12: Anschläge auf touristische Einrichtungen auf Korsika
(Quelle: Lücke 1994, S. 344)
2.4. Touristikpolitik
Die touristische Entwicklung auf den Balearen war bis in die 80er Jahre gekennzeichnet durch das weitgehende Fehlen raumordnerischer und raumplanerischer Konzepte sowie eine mangelhafte Gesetzgebung[86]. 1983 konnte Mallorca endlich über sein eigenes Territorium verfügen, da die Insel erst zu diesem Zeitpunkt die politische Autonomie innerhalb der autonomen Kommunen des Staates Spanien erhielt[87]. Damit war der Grundstein zu einer Gesetzgebung gelegt, die eine planvolle Entwicklung des Fremdenverkehrs und eine Regulierung der Nutzungsansprüche fördert. Folgende Gesetze bzw. Richtlinien wurden seitdem erlassen[88]:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten[89]
Verbesserung der touristischen Gebiete anhand der Anlage von begrünten Zonen für Dienstleistungen, Sport, Spaziergänge etc., wobei öffentliches Gelände geschaffen und die Beseitigung von Gebäuden ermöglicht wird.
Einige Gesetze sind Meilensteine in der touristischen Entwicklung der Balearen, da sie erstmalig den Willen zur Selbstbeschränkung innerhalb der freien Marktwirtschaft zeigen, wie die Sprengung mehrerer Hotelkomplexe der Gemeinde Calvià beweist[90]. Der Versuch, naturnahe und ökologisch wertvolle Biotope vor planlosen weiteren Erschließungsmaßnahmen durch die Touristikbranche zu sichern, ist anerkennenswert. Andererseits existiert auf Mallorca kein regional übergreifender Bebauungsplan, der die Erschließungen der gesamten Insel regulieren könnte[91]. Andere Maßnahmen, wie z. B. eine geplante Touristenabgabe mit Namen „Ökosteuer“, werden kontrovers diskutiert[92]. Es bleibt zu hoffen, dass die größte Baleareninsel es in den nächsten Jahren versteht, unter den Schlagwörtern „Naturschutz“ und „Qualitätstourismus“ sein Landschaftsbild, das die Basis des touristischen Erfolges ist, zu bewahren bzw. zu restaurieren.
Die Touristikpolitik setzte auf Korsika wesentlich früher als Mallorca ein. Bereits in den 50er Jahren entwickelte die Zentralregierung in Paris die ersten Pläne zum Ausbau des Fremdenverkehrssektors auf der Insel. Die Planung der staatlichen Seite fand jedoch von Anfang an ohne Beteiligung der korsischen Bevölkerung statt und war somit ein Grundpfeiler der „Kolonisation“, die der korsische Nationalismus zu bekämpfen versuchte. Die Touristikpolitik lässt sich wie folgt zusammenfassen[93]:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten[94]
Einrichtung einer Agentur zur Koordinierung der touristischen Entwicklung auf Korsika; Zielvorstellung der Agentur: Begrenzung des unkontrollierten touristischen Ausbaus in allen korsischen Fremdenverkehrsregionen; zu große Abhängigkeit vom Regionalparlament lähmt die Suche nach Lösungen der insularen Entwicklungsprobleme.
Bisher war die Touristikpolitik durch Planlosigkeit, Gewinnmaximierung und Rücksichtslosigkeit gegenüber natürlichen Bedingungen gekennzeichnet[95]. Positiv erwähnenswert ist lediglich die Schaffung des Naturparks im Inselinnern, der den Gebirgsregionen zu entscheidenden wirtschaftlichen Impulsen verhelfen konnte. Konkrete Maßnahmen touristischer Entwicklungen, die sich außerhalb von Formen des Massentourismus bewegen, bleiben größtenteils der Eigeninitiative von einzelnen Gemeinden, wie z. B. Pigna[96] und Lama[97], überlassen.
3. Theoretische Grundlagen des Kulturtourismus
Reisen zu kulturellen Zwecken (Studien- und Bildungsreisen) besitzen eine lange Tradition in der Geschichte des Tourismus[98]. In den vergangenen Jahrhunderten waren die Bildungsreisen des gehobenen Bürgertums die vorherrschende Form des Reisens[99]. Erst nach dem Zweiten Weltkrieg übernahm der Sonnen- und Badetourismus die führende Rolle im europäischen Fremdenverkehr. Zu diesem Zeitpunkt gestattete das ungezügelte ökonomische Wachstum in den mitteleuropäischen Ländern einer breiten Bevölkerungsschicht die Möglichkeit eines Sommerurlaubes an den Stränden des Mittelmeeres[100]. Andere Formen des Fremdenverkehrs wurden in den Nachkriegsjahren an den Rand der Bedeutungslosigkeit gedrängt.
Mit dem gesteigerten Regionalbewusstsein und der Suche nach den eigenen historischen Wurzeln entstand in den 70er Jahren ein zunehmendes Bedürfnis nach alternativen Tourismusangeboten, besonders im kulturellen Bereich[101]. Seither ist die Nachfrage nach kulturtouristischen Angeboten und das Wachstum kultureller Produktionen zu Zwecken des Fremdenverkehrs stetig gestiegen und erfreut sich nach gegenwärtigem Stand einer ungebrochenen Konjunkturphase[102].
Der folgende Teil der Arbeit wird sich mit den theoretischen Grundlagen des Kulturtourismus auseinandersetzen, d. h. zunächst den Begriff definieren und systematisieren um anschließend auf den Markt, die Chancen und Risiken sowie auf die Möglichkeiten zur Förderung kulturtouristischer Angebote einzugehen.
3.1. Definitionen
Für den Begriff Kulturtourismus existiert in der Wissenschaft leider keine allgemein anerkannte Definition. Im deutschen Sprachraum wurde der Begriff erst in den 80er Jahren durch die EG eingeführt, während im französischen und englischen Sprachraum schon früher damit operiert wurde[103]. Die folgende Definition ist die am weitesten gefasste:
„Mit Kulturtourismus werden alle Reisen bezeichnet, denen als Reisemotiv schwerpunktmäßig kulturelle Aktivitäten zugrunde liegen.“[104]
Diese Definition verzichtet auf detaillierte Beschreibungen, welche Formen der Kultur für touristische Zwecke genutzt werden können und vernachlässigt räumliche Aspekte sowie die Bedingungen des Angebots und der Nachfrage. Genauer ist dagegen die folgende, in Deutschland weit verbreitete Definition[105]:
„Der Kulturtourismus nutzt Bauten, Relikte und Bräuche in der Landschaft, in Orten und Gebäuden, um dem Besucher die Kultur-, Sozial- und Wirtschaftsent- wicklung des jeweiligen Gebietes durch Pauschalangebote, Führungen, Besich- tigungsmöglichkeiten und spezifisches Informationsmaterial nahe zu bringen. Auch kulturelle Veranstaltungen dienen häufig dem Kulturtourismus.“[106]
Hierbei wird der Begriff der Kultur einer Region unter Einbeziehung der Hoch- und Alltagskultur genauer charakterisiert und der funktionale Aspekt möglicher kultureller Reiseformen in den Vordergrund gestellt[107]. Zusätzlich zu dieser Definition sollte berücksichtigt werden, dass Urlauber nicht ausschließlich kulturelle Reisemotive haben müssen, sondern Kultur als zusätzliche Form der Urlaubsgestaltung in Betracht ziehen können[108]. Hierbei würde dann der Kulturtourismus eine Vermittlungsrolle zwischen früheren und gegenwärtigen kulturellen Lebensweisen der einheimischen Bevölkerung und dem Reisenden übernehmen und somit die Schnittstelle zwischen Urlauber und Region darstellen[109]. Weitere, für diese Arbeit nicht relevante Definitionen sind bei Lindstädt 1994 (S. 9-13) und Weissenborn 1997 (S. 14-17) nachzulesen.
3.2. Systematisierung
Um die definitorischen Grundlagen des Begriffes Kulturtourismus besser einordnen zu können, ist eine Systematisierung kulturtouristischer Reiseformen notwendig. Es existieren viele Möglichkeiten die verschiedenen kulturellen Sehenswürdigkeiten und Eigenarten einer Region der touristischen Nutzung zuzuführen. Die folgende Abbildung vermittelt einen Überblick über die unterschiedlichen Formen eines kulturell orientierten Tourismus und bietet eine adäquate Gliederung an.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 13: Gliederung der Kulturtourismusformen
(Quelle: Weissenborn 1997, S. 19)
Die Inwertsetzung jener Formen des Kulturtourismus ist durch unterschiedliche Arten der Reisegestaltung möglich. Jede Region oder jedes Gebiet muss hierbei seine charakteristischen Eigenarten in eine, der touristischen Nutzung angemessene Art der Gestaltung umsetzen. Folgende Erscheinungsformen des Kulturtourismus können der Umsetzung dienen[110]:
- Eventtourismus
Events sind besondere Veranstaltungen und Ereignisse mit einem zeitlich begrenz- ten Rahmen. Jene Großveranstaltungen können natürlicher, sportlicher, kunstbezo- gener, wirtschaftlicher oder gesellschaftspolitischer Art sein. Städte und Regionen haben hierbei die Möglichkeit sich für eine kurze Zeit einer breiten Öffentlichkeit darzustellen. Zu den großen Events zählen z. B. die Olympischen Spiele, die EXPO, Stadtfeste und Musik- bzw. Medienfestivals.
- Musicaltourismus
Vereinzelte Städte (besonders in Deutschland) partizipieren seit fast 15 Jahren am Boom des Musicaltourismus. Die Erscheinungsform dieser Art des Kulturtourismus basiert auf einer dauerhaften Niederlassung einer Musicalproduktion in einer bestimmten Stadt. Beispiele hierfür sind die Niederlassungen der Musicals „Cats“ und „Phantom der Oper“ in Hamburg, die seit den jeweiligen Premieren Millionen von Besuchern angelockt haben.
- Museums-/ Ausstellungstourismus
Jede Stadt bzw. Region besitzt mittlerweile ein Museum mit einer eigenen, größten- teils themenbezogenen Ausstellung. In den letzten Jahren ist zwar eine Konjunktur hinsichtlich Museumseröffnungen zu beobachten, jedoch gehört der Besuch der tra- ditionellen großen Museen, wie z. B. des Louvre in Paris oder der Uffizien in Flo- renz, seit Jahrzehnten zu den Pflichtveranstaltungen von Städtereisenden und ist somit keine neuartige Erscheinung auf dem Tourismusmarkt.
- Thementourismus
Einige Regionen und Städte versuchen durch eine spezielle, themenbezogene Darstellung ihre charakteristischen Eigenarten herauszustellen und dadurch kulturell interessierte Besucher anzulocken. Hierbei können die Themen aus den verschie- densten bereichen der Kultur entstehen, z. B. der Architektur, Literatur, Musik, Kunst oder Philosophie und Theologie. Meistens verfolgen jene kulturtouristischen Konzepte einen längerfristigen Zeitraum, der über ein oder mehrere Jahre dauern kann (z. B. das „Goethejahr“ in Weimar).
- Kulturrouten
Kulturrouten sind festgelegte Reisewege, die sich anhand von bestimmten Stationen bzw. Haltepunkten einem speziellen Thema (z. B. einer historischen Epoche oder einer ausgewählten Person) widmen. Zumeist sind jene Routen als selbst zu führen- de Tour angelegt, die anhand von Hilfsmitteln (Faltblätter, Wegweiser und Informa- tionstafeln) leicht zu finden ist. Kulturrouten können sowohl von regionalem und ü- berregionalem Umfang sein, oder sich in Form von Lehrpfaden auf lokal begrenzte Einheiten beschränken.
- Bildungstourismus
Bildungsreisen haben in der Geschichte des Tourismus eine lange Tradition. In der heutigen Zeit werden zum Bildungstourismus die Studienreisen und Sprachreisen gezählt. Studienreisen sind zumeist Gruppenreisen mit einem festgelegten Reise- thema und –verlauf, einer begrenzten Teilnehmerzahl und einer qualifizierten Reiseleitung. Jene Reiseform ist überwiegend historisch-, kunst- und kulturorien- tiert. Sprachreisen dienen dagegen primär dem Ziel des Erlernens oder Vertiefens einer Fremdsprache im Mutterland. Bevorzugte Interessenten dieser Form sind hauptsächlich Schüler und Studenten, die in den Ferien an einem festen Ort im Aus- land Fremdsprachenkurse in Anspruch nehmen.
- Industrietourismus
Der Industrietourismus ist eine relativ junge Erscheinungsform auf dem Fremden- verkehrsmarkt. Erst mit den Stillegungen großer Industrieanlagen im ausgehenden 20. Jahrhundert konnte diese Form des Kulturtourismus in größerem Umfang Fuß fassen. Herausragende Beispiele des Industrietourismus sind die Anlagen des Ruhr- gebiets, die im Zuge der IBA (Internationale Bauausstellung) Emscher Park revitali- siert wurden, und die des Saarlandes.
- Städtetourismus
Städtereisen haben sich in den letzten Jahren zu einer der beliebtesten Reiseformen entwickelt. Häufig sind jene Reisen von einem Veranstalter organisiert und gehen über einen vergleichsweise kurzen Zeitraum (bis zu einer Woche). Die Urlauber haben bei der zumeist geleiteten Reise die Möglichkeit, sämtliche Charakteristika einer Stadt kennen zu lernen. Dies kann von der Architektur über Kunst und Kultur bis hin zu Events und Großveranstaltungen reichen.
Weitere Erscheinungsformen von Kulturreisen sind der Religionstourismus in Form von Pilgerfahrten oder –wanderungen, der Miltitärtourismus in Form von Besichtigungen militärischer Anlagen und Einzelobjekten, und der Rootstourismus, dessen Urlaubsmotiv die Spurensuche nach kultureller Identität zur Grundlage hat. Diese Erscheinungsformen können jedoch nur – mit Ausnahme der Pilgerfahrten – geringfügige Besucherzahlen aufweisen und sind somit im Bereich des Kulturtourismus Randerscheinungen.
3.3. Der kulturtouristische Markt
Die gesellschaftlichen Trends der letzten Jahre bewirkten auch auf dem Fremdenverkehrssektor strukturelle Veränderungen. Der gesamte Freizeitbereich ist durch einen Bedeutungszuwachs gekennzeichnet, der sich auch in Form einer veränderten Nachfragestruktur im Hinblick auf Urlaubsgestaltung, Urlaubsmotiv und Urlaubsziel auswirkt[111]. Durch die Verfügbarkeit von mehr Zeit, Geld, Bildung und Wohlstand ist die Urlaubsreise zu einem Ereignis von gesellschaftlicher Notwendigkeit geworden, die alle Schichten der Bevölkerung betrifft[112]. Der Wunsch nach etwas Besonderem, was man im Urlaub erleben kann, führt zu einer differenzierten Ausgestaltung der Angebote im Freizeit- und Tourismusbereich. Hierbei sind Kombinationen der Urlaubsgestaltung gefordert, die die Elemente Kultur, Natur und Erholung miteinander verbinden[113]. Als wesentliche Faktoren für einen Zuwachs der kulturtouristischen Angebote werden ein „Nostalgietrend“[114], der die Vergangenheit glorifiziert, das zunehmende Bildungsniveau der Bevölkerung[115] sowie die ungünstigen Nebenwirkungen des Massentourismus in den südeuropäischen Bildungsreiseländern[116], die eine Trendumkehr zum Kulturtourismus erwarten lassen, ausgemacht.
Im Bereich der Reisemotive lösen die Faktoren „Eindrücke, Entdeckung und Bildung“ die jahrzehntelang vorherrschenden Motive „Abschalten, Ausspannen und Ruhe“ ab[117]. Einen immer höheren Stellenwert erleben kombinierte Urlaubsformen, die alle wesentlichen Aspekte der Erholung, Abwechslung, Natur und Kultur umfassen[118]. Die folgende Tabelle gibt einen Einblick in die veränderten Reisemotive zwischen 1987 und 1992.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Tab. 5: Prozentuale Veränderung der Reisemotive zwischen 1987 und 1992
(Quelle: Lindstädt 1994, S. 36)
Die Motive der kulturinteressierten Nachfrager beziehen sich im Wesentlichen auf Einzelkulturobjekte, Kulturobjekthäufungen, Kulturensembles, kulturelle Ereignisse und die gastronomische Kultur der bereisten Region[119]. Das Hauptinteresse der kulturmotivierten Urlauber liegt dabei auf den Faktoren Bildung und Studium, Besuch kultureller Veranstaltungen und Besichtigung von Kunstwerken[120].
Im Bereich der Urlaubsaktivitäten ist allerdings kein deutlicher Anstieg in Bezug auf kulturtouristische Aktivitäten festzustellen. Die folgende Tabelle weist auf eine eher konstante Entwicklung hin.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Tab. 6: Prozentuale Veränderung der Urlaubsaktivitäten zwischen 1981 und 1992
(Quelle: Weissenborn 1997, S. 23)
Diese relativ konstante Entwicklung ist damit zu erklären, dass jene Unternehmungen Bestandteile von sehr unterschiedlich motivierten Reisen sind und nicht ausschließlich dem Kultururlaub zuzurechnen sind[121]. Dennoch ist in den vergangenen Jahren gerade im Bereich des Besuches kultureller Veranstaltungen ein Anstieg der Besucherzahlen festzustellen[122].
Das Bild des klassischen Bildungs- und Kulturreisenden muss aufgrund der Erfahrungen der kulturtouristischen Anbieter im Laufe der letzten Jahre korrigiert werden. Waren es ursprünglich die hochgebildeten, einkommensstarken und älteren Bevölkerungsschichten, die eine Reise zwecks kulturorientierter Gestaltung unternahmen, so gestaltet sich der Personenkreis jener Reisenden mittlerweile weitaus differenzierter[123]. Jüngere, nicht unbedingt hochgebildete und relativ einkommensschwache Personen unternehmen vermehrt Reisen mit einem kulturell motivierten Hintergrund[124]. Gerade im Bereich der Städtereisen ist der Anteil der 14-29jährigen und der Anteil der Reisenden mit Hauptschulabschluss besonders hoch, was auf eine deutliche Veränderung im Bereich dieser Reiseform hindeutet[125]. Hierbei wurden allerdings nicht die Motive für den Antritt einer solchen Reise hinterfragt. Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass gerade die deutschen Kulturtouristen eine anspruchsvolle und attraktive Reisekombination fordern, die sich aus den Elementen Kultur, Konsum, Erlebnis und Gourmet zusammensetzt[126].
Um jene Anforderungen an eine Reise zu erfüllen, bedarf es gezielter marktstrategischer Maßnahmen zur Schaffung von neuen und anspruchsvollen Angebotsformen der Kulturreise. 13,8 % der deutschen Urlauber traten 1991 ihre Reise aus kulturmotivierten Hintergründen an, was zu einer erheblichen Steigerung gegenüber den 80er Jahren führte und viele Feriengebiete an den Rand ihrer Kapazitäten führt[127]. Die boomartige Entwicklung des Marktes für Kulturreisen führt zu einer differenzierten Ausbildung der Anbieter. Bei den Reiseveranstaltern geht die Tendenz zu kleinen Spezialanbietern, deren Absatzgebiet national ausgerichtet ist und deren Angebote auf das jeweilig gewünschte Klientel zurechtgeschnitten ist[128]. Tourismusverbände setzen verstärkt auf die kulturellen Besonderheiten von Land und Regionen und zusätzlich zu den regionalen Verbänden schließen sich vermehrt Städte oder kulturelle Institutionen zu themenbezogenen Kooperationen zusammen, z. B. die Arbeitsgemeinschaft der UNESCO-Weltkulturgüter in Deutschland[129]. Kulturelle Events schießen aus dem Boden, die Produktion von Musicals an festen Standorten hatte in den 90er Jahren Hochkonjunktur und Museen werden deutlich besucherfreundlicher[130]. Viele Städte und Regionen innerhalb Europas versuchen der Nachfrage nach kulturorientierten Reisen gerecht zu werden, was zu einem Anstieg der kulturellen Produktion in den letzten Jahren führte[131].
Der Boom für kulturorientierte Reisen betrifft zum größten Teil die Städte. In diesem Bereich sind demnach auch die größten Wachstumsschübe und trendartigen Entwicklungen für Kultur- und Bildungsreisen zu erwarten. Städte bieten zu Reisen mit kulturellem Hintergrund verstärkt Pauschalprogramme an, schaffen vermehrt groß angelegte Events zur Reisemotivation und gestalten kulturelle Einrichtungen (Museen, Bibliotheken und Theater) gezielt besucherfreundlicher, um eine große Masse an Besuchern aufnehmen und zufrieden stellen zu können[132]. Hierbei vollführen viele Städte einen Balanceakt zwischen der Darstellung der eigenen kulturellen Besonderheiten und Tendenzen zur Trivialisierung und zur massenorientierten Ausrichtung von Kultur.
3.4. Chancen, Risiken und Auswirkungen
Europa verfügt über eine unermessliche Vielfalt an kulturellen Werten auf engstem Raum. Im Laufe der Geschichte haben die verschiedenen Völker ein kulturelles Erbe hinterlassen, das oft in vielen Schichten übereinanderliegt[133]. Die große Chance des Kulturtourismus besteht darin, diese Werte zu pflegen, den einzelnen Besuchern nahe zu bringen und damit ein Verständnis für andere Kulturen zu schaffen, das Toleranz und Akzeptanz gegenüber allem Fremden beinhaltet[134]. Ein derartig zu realisierender Kulturtourismus sollte folgende Grundsätze beachten[135]:
- Kulturtouristische Angebote sollten für Einheimische und Touristen konzipiert werden. Eine einseitig auf den Tourismus ausgerichtete Kultur verschafft keine Akzeptanz in den bereisten Regionen.
- Der Tourist sollte im Zielgebiet ein regionalspezifisches, authentisches Erlebnis vermittelt bekommen.
- Das kulturelle Potential der Zielregionen sollte längerfristig gesichert, schonend benutzt und sozial- und umweltverträglich gestaltet sein.
- Die kulturtouristischen Angebote sollten sich durch ein hohes Maß an Sachkunde, Gründlichkeit und Phantasie auszeichnen.
Wenn diese Grundsätze bei der Realisierung kulturtouristischer Angebote eingehalten werden, besteht für die Zielregionen die große Chance sowohl ihre kulturellen Bestände zu sichern und dem Urlauber ihre spezifischen Eigenheiten zu vermitteln, als auch positive Auswirkungen für die Region zu erzielen.
Im wirtschaftlichen Bereich äußert sich der Zusammenhang zwischen Tourismus und Kultur häufig in positiven Nebenwirkungen[136]. Mit dem Besuch von kulturellen Veranstaltungen werden meist andere Aktivitäten verknüpft, die zu einer Umsatzerhöhung bei Buchhandlungen, Hotels, Restaurants und Verkehrsbetrieben und dadurch zu einem Multiplikatoreffekt, gerade im Bereich der großen Städte, führen[137]. Doch auch andere positive Effekte können durch kulturtouristische Angebote in den Zielregionen registriert werden[138]:
- Bewusstwerden der eigenen Kultur und Entstehen eines neuen Regionalbewusstseins
- Positiver Beitrag zur Imagebildung
- Regionalpsychologische Stabilisierungseffekte
- Nutzung des endogenen kulturellen Potentials wie Bauten, Relikte und Brauchtum
- Hohe Kaufkraft der Kulturtouristen und große Wertschöpfung für die Region
- Räumliche Diversifizierung der Nachfrage – speziell durch Kulturstraßen – vermeidet Überlastungserscheinungen
- Arbeitsintensiver Sektor mit vielfältigen Beschäftigungsmöglichkeiten für Gästeführer und Reiseleiter
Dazu können kulturtouristische Angebote die Vermittlung globalen, grenzüberschreitenden Denkens ausführen, die Integration der europäischen Völker durch Studienreisen fördern und einen Beitrag zur Völkerverständigung und Vergangenheitsbewältigung leisten[139].
Neben den positiven Effekten, die der Kulturtourismus für die Zielregionen bewirken kann, bestehen jedoch auch Risiken und Gefahren bei einer zu massenorientierten Ausrichtung kulturtouristischer Angebote. Da die touristische Nutzung kultureller Güter ein sehr sensibler Bereich ist, leiden zahlreiche Kulturdenkmäler unter einer Überlastung durch übermäßige touristische Nachfrage[140]. Die Folgen des Massentourismus sind in besonders stark frequentierten Zielgebieten anhand von Zerstörungen der historischen Bausubstanz sowie Beschädigungen in überfüllten Museen, Schlössern und Kirchen deutlich zu erkennen[141]. Die Gefahr der übermäßigen Beanspruchung einzelner Kulturdenkmäler ist deutlich zu erkennen und in einigen Regionen schon in bedenklicher Weise fortgeschritten[142]. Zum Schutz der Kulturgüter werden bereits einige Maßnahmen unternommen (In Lascaux wurden z. B. die weltbekannten Höhlenmalereien zum Schutz der Originale in einem parallelen Höhlensystem detailgenau rekonstruiert), während Möglichkeiten der Reglementierung von Besucherströmen (z. B. in den Uffizien in Florenz) eher mäßig verfolgt werden[143]. Auch im Bereich des Verkehrssektors sind negative Auswirkungen durch die massenhafte touristische Nutzung kultureller Güter auszumachen. Die Überfüllung historischer Innenstädte verursacht z. B. eine überhöhte Lärmbelastung für Anwohner, ein starkes zusätzliches Verkehrsaufkommen und dichtes Gedränge im Umfeld der Kulturgüter[144]. Eine weitere große Gefahr der touristischen Nutzung besteht in der Inszenierung kultureller Erlebnisse und der damit verbundenen Kommerzialisierung von Bräuchen und Veranstaltungen[145]. Es bestehen Tendenzen, dass touristische Arrangements zu einer irrealen Bühnenwelt verkommen, die in einseitig dimensionierten Reiseführer oftmals romantisierend, ästhetisierend und traditionsverhaftet dargestellt werden[146]. Hierbei werden „dunkle“ Perioden der Zeitgeschichte häufig ausgeklammert, um eine makellose Vergangenheit der Region darzustellen[147].
Eine nachhaltige touristische Nutzung kultureller Güter kann nur durch den schonenden Umgang mit den Denkmäler und durch ein umwelt- und sozialverträgliches Fremdenverkehrskonzept realisiert werden. Inwieweit diese Vorgaben umgesetzt werden können, wird die Zukunft zeigen.
3.5. Kulturtourismus in Europa, Spanien und Frankreich
3.5.1. EU
Die Organe der EU (allen voran der Europarat), die für touristische Fragen verantwortlich sind, treten für eine nachhaltige Nutzung der natürlichen und kulturellen Ressourcen durch den Fremdenverkehr ein und forcieren damit die Realisierung von neuen Formen des Tourismus und der Tourismusindustrie[148].
„Tourismus soll heute bei gleichgewichtiger Berücksichtigung der ökonomi- schen, ökologischen, sozialen und kulturellen Aspekte entwickelt werden. In sei- ner Entwicklung soll er die menschliche Dimension bewahren, besonders Infra- strukturen und Einrichtungen in die Natur integrieren und Verantwortung und Schutz gegenüber den Ökosystemen, den Kulturgütern und –stätten und der so- zialen und kulturellen Struktur sichern. Dabei müssen besonders die Rechte und Kulturen der ansässigen Bevölkerung berücksichtigt und geschützt werden [..] Nicht nur der heutige Mensch soll von den kulturellen Werten und Schätzen Eu- ropas profitieren, sondern auch künftigen Generationen müssen diese Werte erhalten werden [.] Der sanfte, menschliche und kulturelle Tourismus scheint ein richtiger Weg in diese Richtung zu sein.“[149]
Bei der Umsetzung dieser Grundsätze im kulturtouristischen Bereich unternimmt die EU verschiedene Anstrengungen. 1993 wurde ein Arbeitskreis eingerichtet, der sich mit besonderen Aspekten einer kulturtouristisch orientierten Ausrichtung des Fremdenverkehrs beschäftigt. Dieses Projekt steht jedoch erst am Anfang seiner konzeptionellen Gestaltung und beschäftigt sich daher noch mit der Erarbeitung einer Grundstudie[150].
Im gleichen Jahr trat der bereits zwei Jahre zuvor von der EU-Kommission vorgelegte „Aktionsplan der Gemeinschaft zur Förderung des Fremdenverkehrs“ in Kraft. Der Kulturtourismus wird darin als ein Bestandteil der zukünftigen Fremdenverkehrsentwicklung gesehen und unterliegt einer speziellen Förderung[151]. Die Bedeutung des Kulturtourismus liegt vor allem in der Entzerrung der Reiseströme und der Stärkung neuer Reiseziele, wobei ein Beitrag zur Steigerung der Völkerverständigung und des europäischen Kulturverständnisses geleistet und die Erhaltung des europäischen Kulturgutes gesichert werden soll[152]. Erste Pilotprojekte wurden bereits anhand dieser Zielsetzungen staatenübergreifend realisiert[153].
Neben diesen Maßnahmen unternimmt die EU weitere Bestrebungen zur Stärkung des Kulturtourismus. Spezielle Sprachlernprogramme (z. B. „Lerne die Sprache des Nachbarn“) und die Entwicklung und Realisierung europäischer Kulturstraßen werden vorangetrieben. Zu ausgesuchten Themen werden Kunstausstellungen durch den Europarat initiiert[154]. Historische Städte werden anhand von Symposien und Fachtagungen im Hinblick auf eine touristische Erschließung gesondert betrachtet, wobei die Städte bei Planungs- und Entwicklungsproblemen den Europarat um technische Hilfe bitten können, die in Form eines Gutachten mit Empfehlungen geleistet wird[155]. Besondere Beachtung verdienen die „Konvention für den Schutz des europäischen architektonischen Erbes“ von 1985 und die „Konvention für archäologische Stätten“ von 1992. Diese Konventionen sichern das Konzept der integrierten Planung und des Schutzes archäologischer Stätten und architektonischer Besonderheiten[156]. Da die Konventionen bereits ratifiziert sind, sind sie für alle Mitgliedsstaaten der EU allgemein und rechtlich verbindlich.
Neben den technischen und rechtlichen Hilfen, kann die EU auch Unterstützungen finanzieller Art leisten. Die finanziellen Mittel zur Förderung touristischer Maßnahmen stammen überwiegend aus den Strukturfonds, die der Regionalentwicklung zugeordnet sind. Hierzu gehören vor allem die „Europäischen Fonds für Regionalentwicklung (EFRE)“ und die sogenannten Gemeinschaftsinitiativen mit bestimmten Themenbereichen[157]. Erstmals gefördert wurde der Kulturtourismus im Rahmen des „Europäischen Jahr des Tourismus 1990“. Die Zielsetzungen eines kulturell orientierten Tourismus waren hierbei die Förderung der besseren Kenntnis und des Lebensstils der anderen Mitgliedsstaaten sowie eine zeitlich und räumlich bessere Verteilung des Fremdenverkehrs unter besonderer Entwicklung neuen Reisezielen und Fremdenverkehrsformen als Alternative zum Massentourismus[158]. Aus den Zielsetzungen leiten sich Projektthemen ab, die den Bereich Kultur- und Bildungstourismus umfassen und für Einzelprojekte mit einem maximalen Zuschuss von 40 % der Gesamtkosten von der EU bedacht werden können[159]. Die große Gefahr der EU-Förderung besteht darin, dass einzelne Fremdenverkehrsträger nur an den Fördermitteln interessiert sind und aus diesem Grund kulturtouristische Themen ohne durchdachte Konzepte, in das sich das spezielle Projekt einfügt, initiieren[160]. Man sollte jedoch die Bedeutung der Förderung durch die EU nicht überschätzen, da der Kulturtourismus nur eine Facette des Tourismus neben vielen anderen unterstützten Tourismusformen ist und daher nur einen Bruchteil der finanziellen Mittel in Anspruch nehmen kann.
[...]
[1] Alle Aufnahmen von Mallorca in dieser Arbeit wurden vom Verfasser in den Monaten März und April des Jahres 2000 gemacht, mit Ausnahme von Bild 2: Imhof 1998, S. 84
[2] Der Maßstab der Karte wurde aufgrund der vorgegebenen Formatgröße der Arbeit vom Verfasser geändert. Er ist auf ca. 1:1.400.000 verkleinert worden.
[3] Alle Aufnahmen von Korsika in dieser Arbeit wurden vom Verfasser im Monat Mai des Jahres 2000 gemacht.
[4] Der Maßstab der Karte wurde aufgrund der vorgegebenen Formatgröße der Arbeit vom Verfasser geändert. Er ist auf ca. 1:1.100.000 verkleinert worden.
[5] Strelocke 1981, S. 331
[6] Fabian/ Ruth 1987, S. 50
[7] siehe Scherer 1999
[8] Spahl 1995
[9] siehe Zeller 1996
[10] siehe Heinrich 1996
[11] siehe Pulver 1988 u. Battesti 1988
[12] Siegfried-Hagenow 1991, S. 173
[13] siehe auch Kapitel 2.3.2.
[14] siehe Schymik 1975
[15] siehe Betz 1996 (1)
[16] siehe von Reden 1989
[17] vgl. Breuer 1992, S. 22
[18] vgl. Breuer 1992, S. 22
[19] vgl. Mayer 1976, S 70ff.
[20] Bardolet 1992, S. 36
[21] vgl. Bardolet 1992, S. 36
[22] vgl. Schmitt 1993, S. 459f. u. Bardolet 1992, S. 40
[23] siehe Lücke 1994, S. 337
[24] siehe Fabian/Ruth 1987
[25] Prosper Mérimée wurde auf Korsika zu seinen berühmten Novellen „Colomba“ und „Matteo Falcone“ inspiriert
[26] Hilckmann 1950
[27] vgl. Pulver 1988, S. 13
[28] siehe Kapitel 2.3.2.
[29] vgl. Siegfried-Hagenow 1991, S. 173
[30] vgl. Hölscher 1995
[31] siehe Kapitel 2.3.2.
[32] Siegfried-Hagenow 1991, S. 175
[33] siehe Nicolai 2000
[34] Bardolet 1992, S. 39
[35] vgl. Bardolet 1992, S. 46
[36] siehe Govern Balear – Conselleria de Turisme 1994
[37] vgl. Bardolet 1992, S. 42
[38] vgl. Bardolet 1992, S. 45
[39] vgl. Schmitt 1993, S. 460
[40] vgl. Bardolet 1992, S. 56-58
[41] siehe Kunze 1992, S. 109f.
[42] siehe Serrano 1992
[43] vgl. Breuer 1992, S. 24f.
[44] siehe Kapitel 2.3.2.
[45] vgl. INSEE 1999, S. 14: Touristischer Druck wird definiert als die Zahl der Touristen pro Einwohner
[46] vgl. Lücke 1994, S. 342
[47] INSEE 1999, S. 211
[48] Pulver 1988, S. 13
[49] vgl. Lücke 1980, S. 449
[50] vgl. Battesti 1988, S. 17 u. INSEE 1999, S. 219
[51] Pulver 1988, S. 13
[52] vgl. Lücke 1994, S. 340ff.
[53] nach Battesti 1988, INSEE 1999, Lücke 1980, Lücke 1994, Lücke 1998 u. Pulver 1988
[54] siehe Abb. 11
[55] siehe Biehusen/ Nepaschink 1997, S. 214
[56] siehe Betz 1996 (1), Leinen 2000 u. Lücke 1986
[57] vgl. Bardolet 1992, S. 38f. u. Schmitt 1993, S. 461f.
[58] vgl. GOB 1992, S. 77
[59] Bardolet 1992, S. 39
[60] Schwede 1999, S. 15
[61] vgl. Schmitt 1993, S. 463
[62] vgl. Mayer 1976 u. Schmitt 1993
[63] vgl. GOB 1992 u. Schwede 1999
[64] GOB 1992, S. 77
[65] vgl. Schmitt 1993, S. 465
[66] siehe Fahrun 2000
[67] vgl. Schwede 1999, S. 16
[68] siehe Serrano 1992
[69] siehe Kapitel 2.4.
[70] Anm. d. Verf.: Auf Korsika werden auch Investitionen, die der Zentralstaat tätigt und von denen die Insel nicht direkt profitiert, als „ausländisch“ angesehen.
[71] siehe Pulver 1988, S. 13: Ende der 80er Jahre waren 83 % der Fremdenverkehrseinrichtungen auf Korsika in der Hand ausländischer Kapitalgeber
[72] vgl. Lücke 1980, S. 452
[73] Siegfried-Hagenow 1991, S. 173
[74] vgl. Waucampt 1978, S. 47f.
[75] vgl. Leicht 1983, S. 12
[76] vgl. Leicht 1983, S. 12f.
[77] vgl. Waucampt 1978, S. 50
[78] siehe Abbildung 12
[79] vgl. Hahn 1995, S. 16
[80] vgl. Culioli 1995 u. Hahn 1996
[81] vgl. Siegfried-Hagenow 1991, S. 154ff.
[82] siehe Chimelli 1995
[83] siehe Gsteiger 1996
[84] Culioli 1995
[85] vgl. Hölscher 1995 u. Siegfried-Hagenow 1991, S. 173
[86] vgl. Scherer 1995, S. 91 u. Schmitt 1993, S. 459
[87] vgl. Bardolet 1992, S. 50
[88] nach Bardolet 1992, S. 51f. u. Schmitt 1993, S. 465f.
[89] Der Namensgeber dieser Gesetze, Jaime Cladera, war in den 80er Jahren Tourismusminister der Balearen
[90] siehe Rodrian 2000 u. Zeller 1996
[91] vgl. Schmitt 1993, S. 466f.
[92] siehe Blum 2000 u. Scherer 1999
[93] nach Battesti 1988, Lücke 1980, Lücke 1988, Lücke 1998, Richez 1996 u. Siegfried-Hagenow 1991
[94] vgl. Siegfried-Hagenow 1991, S.160: Tonangebend im Regionalparlament von Korsika sind die Clanchefs, die durch jegliche Veränderungen um ihre Pfründe fürchten
[95] vgl. Lücke 1998, S. 154
[96] siehe Leinen 2000
[97] siehe Betz (1) 1996
[98] vgl. Richards 1996 (1), S. 3
[99] vgl. Opaschowski 1996, S. 70-72 u. Richards 1996 (1), S. 5
[100] vgl. Opaschowski 1996, S. 87f. u. Richards 1996 (1), S. 7
[101] vgl. Becker 1993 (1), S. 57, Becker 1993 (2), S. 7 u. Nahrstedt 1996, S. 7
[102] vgl. Becker 1993 (2), S. 7 u. Richards 1996 (1), S. 8-12
[103] vgl. Richards 1996 (1), S. 7f. u. Weissenborn 1997, S. 14
[104] Dreyer 1996 (2), S. 26
[105] Weissenborn 1997, S. 17
[106] Becker 1993 (2), S. 8
[107] vgl. Lindstädt 1994, S. 11 u. Weissenborn 1997, S. 17
[108] vgl. Lindstädt 1994, S. 11
[109] vgl. Lindstädt 1994, S. 13
[110] vgl. Becker/Steinecke 1993, S. 145-244, Dreyer 1996 (1), S. 51-150 u. Weissenborn 1997, S. 84-137
[111] vgl. Lindstädt 1994, S. 17
[112] vgl. Lindstädt 1994, S. 17 u. Weissenborn 1997, S. 32
[113] vgl. Lindstädt 1994, S. 17
[114] Lindstädt 1994, S. 17f. u. Weissenborn 1997, S. 33
[115] Opaschowski 1996, S. 128 u. Weissenborn 1997, S. 34
[116] Weissenborn 1997, S. 33
[117] vgl. Lindstädt 1994, S. 36 u. Weissenborn 1997, S. 28
[118] vgl. Lindstädt 1994, S. 36 u. Weissenborn 1997, S. 28
[119] vgl. Weissenborn 1997, S. 31
[120] vgl. Lindstädt 1994, S. 37
[121] vgl. Lindstädt 1994, S. 37
[122] vgl. Weissenborn 1997, S. 23
[123] vgl. Lindstädt 1994, S. 40 u. Weissenborn 1997, S. 26
[124] vgl. Lindstädt 1994, S. 40
[125] vgl. Dreyer 1996 (2), S. 31
[126] vgl. Weissenborn 1997, S. 27
[127] vgl. Opaschowski 1996, S. 128 u. Weissenborn 1997, S. 22
[128] vgl. Dreyer 1996 (2), S. 34
[129] siehe Dreyer 1996 (2), S. 35f.
[130] vgl. Dreyer 1996 (2), S. 36-40
[131] vgl. Richards 1996 (1), S. 8-12
[132] vgl. Dreyer 1996 (2), S. 47f.
[133] vgl. Becker 1993 (1), S. 57
[134] vgl. Maraite 1993, S. 10-13
[135] vgl. Becker 1993, S. 8f.
[136] vgl. Weissenborn 1997, S. 148
[137] vgl. Weissenborn 1997, S. 148f.
[138] vgl. Steinecke 1993 (1), S. 8f., Steinecke 1993 (2), S. 247 u. Weissenborn 1997, S. 150f.
[139] vgl. Steinecke 1993 (1), S. 9
[140] vgl. Weissenborn 1997, S. 152
[141] vgl. Weissenborn 1997, S. 155
[142] siehe Dreyer 1996 (2), S. 44-47
[143] vgl. Weissenborn 1997, S. 156f.
[144] vgl. Weissenborn 1997, S. 152f.
[145] vgl. Becker 1993 (1), S. 59, Steinecke 1993 (2), S. 248 u. Weissenborn 1997, S. 153-155
[146] vgl. Weissenborn 1997, S. 153f.
[147] vgl. Steinecke 1993 (2), S. 248 u. Weissenborn 1997, S. 154
[148] vgl. Bernhardt 1993, S. 84
[149] Bernhardt 1993, S. 84
[150] vgl. Bernhardt 1993, S. 81
[151] vgl. Lindstädt 1994, S. 23
[152] vgl. Lindstädt 1994, S. 23
[153] vgl. Richards 1996 (2), S. 98
[154] siehe Bernhardt 1993, S. 81-83
[155] vgl. Bernhardt 1993, S. 81f.
[156] vgl. Bernhardt 1993, S. 82
[157] vgl. Lindstädt 1994, S. 22
[158] vgl. Lindstädt 1994, S. 22
[159] vgl. Lindstädt 1994, S. 23
[160] vgl. Lindstädt 1994, S. 24
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Originalausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2001
- ISBN (eBook)
- 9783832446987
- ISBN (Paperback)
- 9783838646985
- DOI
- 10.3239/9783832446987
- Dateigröße
- 84.8 MB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- Ruhr-Universität Bochum – unbekannt
- Erscheinungsdatum
- 2001 (November)
- Note
- 1,3
- Schlagworte
- fahrradtouren fremdenverkehrskonzepten wandertouren
- Produktsicherheit
- Diplom.de