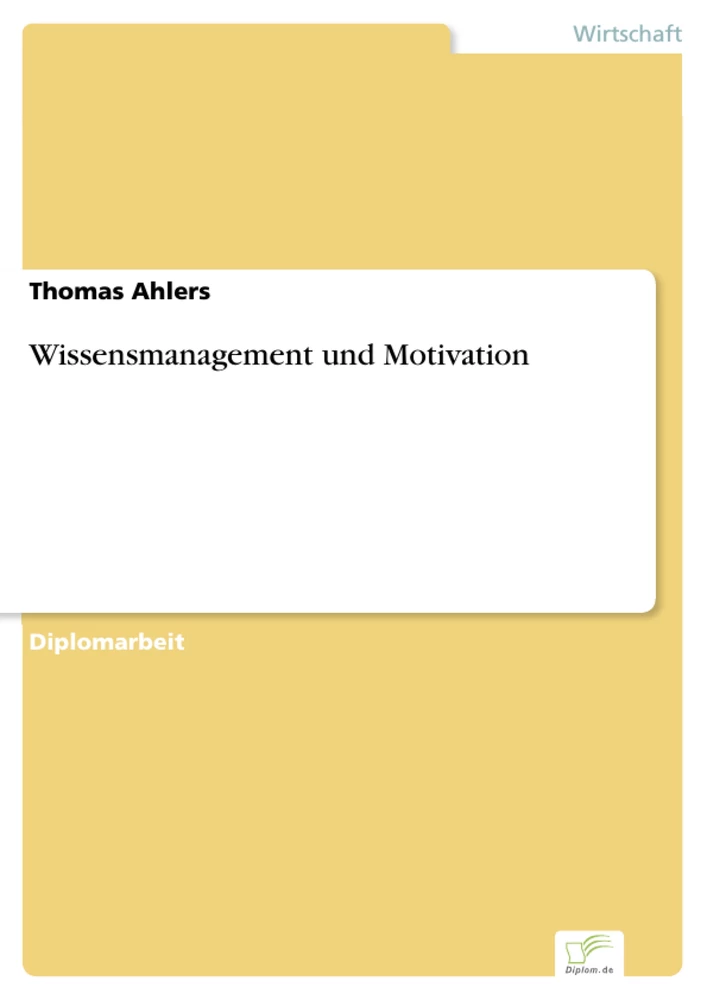Wissensmanagement und Motivation
Zusammenfassung
Herr Ahlers hat mit seiner Diplomarbeit zum Thema Wissensmanagement und Motivation mehrere Inhaltsbereiche aufeinander bezogen, die unterschiedliche Verknüpfungen zwischen sozialwissenschaftlichen Grundlagen und wirtschaftswissenschaftlichen Anwendungsbereichen aufzeigen. Dabei geht der Autor davon aus, daß Wissen sich als der entscheidende Wettbewerbsfaktor in den letzten Jahren herauskristallisiert hat. Damit stellt sich für ihn die Frage, inwieweit sich ein Umfeld generieren läßt, in dem die Mitarbeiter zur Wissensteilung und Wissensnutzung bewegt werden können.
In seinem ersten Abschnitt verweist Herr Ahlers auf die Veränderungen innerhalb der heutigen Wissensgesellschaft. Er skizziert unterschiedliche Perspektiven und Arten des Wissens sowie Transformationsprozesse vom individuellen zum organisationalen Wissen. Was bedeutet letztlich Wissensmanagement? Neben einem historischen Einstieg wird auf einzelne Bausteine sowie Rahmenbedingungen für ein erfolgreiches Wissensmanagement verwiesen. Technische, organisatorische und kulturelle Aspekte werden dabei berücksichtigt.
Im folgenden Abschnitt geht Herr Ahlers differenziert auf Motivationskonzepte ein. Er gibt einen allgemeinen Überblick und erörtert sodann kritisch die Differenzierung in Inhalts- und Prozeßtheorien. Sein Hauptaugenmerk liegt auf der Zielsetzungstheorie sensu Locke. Er verweist in diesem Zusammenhang auf moderierende Aspekte zwischen Zielen und Leistung, den Einfluß individueller Kompetenzen, das Konzept der Selbstwirksamkeit, Feedbackstrategien und Aufgabenkomplexität. Insgesamt betont Herr Ahlers, daß der Ansatz der Zielsetzungstheorie die motivierenden Wirkungen eines ganzheitlichen Wissensmanagements sehr gut veranschaulichen kann. Werden diese Ziele spezifisch und schwierig gestaltet und gleichzeitig in Kooperation mit den Mitarbeitern entwickelt, entfalten sie eine langfristig andauernde motivationale Kraft. Dazu gilt es allerdings ergänzend Instrumente der Wissensorganisation sowie Barrieren des Transfers von Wissen zu diskutieren.
Im letzten Teil seiner Ausführungen geht der Autor auf Realisierungsmöglichkeiten ein. Welche Form von Anreizsystemen bieten sich für das Wissensmanagement an? Lassen sich Anreizsysteme als generelle Lösung für Motivationsprobleme erörtern? Herr Ahlers diskutiert in diesem Zusammenhang unterschiedliche Vorschläge, die von visionären Vorstellungen, über spezifische Vergütungssysteme, strukturelle Anreize bis zu […]
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Wissen
2.1 Wandel zur Wissensgesellschaft
2.2 Wissen versus Gewissen
2.3 Basis des Wissens
2.4 Perspektiven und Arten des Wissens
2.4.1 Implizites und explizites Wissen
2.4.2 Individuelles und kollektives Wissen
2.5 Wissenstransformation
3. Wissensmanagement
3.1 Ursprünge des Wissensmanagements
3.1.1 Technokratisches Wissensmanagement
3.1.2 Wissensökologie
3.2 Ganzheitliches Wissensmanagement
3.3 Bausteinmodell des Wissensmanagements
3.4 Rahmenbedingungen für ein erfolgreiches Wissensmanagement
3.4.1 Technische Rahmenbedingnungen
3.4.2 Organisatorische Rahmenbedingungen
3.4.3 Kulturelle Rahmenbedingungen
3.5 Zwischenfazit I
4. Motivation
4.1 Motivationstheorien im Überblick
4.2 Inhaltstheorien
4.3 Prozesstheorien
4.3.1 Erwartungs-Wert Theorien
4.3.2 Zielsetzungstheorie
4.4 Extrinsische und Intrinsische Motivation
4.4.1 Flow-Erlebnis
4.4.2 Verdrängungseffekte
4.4.3 Eine differenzierte Betrachtung extrinsischer Motivation
5. Commitment
5.1 Grundlagen des Commitments
5.2 Arten des Commitments
5.3 Zwischenfazit II
6. Möglichkeiten der Motivation durch Wissensmanagement
6.1 Herausforderungen des Wissensmanagements
6.2 Instrumente der Wissensorganisation
6.3 Barrieren des Transfers von Wissen
7. Anreizsystem für Wissensmanagement
7.1 Anreizsysteme als generelle Lösung für Motivationsprobleme?
7.2 Lösungsvorschläge
7.2.1 Sinnvermittelnde Visionen
7.2.2 Neue Vergütungssysteme
7.2.3 Strukturelle Anreize
7.2.4 Wissensbezogene Mitarbeiterbeurteilung und -entwicklung
7.2.5 Anerkennung
7.2.6 Freiräume
7.2.7 Management by Knowledge Objectives
7.3 Ziele und Wissensmanagement
8. Fazit
Literaturverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Anhang
1. Einleitung
Die Zukunft gehört Menschen und Unternehmen mit Wissen.
Wissen ist als der entscheidende Wettbewerbsfaktor seit Beginn der 90er Jahre in Theorie und Praxis identifiziert worden. Moderne, zukunftsorientierte Gesellschaften wandeln sich zu Wissensgesellschaften. Produkte und Prozesse werden immer wissensintensiver. Aufgrund der rasanten informationstechnischen Entwicklung und dem Zwang zur permanenten Erweiterung und Aktualisierung des Wissens wird von einer Wissensexplosion und von einer verkürzten Wissenshalbwertszeit gesprochen (Gissler, 1999). Aus diesen Veränderungen wird die Erfordernis deutlich Wissen, zu managen.
Die Globalisierung der Wertschöpfung, der rasante technologische Fortschritt, die wettbewerblichen Anforderungen und die kürzer werdenden Produktlebens- und Innovationszyklen stellen immer größere Herausforderungen dar. Um erfolgreich am Markt bestehen zu können, müssen Unternehmen in immer kürzeren Zeitabständen neue, intelligente Produkte entwickeln, sowie die Anzahl der zu entwickelnden Produkte steigern.
Wissen ist die einzige Ressource, die sich durch Gebrauch vermehrt oder spezifiziert. Gleichzeitig gewährleistet sie die Einzigartigkeit bzw. Nicht-Imitierbarkeit der Produkte wie keine andere Ressource (Fried/Baitsch, 2000). Das Wissen im Unternehmen wird damit zum Kapital.
Mitarbeiter sind in diesem Zusammenhang Träger des wertvollen Guts Wissen (Alex/Becker/Stratmann, 2000). Immer öfter wird in Veröffentlichungen die mangelnde Bereitschaft der Mitarbeiter zum Wissensmanagement beklagt. Mitarbeiterverhalten und Zielsystem stehen in einem konfligierenden Verhältnis. Eine effiziente Umsetzung des Wissensmanagements verlangt nach Mitarbeitern, die sich zu einer wissensbasierten Unternehmenskultur motivieren lassen (North/Varlese, 2001). Neben motivationalen Aspekten, also einer Steigerung der Leistungsbereitschaft (Wollen), dürfen im Rahmen einer ganzheitlichen Sichtweise des Wissensmanagements weder die Leistungsfähigkeit (Können) noch die Leistungsmöglichkeit (Dürfen) vernachlässigt werden. Dafür sind sowohl die Fähigkeiten der Mitarbeiter zu verbessern, als auch strukturelle Maßnahmen zur Schaffung eines geeigneten Umfeldes zu implementieren. Diese Problematik wirft folgende Fragestellungen auf, die es in dieser Arbeit zu beantworten gilt.
Wie lässt sich ein Umfeld generieren, in dem die Mitarbeiter zur Wissensteilung und Wissensnutzung bewegt werden können? Oder anders formuliert: Unter welchen Umständen wird die in jedem Individuum grundsätzlich vorhandene intrinsische Motivation zur Leistungserbringung nicht zerstört?
In vielen Unternehmen wird auf eine Motivierung durch Belohnungen und Anreize gesetzt, um die Kommunikation des expliziten und impliziten Wissens zu fördern. Wie ist aber das Motivationssystem exakt zu gestalten? Welche Vorstellungen haben die Mitarbeiter von der Motivation und welches Ziel steht hinter einer Motivierung seitens des Unternehmens?
Ziel der Arbeit ist es, ein geeignetes Motivations- bzw. Anreizsystem für das Wissensmanagement aufzuzeigen. Kann Wissensmanagement unter bestimmten Bedingungen die Selbstverpflichtung der Mitarbeiter gegenüber dem Unternehmen und dessen Zielen entwickeln oder verstärken? Wenn dies möglich ist, wie müssen die Ziele ausgestaltet sein und welche zusätzlichen Rahmenbedingungen sind zu berücksichtigen?
Zum Abschluss noch einige einführende Worte zur Struktur: Das anschließende zweite Kapitel stellt den Begriff Wissen in all seinen Facetten dar. Darauf aufbauend wird das Wissensmanagement vorgestellt und eine ganzheitliche Perspektive vorgeschlagen, durch die technisch zentrierte Elemente mit humanorientierten Komponenten sinnvoll miteinander verbunden werden. Zusätzlich wird ein pragmatisches Modell des Wissensmanagements erarbeitet, welches von speziellen Rahmenbedingungen begleitet sein sollte.
Im vierten Kapitel werden Motivationstheorien vorgestellt, systematisch differenziert und in Theoriestränge eingeteilt. Der Schwerpunkt wird auf die Zielsetzungstheorie von E. A. Locke (1968) gelegt, die den Prozesstheorien zugeordnet wird. Anhand dieser können Aussagen über Wirkungen von Zielen und Commitment getroffen werden. Denn Commitment, Untersuchungsgegenstand des fünften Kapitels, spielt bei der Akzeptanz des Wissensmanagements durch die Mitarbeiter eine bedeutende Rolle. Anschließend werden Herausforderungen, Instrumente und Barrieren identifiziert, die bei der Umsetzung für ein erfolgreiches Wissensmanagement beachtet werden müssen.
Das siebte Kapitel stellt, nach einer kritischen Abwägung, ob Anreizsysteme generell Möglichkeiten zur Lösung der Motivationsproblematik bereitstellen können, mehrere Lösungsvorschläge zur Verfügung, wie Anreize für Wissensmanagement im Unternehmen zu gestalten sind, bevor abschließend ein Fazit gezogen wird.
2. Wissen
Bevor eine systematische Herangehensweise an das Wissensmanagement sinnvoll geschehen kann, ist der Begriff Wissen genauer zu untersuchen.
2.1 Wandel zur Wissensgesellschaft
„Wir ertrinken in Informationen und hungern nach Wissen“
John Naisbitt
Die gesellschaftlichen Verhältnisse werden sich im Zuge der informationstechnologischen Revolution, wie wir sie seit einigen Jahren erleben, dramatisch verändern. Dies zumindest postuliert der US-Zukunftsforscher Alvin Toffler (2001). Er prophezeit, dass sich durch die Informationstechnologie, die er als dritte große Revolution in der Geschichte der Menschheit, neben Landwirtschaft und Industrialisierung ausmacht, die globalen Machtverhältnisse verändern werden. Die globale Zweiteilung, bestehend aus schwachen Agrarwirtschaften und mächtigen Industrieländern, resultierend aus der industriellen Revolution, wird sich künftig zu einer Dreiteilung hin verschieben. Toffler prognostiziert eine Aufteilung der globalen Machtstruktur in Agrarwirtschaften, auf industrielle Maßenproduktionen spezialisierte Länder und informationsintensive Volkswirtschaften.
Zu ähnlichen Ergebnissen kommen auch Nonaka und Takeuchi (1997), die den gesellschaftlichen Nachkriegsverlauf von einer an der Güterproduktion orientierten Industriegesellschaft über eine Dienstleistungsgesellschaft bis in jüngster Zeit zu einer Informationsgesellschaft deuten. Künftig werden ihrer Meinung nach die Bereiche Herstellung, Service und Information praktisch ausschließlich auf Wissen beruhen.
Drucker (1993) prophezeit eine Wissensgesellschaft, in der nicht mehr Kapital, Bodenschätze oder Arbeitskraft, sondern Wissen die grundlegende Ökonomische Ressource darstellt. Damit bleibt Wissen der einzige Wettbewerbsvorteil der entwickelten Länder im globalen Vergleich.
Was ist nun der Unterschied zwischen einer Informations- und einer Wissensgesellschaft? Diese Frage kann am einfachsten durch das Zitat von John Naisbitt beantwortet werden: „Wir ertrinken in Informationen und hungern nach Wissen“ (zitiert nach: Alex/Becker/Stratmann 2000, S. 47). Das entscheidende für Organisationen scheint es also zu sein, sich in der Informationsflut zurechtzufinden und die notwendigen Informationen herauszufiltern, um sie in Produkte oder Dienstleistungen einfließen zu lassen, mit dem Ziel sich einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen. Die Gesellschaft ist im Prinzip die gleiche, der Unterschied liegt in einer erfolgreichen Strategie der Wissenden, die die Umwelt als Herausforderung und gestaltbar interpretieren und einer „mitschwimmenden“ Strategie der Nichtwissenden oder Reagierenden, welche die Umwelt als gegeben und bedrohlich betrachten.
In der heutigen Wissensgesellschaft können Wettbewerbsvorteile nur noch über ein ausgeprägtes Management der Ressource Wissen erzielt werden. Die Mitarbeiter sind Träger des wertvollen Guts Wissen. Hauptaufgabe jedes Unternehmens ist es daher diese Werte zu sichern, zu bewahren und abzuschöpfen (Alex/Becker/Stratmann, 2000).
Weitere Anzeichen, dass sich die Gesellschaft zu einer Wissensgesellschaft wandelt sind der hohe Wertschöpfungsbeitrag des Wissens und die enorme Börsenkapitalisierung wissensintensiver Unternehmen. Daher wird Wissen ein strategischer Erfolgsfaktor für Unternehmen als Wissenssysteme mit spezifischen Problemlösungswissen und ein Management dieses Wissens wird erforderlich.
Eck (1997) geht noch einen Schritt weiter, indem er Wissen als Basis für ein neues Management Paradigma ausmacht.[1]
2.2 Wissen versus Gewissen
"Wissen ist Macht."
Francis Bacon
Kann Wissen unabhängig vom Gewissen funktionieren oder gehören Wissen und Gewissen zusammen?
Wissen ist nachprüfbar, objektiv und berechenbar. Es ist mit einer persönlichen Werthaltung verbunden. Dazu komplementär verhält sich das Gewissen, es ist das moralische Gesetz im Wissen.
Das Gewissen sucht stets nach Wahrheit und Gerechtigkeit - Wissen hingegen kann nicht wahr oder gerecht sein. Es ist lediglich richtig oder falsch. Wissen wird traditionell erlernt, z. B. in der Universität, am Arbeitsplatz, durch Lehrer, Bücher oder "Learning by doing". Aber wo erwirbt man Gewissen? Gewissen wird definiert "als die Fähigkeit des Menschen, über die moralische Qualität einzelner Handlungen zu entscheiden" (Glückstein, 2001). Gewissen gilt als eine Art höhere Instanz in jedem Menschen; in anderen Religionen bedeutet es die Stimme Gottes und ist daher ein Leitbild für richtiges Verhalten. Damit unterscheidet uns das Gewissen von allen Lebewesen, denn nur der Mensch weiß, warum er wie handelt.
Die Wissensgesellschaft, in der Wissen als vierter Produktionsfaktor wichtiger wird als Arbeit, Boden oder Kapital, wird allerortens propagiert. Die Schlagwörter lauten: Ohne Bildung keine Arbeit und ohne Wissen keine Chance im globalen Wettbewerb.
Aufgabe der Unternehmen ist es, die Informationsflut zu managen. Diese Aufgabe erscheint so selbstverständlich wie früher das Managen von Maschinen oder Mitarbeitern war. Die Tendenz geht heute dahin, dass in der Ausbildung nicht mehr Wissensfakten, sondern Methoden zur Wissensaneignung (Methodenwissen) vermittelt werden. Es existiert bereits die Position des Wissensmanagers, der künftig die Quintessenz unserer Erkenntnisse für Unternehmen und Gesellschaft am Computer herausfiltern und verknüpfen soll. Entscheidend ist das rasante Wachstum der technologischen Auswertungsmöglichkeiten, das als Auslöser dieser Wissensexplosion gelten kann. Nicht Wissen schafft heute Macht, sondern die Fähigkeit, unendlich viele Erkenntnisse computerunterstützt nutzenbringend zu verknüpfen. Doch die technologischen Möglichkeiten sind nutzlos, wenn nicht auch die Einstellung in den Köpfen der Leute zur Wissensteilung verändert werden kann.
Das Gewissen muss dahingehend verändert werden, dass Menschen intrinsisch motiviert werden, Wissen zu teilen, da man auf den Austausch mit Kollegen vertrauen kann. Doch bis dahin ist es noch ein weiter Weg, denn in vielen Unternehmen herrscht noch der Darwinismus (survival of the fittest) und wenn man sein Wissen teilt, beraubt man sich seiner Existenzgrundlage.
Francis Bacon war davon überzeugt, dass Wissen eines Tages alle Probleme der Menschheit zu lösen vermag. Heute verursachen die schnell aufeinander folgenden Wissensschübe, dass die Erkenntnisse von vor einigen Jahren bzw. Jahrzehnten ständig überarbeitet werden müssen und ihre Gültigkeit verlieren.
Doch 400 Jahre nach Bacon schwindet der Glaube in die segensreiche Macht des Wissens. Das exponentielle Wachstum des Wissens und dessen Anwendung hat statt zu Problemlösungen zu den größten Herausforderungen geführt (Atombombe, Klimakatastrofen). Die Kontrolle über die langfristigen Auswirkungen ist den Menschen entglitten. Das Wissen wächst zu schnell für die menschliche Aufnahme- und Verarbeitungskapazität. Vielleicht wird dieses Wissen im Endeffekt die Menschheit vernichten.
Was ist Wissen? Der Mensch gibt seit Jahrtausenden seine Erfahrungen von Generation zu Gerneration weiter. Zunächst war das Übertragungsmedium die Sprache, dann folgte die Schrift und das kulturelle Gedächtnis der Menschheit war lange Zeit überschaubar. Noch zur Zeit Francis Bacons konnte der Gelehrte Geronimo Cardano sagen: "Was die Mathematik anbetrifft, so habe ich fast die gesamte Arithmetik erneuert sowie jenen Teil derselben, den man Algebra nennt" (zitiert nach Glückstein, 2001). Heute versteht ein Mathematiker die Arbeit seines Kollegen kaum noch.
Zweifellos hat eine neue Wissens-Ära begonnen. In der Wissensgesellschaft werden natürliche Ressourcen und Industriekapazitäten unwichtig. Das einzige was zählt, ist das Wissen. Was genau unter Wissen zu verstehen ist, soll in den folgenden Kapiteln erörtert werden. Dabei wird insbesondere der Wissenstransfer, aufgrund von Misstrauen, Mangel an Verständnis und fehlende Änderungsbereitschaft als menschliches Problem bei der Implementierung von Wissensmanagement hervortreten. Diese Schwierigkeiten zu bewältigen wird eine zentrale Herausforderung der Zukunft darstellen.
Wissen ist also immer im Kontext mit dem Gewissen zu betrachten. Es muss moralisch vertretbar sein - nicht alles was möglich ist, ist gleichzeitig wünschenswert. Manches Wissen hätte nie den "Elfenbeinturm" verlassen dürfen. Mit den Konsequenzen müssen die Menschen jetzt leben. Anderes Wissen darf vielleicht künftig den "Elfenbeinturm" nicht verlassen (Entschlüsselung des menschlichen Genoms), da die resultierenden Konsequenzen, aufgrund der begrenzten Rationalität des Menschen, nicht abgeschätzt werden können.
2.3 Basis des Wissens
Häufig werden in Theorie und Praxis die Begriffe Daten, Informationen und Wissen nicht exakt voneinander abgegrenzt. Für ein erfolgreiches Wissensmanagement ist es aber unabdingbar diese Begriffe voneinander zu trennen, um Missverständnissen vorzubeugen. Dafür ist es sinnvoll sie als drei aufeinander aufbauende Ebenen, im Sinne einer Treppe darzustellen - mit Daten als Grundlage und darauf aufbauend Informationen und Wissen (North, 1998).
Allerdings hat die begriffliche Trennung vielleicht auch dazu beigetragen, dass heute in vielen Unternehmen kein einheitliches Verständnis für das Management der eigenen Wissensbasis vorhanden ist. Für die Daten ist die Informatik zuständig, die Ausbildung vermittelt individuelle Fähigkeiten und die Forschung und Entwicklung ist für die Produktinnovation verantwortlich. Da diese Funktionen häufig separat bearbeitet werden, geht Potential der integrierten organisatorischen Wissensbasis verloren.
Daten
Daten bestehen aus Zeichen (Buchstaben, Ziffern, u. ä.), Zeichen werden in Form eines Codes oder einer Syntax zu Daten. Sie können in gedruckter, gespeicherter, visueller oder akustischer Form existieren. Sie repräsentieren Fakten, besitzen jedoch noch keine Bedeutung an sich. Daten erlangen erst dann einen Wert, wenn sie in einen bestimmten Kontext gestellt und damit zur Information transformiert werden können (North, 1998).
Ein Computer kann z. B. ausschließlich Daten verarbeiten, was zur Folge hat, dass Informationen und Wissen zunächst in Daten umgewandelt werden müssen, um gespeichert werden zu können. Werden die Daten in einer Datenbank wieder in einen Kontext gestellt, können sie später zu Informationen und auch in Wissen umgewandelt werden.
Informationen
Daten werden zu Informationen, wenn sie in den Kontext eines Problemzusammenhangs gestellt werden (Rehäuser/Krcmar, 1996). Stattfinden kann dies durch Kategorisierung, Kombinierung, Verdichtung, Analyse, Zusammenfassung und Interpretation von Daten (Davenport/Prusak, 1998).
Informationen werden durch Kommunikation von einem Sender an einen Empfänger weitergegeben. Dabei haben Informationen immer einen subjektiven Charakter, denn die Information hängt von der Interpretation des Empfängers ab. Es ist durchaus möglich (vielleicht sogar die Regel), dass verschiedene Personen die gleiche Nachricht bzw. Information, bestehend aus einzelnen Daten, unterschiedlich beurteilen. Dabei entscheidet der Empfänger, ob es sich um eine Information handelt (Davenport/Prusak, 1998).
Informationen sind für den Empfänger wertlos, wenn sie nicht mit aktuellen oder vergangenen Informationen verknüpft werden können.
Wissen
Informationen sind ein notwendiges Medium für Wissen. Wissen entsteht, wenn Informationen in einen Erfahrungskontext eingebettet werden. Der Unterschied zur Information besteht in einem Lernprozess, der erst durch Verarbeitung und Speicherung der aufgenommenen Informationen ermöglicht wird. Durch die Verknüpfung mit Erfahrungen ist Wissen also auch immer von früher erworbenem Wissen abhängig (Güldenberg, 1998). Ein wichtiges Kriterium für Wissen ist also im Gegensatz zu Daten oder Informationen, dass es immer an Personen gebunden und kontextabhängig ist (Probst et al, 1999).
Wissen ist also verstandene Information und damit auch die Fähigkeit, Kontexte und Situationen richtig einzuschätzen. Damit ist Wissen auch die Konsequenz einer bestimmten Erfahrung, Einstellung, Perspektive oder Absicht einer Person. Probst, Raub und Romhardt (1999, S. 46) definieren Wissen wie folgt:
Wissen bezeichnet die Gesamtheit der Kenntnisse und Fähigkeiten, die Individuen zur Lösung von Problemen einsetzen. Dies umfasst sowohl theoretische Erkenntnisse als auch praktische Alltagsregeln und Handlungsanweisungen. Wissen stützt sich auf Daten und Informationen, ist im Gegensatz zu diesen jedoch immer an Personen gebunden. Es wird von Individuen konstruiert und repräsentiert deren Erwartungen über Ursache-Wirkungs- Zusammenhänge.
Wissensmanagement
Deutsche Unternehmer versprechen sich durch eine effektivere Nutzung der Ressource Wissen eine durchschnittliche Produktivitätssteigerung von bis zu einem Drittel - gleichzeitig aber schätzen 80% der Unternehmer die Nutzung ihrer intellektuellen Werte für wenig effizient bis uneffizient ein (Bullinger, 1998).
Eine andere Studie (Bullinger et al., 1997) besagt, dass 96% der befragten Unternehmen die Thematik Wissensmanagement für wichtig bzw. sehr wichtig halten, aber Pawlowsky (1998) arbeitet in einer anderen Untersuchung heraus, dass lediglich 5% der kleinen und mittleren Unternehmen Wissensmanagement als Inhalt auf ihrer Weiterbildungsagenda haben.
Offensichtlich herrscht in der Praxis keine Einigkeit, was unter Wissensmanagement zu verstehen ist und außerdem klafft eine Lücke zwischen Anspruch und Wirklichkeit bezüglich der konkreten Umsetzung.
Nonaka und Takeuchi (1997) definieren Wissensmanagement als das Bestreben eines Unternehmens, bestehendes Wissen zu nutzen, neues Wissen zu schaffen und dieses in der ganzen Organisation zu verteilen, um es in Produkten, Dienstleistungen, Prozessen, Systemen und Strukturen zu verkörpern.
Das Konzept des Wissensmanagements hat zwei Ursprünge. Der eine ist das Informationsmanagement, das aus den Möglichkeiten hervorging, welche die Informationstechnologie geschaffen hat. Der zweite ist die Idee des Wissens als einzige sichere Quelle nachhaltiger Wettbewerbsvorteile (Nonaka, 1991). Dies kann nur dann der Fall sein, wenn es im Unternehmen selber geschaffen wird (Nonaka et al, 1994).
Der Unterschied zwischen organisationalem Lernen und Wissensmanagement besteht darin, dass organisationales Lernen sich damit beschäftigt, das Unternehmen Wissen aufzunehmen, um sich der Umwelt anzupassen, während Wissensmanagement versucht Wissen zu schaffen – und damit durchaus gestalterisch auf seine Umwelt einwirken kann.
2.4 Perspektiven und Arten des Wissens
Zunächst werden drei unterschiedliche Perspektiven von Wissen aufgezeigt. Im Anschluss daran, werden verschiedene Arten von Wissen genauer differenziert.
Im wesentlichen lassen sich drei Sichtweisen bzw. Perspektiven von Wissen ausmachen: Wissen als Objekt, Wissen als Prozess und Wissen als komplexes, sich selbst organisierendes System.
Wissen als Objekt. In diesem Verständnis wird Wissen als Ressource betrachtet und kann somit einen Wettbewerbsvorteil darstellen. Wissen wird als etwas Wertvolles, Knappes und Dauerhaftes interpretiert. Folgerichtig gilt Wissen als objektiv, transferierbar und speicherbar. Ziel einer Oranisation ist es, mit Hilfe des „Organizational Memory“ (organisationales Gedächtnis) möglichst große Mengen an bedeutsamem Wissen zu konservieren. Denn Informationen aus der Vergangenheit können Gegenwartsentscheidungen unterstützen (Wargitsch, 1998).
Dieser eher technischen Perspektive steht entgegen, dass das Wissen in Organisationen nicht nur die Summe des Wissens in den Köpfen der Menschen, Datenbanken, Technologien, Prozeduren und Patenten ist, sondern, dass zusätzlich implizites Wissen existiert, welches im Rahmen der Organisationskultur und der emotionalen Intelligenz entsteht (Hill, 1997).
Wissen als Prozess. Hill (1997) definiert Wissen als Prozess als nicht objektiv präsent und einfach abrufbar, sondern es wird geschaffen, dargeboten und ständig überholt. Es ist kein dauerhafter Zustand, sondern es verlangt einen fortlaufenden Aneigungs- und Identifikationsprozess. Wissen verlässt nach dieser Sichtweise den statischen Rahmen und die Dynamik von Wissen tritt hervor. Der Verarbeitungsprozess von Informationen durch das Bewusstsein ist das eigentliche Charakteristikum von Wissen (North, 1998).
Wissen als (Weiterentwicklungs-) Prozess kann als Lernen bezeichnet werden. Neues Wissen entsteht durch die affektive Auseinandersetzung eines Individuums mit seiner Umwelt. Organisationales Lernen bedeutet eine Veränderung des organisationalen Gedächtnisses. Diese kontinuierliche Weiterentwicklung der Wissensbasis ist die Grundlage für den Bestand und künftiges Handeln von Organisationen (Maier/Lehner, 1994).
Wissen als komplexes, sich selbst organisierendes System. Wissen ist nach dieser Perspektive in Routinen, Prozessen, Tätigkeiten und Normen enthalten. Es ist in mentalen Modellen verankert, welche sowohl Denken als auch Handeln bestimmen. Wissen ist immer abhängig vom jeweiligen Kontext und der Kultur des sozialen Systems. Die Realität innerhalb einer Organisation wird von sich selbst durch Erfahrungen und Werte geschaffen. Wissen ist also reziprok interdependent mit der Realität, da es einerseits Voraussetzung, andererseits Ergebnis ist. Es ist zweckrelativ, kontext- und aspektabhängig, verhaltensrelevant und daher nie objektiv. Es gilt also immer alle Rahmenbedingungen zu beachten, um Interpretationsfehler zu minimieren (Rehäuser/Krcmar, 1996).
Wissen ist also als sozialer Prozess interpretierbar, der nur kommunikativ stattfinden kann und von dem jeweiligen Zustand des Kommunikationsnetzwerkes innerhalb einer Organisation abhängt (Baecker, 1998). Aus diesem Grund ist das Risiko von Verständigungsproblemen zu beachten, welches durch unterschiedliche Bedeutung oder Interpretation von Wörtern oder durch differente mentale Modelle der Individuen entstehen kann.
Die dargelegten Perspektiven von Wissen existieren allerdings nicht nebeneinander, sondern sie ergänzen sich. Wissen kann situationsbedingt sowohl als Objekt als auch als Prozess interpretiert werden (Davenport/Prusak, 1998).
Im folgenden wird Wissen in verschiedene Wissensarten untergliedert. Als erstes lässt sich Wissen in implizites und explizites Wissen differenzieren. Im Anschluss daran folgt eine Darstellung von individuellem und kollektivem Wissen.
In der Literatur lassen sich noch einige andere Klassifizierungen ausmachen, die hier aber nicht vertieft dargestellt werden können. Dies sind z. B. Unterteilungen in Regel- und Faktenwissen (Pauzke, 1989), in Allgemeines und Besonderes Wissen (Spinner, 1994), in postfiguratives, konfiguratives und präfiguratives Wissen (Eck, 1997) oder in Know-how, Know-why und Know-what (Sanchez, 1997 oder Krüger/Homp, 1997).
2.4.1 Implizites und explizites Wissen
Eine in der Literatur übliche Kategorisierung von Wissen ist die Unterscheidung von implizitem und explizitem Wissen von Polanyi (1958). Unter explizitem Wissen wird generell jenes Wissen subsummiert, welches in artikulierter, transferierbarer und archivierbarer Form existiert. Es ist objektiv und zugänglich, nicht an ein Subjekt gebunden (disembodied knowledge) (Schreyögg, 2001). Beispiele hierfür sind Dokumente oder Patente. Implizites Wissen stellt das persönliche Wissen eines Individuums dar. Es ist subjektiv und verborgen, gebunden an ein Individuum (embodied knowledge) und beruht auf Werten, Gefühlen und Intuition (North, 1998). Implizites Wissen fußt auf den Sachverhalt, dass viele Aspekte des Wissens und Könnens von Individuen oder Organisationen nicht in Worte gefasst sind und möglicherweise auch nicht gefasst werden können (Polanyi, 1985).
Eine Person muss nicht unbedingt wissen, dass sie dieses (implizite) Wissen besitzt und sie muss auch nicht erklären können, wie sie kann, was sie kann (Willke, 1998). Implizites Wissen enthält technische und kognitive Elemente. Der technische Aspekt beinhaltet konkretes Know-how, handwerkliches Geschick und Fertigkeiten - die kognitiven Elemente umfassen Mentale Modelle (Paradigmen, Perspektiven, Vorstellungen und Überzeugungen), mit denen sich Menschen durch Erzeugung und Handhabung von Analogien in der Welt zurechtfinden (Petkoff, 2001 oder Rehäuser/Krcmar, 1996).
2.4.2 Individuelles und kollektives Wissen
Individuelles (auch: privates) Wissen befindet sich nur für einzelne Individuen im Zugriff – kollektives (auch: organisationales) Wissen dagegen kann von mehreren Individuen zur gleichen Zeit in Anspruch genommen werden.
Unter kollektivem Wissen werden einerseits die Fähigkeiten einer Organisation verstanden, die über die einzelnen Fähigkeiten der Individuen hinausgehen, andererseits das Wissen, das bei verschiedenen Mitarbeitern in gleicher Form vorhanden ist (Rüstmann, 1999). Kollektives Wissen ist im Gegensatz zu individuellem Wissen eingebettet in ein Netz von nicht zerlegbaren Beziehungen, das verloren geht, wenn es aus seinem Umfeld losgelöst wird. Es ist daher mehr als die Summe allen individuellen Expertenwissens. Es besteht sowohl aus explizitem Wissen als auch aus verborgenem (implizitem) Wissen (Schneider, 1996). Kollektives (oder auch organisationales) Wissen ist immer in Bezug auf seine Umwelt (Unternehmenskultur, Organisationsstruktur, u. ä.) zu sehen.
Nach Argyris und Schön (1999) kann organisationales Wissen aus zwei verschiedenen, sich ergänzenden Voraussetzungen entstehen. Erstens fungieren Organisationen als Bestandsumfelder für Wissen. In dieser Form kann Wissen im Kopf einzelner Individuen, in Akten, offiziellen oder inoffiziellen Plänen oder materiellen Objekten einer Organisation angesammelt und gespeichert sein. Zweitens können Organisationen Wissen direkt darstellen. In diesem Sinne verkörpern sie Strategien zur Durchführung schwieriger Aufgaben, oder Wissen verbirgt sich in Abläufen und Verfahren, die selbst dann entschlüsselt und angewandt werden können, wenn dieses Wissen implizit ist.
Sanchez (1997) nimmt eine noch feinere Differenzierung des kollektiven Wissens vor, indem er intraorganisationales von interorganisationalem Wissen unterscheidet. Ersteres bezeichnet Wissen von Gruppen innerhalb eines Unternehmens, letzteres Wissen, welches über Unternehmensgrenzen hinweg zwischen Organisationen besteht. In jeder dieser Kategorien kann Wissen in impliziter oder expliziter Form vorliegen.
2.5 Wissenstransformation
Nun stellt sich die Frage, wie es möglich ist, individuelles Wissen in organisationales Wissen zu transformieren, damit es von Organisationen auch effektiv genutzt werden kann. Denn für den Erfolg wissensorientierter Unternehmensführung ist es entscheidend, wie individuelles in kollektives Wissen und kollektives wiederum in individuelles Wissen übertragen wird (North, 1998).
Eine Antwort auf diese Frage bieten Nonaka und Takeuchi (1997) mit dem Konzept der Wissensspirale. Die Spirale gibt nicht nur Aufschluss darüber, wie individuelles Wissen in organisationales Wissen übertragen wird, sondern auch wie gänzlich neues Wissen entsteht.[2]
Aufbauend auf Polanyi`s Dichotomie zwischen implizitem und explizitem Wissen identifizieren sie das Grundproblem des Wissensmanagements als die Überführung von implizitem in explizites Wissen, denn erst explizites Wissen ist für die Organisation verfügbar und somit über einzelne Personen hinaus nutzbar.
In einer Kreuztabellierung ergeben sich daraus vier Modi der Wissensgenerierung (siehe Abbildung 1), die bei optimaler Prozessgestaltung eine Spirale der organisationalen Wissensgenerierung bilden.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 1: Vier Formen der Wissensumwandlung aus: Nonaka/Takeuchi, 1995, S. 75
Sozialisierung ist die Weitergabe und Verteilung impliziten Wissens, ohne dass dabei die Ebene des impliziten Wissens verlassen wird. Dies geschieht beispielsweise in der klassischen Lehrsituation. Der Lehrling beobachtet, übt und ahmt nach, ohne dass viele Worte gesprochen werden müssen und erwirbt dadurch das implizite Wissen des Meisters in einer gemeinsamen Handlungspraxis (Willke, 1998). Der entscheidende Faktor ist die Erfahrung. Ohne gemeinsame Erfahrung fällt es schwer sich in die Denkprozesse des anderen hineinzuversetzen. Der bloße Informationstransfer ohne Erfahrungskontext ergibt oft nur wenig Sinn (Nonaka/Takeuchi, 1997).
Externalisierung dagegen, setzt Sprechen und Schreiben voraus. In diesem Fall wird implizites Wissen expliziert und so sukzessive einer Reflexion zugänglich gemacht (Schreyögg, 1997). In diesem Prozess nimmt das Wissen die Form von Metaphern, Analogien, Modellen oder Hypothesen an. Obwohl Nonaka und Takeuchi (1997) diese Ausdrucksformen, wegen der Diskrepanz zwischen Bildern und Sprache, als unzureichend, unlogisch und unangemessen bezeichnen, schreiben sie ihnen förderliche Wirkungen auf Reflexion und Interaktion zu.[3]
Kombination hat zum Ziel, das neu gewonnene explizite Wissen mit bestehendem expliziten Wissen zu verbinden (Häcki, 1997). Der Austausch und die Kombination vollziehen sich über Medien wie Dokumente, Besprechungen, Telefon oder Computernetze. Eine Neuzusammenstellung vorhandener Informationen durch Sortieren, Hinzufügen, Kombinieren oder Klassifizieren von explizitem Wissen, generiert neues Wissen (Nonaka/Takeuchi, 1997).
Internalisierung verinnerlicht das explizite Wissen wieder zu impliziten Wissen, damit es permanent in die tägliche Arbeit einfließt und wieder eine Quelle neuen Wissens darstellt (Häcki, 1997). Der Prozess vollzieht sich dann, wenn geschriebenes oder dokumentiertes Wissen schrittweise in die täglichen Handlungen des Systems übernommen bzw. in ihm gelebt wird. Nonaka und Takeuchi (1997) vergleichen diesen Prozess mit dem „learning by doing“.
Alle vier Elementarprozesse durchlaufen mehrmals spiralenartig jede einzelne Ebene ausgehend vom Individuum bis zur Ebene organisationaler Netzwerke – also auf einem Kontinuum zunehmender Kollektivität. Sie erfolgen hierarchie- und funktionsübergreifend. Nonaka und Takeuchi (1997) identifizieren fünf Voraussetzungen oder Prinzipien eines effektiven Wissensmanagements: (1) die unternehmerische Intention als Sinngeber und treibende Kraft, (2) die Autonomie als Gestaltungsfreiraum, (3) Fluktuation und Chaos als Auslöser, um Routinen, Gewohnheiten und Wahrnehmungsmuster aufzubrechen, (4) Redundanz von Informationen, die ermöglicht durch Intervenieren zu lernen und Mitdenken zu fördern und (5) die erforderliche Varietät, um flexibel zu sein und alle möglichen Informationsquellen nutzen zu können.
Dieses Konzept des Wissensmanagements überwindet die Dichotomie von implizitem und explizitem Wissen auf allen organisationalen Ebenen und betont die Rolle des Individuums. Damit verändert es die Rollen des Managements. Gefordert werden Projekte als Einheiten, um neues Wissen zu schaffen. Dabei wird über Hierarchien und Funktionen hinausgegangen. Speicher des vorhandenen Wissens sind die Unternehmenskultur und die Informationstechnologie.
Bei allen positiven Hervorhebungen darf aber die Kritik, die dieses Modell erfahren hat, nicht unterschlagen werden. Es kann in Frage gestellt werden, ob die Generierung jedwedes neuen Wissens zwingend notwendig immer mit Externalisierung beginnt - oder sind nicht auch andere Ansatzpunkte denkbar. Problematisch ist weiterhin die ohne jedes Argument gesetzte These, dass jede Wissenserzeugung beim Individuum beginnen müsse (Schreyögg/Noss, 1997). Des Weiteren bleibt zu hinterfragen, ob Wissen grundsätzlich nur wie im Spiralprozess propagiert entstehen kann.
Der Vollständigkeit halber bleibt noch zu ergänzen, in welcher Form Wissen existieren kann. Rehäuser und Krcmar (1996) definieren Wissensträger als Objekte, Personen oder Systeme, die sowohl Wissen speichern, als auch repräsentieren können. Dies können sowohl Individuen als auch physikalische Medien (Papier oder elektronische Medien) sein. Die Weiterentwicklung von Wissen ist allerdings dem Menschen bzw. den Systemen unter Einschluss des Menschen vorbehalten. Die organisatorische Wissensbasis besteht aus: Dokumentationen (gedruckt und/ oder gespeichert), Daten-, Methoden- und Modellbanken, Systeme (Expertensysteme), der Mensch (Experten) und die Unternehmenskultur[4].
3. Wissensmanagement
"Was wir wissen, ist ein Tropfen,
was wir nicht wissen – ein Ozean."
Isaac Newton
Wie einleitend kurz in der Definition von Wissensmanagement von Nonaka und Takeuchi (Kap. 2.5) angerissen, ist es die Hauptaufgabe des Wissensmanagements, bestehendes Wissen zu nutzen, neues Wissen zu schaffen und dieses in der gesamten Organisation zu verteilen, um es in Produkten, Dienstleistungen, Prozessen, Systemen und Strukturen zu verkörpern. Durch die Wissensspirale ist zusätzlich die Notwendigkeit verdeutlicht worden, personengebundenes Wissen der gesamten Organisation verfügbar zu machen, Wissen in der Organisation transparent zu gestalten und den Wissensaustausch innerhalb der Organisation zu fördern. Des Weiteren soll mit dem Instrument des Wissensmanagements der Verlust von Wissen verhindert und die Speicherung vorhandenen Wissens gewährleistet werden, um letztendlich das (gewonnene) Wissen zum Auf- bzw. Ausbau von Wettbewerbsvorteilen zu nutzen.
Willke (1998) wählt eine systemische Sichtweise auf das Wissensmanagement. D. h. er betrachtet Wissensmanagement als Element eines Zusammenhangs gesellschaftlicher, organisationaler, technologischer und individueller Faktoren. Darauf aufbauend definiert er Wissensmanagement als „die Gesamtheit organisationaler Strategien zur Schaffung einer intelligenten Organisation“ (Willke, 1998, S. 39). Personale Strategien behandeln demnach das organisationsweite Niveau der Kompetenzen, Ausbildung und Lernfähigkeit der Mitarbeiter. Für die Organisation als System interessiert die Schaffung, Nutzung und Entwicklung der kollektiven Intelligenz und des „collective mind“ (Weick/Roberts, 1993). Die technologische Komponente betrifft die Effizienz von Organisationen hinsichtlich spezifischer Kommunikations- und Informationsinfrastrukturen.
Nach Picot (1990) hängt der Erfolg des unternehmerischen Wertschöpfungsprozesses von einer erfolgsträchtigen Strategie bzw. einer erstklassigen Idee ab. Dies zu erreichen ergibt sich nach Rehäuser und Krcmar (1996) vor allem durch die (Möglichkeit einer) Ungleichverteilung von Informationen und Wissen in der Wirtschaft.[5]
Mit dem Wissensmanagement wird eine (umwelt-) deterministische Sicht verlassen und ein (Umwelt-) Interaktionsansatz gewählt. Denn im Gegensatz zum organisationalen Lernen wird durch die Wissensschaffung von einer Gestaltbarkeit der Umwelt ausgegangen.
Wissen ist aus der systemischen Perspektive für die meisten Organisationen kein Systemzweck. D. h. Organisationen „produzieren“ nicht neues Wissen um des Wissens willen, sondern sie müssen mit wissensbasierten Produkten und Dienstleistungen für konkrete Kunden in konkreten Märkten spezifische Organisationsziele erreichen (Willke, 1998). Ansatzpunkte des (organisationalen) Wissensmanagements sind damit Kernkompetenzen[6], um Wertschöpfung und Wertschätzung in den Augen der Stakeholder[7] zu gewährleisten. Wird Wissensmanagement so umgesetzt, sind die Voraussetzungen für Lernfähigkeit und Innovationskompetenz gegeben, denn diese beiden Qualitäten werden künftig in einer Wissensgesellschaft, im Kontext globalen Wettbewerbs, unter Bedingungen der Wissensarbeit und globaler Vernetzung, Organisationen in die Lage versetzen, ihre Wertschöpfung und Wertschätzung zu erhöhen (Willke, 1998; 2000).
3.1 Ursprünge des Wissensmanagements
Wissen wurde schon immer in Organisationen implizit gemanagt. Aber Wissensmanagement, also die systematische Auseinandersetzung mit Wissen ist ein relativ neues und aktuelles Thema (Wiig, 1997).
Eine wissenschaftliche Systematisierung von Ansätzen ist aufgrund der Vielzahl von Dimensionen schwierig (vgl. Roehl, 2000). So unterteilen beispielsweise Schneider (1996), Röpnack (1997) und Schmitz und Zucker (1996) die vorliegenden Wissensmanagementansätze in einen instrumentell-technischen und einen konstruktivistischen Strang, bzw. in Management von Wissen und Management für Wissen (Schmitz/Zucker, 1996). Ersterer behandelt die Ressource Wissen als Objekt im oben definierten Sinne, also mit Focus auf Informationsmanagement, Rationalisierung und Künstliche Intelligenz. Letzterer interpretiert Wissen als Prozess, der Schwerpunkt liegt also auf Beziehungspflege, Prozessmanagment und menschlicher Intelligenz.
Eine inhaltlich andere Einteilung nehmen Schüppel (1996), Albrecht (1993) und Hoffmann und Patton (1996) vor. Sie differenzieren zwischen technik- und humanorientierten Ansätzen des Wissensmanagements. Technikorientierte Ansätze umfassen ein erweitertes Datenbankmanagement während humanorientierte Ansätze sich auf den Menschen als Wissensträger konzentrieren. Schüppel (1996) bezeichnet diese Klasse von Ansätzen auch Humanressourcenansatz. Dieser Begriff scheint aber aufgrund der Vielzahl vorliegender Ansätze unpassend.
Roehl (2000) erkennt die Diversität und damit schwierige Vergleichbarkeit der Ansätze und nimmt den Umweg über die Erarbeitung von Systematisierungdimensionen, um Entwicklungslinien und Exponenten des Wissensmanagements herauszuarbeiten, vgl. Abbildung 2.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 2: Entwicklungslinien und Exponenten des Wissenmanagements, aus: Roehl, 2000, S. 90
Er identifiziert drei Entwicklungslinien: die ingenieurswissenschaftliche, die betriebswirtschaftliche und die soziologische. Diese stehen in einem durch zwei Dimensionen definierten Rahmen. Die erste Dimension beschreibt die Gestaltungsorientierung der Ansätze von konkret bis abstrakt, die zweite Dimension unterscheidet den Grad der Gestaltungsperspektive zwischen technologieorientiert und sozial orientiert.
Diese Unterteilung sprengt allerdings den Rahmen der Arbeit, daher genügt es der Zweiteilung von North (1998) zu folgen, um Extrempositionen zweier unterschiedlicher Denkrichtungen des Wissensmanagements auszumachen. Einerseits gibt es Ausarbeitungen, welche auf Informations- und Kommunikationstechnologien basieren, andererseits existieren Untersuchungen, die Rahmenbedingungen schaffen, in denen sich Wissen oder Menschen als Wissensträger entwickeln können. Die beiden komplementären Denkrichtungen werden als technokratisches Wissensmanagement und Wissensökologie beschrieben (North, 1998).
3.1.1 Technokratisches Wissensmanagement
Der technokratische-, IT- oder auch technikorientierte Ansatz beschränkt sich meist auf Überlegungen, wie mit maschineller Hilfe (Elektronische Datenverarbeitung), Wissen in Unternehmen besser und schneller verarbeitet werden kann (Schüppel, 1996). Die Bestandteile des so verstandenen Wissensmanagements sind also zunächst der Wissenserwerb im Sinne einer Aufladung der Wissensbasis, im nächsten Schritt die Wissenssystematisierung, -speicherung und –kontrolle und abschließend die Wissensbereitstellung und –nutzung. Zur Zeit mündet diese Auffassung in eine informationstechnisch orientierte Grundperspektive.
Das technische Verständnis von Wissensmanagement wirft allerdings Probleme auf, von denen hier einige genannt werden sollen. Eine bewusste Gestaltung der Organisation ist nur bedingt möglich, der Emergenz der Wissensstrukturierung wird keine Rechnung getragen und implizites Wissen bleibt diesem Ansatz verschlossen, da es nicht abgebildet werden kann. Unter Nichtberücksichtigung leiden außerdem die Wissensentwicklung, die Generierung neuer Geschäftsfelder, die Erneuerung von innen und das Lernen von externen Wissensquellen.
Gemessen an den oben ausgeführten möglichen Sichtweisen von Wissen (Objekt, Prozess und Wissen als komplexes, sich selbst organisierendes System), wird im technokratischen Verständnis Wissen als Objekt aufgefasst. Ganz anders verhält es sich bei wissensökologischen Ansätzen. Sie interpretieren Wissen, wie gezeigt werden wird, als komplexes, sich selbst organisierendes System.
3.1.2 Wissensökologie
Der wissensökologische Ansatz betont die Prozesshaftigkeit von Wissen und die Elemente der Selbstorganisation. Er versteht Wissen als ein sich selbst organisierendes System, welches infolge seiner Komplexität und der Geschwindigkeit des Wandels nicht vollständig steuerbar ist. Deshalb ist es nicht möglich Wissen im engeren Sinne zu managen, sondern es kann lediglich versucht werden, einen Rahmen zu schaffen, um Wissen zu entwickeln und Mitarbeiter für Wissenserwerb und -nutzung zu motivieren (North, 1998). Organisationen werden in einem systemtheoretischen Rahmen als dynamisch lernende Systeme verstanden, die sich selbstreferentiell durch Auseinandersetzung mit sich selbst und der Umwelt erneuern. Dem Wissensmanagement fällt die Aufgabe zu, infrastrukturelle und organisatorische Voraussetzungen zu schaffen, damit die organisatorische Wissensbasis genutzt, geändert und entwickelt werden kann (Rehäuser/Krcmar, 1996).
Nach North (1998) lassen sich vier Elemente einer Wissensökologie identifizieren: (1) ehrgeizige Ziele, die nur in Zusammenarbeit erreicht werden können, (2) ein Werte-system, das Offenheit für Neues und für Veränderungen, Zusammenarbeit und Authentizität erlaubt, (3) ein Anreizsystem, welches diese Werte fördert und (4) Träger und Medien, die dynamisches organisationales Lernen unterstützen.
Die beiden dargestellten Perspektiven sind als Extrempositionen zu verstehen. Welche Sichtweise bevorzugt wird, hängt fallweise von der Art des Wissens ab. Explizites Wissen erfordert beispielsweise eine Speicherung in Datenbanken. Hierfür sind technokratische Systeme besser geeignet, da sie für eine Speicherung und anschließende Verbreitung speziell konzipiert wurden, und dadurch der Wissensverlust minimiert werden kann. Implizites Wissen kann in solchen Systemen nicht gespeichert werden, da es definitionsgemäß nur im intensiven persönlichen Kontakt vermittelbar ist und in Datenbanken verloren gehen würde.
3.2 Ganzheitliches Wissensmanagement
Umfassende neue Ansätze gehen von einem ganzheitlichen Wissensmanagement aus[8], welches Elemente der Technik- und der Humanorientierung sinnvoll miteinander verbindet.
Die Potentiale, die der Einsatz von Wissensmanagement bieten kann, sind nur dann dimensionsübergreifend optimal ausschöpfbar, wenn ein ganzheitlicher Ansatz gewählt wird. Dazu sind drei Gestaltungsdimensionen zu beachten (Bullinger/Wagner/Ohlhausen, 2000). Neben der informationstechnischen Dimension (geeignete technische Infrastruktur) sind auch organisationale Elemente (Unternehmensstruktur, Prozesse usw.) und Humanressourcen (Unternehmenskultur, Motivation, usw.) zu beachten.
Ein ausschlaggebender Erfolgsfaktor zur Erreichung einer Unternehmenskultur, die Wissenstransfer unterstützt ist ein zielorientiertes Human Ressource Management. Der Faktor Mitarbeiter, dessen Wissen in der Gesamtheit die organisationale Wissensbasis einer Organisation darstellt, ist frühzeitig in den Prozess des Wissensmanagements einzubinden. Können die Mitarbeiter nicht zur Wissensteilung motiviert werden, ist effektives und erfolgreiches Wissensmanagement nicht zu bewerkstelligen.
Das im folgenden darzustellende Modell der Wissensbausteine von Probst, Raub und Romhardt (1999) ist als Phasenmodell aufgebaut. Dieses Phasenmodell enthält, wie andere Phasenmodelle[9], sowohl Komponenten des klassischen Managementprozesses als auch Elemente der Wissensökologie. Sie verstehen Wissensmanagement eher pragmatisch und schlagen vor es als einen Prozess zu begreifen. Dieser praxisorientierte Ansatz unterstützt eine pragmatische Umsetzung eines ganzheitlichen Wissensmanagements.
3.3 Bausteinmodell des Wissensmanagements
Als die zwei prominentesten Modelle für den Prozess des Wissensmanagements und der Wissensschaffung gelten Nonaka und Takeuchi (1997) mit der Wissensspirale, sowie Probst, Raub und Romhardt (1999) mit dem Bausteinmodell des Wissensmanagements.
Da die Wissensspirale von Nonaka und Takeuchi bereits im Kap. 2.5 herausgearbeitet wurde, soll das Modell von Probst, Raub und Romhardt nachfolgend näher untersucht werden. Das Modell verlässt den sehr theoretischen Rahmen, der z. B. von Nonaka und Takeuchi verwendet wurde und zielt vor allem auf einen engeren Praxisbezug ab und hebt instrumentelle Aspekte hervor. Wissensmanagement wird in diesem integrativen Ansatz als handlungsbezogene Weiterentwicklung des Organisationalen Lernens verstanden (Roehl, 2000).
Die „Geneva Knowledge Group“, eine wissenschaftliche Gruppe von der Universität Genf, entwickelte in Zusammenarbeit mit einigen Unternehmen durch gemeinsame Projekte und Diskussionsforen ein integriertes Konzept des Wissensmanagements (Bendt, 2000). Wissensmanagement soll danach nicht Selbstzweck sein, sondern an konkrete Fragestellungen ankoppeln, um den Implementierungserfolg zu erhöhen (Romhardt, 1998). Grafisch lässt sich das Bausteinmodell wie in Abb. 3 darstellen.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 3: Bausteine des Wissensmanagements aus: Probst/Raub/Romhardt, 1997, S. 56
Probst, Raub und Romhardt (1999; vgl. auch zu folgenden Ausführungen) postulieren einen Grundprozess, in dem Identifikation, Erwerb, Entwicklung, Verteilung, Nutzung und Bewahrung von Wissen unterschieden werden. Darüber setzen sie einen Feedbackprozess, in dem aus der Wissensbewertung neue oder veränderte Wissensziele folgen.
Die einzelnen Bausteine stellen eine Konzeptualisierung von Aktivitäten dar, die unmittelbar wissensbezogen sind. Die Anordnung der Bausteine folgt zwei Prinzipien. Der äußere Kreislauf mit den Elementen Zielsetzung, Umsetzung und Messung bildet den traditionellen Managementprozess ab. Damit wird die Relevanz strategischer Ziele, sowie die Bedeutung eindeutiger und konkreter Zielsetzungen unterstrichen. Des Weiteren berücksichtigt er die Notwendigkeit Messungen durchzuführen, um der Idee der zielgerichteten Steuerung gerecht zu werden (Probst/Raub/Romhardt, 1999).
Der innere Kreislauf beinhaltet die einzelnen Bausteine. Wissensprobleme entstehen, wenn ihnen nicht genügend Aufmerksamkeit geschenkt wird. Das Baustein-Konstrukt wird verwendet, damit der Managementprozess in logische Phasen strukturiert werden kann, Ansätze für Interventionen angeboten und Wissensprobleme schnell identifiziert werden können. Zusätzlich betont es die Interdependenz der einzelnen Bausteine, die eine isolierte Beeinflussung ausschließen. Nachfolgend werden die einzelnen Bausteine genauer vorgestellt.
Wissensziele
Das grundsätzliche Problem bei der Definition von Wissenzielen ist, dass niemand weiß, welches Wissen in der Zukunft benötigt wird. Damit entwickelt die Diskussion um Wissensziele eine gewisse philosophische Qualität. Polanyi lehnt dieses Wissensziel-Problem als Vorstellung einer Problemlösung an Platons Menon an, welche in einer Paradoxie mündet: "Die Suche nach der Lösung eines Problems, sagt er, sei etwas Widersinniges; denn entweder weiß man wonach man sucht, dann gibt es kein Problem; oder man weiß es nicht, und dann kann man nicht erwarten, irgend etwas zu finden" (Polanyi (1985, S. 28), zitiert nach Roehl, 2000, S.266). Allerdings ist irgendeine Form von Zielformulierung für jedes systematische Vorgehen unabdingbar. Denn die Langsamen werden den Wettbewerb nicht überleben, aber die, die nicht wissen, wohin sie wollen, sind, auch wenn sie schnell sind, nicht schneller dort (Roehl, 2000).
Die Definition von Wissenszielen dient als Orientierungsmaßstab bzw. gibt die Richtung für die Aktivitäten des Wissensmanagements vor. Die Ziele sind im normativen, strategischen und operativen Bereich zu formulieren. Normative Ziele dienen der Entwicklung einer förderlichen Unternehmenskultur. In strategischer Hinsicht erläutern sie die angestrebten Kompetenzen und das Kernwissen der Organisation. Die operativen Ziele übersetzen schließlich die normativen und strategischen Ziele in umsetzungs- und handlungsorientierte, sowie messbare Teilziele. Ausreichend konkret formulierte Ziele sind notwendig, um später Messungen vornehmen zu können. Dies kann nur geschehen, wenn sie auf einzelne Organisationsbereiche heruntergebrochen und aufgeschlüsselt werden. Operative Ziele sichern daher persönliche, wissensbezogene Zielvereinbarungen im Sinne eines Managements by Knowledge Objektives[10] (Probst/Raub/Romhardt, 1999). Wissensziele sollen aber nicht die Planung revolutionieren, an Zielkategorien strategischer oder finanzieller Planung wird weiterhin festgehalten, sie ergänzen vielmehr die herkömmlichen Planungsaktivitäten.
Wissensidentifikation
Wenn ein Mensch schon nicht alles wissen kann, dann muss er zumindest wissen, wo er sich das Wissen holen kann. Daher ist eine Wissensidentifikation als Gegenmaßnahme zur Intransparenz notwendig.
„Gerade multinationale Unternehmen klagen darüber, dass sie in wichtigen Bereichen den Überblick über ihre internen Fähigkeiten und Wissensbestände verloren haben“ (vgl. Probst/Raub/Romhardt, 1997, S. 101). Besonders in Großkonzernen herrscht Unklarheit darüber, wo welcher Experte mit welcher Expertise sitzt und an welchen Projekten gerade gearbeitet wird. Neue Managementmethoden, wie Lean Management, Reengineering oder Restrukturierungen verstärken die Intransparenz, da sie effiziente, informelle Netze auseinanderreißen. Damit also Ineffizienz, uninformierte Entscheidungen und Doppelspurigkeiten vermieden werden, gibt es Lösungsvorschläge, wie z. B. Wissenslandkarten oder Intranets[11]. Neben den hervorragenden Möglichkeiten der Informationstechnologie darf nicht der Faktor Mensch als Träger impliziten Wissens vergessen werden. Dazu müssen sich Wissensanbieter und –nachfrager auf einer Plattform kennen lernen können (Probst/Romhardt, 1997).
Wissenserwerb
Sämtliches für das Know-how notwendige Wissen kann nicht von einem Unternehmen allein hergestellt werden. Daher existieren neben der internen Wissensgenerierung weitere Möglichkeiten des Wissenserwerbs.
Um Wissenslücken zu füllen oder kritische Fähigkeiten zu erhalten, muss Wissen aufgenommen werden. Dabei lässt sich der Erwerb von Wissen anderer Firmen, von Stakeholdern, externen Wissensträgern und von Wissensprodukten unterscheiden. Beim Import des Wissens ist jedoch zu beachten, dass das Gleichgewicht zwischen der inneren Routine und der Anschlussfähigkeit des Wissens immer hergestellt ist, da sonst durch eine zu große Ablehnung kein neues Wissen entstehen kann. Gleichzeitig ist zu beachten, ob mit dem Erwerb eine Investition in die Zukunft (Potential) oder eine Investition in die Gegenwart (direkt verwertbares Wissen) getätigt wird. Ein integriertes Wissensmanagement muss beide Komplexe beinhalten und mit geeigneten Instrumenten fördern (Roehl/Romhardt, 1997).
Wissensentwicklung
An diesem Baustein setzen viele Managementforscher an. Focussiert wird die Frage, wie neue Fähigkeiten, neue Produkte, bessere Ideen und leistungsfähigere Prozesse geschaffen werden können. Wissensentwicklung schließt sowohl die Kreierung bisher intern als auch extern noch nicht bestehender Fähigkeiten ein. Dabei kann die Entwicklung auf individueller und auf kollektiver Ebene stattfinden, z. B. nach Projekten durch den Einbau von lessons learned können durch Selbstreflexion Erfahrungen, und damit das Ergebnis eines kollektiven Lernprozesses, weitergegeben werden.
Meist entzieht sich die Wissensentwicklung einer direkten Steuerung, aber sie kann durch ein Klima der Offenheit, des Vertrauens und der Fehlertoleranz, durch die Schaffung von Freiräumen oder Möglichkeiten des Vorschlagswesens gefördert werden.
Wissens(ver)teilung
„Wissen auf die richtigen Mitarbeiter zu verteilen, beziehungsweise organisationales Wissen an die richtige Stelle zu bringen, wo es gerade dringend gebraucht wird, ist eine der schwierigsten und am meisten unterschätzten Hindernisse für ein erfolgreiches Wissensmanagement“ (Probst/Raub/Romhardt, 1997). Grundvoraussetzung ist, dass Wissen für alle nutzbar ist. Es muss nicht von allen Mitarbeitern alles gewusst werden - das ökonomische Prinzip der Arbeitsteilung erfordert lediglich eine sinnvolle Beschreibung und Steuerung des Wissens(ver)teilungsumfangs. Die Wissensverteilung kann durch eine Push-Strategie (zentrale Wissens verteilung) oder durch eine Pull-Strategie (dezentrale Wissens teilung) organisiert sein (Bendt, 2000). Aber nicht jede Wissensart ist für eine effiziente Wissensmulitplikation geeignet (implizites vs. explizites Wissen).
Wissens(ver)teilung kann der reinen Multiplikation von Wissen oder dem Zugriff auf Erfahrungen (lessons learned) sowie dem synchronen Zugriff auf organisationale Wissensbestände und deren Transformation dienen (Probst/Romhardt, 1997).
Zu beachten ist, dass man auf kulturelle und individuelle Barrieren stoßen kann, da nicht jede Unternehmenskultur offen Wissen austauscht oder in vielen Köpfen Wissensteilung mit Machtverlust[12] einhergeht.
Wissensnutzung
Die Wissensnutzung, also der effiziente Einsatz organisationalen Wissens zum Nutzen des Unternehmens, ist Ziel und Zweck des Wissensmanagements. Die Bemühungen zur Wissensidentifikation und Wissens(ver)teilung waren vergeblich, wenn die Wissensnutzung nicht sichergestellt ist. Dazu ist es notwendig, Routinen zu durchbrechen und neue Wege zu gehen, um dem natürlichen Beharrungsvermögen von Organisationen und deren Mitgliedern entgegenzuwirken. Werden neue Wissenssysteme nicht genutzt, kann es zur „Todesspirale“ kommen: Geht die Nutzung des Systems zurück, so hat dies zur Konsequenz, dass Investitionen in Zugriffsfreundlichkeit zurückgeschraubt werden. Dadurch vermindert sich die Datenqualität und das Vertrauen in die Daten geht verloren. Dies hat zur Folge, dass das System weniger genutzt wird, womit sich der Teufelskreis schließt (Probst/Raub/Romhardt, 1999).
Die Anstrengungen des Wissensmanagements sind erfolglos, wenn die Nutzer nicht vom Nutzen des neuen Systems überzeugt sind. Nutzer und Nutzung liegen nicht zufällig sprachlich so dicht beieinander (Probst/Romhardt, 1997).
Wissensbewahrung
Einerseits ist es schwierig die bewahrungswürdigen Informationen aus der Informationsflut zu selektieren und zu speichern, andererseits leiden viele Organisationen an einer „kollektiven Amnesie“ (Probst/Romhardt, 1997), die sie durch die Zerstörung informeller Netzwerke im Zuge von Reorganisationsmaßnahmen erlitten haben. Um bestehende Fähigkeiten der Organisation auch in Zukunft nutzen zu können, bestehen die Hauptprozesse der Wissensbewahrung in einer adäquaten Selektion des Bewahrungswürdigen, angemessener Speicherung und regelmäßiger Aktualisierung des Wissens. Die Leitregel der Wissensselektion lautet, dass nur Wissen bewahrt wird, welches in Zukunft für Dritte nutzbar sein könnte. Der verwendete Konjunktiv deutet auf die Schwierigkeit der Selektion hin, da Künftiges nie befriedigend antizipiert werden kann (vgl. dazu die einleitenden Ausführungen dieses Kap. zu Wissenszielen).
Zur Wissensbewahrung sind Individuen mit ihrem impliziten Wissen und informellen Netzwerken von großer Bedeutung. Hier können Anreizsysteme oder Austrittsbarrieren für Kontinuität im Sinne einer langfristigen Personalbindung greifen (vgl. Kap. 7).
Mit der Wissensbewahrung schließt sich der innere Kreislauf. Wobei Kreislauf nicht, wie gesagt, andeuten soll, die Bausteine stünden zusammenhangslos nebeneinander, vielmehr gehen Probst, Raub und Romhardt von einem interdependenten Verhältnis aller Bausteine zueinander aus.
Wissensbewertung
Die Messung und Bewertung von Wissen gehört mit zu den größten Problemen, die das Wissensmanagement zu bewältigen hat. Gerade in der heutigen börsenkursgeprägten Welt wird mehr denn je auf Zahlen geachtet. Hinzu kommt, dass die durch das Aufkommen des Managements verursachte Trennung von Eigentum und Verfügungsgewalt meist kurzfristig ausgelegte Projekte bevorzugt. Langfristig bessere Strategien werden von Managern meist abgelehnt, wenn kurzfristig ein negativer Cash-Flow zu erwarten ist. Denn sie werden an Zahlen gemessen und können schnell und ohne persönliche Nachteile ihren Posten verlassen.
Wissensmanager können nicht auf ein erprobtes Finanzinstrumentarium zurückgreifen – aber wie soll man Projekte initiieren, die weder kurz- noch langfristig direkt messbare Ergebnisse präsentieren? Der entscheidende Durchbruch konnte hier noch nicht erzielt werden (Probst/Romhardt, 1997). Wie kann man beispielsweise die Kosten festhalten, die gespart wurden, da man für ein bestimmtes Problem auf das Know-how anderer Experten in Tochterorganisationen zurückgreifen konnte und damit das "Rad" nicht ein zweites Mal neu erfinden musste? Erfolgreiches Wissensmanagement ist in der Lage, Doppelarbeit, sowie Zeit- und Produktivitätsverluste zu verhindern, die insbesondere in dezentralen internationalen Großunternehmen aufgrund der räumlichen Trennung von Experten und dem daraus resultierenden mangelnden Informations- und Wissensaustausch resultieren.[13]
Hier bedarf es einerseits der Weitsichtigkeit der Unternehmensführung, andererseits der Entwicklung neuer adäquater Messinstrumente, die auch „weiche Faktoren berücksichtigen, wie sie z. B. durch die Balanced Score Card[14] (Kaplan/Norton, 1996) oder die Messung des „Intellektuellen Kapitals“ bei Skandia (Edvinson/Malone, 1997) angedeutet werden.
Die zuvor definierten normativen, strategischen und operativen Ziele werden gemessen und eine Zielerreichung durch einen Soll-Ist-Vergleich bestimmt. Nun zeigt sich die Qualität der formulierten Ziele. Allgemein formulierte Ziele erweisen sich gegenüber spezifizierten Zielen unterlegen. Wissensorientierte Kulturanalysen, die Erstellung von Fähigkeitsbilanzen oder die Intensivierung von Methoden des Ausbildungscontrolling sind konkreter und eher messbar, als allgemeine Ziele, wie „Wir wollen ein lernendes Unternehmen werden“ (Probst/Romhardt, 1997).
Resümierend kann man mit den Worten von Roehl und Romhardt (1997, S. 45) konstatieren: "Der Anspruch, Wissen exakt messen zu können gaukelt dort Objektivität vor, wo nur Unschärfe sein kann".
Fazit
Wissensmanagement muss von der Top-Managementebene unterstützt werden. Denn durch die neu entstandene Wissenstransparenz verlieren Experten ihre Sonderstellung, die vormals durch Informationsvorsprünge gewährleistet war. Damit büßen sie einen Teil ihrer Machtbasis ein. Es gilt insbesondere die Experten von der Vorteilhaftigkeit des Wissensmanagements zu überzeugen, um politische Spiele zu vermeiden. Ohne sie ist implizite Wissensweitergabe nicht möglich.
Wissensmanagement ist eine Querschnittsaufgabe. Die Organisationsstrukturen müssen dahingehend verändert werden, dass sie den Fluss des Wissens unterstützen und nicht durch Abteilungs- oder intraorganisationales Denken behindern. Schließlich gilt es die getrennten Funktionslogiken vom z. B. Personalbereich, der Informatik, der Forschungs- und Entwicklungsabteilung und der Unternehmensplanung zu koordinieren. Daher muss sich die Wissensnutzung in der Ablauforganisation und Unternehmenskultur niederschlagen (Probst/Romhardt, 1997). Die Integration von (partizipativen) Wissenszielen in die Unternehmensstrategie muss gewährleistet sein, um Wissensmanagement erfolgreich umzusetzen.
Im Zuge der weltweiten Vernetzung aller Arbeitsplätze entstehen Kommunikationsstrukturen, welche mit den vorhandenen Organisationsstrukturen nicht handhabbar sind. Das Wissensmanagement hat dafür Sorge zu tragen, den Faktor Mensch mit seinen Fähigkeiten und Erfahrungen mit den technologischen Möglichkeiten zu verbinden.
Kritisiert wird am Modell der Wissensbausteine der weitgehende Verzicht auf eine theoretische Fundierung. Modelle sollten zwar pragmatisch einfach und nutzbar sein, aber „in komplizierten und komplexen Kontexten widerspricht forcierte Einfachheit oft einem wirklichen Nutzen“ (Willke, 1998, S. 78).
3.4 Rahmenbedingungen für ein erfolgreiches Wissensmanagement
Drei Rahmenbedingungen lassen sich identifizieren, die erfüllt sein müssen, um für ein erfolgreiches ganzheitliches Wissensmanagement die Voraussetzungen zu schaffen. Dabei sind technische, organisatorische und kulturelle Rahmenbedingungen zu beachten.
3.4.1 Technische Rahmenbedingnungen
Durch eine informationstechnische Vernetzung aller Mitarbeiter soll ein schneller und ungehinderter Zugang zu Expertenwissen innerhalb der Organisation gewährleistet werden. Dies kann z. B. durch ein Intranet realisiert werden. Die intraorganisationalen, bzw. durch Fusionen, Kooperationen o. ä. Netzwerke verstärkt benötigten interorganisationalen, Informations- und Kommunikationsstrukturen werden immer häufiger um Groupware-Anwendungen[15] ergänzt, welche die Zusammenarbeit von räumlich getrennten Teams oder Projekten erleichtern soll.
[...]
[1] Vgl. zu Kap. 2.2 Glückstein (2001).
[2] Die (selbstreferentielle) Generierung neuen Wissens durch Lernprozesse ist eine von vier Formen des organisationalen Lernens. Die übrigen sind: Lernen aus Erfahrung, Vermitteltes Lernen und Lernen durch Inkorporation neuer Wissensbestände (Schreyögg, 1997).
[3] Die Metapher hat in diesem Prozess eine besondere Bedeutung. Metaphern harmonisieren einen ihnen inhärenten Widerspruch durch Analogien, die das unbekannte reduziert und die Gemeinsamkeiten von zwei verschiedenen Dingen betont (Nonaka/Takeuchi, 1997). Nach Donnellon, Gray und Bougon (1986) erzeugen Metaphern eine neue Erfahrungsinterpretation, indem sie den Zuhörer auffordern, eine Sache im Sinne einer anderen zu betrachten und somit eine neue Realitätserfahrung bewirken. Dadurch bilden sie eine Art Kommunikationsmechanismus zur Versöhnung von Bedeutungsdiskrepanzen. Behrend (1998) hingegen kritisiert Explikation implizitem Wissens über die Metapher als letztendlich unzulängliches Hilfsmittel. Er erläutert dies am Beispiel des Radfahrens. Die Kenntnis physikalischer Regeln und die bildhafte Erläuterung des Radfahrens kann zwar einen ersten Eindruck vermitteln, ist aber nicht mit der tatsächlichen Erfahrung zu vergleichen.
[4] Die Unternehmenskultur als Wissensträger ist in etwa wie folgt vorstellbar: Die Unternehmenskultur ist durch die Geschichte des Unternehmens und seiner Umwelt geprägt. Das im Laufe der Zeit gewachsene Wissen hat sich im organisatorischen Gedächtnis niedergeschlagen und damit die Unternehmenskultur gebildet (Rehäuser/Krcmar, 1996).
[5] Aus dieser Sicht wird Wissen als strategischer Wettbewerbsvorteil betrachtet. Hier haben sich zwei komplementäre Sichtweisen gebildet, der umweltbezogene Ansatz (Wettbewerbsvorteile entstehen aus der Ungleichverteilung von Information und Wissen zwischen Unternehmen. Unternehmertum besteht im Erkennen und Nutzen von Wissensunterschieden) und der ressourcenbezogene Ansatz (Wettbewerbsvorteile entstehen durch unterschiedliche Verhaltensweisen. Im Gegensatz zum umweltbezogenen Ansatz können diese Vorteile langfristig sein) (vgl. dazu eingehender North, 1998 und die dort angegebene Literatur).
[6] Kernkompetenzen bestehen aus organisationalem Wissen. Das organisationale Wissen ist mehr als die Summe des individuellen Wissens in der Organisation. Das rührt daher, dass Kernkompetenzen nur im Zusammenspiel mehrerer Personen aufgebaut werden können und deren implizitem Wissen bedürfen. Daher können Organisationen auch den Weggang einzelner Wissensträger überstehen, wobei eine gewisse Wissensdiffusion nicht verhindert werden kann.
[7] Unter Stakeholder werden beispielsweise Kunden, Lieferanten, Eigentümer, Mitarbeiter, Politiker, Medien und Meinungsbildner subsummiert (Probst et al. 1997).
[8] Vgl. dazu die im Kap. 3 erläuterte systemische Sichtweise von Willke (1998).
[9] Andere Beispiele für ein Phasenmodell werden vorgestellt von Rehäuser und Krcmar (1996), Edvinson (1997), Pawlowsky (1994), Hoffmann und Patton (1996), Güldenberg (1998) oder Schmitz und Zucker (1996).
[10] Vgl. zum Management by Knowledge Objectives als Lösungsvorschlag innerhalb eines Anreizsystems für Wissensmanagement Kap. 7.2.7.
[11] Vgl. zu weiteren Instrumenten der Wissenorganisation ausführlich Kap. 6.2
[12] Vgl. zu den Barrieren des Wissenstransfers ausführlich Kap. 6.3.
[13] Zucker (1997) beziffert die durch Überschneidungen von F & E Tätigkeiten auftretenden Doppelerfindungen in Deutschland mit einem volkswirtschaftlichen Schaden auf 24 Mrd. DM.
[14] Mit der Balanced Score Card wird ein Unternehmen aus vier Perspektiven betrachtet: die Kundenperspekive, die finanzielle Perspektive, die Perspektive der internen Geschäftsprozesse und die Lern- und Wachstumsperspektive. Zusätzlich werden kurz- und langfristige Ziele festgehalten, wie auch monetäre und nichtmonetäre Steuerungsgrößen verbunden.
[15] Zu Groupware Anwendungen zählen Netzwerke, die die elektronische Kommunikation ermöglichen, wie z. B. Diskussionsforen im Intranet, E-Mail oder Network- und Videokonferenzen, sowie Anwendungen, die die Zusammenarbeit in Gruppen optimieren sollen, wie beispielsweise Zeit- und Aufgabenmanager oder Workflow-Management. Davon zu unterscheiden sind Werkzeuge des Corporate Memory, die in Abhängigkeit der Wissensart das gesuchte Wissen direkt zur Verfügung stellen, z. B. Datenbanken oder, falls das benötigte Wissen nicht formalisierbar ist den Zugang zum Wissen ermöglichen, beispielsweise Expertenverzeichnisse (Bendt, 2000).
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Originalausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2001
- ISBN (eBook)
- 9783832446550
- ISBN (Paperback)
- 9783838646558
- DOI
- 10.3239/9783832446550
- Dateigröße
- 1.1 MB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- Freie Universität Berlin – Wirtschaftswissenschaften
- Erscheinungsdatum
- 2001 (Oktober)
- Note
- 1,0
- Schlagworte
- wissensmanagement commitment motivation management knowledge objectives ziele
- Produktsicherheit
- Diplom.de