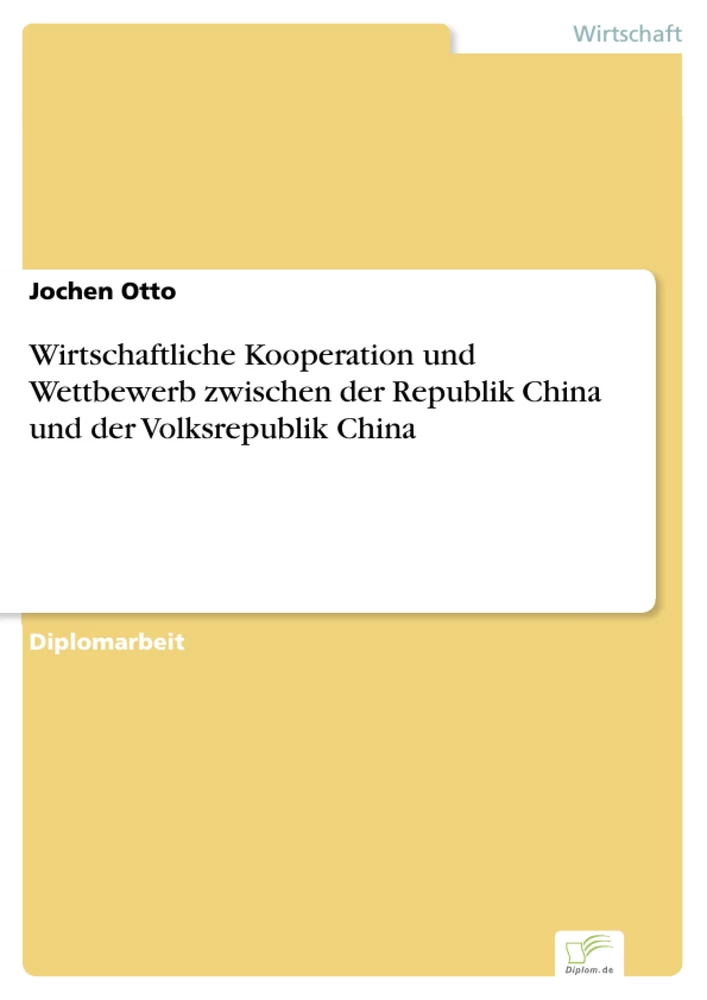Wirtschaftliche Kooperation und Wettbewerb zwischen der Republik China und der Volksrepublik China
Zusammenfassung
Diese Arbeit setzt sich mit der wirtschaftlichen Kooperation und dem Wettbewerb zwischen der Volksrepublik China (VR China) und der Republik China (ROC) auseinander. Sie soll die zunehmende Verflechtung der beiden Teile Chinas zum größten, ethnischen weitgehend einheitlich geprägten Wirtschaftsraum der Welt näher untersuchen und sich daraus ergebende Perspektiven aufzeigen.
Untersuchungsgegenstand
Die besondere Bedeutung kommt dabei der komplexen Welt Chinas zu. Hier sind Politik, Wirtschaft, Kultur und Sprache auf eine besondere Weise miteinander verbunden.
Untrennbar damit verknüpft ist dabei Chinas Suche nach einem neuen System. Die Transformation von einem revolutionären kommunistischen Staat zu einem konventionelleren Entwicklungsland wurde dabei von Ideologie und politischen Auseinandersetzungen beherrscht. Hauptziele der Pekinger Führung waren Wirtschaftsreform, soziale Stabilität und rasches Wachstum im Gleichgewicht zu halten.
Es ist zu vermuten, daß die Entwicklung der VR China dem Pfad der ROC folgen wird, und zwar politisch (Schlagwort der Entwicklungsdiktatur), wirtschaftspolitisch (ostasiatisches Modell) und wirtschaftlich (Hochwachstum der kleinen Tiger). Dies stützt sich hauptsächlich darauf, daß es sich um Staaten eines einheitlichen chinesischen Kulturraumes handelt. Auch der zur Zeit stattfindende rasche, intensive Prozeß der wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Integration dieses Raumes stütz diese Vermutung.
Insofern könnten die ROC und die VR China ein Fall zeitverschobener, strukturell ähnlicher Entwicklung sein, wie das auch für Japan und Südkorea diagnostiziert wurde.
Bedeutend ist die Abkehr der ROC vom politischen Autoritarismus, der bereits nunmehr fünfzehn Jahre zurückliegt. Der Grad der bis heute erreichten Konsolidierung demokratischer Institutionen sowie das Entwicklungsniveau zivilgesellschaftlicher Selbstorganisationen sind bemerkenswert.
Der Geschichte Chinas kommt auch unter Berücksichtigung des tragenden Beziehungsnetzes, das in der chinesischen Kultur besondere Formen angenommen hat, eine wichtige Rolle bei der Betrachtung zu. Weiter ist ein Blick auf das internationale Umfeld erforderlich, um den Stellenwert des großchinesischen Raumes aufzuzeigen.
Das chinesische Volk, ein Fünftel der Menschheit, hat zweifellos bei der Überwindung von Armut, Rückständigkeit und bei der Modernisierung seiner Wirtschaft Riesenschritte nach vorn getan. Die konkreten Maßnahmen dieses […]
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis
Tabellenverzeichnis.
Abbildungsverzeichnis
Kartenverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
1. Einleitung: Rahmen und Konzeption
1.1 Untersuchungsgegenstand
1.2 Zielsetzung
1.3 Forschungsstand
1.4 Konzeption und Aufbau der Arbeit
2. China, Taiwan und die chinesische Nation: der geschichtliche Kontext
2.1 Historische Bestimmungsfaktoren bis
2.1.1 Machtkampf zwischen der Guomindang und der Kommunistischen Partei
2.1.2 Die politische und wirtschaftliche Sonderstellung der Insel Taiwan
2.2 Die Teilung des Landes
2.3 Die Ausrichtung der Wirtschaft von 1949 bis Ende der siebziger Jahre
2.3.1 Außenhandel der VR China
2.3.2 Außenhandel der ROC
2.3.3 Wirtschaftskontakte zwischen der VR China und der ROC vor Beginn der achtziger Jahre
3. Voraussetzung der ökonomischen Verflechtung
3.1 Die Republik China: Liberalisierung und Pragmatismus
3.1.1 Die Ära der Entwicklungsdiktatur von 1949-
3.1.2 Die demokratische Ära ab
3.2 Die Volksrepublik China: wirtschaftliche Öffnung und Reformen
3.2.1 Kurswechsel unter Deng Xiaoping – Wandel vom Plan zum Markt
3.2.2 Stufen der wirtschaftlichen Entwicklung
3.2.3 Die Öffnung der VR China zur Welt
3.2.4 Herausforderungen für die Wirtschaftspolitik
3.2.5 Die Rolle der Landsleute im wirtschaftlichen Entwicklungsprozeß
3.3 Wirtschaftskontakte zwischen der VR China und der ROC ab den achtziger Jahren
4. Die derzeitige Wirtschaftsverflechtung und ihr Potential
4.1 Die ROC als Investor in Asien
4.2 Wettbewerb und intraregionaler Kooperationsprozeß durch Wachstum
4.2.1 Wettbewerbsebenen zwischen der ROC und der VR China
4.2.2 Erklärungsansätze zum wachsenden Wettbewerb und zur intraregionalen Kooperation
4.2.3 Ein asiatisches Wachstumsmodell (Fluggänsemodell von Akamatsu)
4.3 Der Standort Festlandchina als Wirtschaftspotential
4.4 Netzwerke und das kulturelle Muster wirtschaftlicher Integration in China
4.5 Die Struktur des Engagements der ROC auf dem Festland
4.6 Anomalien des Marktes
5. Abschließende Bewertung und Zukunftsperspektiven
Literaturverzeichnis
Anhang
Tabellenverzeichnis
Tabelle 1 Wirtschaftsstrukturelle Merkmale der ROC und der VR China von
Tabelle 2 Entwicklungsstrategien und wirtschaftlichen Schwerpunkte in der VR China und der ROC, 1949-
Tabelle 3 Veränderung der Wirtschaftsstruktur der VR China
Tabelle 4 Wachstumsraten der Industrie und des Bausektors in der VR China
Tabelle 5 Der Außenhandel der VR China
Tabelle 6 Vergleich der Wirtschaftsstruktur in der ROC und der VR China
Abbildungsverzeichnis
Abbildung 1 Raumzeitliches Ausbreitungsmuster der intraregionalen Kapitalverflechtungen in Ost/Südostasien
Abbildung 2 Modellbeispiel der Entwicklung des inter- und intraregionalen Handelsvolumens zwischen der ROC, der VR China und Hongkong im Ost/Südostasien Wirtschaftsraum
Abbildung 3 Produktion und Außenhandel im Modell der Fluggänse
Kartenverzeichnis
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abkürzungsverzeichnis
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
1. Einleitung: Rahmen und Konzeption
Diese Arbeit setzt sich mit der wirtschaftlichen Kooperation und dem Wettbewerb zwischen der Volksrepublik China (VR China) und der Republik China (ROC) auseinander. Sie soll die zunehmende Verflechtung der beiden Teile Chinas zum größten, ethnischen weitgehend einheitlich geprägten Wirtschaftsraum der Welt näher untersuchen und sich daraus ergebende Perspektiven aufzeigen.
1.1 Untersuchungsgegenstand
Die besondere Bedeutung kommt dabei der komplexen Welt Chinas zu. Hier sind Politik, Wirtschaft, Kultur und Sprache auf eine besondere Weise miteinander verbunden (vgl. Gälli 1995, S.1).
Untrennbar damit verknüpft ist dabei Chinas Suche nach einem neuen System. Die Transformation von einem revolutionären kommunistischen Staat zu einem konventionelleren Entwicklungsland wurde dabei von Ideologie und politischen Auseinandersetzungen beherrscht. Hauptziele der Pekinger Führung waren Wirtschaftsreform, soziale Stabilität und rasches Wachstum im Gleichgewicht zu halten (vgl. Kemenade 1997, S.10 ff.).
Es ist zu vermuten, daß die Entwicklung der VR China dem Pfad der ROC folgen wird, und zwar politisch (Schlagwort der „Entwicklungsdiktatur“), wirtschaftspolitisch („ostasiatisches Modell“) und wirtschaftlich („Hochwachstum der kleinen Tiger“). Dies stützt sich hauptsächlich darauf, daß es sich um Staaten eines einheitlichen chinesischen Kulturraumes handelt. Auch der zur Zeit stattfindende rasche, intensive Prozeß der wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Integration dieses Raumes stütz diese Vermutung.
Insofern könnten die ROC und die VR China ein Fall zeitverschobener, strukturell ähnlicher Entwicklung sein, wie das auch für Japan und Südkorea diagnostiziert wurde (vgl. Herrmann-Pillath 1997, S.324).
Bedeutend ist die Abkehr der ROC vom politischen Autoritarismus, der bereits nunmehr fünfzehn Jahre zurückliegt. Der Grad der bis heute erreichten Konsolidierung demokratischer Institutionen sowie das Entwicklungsniveau zivilgesellschaftlicher Selbstorganisationen sind bemerkenswert (vgl. Schubert 1996, S.1).
Der Geschichte Chinas kommt auch unter Berücksichtigung des tragenden Beziehungsnetzes, das in der chinesischen Kultur besondere Formen angenommen hat, eine wichtige Rolle bei der Betrachtung zu. Weiter ist ein Blick auf das internationale Umfeld erforderlich, um den Stellenwert des großchinesischen Raumes aufzuzeigen (vgl. Gälli 1995, S.1).
Das chinesische Volk, ein Fünftel der Menschheit, hat zweifellos bei der Überwindung von Armut, Rückständigkeit und bei der Modernisierung seiner Wirtschaft Riesenschritte nach vorn getan. Die konkreten Maßnahmen dieses Übergangs haben jedoch viele Widersprüche hervorgebracht, zu zeitweiligen Rückschlägen und unerwünschten Nebenwirkungen, vor allem aber zu Korruption geführt.
Seit Anfang der achtziger Jahre spielen intensiver Handel und Investitionen aus Hongkong sowie seit Ende der achtziger Jahre auch aus der ROC eine bedeutende Rolle bei der Umgestaltung des chinesischen Festlandes. Bedeutend ist hierbei vor allem die ansteckende Wirkung der Gesellschaftssysteme und des Lebensstils dieser beiden chinesischen „Randgebiete“.
In kaum zwanzig Jahren haben sich die Chinesen aus „Mao anbetenden blauen Ameisen“ zu „nihilistischen, höchst individualistischen, geldgierigen Genußmenschen“ gemausert, vielleicht der neuesten Spezies „wirtschaftlicher Wesen“, wie man die Japaner auf dem Höhepunkt ihres wirtschaftlichen Aufstiegs in den siebziger Jahren nannte (Kemenade 1997, S.10). Die Verlagerung der arbeitsintensiven Verarbeitungsindustrien Hongkongs und der ROC mitsamt ihren Managementerfahrungen und ihrem Export-Know-how nach Festlandchina löste in dem unerschöpflichen Reservoir billiger Arbeitskräfte und auftauchender unternehmerischer Elemente dieses Landes Synergieeffekte aus. Festlandchina fungierte somit als verlängerte Werkbank Hongkongs und der ROC. Der VR China ermöglichte dies, ihre Autarkie der Armut in weniger als zehn Jahren abzuwerfen und in den Kreis der stärksten Handelsmächte aufzusteigen. Die VR China ist gegenwärtig auf dem Wege, das neueste „ostasiatische Wunder“ zu vollbringen, wie es bisher von den High Performing Asian Economies (HPAEs) wie Japan und den „vier Tigern“ (Südkorea, der ROC auf Taiwan, Hongkong und Singapur) verkörpert wurde. Vielleicht wird die Volksrepublik (VR) eines Tages die Rolle der „Mutter aller Tiger“ übernehmen.
Am 1. Juli 1997 hat die VR China auf der Grundlage der Formel „ein Land - zwei Systeme“ die Souveränität über Hongkong herstellen können. Das Problem der Wiedervereinigung mit der ROC ist weitaus komplizierter. Die ROC ist eine konkurrierende, alternative chinesische (Teil-) Nation mit einem komplett gewählten politischen System und einer starken Unabhängigkeitsbewegung. Außerdem gibt es im Unterschied zu dem nach 99 Jahren ausgelaufenen Pachtvertrag mit Hongkong (New Territories und 235 umliegende Inseln) für die Rückkehr der Insel Taiwan keine zeitliche Grenze. Darüber hinaus genießt die ROC beim Widerstand gegen den Druck der VR China die bedingte Unterstützung der USA. Durch die Übernahme Hongkongs und Macaos rückte jedoch die Lösung der „Taiwanfrage“ an die Spitze der nationalen Prioritäten der VR China (vgl. Seitz 2000, S.411 und Kemenade 1997, S.10-11). Sogar die Rückgewinnung des Eilands durch kriegerische Gewalt bleibt, trotz verstärkter Wirtschaftskontakte, nicht ausgeschlossen. Von der Drohung auf der Insel einzufallen, rückt die Regierung der VR China bis heute nicht ab, wie z.B. im Falle einer einseitigen Unabhängigkeitserklärung der ROC auf Taiwan oder auch nur eines allzu provokanten Hinauszögerns der Wiedervereinigung (vgl. Suberg 1997, S.2). In einem Anfang des Jahres 1995 vom Propaganda Department der KP Chinas veröffentlichten internen Dokument hieß es ausdrücklich: „Der Option der Waffengewalt gegen Taiwan werden wir unter keinen Umständen abschwören“ (vgl. Zhongguo Jingji Shibao 1995).
Wie im Falle Hongkongs und Macaos ist es der Pekinger Regierung bereits gelungen, zwischen der Regierung der ROC und den Kapitalisten des Landes Zwietracht zu säen. Die neue Strategie läuft darauf hinaus, die taiwanesische Geschäftswelt zu immer größeren Investitionen zu verlocken und zugleich mit einer Politik des Drucks und der Isolierung zu untergraben, was noch von den internationalen Positionen der ROC übrig ist. Diese Politik hat wechselnden Erfolg, wird aber mit der Zeit sicher zunehmende Wirkungen zeigen. Das Drohen der VR China mit militärischer Gewalt, mit der die Unabhängigkeitsbewegung eingeschüchtert und die Fortschreitung der Demokratisierung in der ROC beeinflußt werden soll, schlug allerdings bisher immer ins Gegenteil um. Die politische Wiedervereinigung bleibt eine langwierige Angelegenheit, aber wirtschaftlich ist die ROC bei Betrachtung des Investitions- und Handelsvolumens bereits Teil der „China AG“ (vgl. Kemenade 1997, S.12).
1.2 Zielsetzung
In der Ausarbeitung des Themas müssen einige grundlegende Gegebenheiten beachtet werden.
So ist bei der Kooperation und dem Wettbewerb im wirtschaftlichen Bereich der beiden Akteure stets die Kompromißlosigkeit in politischen Fragen mit einzubeziehen. In einer Welt der zunehmenden wechselseitigen Abhängigkeiten pflegen die VR China und die ROC immer noch eine Politik des Säbelrasselns. Die Regierung der ROC beurteilt die zunehmende Verflechtung im Wirtschaftsbereich als wachsende Bedrohung der eigenen Sicherheit und Herrschaft. Man fürchtet, daß mit fortschreitender Abhängigkeit die Insel ihre wirtschaftliche Autonomie verlieren könnte, d.h. genau in dem Bereich, wo es der ROC bisher erfolgreich gelang, sich von der VR China abzusetzen. Darüber hinaus leistet man zudem einen großen Beitrag zum wirtschaftlichen Aufschwung der VR China. Es sind vornehmlich private Akteure, die hinter der Wirtschaftsintegration stehen. Sogar Teile der innovativen Aktivitäten werden folglich auf das Festland verlagert. Die Problematik ist hierbei der Beitrag, den taiwanesische Unternehmer zur potentiellen Modernisierung der Volksbefreiungsarmee (VBA) auf dem Festland leisten. Hier ist Interdependenz also keinesfalls mit Bedrohungsminderung gleichzusetzen. Aus dieser Einschätzung resultiert eine Regierungspolitik der ROC, die als Versuch des wirtschaftlichen „containment“ gegenüber dem Festland bezeichnet werden könnte, die aber den Interessen der eigenen Wirtschaft entgegensteht. Auch dieser Aspekt muß in den weiteren Ausführungen Beachtung finden, da dieser Zustand unhaltbar wird und bereits von Teilen der Wirtschaft unterminiert wird. Die hieraus resultierende Verflechtung verdeutlicht, daß sie nicht nur von keiner Institutionalisierung der politischen Beziehungen begleitet wird, sondern sie wird gegen oder zumindest über das Interesse einer der beiden Regierungen hinweg erfolgen.
Zusammenfassend läßt sich sagen, daß alle weiteren Ausführungen deshalb unter folgender Maßgabe stehen: Die Interaktion der politischen Instanzen auf beiden Seiten bezüglich der Wirtschaftsbeziehungen werden vorrangig von außerökonomischen Interessen bestimmt, rein volkswirtschaftliche Erwägungen spielen eine wichtige, doch nicht prioritäre Rolle. Der politische Konflikt beherrscht und gestaltet die wirtschaftliche Kooperation. Die VR China verfolgt dabei das Ziel der baldigen Wiedervereinigung zu ihren Bedingungen und richtet ihre Politik im Sinne einer Umarmungstaktik mit Hilfe der Lockerung durch wirtschaftliche Profite aus. Die Interessen der ROC dagegen bestehen in der einstweiligen Beibehaltung des Status quo. Die Regierungspolitik verfolgt das möglichst eigenständige Überleben und hofft auf eine eventuelle Demokratisierung auf dem Festland. Zwischen innenpolitischem Druck und VR-chinesischen Drohungen bleibt ihr nicht viel Handlungsspielraum.
Auch die Tatsache, daß sich mit den taiwanesischen Geschäftsleuten auf dem Kontinent ein Akteur herausgebildet hat, der den Beziehungszusammenhang maßgeblich beeinflußt und dabei doch rein wirtschaftliche Interessen verfolgt, also sich scheinbar der „politischen Logik“ entzieht, widerspricht der These nur auf den ersten Blick. Es ist der Souveränitätskonflikt, der diesem neuen Akteur erst sein beachtliches Gewicht und seinen Einfluß hüben wie drüben verleiht.
Für einen solchen Ansatz spricht neben dem ungelösten Problem der Teilung und der Vehemenz des chinesischen Nationalismus auch die Verschiedenheit der politischen Systeme. Die Beziehungen zur Außenwelt sind in diesem Noch-Staatshandelsland per se Sache der Politik. Die gegenseitige wirtschaftliche Abhängigkeit wurde lange Zeit als Schwächung der nationalen Eigenständigkeit begriffen und mit einer Strategie der Selbstgenügsamkeit bekämpft. Diese interdependenten Strukturen liegen den Beziehungen deshalb ohne Zweifel zu Grunde. Die Leitgedanken der Arbeit sind soweit vorgestellt und die schrittweise Einordnung des Themas erfolgt im weiteren Verlauf.
1.3 Forschungsstand
Die wirtschaftliche Kooperation und der Wettbewerb der VR China und der ROC werden von der Wissenschaft, was den deutschen Sprachraum anbelangt, noch immer stiefmütterlich behandelt. Dies gilt zwar weniger für Analysen der jeweiligen Wirtschaftsentwicklung und Politik, jedoch wird der Zusammenhang von wirtschaftlicher Kooperation und politischer Gegnerschaft über die Meerenge vor Taiwan bisher kaum systematisch behandelt. Es fehlt vielmehr an einer vernetzten Betrachtung der beiden Länder. Vor allem der Dynamik und dem Potential des chinesisch-taiwanesischen Handels und der Investitionen, verbunden mit dem Spannungsverhältnis zur Politik wurde nicht ausreichend Rechnung getragen. Der Wirtschaftsaustausch hat sich zwischen der ROC und der VR China erst kürzlich derart intensiviert. Bis Mitte der achtziger Jahre war selbst der indirekte Warenverkehr über Drittregionen offiziell verboten, weshalb in erster Linie geschmuggelt wurde. Vor allem westliche Beobachter vermieden es lange Zeit, den politischen Spannungen zwischen den mit hohem Wachstumszahlen ausgestatteten Ökonomien der Region nachzugehen. Bei den chinesischen bzw. taiwanesischen Autoren ist aufgrund der politischen Brisanz in den Beziehungen der ROC und der VR China Vorsicht geboten. So sind zahlreiche Schriften politisch voreingenommen und zielgerichtet. In der Arbeit werden deshalb hauptsächlich solche Werke berücksichtigt, in deren Mittelpunkt tatsächlich die Dynamik oder das Nebeneinander von Konflikt und Kooperation sowie Wirtschaft und Politik steht. Als Beispiel sind hier folgende Autoren aufzuführen: Carsten Herrmann-Pillath, Sebastian Heilmann, Anton Gälli, Gunter Schubert, Tim Trompedach und Oskar Weggel. Die hier erwähnte Reihe von Autoren ist keinesfalls vollständig.
Hervorzuheben ist hier Carsten Herrmann-Pillath, der im besonderen Maße auf die Bedingungen der innenpolitischen Entwicklung für die wirtschaftlichen und politischen Beziehungen eingeht. Dabei geht der Autor zum Beispiel auf die internen Machtkämpfe der KP Chinas ein und beschäftigt sich mit den Auswirkungen der Pluralisierung und Demokratisierung in der ROC. Auch die inoffiziellen Kultur- und Wirtschaftskontakte zwischen den beiden Staaten stellt er heraus. Er beschreibt einen gewissen „trade off“ zwischen politischer und wirtschaftlicher Integration.
1.4 Konzeption und Aufbau der Arbeit
Die vorliegende Arbeit besteht aus der Einleitung, den drei Hauptteilen und der abschließenden Bewertung:
Zur Überprüfung der grundlegenden Hypothese „wirtschaftliche Kooperation und Wettbewerb zwischen der VR China und der ROC“ werden sukzessive die politischen Hintergründe, Bedingungen und Auswirkungen der Wirtschaftskontakte analysiert.
Hierfür bietet es sich im ersten Hauptteil zunächst an, den geschichtlichen Kontext und die Anatomie der beiden Systeme darzustellen. Auch die Entwicklung der Wirtschaftskontakte wird dabei mit einbezogen. Eine chronologische Vorgehensweise erscheint diesbezüglich am besten geeignet.
Im zweiten Hauptteil werden die Voraussetzungen zur ökonomischen Verflechtung näher betrachtet. Hier spielen vor allem innenpolitische Veränderungen eine gewichtige Rolle. Im Zusammenhang dazu wird parallel die wirtschaftliche Entwicklung der ROC und der VR China gegenübergestellt. Auch wird die Entwicklung der Wirtschaftskontakte zwischen den beiden Staaten ab den achtziger Jahren aufgezeigt.
In der weiteren Folge werden die Gründe für die fortschreitende wirtschaftliche Kooperation und Wettbewerb zwischen der VR China und der ROC analysiert. Dabei werden Erklärungsansätze zum wachsenden Wettbewerb und zur intraregionalen Kooperation aufgezeigt. Auch wird in diesem Zusammenhang auf die Bedeutung der chinesischen Netzwerke eingegangen.
In den abschließenden Betrachtungen werden dann die erarbeiteten Ergebnisse zusammengefaßt und eine Prognose für die zukünftigen Entwicklungspotentiale mit den bestehenden Risiken aufgezeigt. Am Schluß soll eine Beantwortung der eingangs gestellten Frage erfolgen.
Zur Verwendung einiger Begriffe ist noch folgendes zu sagen: Sowohl die nationalchinesische als auch die kommunistische Regierung Chinas, die beide den Anspruch auf Alleinvertretung Gesamtchinas erheben, betrachten Taiwan als eine Provinz Chinas. Wenn im folgenden von der Regierung Taiwans oder der Regierung auf Taiwan die Rede ist, ist damit nicht die Provinzregierung Taiwans gemeint, sondern die nationalchinesische Regierung mit ihrem Sitz in Taipeh. In der Betrachtung der Entwicklung werde ich, dem internationalen Gebrauch entsprechend, den offiziellen Namen der Republik China auf Taiwan (ROC) benutzen. Die Bevölkerung auf Taiwan werde ich mit taiwanesisch und nicht mit chinesisch bezeichnen; falls notwendig, werde ich zwischen „Taiwanesen“ und „Festlandchinesen“, dem Teil der Bevölkerung Taiwans, die nach 1945 auf die Insel kamen, unterscheiden.
Auch muß erwähnt werden, daß in den verschiedenen Literaturquellen eine große Diskrepanz der Daten festzustellen ist und dies deshalb eine besondere Sorgfalt bei der Ausarbeitung, bzw. Kompromisse erfordert.
Im weiteren finden sich im laufenden Text bzw. im Anhang geographische Karten zum chinesischen Wirtschaftsraum, um alle im Text erwähnten Gebiete, Provinzen, und Städte für den Leser geographisch lokalisierbar zu machen.
2. China, Taiwan und die chinesische Nation: der geschichtliche Kontext
Die heutigen Beziehungen zwischen der ROC und der VR China werden nur mit Blick auf den geschichtlichen Zusammenhang verständlich. Daher werden die entscheidenden Determinanten kurz vorgestellt.
China kann auf eine vier- bis fünftausendjährige quellenmäßig belegte Geschichte zurückblicken. Von Anfang an durchziehen die chinesische Geschichte bestimmte Spannungsverhältnisse, die bis heute Denken und Handeln der Chinesen prägen. Hier ist erstens das Spannungsverhältnis zwischen Einheit und Teilung des chinesischen Kulturraumes zu erwähnen. Eng mit diesem Problem verbunden ist zweitens das Verhältnis Chinas zur Außenwelt und drittens dasjenige zwischen der Zentrale und den Regionen. Als vierter Strang ist das Spannungsverhältnis zwischen autokratischer Herrschaft und Rebellentum zu nennen und als fünfter schließlich das Spannungsverhältnis zwischen den Kräften der Bewahrung und Erneuerung (vgl. Staiger 1997, S.3).
2.1 Historische Bestimmungsfaktoren bis 1949
Die folgende Darstellung der Chinesischen Geschichte lehnt sich an Wolfram Eberhard 1971 „Geschichte Chinas“ an.
In der gesamten chinesischen Geschichtsschreibung herrscht weit verbreitet die Vorstellung von China als einem Einheitsstaat vor. Einheit versprach Macht, Stabilität und Frieden; Teilung hingegen Schwäche, Unruhe und Krieg. Dennoch war das chinesische Reich keinesfalls immer eine staatliche Einheit, sondern es gab mehrfach Perioden der Teilung. Diese zeichneten sich dadurch aus, daß sie kulturell besonders ergiebig waren.
Im Jahre 221 v. Chr. gelang es erstmals einen Einheitsstaat herzustellen und so das chinesische Kaisertum, das über 2000 Jahre Bestand hatte, zu begründen.
In den vorangegangenen zwei Jahrtausenden hatte sich der chinesische Kulturraum allmählich herausgebildet. Er umfaßte zunächst ein relativ begrenztes Gebiet am Mittel- und Unterlauf des Gelben Flusses (Huang he), von wo er sich allmählich ausdehnte, indem er verschiedene Lokalkulturen in sich aufnahm.
2.1.1 Machtkampf zwischen der Guomindang und der Kommunistischen Partei
Die Einheit ging nach dem Sturz des Kaisertums 1911 wieder verloren, als zahlreiche Provinzen unter der Führung mächtiger Militärmachthaber von der Zentralregierung abfielen. Nach vergeblichen Bemühungen Sun Yatsens[1] konnte erst sein Nachfolger Chiang Kaishek[2] zwischen 1926 und 1928 die Einheit wiederherstellen. Zwischen 1928 und 1949 war China aber nur dem Namen nach ein einheitlicher Staat. Tatsächlich hatten sich weite Teile des Reiches der Zentralmacht entzogen und führten ein Eigendasein. Dazu zählten die Stützpunkte der Kommunisten in der Provinz Jiangxi (1928 bis 1934) und danach in Nordchina mit Yan`an als Zentrum ebenso wie Nordostchina (Mandschurei), das von den Japanern besetzt war, und Tibet, das seit dem 18. Jahrhundert chinesisches Protektorat war und sich für unabhängig erklärte (vgl. Eberhard 1971, S.370 ff.).
Somit konnte sich das revolutionäre Gedankengut nur für kurze Zeit entfalten, doch nach Errichtung der autoritären Zentralmacht unter der Herrschaft der Guomindang (GMD) fand es ein jähes Ende. War die Partei zu Sun Yatsens Lebzeiten noch seinem revolutionären Programm verpflichtet, so verwandelte sie sich unter seinem Nachfolger Chiang Kaishek insbesondere nach dem Bruch zwischen Nationalisten und Kommunisten im Frühjahr 1927 in einen Hort konservativer Ideen, namentlich des Konfuzianismus.
Der Konservatismus der GMD trug nicht unwesentlich zum Scheitern der Nationalregierung bei. Er bewirkte die weitgehende Entfremdung der Intellektuellen von der Partei. Ein großer Teil von ihnen suchte in der Kommunistischen Partei (KP) eine neue geistige Heimat. Entscheidender war aber, daß sich die bäuerliche Bevölkerung, die am Vorabend des Sieges der Kommunisten 80 Prozent der Bevölkerung ausmachte, von der Nationalregierung vernachlässigt fühlte. Der Grund dafür bestand darin, daß die Nationalisten es versäumten, die soziale Frage, namentlich eine wirksame Agrarreform, in Angriff zu nehmen. Indem sich die Kommunisten vorrangig dieser Frage annahmen, verschafften sie sich großen Rückhalt in der Bevölkerung.
Für den Sieg der Kommunisten im Bürgerkrieg sind darüber hinaus noch andere Gründe verantwortlich, wie z. B. die innerhalb der Spitze der GMD um sich greifende Korruption und vor allem die Kriegswirren, die in China das Vordringen der Japaner förderte und die vielen positiven Reformansätze der Nationalregierung zerstörte. Angesichts der mangelnden Erfolge der GMD gelang es der KP, sich in breiten Kreisen der Bevölkerung als die überzeugendere Alternative darzustellen (vgl. Bianco 1969, S.71 ff.).
Mit dem Sieg der Kommunisten 1949 wurde China somit wieder zu einem Einheitsstaat, lediglich die Insel Taiwan und einige kleine Inseln konnten dem Reich nicht einverleibt werden (vgl. Eberhard 1971, S.370 ff.).
2.1.2 Die politische und wirtschaftliche Sonderstellung der Insel Taiwan
Die Insel Taiwan ist in ihrer politischen und wirtschaftlichen Bedeutung ein Unikum in der Geschichte und stellt seit Jahrhunderten eine Ausnahme im chinesischen Kulturraum dar (vgl. Gälli 1996, S.39). Die Beziehungen zum Festland waren nur kurze Zeit normalisiert. Während der letzten Jahrhunderte des fremdregierten Kaiserreichs hatte die Regierung eine Besiedelung strikt beschränkt, denn man bezweifelte die politische und administrative Kontrollierbarkeit jenseits der Taiwan-Straße.
Der gesellschaftliche und wirtschaftliche Niedergang des Kaiserreichs im 19. Jahrhundert zog einen Strom von Migranten nach Taiwan, der erhebliche Entwicklungspotentiale entstehen ließ. Die günstigen agrarökologischen Bedingungen in Taiwan ließen das Land schnell zu einem Netto-Exporteur von Nahrungsmitteln für das Festland werden. Der entsprechende Kapitalzufluß legte den Grundstein für den rasch wachsenden Wohlstand.
Da das Land gleichzeitig von verschiedenen imperialistischen Mächten als strategisch wichtig erachtet wurde, wertete die kaiserliche Regierung Taiwan von der Präfektur zur Provinz auf und begann mit dem systematischen Aufbau von Organisationen und Institutionen. Über die Besteuerung der taiwanesischen Bevölkerung versuchte man, die für die militärische Verteidigung unerläßlichen Gelder intern zu mobilisieren. Dies traf jedoch auf erheblichen Widerstand bei der Bevölkerung. Gegen Ende des 19. Jahrhunderts hatte das Land nach Hongkong vermutlich das höchste Entwicklungsniveau in China erreicht.
Während der japanischen Kolonialzeit (1895 bis 1945) setze sich diese Entwicklung fort, gleichzeitig wurde die taiwanesische Wirtschaft durch die neuen Kolonialherren nach Japan hin orientiert, die naturräumliche Bindung zum Festland wurde unterbrochen.
Von einer engeren gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Integration mit dem Festland darf also nur für die kurze historische Episode unmittelbar vor der japanischen Okkupation gesprochen werden (vgl. Taiwan Handbuch 1995, S.21-22).
Als Folge der Niederlage Chinas im Chinesisch-japanischen Krieg (1894 bis 1895) wurden Taiwan und Penghu (Pescadoren) im Jahre 1895 durch den Vertrag von Shimonoseki zur japanischen Kolonie (vgl. Suberg 1997, S.23-24).
Trotz des erbitterten Widerstands der Taiwanesen und Ureinwohner sowie der Versuche, eine Republik auszurufen, blieb Taiwan fünfzig Jahre lang unter japanischer Fremdherrschaft (1895 bis 1945). Mit aller Härte versuchte Japan in dieser Zeit, chinesisches Kultur- und Gedankengut auszurotten. Japanisch wurde zur Amtssprache erklärt, strengste Gesetze wurden erlassen, taiwanesischen Kindern wurde lange Zeit der Schulbesuch untersagt. Erst zu einem späteren Zeitpunkt war es für Taiwan-Chinesen wieder möglich zu studieren, allerdings nur die Fächer Medizin und Landwirtschaft (vgl. Weggel 1991, S.85 und Taiwan Handbuch 1995, S.21).
Taiwans Wirtschaft erlebte während der japanischen Besatzung einen Aufschwung - nicht zuletzt im Dienste der Expansionspolitik und Aufrüstung Japans. Man darf jedoch nicht übersehen, daß in der japanischen Besatzungsperiode auch wichtige Grundlagen für Taiwans Modernisierung geschaffen wurden. Vor allem in den Bereichen Industrie sowie der Transport- und Ausbildungsinfrastruktur fanden entscheidende Verbesserungen statt.
Aufgrund der Erklärung von Kairo und des Potsdamer Abkommens mußten die Japaner nach dem Ende des zweiten Weltkriegs Taiwan und Penghu nach fünfzigjähriger Herrschaft wieder an China abtreten. Die Nationalregierung erklärte Taiwan 1945 zu einer Provinz der Republik China, die sechs Millionen Taiwan-Chinesen wurden chinesische Staatsbürger (vgl. Taiwan Handbuch 1995, S.22).
2.2 Die Teilung des Landes
Mit einem Schlag sah sich Taiwan am Ende des Zweiten Weltkriegs von der japanischen Kolonialherrschaft und der damit verbundenen Gängelung befreit.
Seine Selbständigkeit währte aber nur kurz. Schnell wurde Taiwan „heim ins Reich“ geholt (Weggel 1992, S. 31). Taiwan, das unter der Regie der GMD von der „Republik China“ übernommen wurde, stand nun eine fünfjährige schwere politische Krise (1945 bis 1950) bevor, und es waren seit 1950 viele Reformen nötig, um einen wirtschaftlichen Aufschwung zu ermöglichen.
Taiwan hatte nun mit einer Zwangssituation zu kämpfen, nämlich der Niederlage des GMD-Regimes im Bürgerkrieg, die zur Flucht der Reste des Regierungs-, Partei- und Militärapparates der Republik China auf die vermeintlich sichere Insel Taiwan (Formosa) zwang, und zweitens dem Zusammenprall zwischen Festlandchinesen und Taiwanesen, der zu einem rapiden innenpolitischen Klimasturz führte.
Die nationalchinesische Regierung sah in den Taiwanesen anfangs Kollaborateure, die mit den japanischen Feinden gegen die eigenen Truppen seit 1937 auf dem Festland gekämpft hatten (Rohde 1999, S.271).
Was den Konflikt mit der Inselbevölkerung anbelangt, so war er wegen der so rigid antikommunistischen Ideologie und wegen des auf Hochrüstung und „Rückeroberung des Festlandes“ ausgerichteten Grundkurses der neuen Machthaber von vornherein kaum vermeidbar. Die Insel sollte ja nur als Mittel zum Zweck dienen. Ab 1945 diente sie der GMD als Nachschublieferant für den festländischen Bürgerkrieg und 1949 als Basis zur Rückeroberung des Festlands. Niemand in der GMD dachte damals ernsthaft an einen Verbleib auf Taiwan und daher konnte man sich auch den Luxus freundlicher Beziehungen zur einheimischen Bevölkerung nicht leisten (vgl. Taiwan Handbuch 1995, S.22 ff.). Wie schon zwischen 1937 und 1945 unter japanischer, so sollten auch jetzt unter GMD-Ägide „alle Räder für den Sieg“ rollen (Weggel 1992, S.31). Mit dieser Entwicklung und der neuen Rolle Taiwans als letzte Bastion der GMD wurde die Insel zum Streitobjekt und rückte als solches erst ins Bewußtsein der KP Chinas.
Anhand von Quellen aus jener Zeit ist zu sehen, daß entgegen der heutigen volksrepublikanischen Geschichtsschreibung die kommunistische Parteiführung Taiwan bis in die 40er Jahre noch als einen von China unabhängigen Nationalstaat begriff, dessen Befreiungsbewegung gegen die japanischen Kolonisatoren Unterstützung verdiene.
In einer Rede Mao Zedongs[3] von 1935 ist zulesen, daß die japanischen Arbeiter und Bauern sowie die unterdrückten Nationen Korea und Taiwan sich unter der prachtvollen Führung der Kommunistischen Partei Japans darauf vorbereitete, den japanischen Imperialismus niederzuschlagen (vgl. Rudolf 1984, S.21).
Taiwan wurde also als hoffnungsvolle eigenständige Nation betrachtet, deren Kampf gegen die Unterdrücker nicht einmal von den chinesischen, sondern von den japanischen Kommunisten organisiert werden sollte. Zu den Ergebnissen der bereits zuvor erwähnten Kairoer Konferenz (1. bis 26. November 1943), während derer die USA, Großbritannien und China (vertreten durch Chiang Kaishek) u.a. die Rückgabe Taiwans und der Penghu- Inseln nach Kriegsende an China beschlossen, äußerte sich die damals noch in Yan'an versammelte KP Chinas kaum. Erst mit der blutigen Niederschlagung des Aufstandes der taiwanesischen Bevölkerung gegen das repressive GMD- Regime am 28. Februar 1947 begann man sich für die Insel zu interessieren (vgl. Suberg 1997, S.26).
Mit dem Rückzug der konkurrierenden GMD auf die Insel Taiwan hat sich die Position der Kommunisten verhärtet und seit jener Zeit beansprucht die KP China die Insel Taiwan. Die Reste der ROC auf Taiwan sind zu einem ideologischen Prestigeproblem geworden, zu einer ständigen Infragestellung des eigenen Machtanspruchs der KP (vgl. Lüpke 1988, S.6).
Allein die amerikanische Präsenz im Pazifik ist der Grund dafür, daß die Insel Taiwan nicht zu Beginn der fünfziger Jahre von den festländischen Kommunisten erobert werden konnte, wie es ursprünglich gemäß höchstem Kampfauftrag der Partei geplant war. Die USA sahen sich durch den Ausbruch des Korea-Krieges (1950 bis 1952) zur Aufgabe ihrer „noninvolvement“- Politik veranlaßt. Um den gefürchteten Vormarsch des Kommunismus in Asien zu verhindern, wurde die Nationalchinesische Regierung auf Taiwan unterstützt (vgl. Weggel 1991, S.111). Für Taiwan und somit für die Nationalchinesische Regierung bedeutete diese Situation einen wichtigen Zeitgewinn im Kampf gegen die Kommunisten.
Der ROC auf Taiwan gelang es damit, sich politisch zu erholen und wirtschaftlich sogar verhältnismäßig rasch zu konsolidieren. Die ROC wurde so zu einem wichtigen Stützpunkt der Amerikaner im chinesischen Meer und galt als wichtigste Basis der freien Welt vor der Haustür Rotchinas. Weggel spricht von einem „unversenkbaren Flugzeugträger“[4] der USA im pazifischen Vorfeld (Weggel 1992, S.32). In der Folgezeit erhielt die ROC umfangreiche amerikanische Hilfe und wurde unter dem militärischen Schutz der 7. US-Flotte gestellt.
2.3 Die Ausrichtung der Wirtschaft von 1949 bis Ende der siebziger Jahre
Für eine genaue Betrachtung der beiden Wirtschaftsräume ist es unerläßlich, die Entwicklung der VR China in zwei historische Abschnitte zu untergliedern, nämlich das maoistische (bis 1978) und das dengistische China (1978 bis heute).
Die VR China hat im Beobachtungszeitraum mehrfach weitreichende politische und wirtschaftliche Umbrüche und Krisen erfahren, während die ROC Taiwan in den ersten Jahren als Stützpunkt für die Rückeroberung des Festlandes sah und die gesamte wirtschaftliche Entwicklung auf dieses Ziel ausrichtete. Die Entwicklungsstrategien und entwicklungspolitischen Konzepte waren nach diesem Ziel ausgerichtet (vgl. Shen 1992, S.56). Mit fortschreitender Zeit begann in den achtziger Jahren schrittweise und kontinuierlich ein politischer Wandel. Dieser hatte natürlich auch Konsequenzen für die wirtschaftliche Entwicklung.
Zur Verdeutlichung sind in der folgenden Tabelle die wirtschaftsstrukturellen Merkmale von 1952 der ROC und der VR China aufgeführt, um die wirtschaftlichen Startbedingungen zu verdeutlichen.
Tabelle 1: Wirtschaftsstrukturelle Merkmale der ROC und der VR China von 1952 (Anteile in %)
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten[5] [6]
Quelle: Herrmann-Pillath 1997, S.342
Nicht zu vernachlässigen ist bei der Betrachtung der Faktor der unterschiedlichen Größe beider Staaten. Die VR China nimmt mit 9.560.770 km² Größe die Position des drittgrößten Landes der Erde ein und ist damit sogar größer als die USA. Die von der ROC verwalteten Gebiete sind dagegen nur 36.981 km² groß, davon entfallen 36.182 km² auf die Hauptinsel Taiwan. Dies entspricht einem Flächenverhältnis der ROC zur VR China von 1 zu 259. Zur graphischen Veranschaulichung siehe auch Karte 1 und Karte 2. Die Insel hat dabei eine Länge von 394 km und ist an der breitesten Stelle 144 km breit (vgl. Ostasiatischer Verein e.V. 2000 und CIA World Factbook 2001).
Karte 1: China (VR China, ROC auf Taiwan)
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Quelle: Eigene Darstellung
Karte 2: ROC mit den Inseln Taiwan, Quemoy (Kinmen), Matsu und Penghu Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Quelle: Columbus Online 2001, übernommen und ergänzt durch den Autor
Bestimmte zentrale Schwierigkeiten der wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Entwicklung des Festlandes treten auf Taiwan nicht auf, wie z.B. große interregionale Entwicklungsunterschiede, Migration als Folge solcher Unterschiede, hohe Kosten des Aufbaus und der Arbeit staatlicher Organe, weitreichende Mängel der Transport- und Verkehrsinfrastruktur und spezifische Herausforderungen an die äußere Sicherheit.
Auch auf die Ausgangsbedingungen der Entwicklung der Regionen muß hingewiesen werden. Die Insel Taiwan war Mitte des 20. Jahrhunderts die am weitesten entwickelte Region des chinesischen Kulturraums. Sie war nach Japan die wohlhabendste Gesellschaft und hatte bereits ein umfangreiches Industrialisierungsprogramm seiner Kolonialmacht durchlaufen. Auf diesen gewaltigen Entwicklungsvorsprung der Insel gegenüber dem Festland, das von japanischer Invasion und Bürgerkrieg betroffen war, ist bei allen Vergleichen zu achten (vgl. Herrmann-Pillath 1997, S.332).
Auch eine in der VR China rigoros durchgeführte Bodenreform ab 1950 und die damit verbundenen Volkstribunale, in der rund 300 Mio. Menschen getötet wurden, beeinflußten die Entwicklung negativ (vgl. Elegant 1990, S.366 ff.).
Mao Zedong raubte den Menschen jegliche politische und private Freiheit. In Volkskommunen wurde der Sozialismus nach sowjetischem Vorbild auf die VR China übertragen und die gesamte Industrie verstaatlicht. Die Hälfte der zur Verfügung stehenden Mittel wurden für den Aufbau der Schwerindustrie eingesetzt (vgl. Vermeer 1995, S.17 ff.).
In der ROC dagegen wurde mit Druck und Hilfe der USA eine der effektivsten Landreformen dieses Jahrhunderts durchgeführt (vgl. Gälli 1995, S.32). Massive technische und finanzielle Hilfe aus den USA und später auch aus Japan verhalfen der Insel schneller und zielstrebiger als anderen Staaten eine leistungsfähige Industrie aufzubauen.
Das Engagement der sich nach Taiwan zurückgezogenen Festländer und der Überseechinesen, eine insgesamt geschickte Planung sowie eine gute Mischung von privaten und staatlichen Interessen, waren weitere Elemente, die sich belebend auf diesen Aufschwung auswirkten. Förderlich für die unternehmerische Konkurrenz war auch, daß die Industrie nicht in erster Linie für den kleinen einheimischen Markt oder regionale Teilmärkte, sondern für die westlichen Industrieländer produzierte (vgl. Gälli 1988, S.37).
Um einen besseren Überblick über die Entwicklungsstrategien und wirtschaftlichen Schwerpunkte in der VR China und der ROC zu ermöglichen sind diese in der folgenden Tabelle nochmals zusammengefaßt gegenübergestellt.
Tabelle 2: Entwicklungsstrategien und wirtschaftlichen Schwerpunkte in der VR China
und der ROC, 1949-1979
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Quelle: Herrmann-Pillath 1998, S.262
2.3.1 Außenhandel der VR China
Mit der Gründung der VR China am 1. Oktober 1949 richteten sich die außenwirtschaftlichen Beziehungen einseitig auf die sozialistischen Länder aus, speziell auf die damalige Sowjetunion. Die Beziehungen zu den kapitalistischen Ländern brachen dagegen zusammen. Das im Zusammenhang mit dem Koreakrieg im Jahre 1951 verhängte UN-Handelsembargo gegen die VR China, verstärkte diesen Prozeß zusätzlich und brachte die Beziehungen zwischen dem Westen und der VR China völlig zum erliegen (vgl. Xueming 1998, S.302-303).
Das Wirtschaftssystem der VR China vor Beginn der Reformen war das einer nach außen weitgehend abgeschotteten zentralen Planwirtschaft nach sowjetischem Muster. In Anbetracht der vorrevolutionären Erfahrung wirtschaftlicher Fremdbestimmung war die ökonomische Autarkie ein wesentliches Anliegen der neuen politischen Führung und wurde durch den chinesischen-sowjetischen Bruch noch verstärkt. Es wurde eine binnenmarktzentrierte Entwicklungsstrategie im Schutze der Landesgrenzen und einer inkonvertiblen Währung verfolgt. Der Außenhandel hatte eine ausdrücklich ergänzende Funktion und sollte zentral gesteuert seinen Beitrag zur schnellen Industrialisierung liefern. Importiert wurden fast ausschließlich Güter, die zur inländischen Produktion nötig waren. Die Exporte hatten allein die Erwirtschaftung der dafür notwendigen Devisen zum Ziel und wurden möglichst gering gehalten, um die Versorgung des Binnenmarktes nicht zu gefährden (vgl. Cheng 1985, S.15 ff.).
Die Pekinger Führung erkannte sehr schnell, daß sie ihre Handelsbeziehungen als Mittel zur Durchsetzung außenpolitischer Zwecke einsetzen konnte. Vor 1971 bemühte sich die VR China so vor allem bei nichtkommunistischen Ländern um die Gewinnung diplomatischer Anerkennung. Im Laufe der Zeit gelang es der Pekinger Führung, diese Politik zu perfektionieren und im speziellen zur Einflußnahme auf die internationale Taiwanpolitik einzusetzen (vgl. Suberg 1997, S.30-31).
Dies gelang erst, nachdem die VR China 1971 Mitglied der UNO wurde und damit die Position der Republik China übernehmen konnte. Der Außenhandel stieg seit dem ganz rapide an (vgl. Xueming 1998, S.302-303).
2.3.2 Außenhandel der ROC
Als kleine Ökonomie ohne nennenswerte Bodenschätze war Taiwan im Gegensatz zum Festland schon früh gezwungen, seine Aktivitäten nach außen auszurichten. In Verbindung mit einem höheren Grad außenwirtschaftlicher Öffnung bestand ein weiterer Unterschied in der Zulassung und Förderung privatwirtschaftlicher Aktivitäten und Märkte (vgl. Schüller 1993, S.158). Wesentliche Faktoren für Taiwans schnelles wirtschaftliches Abheben sind eine von den Japanern hinterlassene verbesserte Infrastruktur und beträchtliche Summen amerikanischer Wirtschaftshilfe zwischen 1951 und 1968.
Die Regierung der ROC begann 1951 mit einer umfassenden Importsubstitutionspolitik. Bis zu diesem Zeitpunkt hat es keinerlei Importbeschränkung gegeben. Zwischen 1949 und 1951 entstanden große Zahlungsbilanzdefizite, so daß die vom Festland geretteten Gold- und Devisenreserven der Regierung Nationalchinas schnell aufgebraucht waren. Die Situation zwang die Regierung zu umfangreichen Importbeschränkungen und Devisenkontrollen. Mit Hilfe von Zöllen, nichttarifären Handelshemmnissen, Devisenkontrollen und anderen protektionistischen Instrumenten sollte die wirtschaftliche Entwicklung des Landes vorangebracht und die nationale Verteidigungsfähigkeit erhöht werden (vgl. Cheng 1985, S.12).
Im Gegensatz zu vielen Ländern der Dritten Welt ermöglichte es vor allem diese effiziente staatliche Wirtschaftslenkung der Regierung der ROC auf Taiwan schon früh und erfolgreich die Koordination der Ökonomie zu übernehmen. Auch gelang es der Regierung, die sehr restriktive Geldpolitik aufgrund der hohen Wachstumsraten beizubehalten (vgl. Suberg 1997, S.31 ff.).
Die Verfassung von 1947 sicherte dem Staat eine dominante Rolle bei der Modernisierung des Landes zu. Zur Verwirklichung dieses Ziels wählte die Regierung eine Importsubstitutionspolitik und orientierte sich nicht an den liberaleren Beispielen der beiden anderen kapitalistischen chinesischen Volkswirtschaften Hongkong und Singapur (vgl. Gälli 1995, S.119). Die politische Situation der ROC auf Taiwan war zu diesem Zeitpunkt extrem unsicher. Kein ausländischer Investor hätte zu diesem Zeitpunkt in der ROC investiert, da jederzeit mit einer kommunistischen Invasion und einer damit verbundenen Enteignung zu rechnen war. Die Strategie, die Industrialisierung mit Freihandel und mit Hilfe ausländischer Investitionen zu erreichen, war zu diesem Zeitpunkt somit unmöglich. Die Importsubstitutionspolitik war angesichts der gegebenen Umstände die einzig mögliche Strategie, die der nationalchinesischen Führung zur Verfügung stand (vgl. Rohde 1999, S.325). Zur Unterstützung wurden die Gewerkschaften mit dem „nationalen“ Entwicklungsprojekt aus- bzw. gleichgeschaltet. Durch die ständige Bedrohung der volksrepublikanischen Gegenseite kam es praktisch zu keinen Streiks auf der Insel. In den sog. „Maßnahmen zur Behandlung von Arbeitskonflikten für die Zeit der kommunistischen Rebellion“ mußten die Gewerkschaften ausschließlich dem Ziel des nationalen Wirtschaftsaufbaus dienen (vgl. Fronius 1995, S.175). Diese Situation garantierte eine Billiglohnproduktion, die Wettbewerbsvorteile für die arbeitsintensiven Produkte gewährleistete und der Regierung neuen Spielraum gab (vgl. Suberg 1997, S.32).
Dies war sehr wichtig, da die Importsubstitutionspolitik aufgrund des kleinen Binnenmarktes sehr schnell an ihre Grenzen stieß. Von 1958 bis 1960 wurden daher viele handelsbeschränkende Maßnahmen aufgehoben. Mit einer Politik der Exportförderung trat die ROC in den sechziger Jahren in eine neue Phase der Entwicklung ein. Im Jahre 1972 beschloß die Regierung, die Wirtschaftspolitik erneut umzustellen. Nun sollten verstärkt die kapitalintensiven Industriebranchen entwickelt werden (vgl. Xueming 1998, S.307).
2.3.3 Wirtschaftskontakte vor Beginn der achtziger Jahre
Wirtschaftsbeziehungen über die Taiwanstraße waren grundsätzlich verboten, gemäß der Antikontaktpolitik der Regierung der ROC und der Politik der verschlossenen Tür der VR China vor 1979. Wenn es trotzdem zum Austausch kam, so geschah dieser indirekt über Drittstaaten. Bedingt durch den intensiven Warenaustausch zwischen den asiatischen Ländern, der Außenhandelspriorität der ROC und Hongkongs wirtschaftliche Funktion für das chinesische Festland, hatten Export/Import-Gesellschaften in der ehemaligen Kronkolonie, in Macao, Singapur und Japan einen inoffiziellen Warenaustausch zwischen den voneinander abgeschnittenen Bürgerkriegsgegnern ermöglicht.
Hinweise auf die ersten taiwanesischen Investitionen auf dem Festland, die nach den Bestimmungen der ROC immer noch illegal erfolgten, wurden laut Statistiken der VR China erst 1983 getätigt.
Der indirekte Handel belief sich vor 1979 auf zu vernachlässigende Bruchteile des Außenhandelsvolumens der beiden Staaten (vgl. Kao 1994, S.141). 1977 hatte, so die Zeitschrift Intereconomics, die ROC über Hongkong Waren im Wert von 60 Mio. DM aus der VR China bezogen. Im ersten Halbjahr 1978 investierte die ROC eine Summe von 50 Mio. DM in den Kauf von Gewürzen, Medikamenten und Mineralien zur Porzellanherstellung vom chinesischen Festland (vgl. Halbach 1979, S.154). In der umgekehrten Richtung war der Handel deutlich geringer: Über die ehemalige Kronkolonie kamen 1978 nur für 50000 US$ Waren aus Taiwan in die VR China (vgl. China Aktuell 1980, S.36). Zum wahrscheinlich größeren ROC-Anteil chinesischer Importe aus Japan liegen keine Zahlenangaben vor (vgl. Halbach 1979, S.154).
Bedeutung hatte auch der Schmuggel von Küste zu Küste bzw. Fischerboot zu Fischerboot. Dieser Tauschhandel ging trotz Verbotes von Seiten der ROC vor allem von den Inseln Kinmen und Matsu aus, die in unmittelbarer Nähe des Festlandes liegen. (vgl. im Anhang Karte 5, Die Taiwan- Straße). Auf der anderen Seite tolerierte die VR China diesen Austausch und förderte diesen Kleinhandel (xiao'e maoyi).
Die Wirtschaftsbeziehungen gewannen jedoch erst mit der Öffnungspolitik der VR China ab 1970 und einem Wandel der GMD-Festlandspolitik ab Mitte der achtziger Jahre an Bedeutung (vgl. Suberg 1997, S.47).
3. Voraussetzung der ökonomischen Verflechtung
Innenpolitische Entwicklungen waren auf beiden Seiten die wichtigsten Auslöser für die gegenseitige Durchlässigkeit beider Ökonomien. Auf nationalchinesischer Seite ermöglichte die Dekompression des autoritären Regimes und der Wandel des Verhältnisses zwischen Taiwanesen und Festländern die von den einheimischen Geschäftsleuten geforderte Lockerung der Antikontaktpolitik. Seitens des Kontinents wirkte die unter Deng Xiaoping veranlaßte Reformpolitik als ökonomischer Katalysator (vgl. Wang 1985, S.45).
3.1 Die Republik China: Liberalisierung und Pragmatismus
Die ROC auf Taiwan ist nicht nur ein Ausnahmebeispiel für eine gelungene späte Industrialisierung, sondern auch für eine relativ friedliche Entwicklung, die ausgehend vom Bürgerkrieg und Kriegszustand sich allmählich in Richtung Demokratie entwickelte. Der Verlust des chinesischen Festlands an die Kommunisten war eine bittere Lektion für die Regierung der Republik China. Sie mußte ihren Sitz im Dezember 1949 nach Taipeh verlegen. Zwar scheiterten die militärischen Versuche der VR China zur Unterwerfung Taiwans, doch sieht sich ROC seit Beginn der siebziger Jahre nach dem UNO- Austritt einer ständig zunehmenden außenpolitischen Isolierung durch Peking konfrontiert (vgl. Wang 1985, S.7). Ein wichtiger Schritt, diese politische Situation zu durchbrechen, war das Abwerfen innenpolitischen Ballastes (vgl. Taiwan Handbuch 1995, S.9).
Heute ist die ROC auf Taiwan eine bedeutende Wirtschaftsmacht. Durch beispiellosen Fleiß und unternehmerisches Geschick hat sich das Land innerhalb weniger Jahrzehnte zu einer der großen Exportnationen der Erde entwickelt. Die Inselrepublik rangiert heute unter den Industrienationen hinsichtlich ihres Bruttoinlandsproduktes (BIP) an 20. Stelle und beim BIP pro Kopf an 25. Stelle (vgl. Schütte 1999, S.827). In Zahlen ausgedrückt sind das 16854 US$ Pro-Kopf-Einkommen. Berechnet nach der Formel vom internationalen Kaufkraftvergleich[7] liegt die ROC sogar weltweit an 18. Stelle. Damit liegt die ROC hinter Japan, das mit 20616 US$ führt, in Asien an zweiter Position (vgl. Taiwan Aktuell 2000).
Das Weltwirtschaftsforum[8] (WEF) in Davos stufte die ROC 2000 sogar auf den weltweit vierten Platz des „Global Competitiveness Report“[9] ein (vgl. APEC 2001). Der Bericht stuft dabei die Länder aufgrund ihrer Wettbewerbsfähigkeit ein. Wettbewerbsfähigkeit wird dabei definiert als institutioneller und politischer Rahmen zur Förderung eines anhaltend raschen Wirtschaftswachstums, und zwar vorausblickend über einen Zeitraum von fünf bis zehn Jahren (vgl.World Economic Forum 2001).
Der Prozeß der Demokratisierung wurde dabei „von oben“ mit Sorgfalt vorangetrieben. Zuerst galt es vor allem drei Aufgaben zu lösen, die der ROC auf Taiwan die nötige Stabilität zurückbringen sollte, um weiter bestehen zu können. Am wichtigsten war es, die militärische Abwehr zu organisieren, ein Reformprogramm durchzuführen und die Wirtschaft wiederzubeleben (vgl. Schubert 1994, S.32-33).
3.1.1 Die Ära der Entwicklungsdiktatur von 1949-1986
In den Anfangsjahren war vor allem das Militär gefragt; kam es doch zwischen 1949 und 1962 beinahe „pünktlich“ alle vier Jahre zu militärischen Zusammenstößen zwischen GMD- Truppen und der VBA. Mit über 20000 VBA-Soldaten versuchte die VR China die kleinen Inselgruppen Kinmen und Matsu vergeblich einzunehmen. Diese Erfolge wurden jedoch von zwei schweren Niederlagen begleitet: Hainan und die Shanghai gegenüberliegenden Zhoushan- Inseln gingen verloren. 1955 folgten die Dachen-Inseln. 1958 kam es zu einem Dauerbombardement gegen die sog. „Frühwarnstation“ Kinmen, die formell als Teil der Provinz Fujian gilt, aber unter nationalchinesischer Militärverwaltung steht. In dessen Verlauf gingen 44 Tage lang täglich rund 10000 Granaten auf dieses „Miniatur-Taiwan“ nieder (vgl. Rohde 1999, S.295 ff.). Diese Dauerauseinandersetzungen zehrten so stark an der wirtschaftlichen Substanz der ROC auf Taiwan, daß offensichtlich ohne amerikanischer Hilfe die Existenz gefährdet gewesen wäre.
Somit hing außenpolitisch das Schicksal der ROC 1949/50 am seidenen Faden. Die USA hatten sich zunehmend von ihrem Bündnispartner Chiang Kaishek distanziert und schließlich in einem speziellen „China White Paper“ vom 5. August 1949 verkündet, die GMD müsse die Konsequenzen aus ihrer Niederlage im chinesischen Bürgerkrieg selber tragen (vgl. US Department of Defense 1971, S.226 ff.). Am 5. Januar 1950 versagte Präsident Truman jede amerikanische Unterstützung für das von einer militärischen Intervention der VR China schwer bedrohte Taiwan (vgl. Kindermann 1980, S.52 ff.).
Die Insel sollte nicht zu dem vorgeschobenen, gegen die UDSSR und China gerichteten anti- kommunistischen Sicherheitsgürtel der USA angehören, dessen „asiatische Seite“ die Philippinen und Japan einschloß. Die ROC war somit völlig auf sich allein gestellt.
Wären die USA ihrer damaligen Taiwan-Politik treu geblieben, so hätte die ROC auf Taiwan politisch wohl kaum überlebt. Der überraschende Ausbruch des Korea-Krieges am 25. Juni 1950 veranlaßte die amerikanischen Militärs jedoch zum raschen Umdenken. Die 7. US-Flotte fuhr in die Taiwanstraße ein, weil die Insel für Washington nun plötzlich eine überragende geostrategische Bedeutung gewann. Vier Jahre später, am 2. Dezember 1954, unterzeichneten die USA und die ROC einen Verteidigungspakt. Der amerikanische Einfluß sicherte der ROC die internationale Anerkennung seines Anspruchs auf die Gesamtvertretung Chinas und einen Sitz im ständigen Sicherheitsrat der Vereinten Nationen. Außenpolitisch war die Herrschaft der GMD somit abgesichert.
Dies konnte innenpolitisch nicht ohne Konsequenzen bleiben. Die ROC erhielt umfangreiche amerikanische Wirtschafts- und Militärhilfe (vgl. Schubert 1994, S.32). Bis erstere 1965 eingestellt wurde, erreichte sie ein Volumen von 1,4 Mrd. US$. Hinzu kamen noch etwa 2,5 Mrd. US$ zur Beschaffung von Waffen und Heeresgut im Rahmen der Militärhilfe (vgl. Gälli 1988, S.52-53).
Im Gegenzug mußte sich die Führung der ROC auf Taiwan den amerikanischen Demokratisierungs- und Reformvorstellungen beugen. Dadurch geriet die GMD in eine Zwickmühle, da sie auf amerikanischen Druck hin 1950 eine Bodenreform durchführte, 1951 Kommunalwahlen abhalten ließ und eine Verfassung nach dem Muster einer westlichen Demokratie einführte.
Dabei basierten die entwicklungspolitischen Vorstellungen auf den Ideen Sun Yatsens und spiegelten sich dann auch direkt in der Verfassung von 1947 wieder. Dem Staat kam dabei eine dominante Rolle bei der Umgestaltung der Wirtschaft zu. Die Republikverfassung übernimmt explizit die von Sun Yatsens aufgestellte „Lehre vom Volkswohl“ (minshengzhuyi) als Grundlage der nationalen Entwicklungsstrategie (vgl. Taiwan Handbuch 1995, S.38).
Auf der anderen Seite aber sah sie sich mit dem Haß der von den „Ereignissen des 28. Februar“ (1947) geschockten Bevölkerung konfrontiert und befürchtete „kommunistische“ Einflüsse. Während des Aufstandes wurden schätzungsweise zwischen 10000 und 20000 Personen getötet. Innerhalb weniger Tage wurde vor allem die taiwanesische Elite, die dem Regime der GMD hätte gefährlich werden können, getötet, verhaftet oder ins Exil vertrieben (vgl. Rohde 1999, S.273). Daraufhin erfolgte am 18. April 1948 eine einstweilige Mobilmachungsregelung für die Zeit der Niederwerfung der kommunistischen Aufständischen. Dieser Erlaß kam einem Ermächtigungsgesetz gleich, es gab dem Staatspräsidenten die Möglichkeit, ein uneingeschränktes Notverordnungsrecht auszuüben (vgl. Weggel 1991, S.100). Als eigentliche Verfassung diente von nun an nicht mehr das liberale Grundgesetz von 1947, sondern eben diese „Interimsregelung“ vom 18. April 1948 (die erst am 30. April 1991 aufgehoben wurde). Die Führung war somit immer wieder gezwungen, einen Spagat zwischen Verfassungsform und Verfassungswirklichkeit zu vollziehen, um in ihrem Abwehrkampf gegen die Kommunisten bestehen zu können.
Diese „Vorläufigen Bestimmungen“ höhlten die geltende Verfassung aus, vor allem, indem sie Amtszeitbeschränkung des Staatspräsidenten aufhoben und ihm das Recht auf die Einrichtung besonderer Exekutivorgane zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung einräumten (vgl. Schneider 1996, S.14 ff). Vor allem die fünfziger Jahre waren durch den „weißen Terror“ des GMD- Regimes geprägt, dem schätzungsweise mehrere tausend Menschen durch Inhaftierung und Exekution zum Opfer fielen. Viele andere entzogen sich den Verfolgungen durch den Weg ins Exil (vgl. Meyer 1996, S.100-101).
Eine andere zentrale Verfügung der „Vorläufigen Bestimmungen“ sah vor, daß alle in den Jahren 1947/48 auf dem chinesischen Festland gewählten Abgeordneten der Nationalversammlung, des Legislativyuans (Parlament) sowie des Kontrollyuans[10] ihr Mandat bis zur „Befreiung“ der kommunistisch beherrschten Gebiete und neuen gesamtnationalen Wahlen behalten sollten (vgl. Rohde 1999, S.276-277).
Damit waren freie Wahlen dieser Spitzengremien auf Taiwan nicht möglich. Die auf Zeit gewählten Amtsinhaber wurden somit zu zeitlosen „alten Abgeordneten“ (lao tai-piao).
Der Einfluß der Bevölkerung auf die nationale Politik war deshalb in den fünfziger und sechziger Jahren sehr gering, da ihr Anteil gemessen an der gesamtchinesischen Bevölkerung nur sehr gering ist (vgl. Kemenade 1997, S.162).
Aufgrund der „Vorläufigen Bestimmungen“ konnten die in der Verfassung vorgesehenen, regelmäßigen Wahlen dieser Gremien somit nicht durchgeführt werden. Bis zu den ersten kompletten Neuwahlen der Nationalversammlung und des Legislativyuans mußte die Bevölkerung der Insel weitere zwanzig Jahre warten (vgl. Schubert 1998, S.208).
Zu Beginn der siebziger Jahre mußte die ROC eine Reihe schwerer außenpolitischer Rückschläge hinnehmen. Am 25. Oktober 1971 votierte die Generalversammlung der Vereinten Nationen (UNO) mit 73 gegen 35 Stimmen bei 17 Enthaltungen für die Aufnahme der VR China in die Weltorganisation. Damit war klar, daß die internationale Staatengemeinschaft den Anspruch der Regierung der ROC, Gesamtchina zu repräsentieren, nicht länger akzeptierte. Daraufhin zog sich die ROC sofort aus der UNO zurück. Machtlos mußte man mit ansehen, wie wenige Monate später im Februar 1972 der amerikanische Präsident Nixon nach Peking reiste, um dort das „Shanghaier Kommunique“ mit der für die VR China so wichtigen Taiwan- Klausel unterzeichnete. Diese erklärte Taiwan zu einem Bestandteil Gesamtchinas und die Taiwanfrage zu einer innerchinesischen Angelegenheit.
Die neue Chinapolitik der USA hatte somit für die ROC weitreichende Folgen. Innerhalb der nächsten Jahre wendeten sich alle wichtigen Länder von der ROC ab und der VR China zu. Heute unterhält die ROC noch mit rund 30 Staaten diplomatische Beziehungen, von denen die meisten klein und politisch eher unbedeutend sind. Es handelt sich um Länder in Zentral- und Südamerika, Afrika und im pazifischen Raum. In Europa unterhält man nur noch mit dem Vatikan offizielle Beziehungen.
Diese Entwicklung zwang die ROC, sich noch mehr auf die eigenen Kräfte zu stützen und das Land wirtschaftlich und politisch voranzubringen, um aus eigener Stärke den Abwehrkampf gegen die VR China bestehen zu können (vgl. Yong-ding 1989, S.179 und Schubert 1998, S.209).
Auch die Ölkrise 1973/74, die zu einer steigenden Inflation und Rezession führte, zwang die Regierung zum Handeln. Der Gefahr des ständig wachsenden innergesellschaftlichen Protestpotentials mußte begegnet werden.
Die Lösung des größten innenpolitischen Problems, der bis dahin praktizierte Ausschluß der Taiwanesen als Bevölkerungsmehrheit aus den nationalen politischen Gremien und Schaltstellen wurde jetzt angepackt (vgl. Kittlaus 1994, S.51). So ist 1972 unter Anweisung Chiang Ching-kuos[11] (zu dieser Zeit Premierminister) die Kooptierung der Taiwanesen zur nationalen politischen Führung beschlossen worden. Den Taiwanesen wurden Posten in Partei- und Regierungsspitze überlassen und die „eingefrorenen“ parlamentarischen Organe zugänglich gemacht. Diese „Taiwanisierung“ (bentuhua) der Politik war für die weitere Entwicklung der ROC nachhaltig und führte mit der Zeit zu einer sich entwickelnden Schicksalsgemeinschaft, die gewillt war, gemeinsam das Land mit Erfolg nach vorne zu bringen (vgl. Rohde 1999, S.279).
Im bewußten Gegensatz zu den marxistischen Anschauungen und in Anlehnung an Sun Yatsens (Sun Yixians) wurde die Hauptaufgabe einer chinesischen Regierung festgelegt. In erster Linie galt es, die vier Grundbedürfnisse der Bevölkerung, das heißt die Wünsche nach Nahrung, Kleidung, Unterkunft sowie der Infrastruktur und Erziehung zu erfüllen. Gleichzeitig wurde eine Zügelung des Kapitalismus angestrebt. Der Staat sollte das Privatkapital und den Außenhandel kontrollieren. Die Regierung überführte Versorgungsunternehmen und andere Unternehmen mit Monopolstatus in staatliches Eigentum, auch stellte sie die Finanzinstitutionen unter ihre direkte Kontrolle, um die substantielle Gleichheit bei der Einkommensverteilung zu erreichen und ein Wohlfahrtssystem etablieren zu können (vgl. Shen 1992, S.56 ff. und Weggel 1991, S.123 ff.).
Was die GMD in den ersten Jahren am wichtigsten erachtete, waren die antikommunistischen Elemente und der Ruf nach einer Bodenreform. Jedoch wurde dabei auf zu viel Verstaatlichung verzichtet und eine erfolgreiche Landreform durchgeführt. Das entsprechende Programm wurde in drei Phasen durchgeführt: 1949 erfolgte die Reduzierung des Pachtzinses, 1951 der Verkauf öffentlichen Landbesitzes und 1953 schließlich die Durchsetzung des Mottos „das Land dem Bebauer“ (Taiwan Handbuch 1995, S.82).
Unter dem jahrhundertealten Pachtsystem war eine große Anzahl von Bauern nicht Besitzer des Bodens, den sie bebauten. Die Pacht betrug mindestens 50% des Ernteertrages (vgl. Cheng 1985, S.12). Das Reformprogramm brachte eine entscheidende Wende zum Besseren und zeigte vielfältige Wirkungen. Der Anteil der Pächterfamilien von ursprünglich 39% aller Bauernfamilien nahm deshalb bis 1985 auf 6% ab. Die landwirtschaftliche Produktion stieg merklich an, und die verbesserte Umverteilung der Einkommen brachte mehr soziale Gerechtigkeit in die ländlichen Gebiete (vgl. Wang 1985, S.12). Die Grundbesitzer wiederum waren durch die getroffenen Zahlungsvereinbarungen gezwungen, ihr Kapital vom Land in die Industrie zu verlagern, was während des Frühstadiums der industriellen Entwicklung äußerst willkommen war (Taiwan Handbuch 1995, S.82 ). Heute sind noch 8% der Beschäftigten in der Landwirtschaft tätig und die Bedeutung des Sektors mit nur noch 3% zum erwirtschafteten BIP ist gering. Im Vergleich betrug dieser Anteil 1952 noch 35% (vgl. CIA World Factbook Taiwan 2001).
An diesem Beispiel wird deutlich, daß Landreformen erfolgreich durch friedliche und graduelle Maßnahmen erreicht werden können - ohne Blutvergießen und Gewalt. Eine Umverteilung ohne Enteignung, sondern mit Besteuerungs- und Aufkaufinstrumenten zu bewerkstelligen, war das Leitmotiv der Modernisierungsüberlegungen in der Regierung der ROC. Im Vordergrund stand dabei die Verknüpfung von technologischer Innovation und sozialer Abfederung mit dem Endziel einer systemüberwindenden Reform.
3.1.2 Die demokratische Ära ab 1986
In den folgenden Jahren wurden unter der Präsidentschaft von Chiang Ching-kuo zahlreiche weitere Reformen erlassen, die die politische Landschaft der ROC stark veränderten. 1978 wurde mit Shieh Tung-min erstmals ein Taiwanese Vizepräsident der Republik, zehn Jahre später übernahm nach dem Tode Chiangs der taiwanstämmige Lee Teng-hui[12] die Präsidentschaft (vgl. Taiwan Handbuch 1995, S.46).
Unter Chiangs Amtszeit konnte sich auch die nach taiwanesischer Unabhängigkeit strebende Demokratisch-progressive Partei[13] (DPP) gründen und wurde wider Erwarten nicht verboten.
Am 15. Juli 1987 wurde nach 38 Jahren der Kriegszustand offiziell aufgehoben (vgl. Taipeh Vertretung 2000). Lee Teng-hui führte in der Folge den Reformkurs fort und stellte einen Regimewandel in Aussicht. Am 1. April wurde das offizielle Ende der Parteikontrolle über das Militär vollzogen. Die Pressezensur sowie das Versammlungs- und Demonstrationsverbot wurden sukzessive aufgehoben. Am 20. Januar 1989 wurde ein Gesetz geschaffen, das die Gründung neuer Parteien legalisierte. Die Parlamente wurden allmählich von ihrer Dekorations- und Stempelfunktion befreit und erhielten zunehmend die Bedeutung demokratischer Foren. Am 1. Mai 1991 hob die Nationalversammlung auf Vorschlag des Präsidenten Lee Teng-hui auch die „vorläufigen Bestimmungen“ auf, womit die Verfassung erstmals vollständig in Kraft trat (vgl. Schneider 1996, S.7).
[...]
[1] Sun Yatsen (Sun Yixian, 1866-1925, Revolutionär, Parteigründer und Staatsmann)
[2] Chiang Kaishek (Jiang Jieshi, 1887-1975, General, Politiker, seit 1950 Präsident des „freien Teils“ der ROC, der Insel Taiwan)
[3] Mao Zedong (1893-1976, Staats- und Parteiführer, Gründer der VR China 1949)
[4] Aussage fiel anläßlich eines Besuches in Taipeh von General Douglas McArthur am 31.Mai 1950.
[5] Basiswert ist das Volkseinkommen
[6] Anteile der öffentlichen Unternehmen in der VR China am Output beziehen sich auf industrielle Staats- und Kollektivunternehmen
[7] Purchasing power parity, PPP (Formel vom IWF erstmals im Jahr 2000 als Basis für den Vergleich des Lebensstandards verschiedener Länder eingesetzt worden. Ist exakter als einfache Umrechnung des BIP eines Landes in eine einheitliche Währung (z.B. US$) über die jeweiligen Wechselkurse).
[8] World Economic Forum (WEF),aus dem1971 gegründeten European Management Symposium hervorgegangen,1987 in WorldEconomicForum umbenannt. Zielsetzung ist eine weltweite Vernetzung zwischen den Entscheidungsträgern aus Wirtschaft, Politik, Wissenschaft und Medien zu erreichen.
[9] vom WEF und vom Lausanner Managementinstitut IMD herausgegeben, seit 1994 werden OECD- und Entwicklungsländer gemeinsam, aufgrund ihrer Wettbewerbsfähigkeit eingestuft.
[10] Er ist das höchste Aufsichtsorgan der Regierung. Seine Kompetenzen umfassen die Beamten- u. Ministerklage, die Überprüfung der Amtsführung u. die Rechnungskontrolle.
[11] Chiang Ching-kuo: geb.1910, gest. 1988, Sohn Chiang Kai-sheks, 1972-1978 Premierminister der ROC, 1978 Präsident der ROC, initiierte Reformprozeß und hob Kriegsrecht auf).
[12] Lee Teng-hui: geb. 1923 in Taipeh, 1984 Vize- u. von 1988-2000 Präsident der ROC.
[13] Democratic Progressive Party (Minzhu jinbudang) im Herbst 1986 noch vor Aufhebung des Kriegsrechts gegründet.
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Originalausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2001
- ISBN (eBook)
- 9783832446468
- ISBN (Paperback)
- 9783838646466
- DOI
- 10.3239/9783832446468
- Dateigröße
- 1.5 MB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- Ludwig-Maximilians-Universität München – Betriebswirtschaftslehre
- Erscheinungsdatum
- 2001 (Oktober)
- Note
- 2,0
- Schlagworte
- wettbewerb großchina taiwan
- Produktsicherheit
- Diplom.de