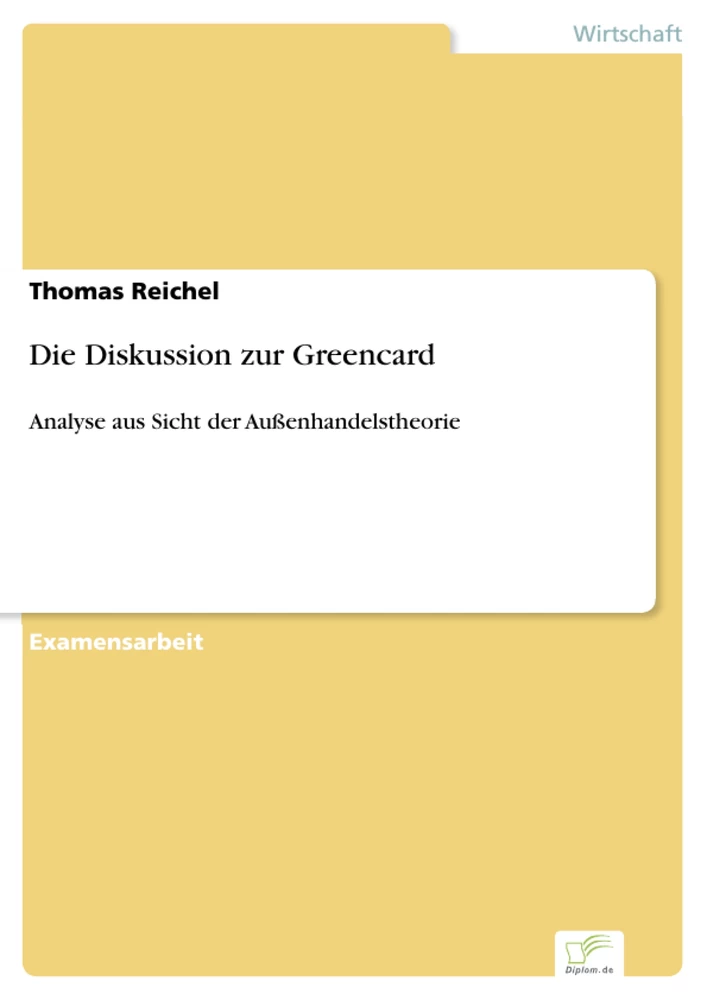Die Diskussion zur Greencard
Analyse aus Sicht der Außenhandelstheorie
©2000
Examensarbeit
72 Seiten
Zusammenfassung
Inhaltsangabe:Einleitung:
Die Bundesregierung hat beschlossen, ab dem 1.August 2000 bis zu 20 000 ausländischen Arbeitskräften der Informationstechnologie eine Arbeitserlaubnis in Deutschland zu genehmigen. Mit der sogenannten Green-Card-Regelung können Arbeiter aus Nicht-EU-Staaten, die eine Hochschul- bzw. Fachhochschulausbildung im Bereich der Informations-technologie nachweisen oder ein Mindest-Jahresgehalt von 100 000 DM erhalten, von deutschen Firmen angeworben werden. Diese Arbeitskräfte, die eine Aufenthaltsgenehmigung von 5 Jahren erhalten, sollen den Engpass an Fachkräften der Informations- und Kommunikationstechnik beheben.
Aus volkswirtschaftlicher Sicht erhöht die Green-Card-Regelung die Faktorausstattung Deutschlands mit qualifizierten Arbeitskräften.
Hat nun diese - wenn auch um eine relativ geringe Zahl - veränderte Faktorausstattung Einfluss auf die Produktionsstruktur der deutschen Wirtschaft und/oder auf die Einkommensverteilung? Dieser Frage soll in der folgenden Arbeit anhand zweier außenhandelstheoretischer Modelle nachgegangen werden.
Es gibt zahlreiche Modelle, die den Außenhandel und seine Auswirkungen beschreiben und erklären. Im Ricardo-Modell liegt die Ursache für den Außenhandel in relativen Kosten- vorteilen, die ein Land bei der Produktion bestimmter Güter hat. Die in einzelnen Wirtschaftsbereichen unterschiedliche Produktivität des einzigen Produktionsfaktors Arbeit entscheidet darüber, welche Güter ein Land vornehmlich produziert.
Eli Heckscher und der Wirtschaftsnobelpreisträger von 1977, Bertil Ohlin, entwickelten ein Modell, das die in den einzelnen Ländern unterschiedliche Ausstattung mit Produktionsfaktoren als Grund für die Aufnahme außenwirtschaftlicher Beziehungen herausstellt. Mögliche Produktivitätsunterschiede zwischen den Volkswirtschaften werden hier nicht einbezogen.
Dieses, im folgenden Heckscher-Ohlin-Modell genannte Erklärungsmuster kann auch Änderungen der Faktorausstattung, wie sie durch die Green-Card auftreten, berücksichtigen. Besondere Bedeutung kommt hierbei dem sogenannten Rybczynski-Theorem zu, das die Auswirkungen der Faktorbestandsänderung auf die Produktion eines Landes darlegt.
Ein zweites Modell, das in dieser Arbeit vorgestellt wird, ist das Spezifische Faktorenmodell. Hier werden Änderungen der Einkommensverteilung eines Landes sichtbar, wenn man davon ausgeht, dass manche Produktionsfaktoren, z.B. angeworbene IT-Kräfte, mobil sind und andere, etwa der Boden, nur für spezielle […]
Die Bundesregierung hat beschlossen, ab dem 1.August 2000 bis zu 20 000 ausländischen Arbeitskräften der Informationstechnologie eine Arbeitserlaubnis in Deutschland zu genehmigen. Mit der sogenannten Green-Card-Regelung können Arbeiter aus Nicht-EU-Staaten, die eine Hochschul- bzw. Fachhochschulausbildung im Bereich der Informations-technologie nachweisen oder ein Mindest-Jahresgehalt von 100 000 DM erhalten, von deutschen Firmen angeworben werden. Diese Arbeitskräfte, die eine Aufenthaltsgenehmigung von 5 Jahren erhalten, sollen den Engpass an Fachkräften der Informations- und Kommunikationstechnik beheben.
Aus volkswirtschaftlicher Sicht erhöht die Green-Card-Regelung die Faktorausstattung Deutschlands mit qualifizierten Arbeitskräften.
Hat nun diese - wenn auch um eine relativ geringe Zahl - veränderte Faktorausstattung Einfluss auf die Produktionsstruktur der deutschen Wirtschaft und/oder auf die Einkommensverteilung? Dieser Frage soll in der folgenden Arbeit anhand zweier außenhandelstheoretischer Modelle nachgegangen werden.
Es gibt zahlreiche Modelle, die den Außenhandel und seine Auswirkungen beschreiben und erklären. Im Ricardo-Modell liegt die Ursache für den Außenhandel in relativen Kosten- vorteilen, die ein Land bei der Produktion bestimmter Güter hat. Die in einzelnen Wirtschaftsbereichen unterschiedliche Produktivität des einzigen Produktionsfaktors Arbeit entscheidet darüber, welche Güter ein Land vornehmlich produziert.
Eli Heckscher und der Wirtschaftsnobelpreisträger von 1977, Bertil Ohlin, entwickelten ein Modell, das die in den einzelnen Ländern unterschiedliche Ausstattung mit Produktionsfaktoren als Grund für die Aufnahme außenwirtschaftlicher Beziehungen herausstellt. Mögliche Produktivitätsunterschiede zwischen den Volkswirtschaften werden hier nicht einbezogen.
Dieses, im folgenden Heckscher-Ohlin-Modell genannte Erklärungsmuster kann auch Änderungen der Faktorausstattung, wie sie durch die Green-Card auftreten, berücksichtigen. Besondere Bedeutung kommt hierbei dem sogenannten Rybczynski-Theorem zu, das die Auswirkungen der Faktorbestandsänderung auf die Produktion eines Landes darlegt.
Ein zweites Modell, das in dieser Arbeit vorgestellt wird, ist das Spezifische Faktorenmodell. Hier werden Änderungen der Einkommensverteilung eines Landes sichtbar, wenn man davon ausgeht, dass manche Produktionsfaktoren, z.B. angeworbene IT-Kräfte, mobil sind und andere, etwa der Boden, nur für spezielle […]
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
ID 5039
Reichel, Thomas: Die Diskussion zur Greencard: Analyse aus Sicht der Außenhandelstheorie /
Thomas Reichel - Hamburg: Diplomica GmbH, 2002
Zugl.: München, Universität, Staatsexamen, 2000
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte, insbesondere die
der Übersetzung, des Nachdrucks, des Vortrags, der Entnahme von Abbildungen und Tabellen,
der Funksendung, der Mikroverfilmung oder der Vervielfältigung auf anderen Wegen und der
Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen, bleiben, auch bei nur auszugsweiser Verwertung,
vorbehalten. Eine Vervielfältigung dieses Werkes oder von Teilen dieses Werkes ist auch im
Einzelfall nur in den Grenzen der gesetzlichen Bestimmungen des Urheberrechtsgesetzes der
Bundesrepublik Deutschland in der jeweils geltenden Fassung zulässig. Sie ist grundsätzlich
vergütungspflichtig. Zuwiderhandlungen unterliegen den Strafbestimmungen des
Urheberrechtes.
Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in diesem
Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme, dass solche
Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei zu betrachten
wären und daher von jedermann benutzt werden dürften.
Die Informationen in diesem Werk wurden mit Sorgfalt erarbeitet. Dennoch können Fehler nicht
vollständig ausgeschlossen werden, und die Diplomarbeiten Agentur, die Autoren oder
Übersetzer übernehmen keine juristische Verantwortung oder irgendeine Haftung für evtl.
verbliebene fehlerhafte Angaben und deren Folgen.
Diplomica GmbH
http://www.diplom.de, Hamburg 2002
Printed in Germany
Wissensquellen gewinnbringend nutzen
Qualität, Praxisrelevanz und Aktualität zeichnen unsere Studien aus. Wir
bieten Ihnen im Auftrag unserer Autorinnen und Autoren Wirtschafts-
studien und wissenschaftliche Abschlussarbeiten Dissertationen,
Diplomarbeiten, Magisterarbeiten, Staatsexamensarbeiten und Studien-
arbeiten zum Kauf. Sie wurden an deutschen Universitäten, Fachhoch-
schulen, Akademien oder vergleichbaren Institutionen der Europäischen
Union geschrieben. Der Notendurchschnitt liegt bei 1,5.
Wettbewerbsvorteile verschaffen Vergleichen Sie den Preis unserer
Studien mit den Honoraren externer Berater. Um dieses Wissen selbst
zusammenzutragen, müssten Sie viel Zeit und Geld aufbringen.
http://www.diplom.de bietet Ihnen unser vollständiges Lieferprogramm
mit mehreren tausend Studien im Internet. Neben dem Online-Katalog und
der Online-Suchmaschine für Ihre Recherche steht Ihnen auch eine Online-
Bestellfunktion zur Verfügung. Inhaltliche Zusammenfassungen und
Inhaltsverzeichnisse zu jeder Studie sind im Internet einsehbar.
Individueller Service
Gerne senden wir Ihnen auch unseren Papier-
katalog zu. Bitte fordern Sie Ihr individuelles Exemplar bei uns an. Für
Fragen, Anregungen und individuelle Anfragen stehen wir Ihnen gerne zur
Verfügung. Wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit.
Ihr Team der Diplomarbeiten Agentur
I
Gliederung:
1. Einleitung S.
1
2. Das Heckscher- Ohlin- Modell S.
3
2.0. Voraussetzungen und Annahmen
S. 3
2.1. Das Stolper- Samuelson-Theorem
S. 4
2.2. Das RybczynskiTheorem.
S. 7
2.3. Ausgleich der Faktorpreise über die Güterpreise
S. 10
2.4. Darstellung der Export- und Importstruktur eines Landes mit der
EdgeworthBox
S. 13
3. Das spezifische Faktorenmodell
S. 17
3.1. Das Grundmodell mit einem spezifischen Faktor
S. 17
3.2. Berücksichtigung von international mobilem Humankapital
S. 23
4. Auswertung von Datenmaterial und Vergleich mit den
modelltheoretischen Vorhersagen S.
26
4.0. Vorbemerkungen
S.
26
4.1.
Grundlegende Daten zum Außenhandel
S. 27
4.2. Deutschlands
Industriestruktur
im internationalen Vergleich
S. 30
4.2.1. Kapitalausstattung und Arbeitskräftepotential S.
31
4.2.2. Die Marktposition Deutschlands bei technischen und
forschungsintensiven Gütern
S. 39
II
4.2.3. Zusammenfassung
S. 46
4.3.
Ausbildungsniveau und Entlohnung von Humankapital in
verschiedenen Ländern
4.3.1. Ausbildungsniveau und Bildungsausgaben
S. 47
4.3.2. Internationaler Lohnvergleich hochqualifizierter Arbeitskräfte
S. 53
5. Fazit und Ausblick S.
58
6. Anhang und Literaturangaben S.
60
III
Verzeichnis der Tabellen, Graphiken und Abbildungen:
Abbildung 1 Stundenlöhne in der Industrie in ausgewählten Ländern in
Prozenten der Löhne in den USA
S. 12
Abbildung 2 Anteile der deutschen Ein- und Ausfuhr 1998 nach Ländergruppen S. 27
Abbildung 3 Entwicklung des Außenhandels
S. 28
Abbildung 4 Welthandel 1997 (Länder mit der höchsten Einfuhr bzw. Ausfuhr)
S. 28
Tabelle 1 Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen in US-$ (1993-1997)
S. 29
Graphik 1 Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen in US-$ (1993-1997)
S. 29
Tabelle 2 Wachstum des Pro-Kopf-Einkommens 1950-1992
S. 30
Abbildung 5 Nettokapitalexporte im Verhältnis zur Kapitalreichlichkeit
eines Landes
S. 32
Tabelle 3 Daten zum Nettokapitalstock
S. 33
Graphik 2 Kapitalstock je Erwerbstätigen
S. 34
Graphik 3 Entwicklung des Nettokapitalstocks seit 1971
S. 34
Tabelle 4 Produktivität im Produktions- und Dienstleistungssektor
S. 36
Graphik 4 Vergleich der Produktivität im Produktions- und
Dienstleistungssektor
S. 37
Tabelle 5 Kapitalintensität im Produktionssektor ausgewählter OECD-Staaten S. 38
Abbildung 6 Spezialisierung Deutschlands bei FuE-intensiven Waren gegenüber
den USA, Japan und der EU-15
S. 39
Tabelle 6 FEK-Personal, Hochqualifizierten- und Selbständigenquote in
ausgewählten Dienstleistungsbereichen in Deutschland 1995
S. 41
Tabelle 7 Inländische Produktion, Inlandsnachfrage und Beschäftigung bei
FuE-intensiven Branchen in ausgewählten OECD-Ländern 1993 bis
1994/95
S. 42
Tabelle 8 Welthandelsanteile der OECD- Länder bei FuE-intensiven Waren
1991-1995 in Prozent
S. 43
Graphik 5 Welthandelsanteile in der Spitzentechnik
S. 44
Abbildung 7 Beitrag der FuE-intensiven Branchen zum Bruttoinlandsprodukt im
internationalen Vergleich
S. 45
IV
Tabelle 9 Ausgaben für Forschung und Entwicklung in % des BIP (alle
Wirtschaftsbereiche)
S. 46
Graphik 6 Ausgaben für Forschung und Entwicklung in % des BIP
S. 46
Tabelle 10 Erwerbspersonen im Alter von 25-64 Jahren nach dem höchsten
Bildungsabschluss in Prozent (1996)
S. 48
Graphik 7 Erwerbspersonen nach dem höchsten Bildungsabschluss in Prozent S. 49
Tabelle 11 Verteilung der Schüler und Studierenden auf die Bildungsbereiche
nach Ländern in Prozent
S. 49
Graphik 8 Verteilung der Schüler und Studierenden Deutschland
S. 50
Graphik 9 Verteilung der Schüler und Studierenden Frankreich
S. 50
Graphik 10 Entwicklung des Studentenanteils
S. 51
Tabelle 12 Bildungsausgaben im Verhältnis zum BIP in Prozent (1995)
S. 51
Graphik 11 Bildungsausgaben im Verhältnis zum BIP in Prozent (1995)
S. 52
Tabelle 13 Internationaler Lohnvergleich
S. 53
Graphik 12 Nettojahresgehalt eines Ingenieurs 2000
S. 54
Abbildung 8 Länderspezifisches durchschnittliches Bruttoeinkommen für
Universitätsabsolventen der Informatik 1998
S. 55
Foto1
Greencard erstmals schwarz auf weiß
S. 60
Foto 2 Eli Heckscher und Bertil Ohlin
S. 60
1
1. Einleitung:
Die Bundesregierung hat beschlossen, ab dem 1.August 2000 bis zu 20 000 ausländischen
Arbeitskräften der Informationstechnologie eine Arbeitserlaubnis in Deutschland zu
genehmigen. Mit der sogenannten Green-Card-Regelung können Arbeiter aus Nicht-EU-
Staaten, die eine Hochschul- bzw. Fachhochschulausbildung im Bereich der
Informationstechnologie nachweisen oder ein Mindest-Jahresgehalt von 100 000 DM
erhalten, von deutschen Firmen angeworben werden. Diese Arbeitskräfte, die eine
Aufenthaltsgenehmigung von 5 Jahren erhalten, sollen den Engpass an Fachkräften der
Informations- und Kommunikationstechnik beheben.
Aus volkswirtschaftlicher Sicht erhöht die Green-Card-Regelung die Faktorausstattung
Deutschlands mit qualifizierten Arbeitskräften.
Hat nun diese - wenn auch um eine relativ geringe Zahl - veränderte Faktorausstattung
Einfluss auf die Produktionsstruktur der deutschen Wirtschaft und/oder auf die
Einkommensverteilung? Dieser Frage soll in der folgenden Arbeit anhand zweier
außenhandelstheoretischer Modelle nachgegangen werden.
Es gibt zahlreiche Modelle, die den Außenhandel und seine Auswirkungen beschreiben und
erklären. Im Ricardo-Modell liegt die Ursache für den Außenhandel in relativen Kosten-
vorteilen, die ein Land bei der Produktion bestimmter Güter hat. Die in einzelnen
Wirtschaftsbereichen unterschiedliche Produktivität des einzigen Produktionsfaktors Arbeit
entscheidet darüber, welche Güter ein Land vornehmlich produziert.
Eli Heckscher und der Wirtschaftsnobelpreisträger von 1977, Bertil Ohlin, entwickelten ein
Modell, das die in den einzelnen Ländern unterschiedliche Ausstattung mit
Produktionsfaktoren als Grund für die Aufnahme außenwirtschaftlicher Beziehungen
herausstellt. Mögliche Produktivitätsunterschiede zwischen den Volkswirtschaften werden
hier nicht einbezogen.
Dieses, im folgenden Heckscher-Ohlin-Modell genannte Erklärungsmuster kann auch
Änderungen der Faktorausstattung, wie sie durch die Green-Card auftreten, berücksichtigen.
Besondere Bedeutung kommt hierbei dem sogenannten Rybczynski-Theorem zu, das die
Auswirkungen der Faktorbestandsänderung auf die Produktion eines Landes darlegt.
2
Ein zweites Modell, das in dieser Arbeit vorgestellt wird, ist das Spezifische Faktorenmodell.
Hier werden Änderungen der Einkommensverteilung eines Landes sichtbar, wenn man davon
ausgeht, dass manche Produktionsfaktoren, z.B. angeworbene IT-Kräfte, mobil sind und
andere, etwa der Boden, nur für spezielle Produkte verwendet werden können.
Die Ausführungen bestehen aus einem theoretischen Teil, in dem 2 Außenhandelsmodelle
vorgestellt werden (Kapitel 2 und 3), und einem empirischen Teil, der Strukturen der
deutschen Wirtschaft und mögliche Auswirkungen der Green-Card-Regelung untersucht.
3
2. Das Heckscher-Ohlin-Modell
2.0. Voraussetzungen und Annahmen des Heckscher-Ohlin-Modells
Um im weiteren Verlauf der Ausführungen auf grundlegende Vorüberlegungen verzichten zu
können, sollen zunächst die Grundannahmen des Heckscher-Ohlin-Modells aufgeführt
werden. Davon abweichende Bedingungen werden dann im jeweiligen Abschnitt erwähnt.
Im Heckscher-Ohlin-Modell gelten grundsätzlich folgende Voraussetzungen:
1. Es werden 2 Länder betrachtet, die mit zwei Produktionsfaktoren ( Arbeit = L und
Kapital = K) zwei Güter (X und Y) erzeugen.
2. Beide Güter werden in jedem Land hergestellt (keine vollständige Spezialisierung).
3. In beiden Ländern ist das gleiche Gut (etwa X) für jedes Faktorpreisverhältnis
arbeitsintensiv, das andere jeweils kapitalintensiv
1
.
4. Die relative Faktorausstattung
L
K
divergiert zwischen den Ländern.
5. Beide Faktoren sind innerhalb eines Landes völlig mobil, zwischen den Ländern aber
absolut immobil (z.B. kein Arbeitskräfteaustausch).
6. Es herrscht in jedem Land Vollbeschäftigung.
7. Die Produktionsfunktionen sind in beiden Ländern identisch. Dies beinhaltet, dass es
keine Technologie- oder Produktivitätsunterschiede zwischen den Ländern gibt.
8. Die Faktorintensität bei der Produktion eines Gutes ist für jede Outputmenge gleich
(konstante Skalenerträge).
1
Zur Umkehrung der Faktorintensität siehe Rose: ,,Theorie der Außenwirtschaft", S.433 ff.
4
9. Man geht von Cobb-Douglas-Produktionsfunktionen aus, d.h. Q
X
( K, L) = K
L
1-
und Q
Y
= K
L
1-
. Der Faktorbedarf ist aber für jedes Gut unterschiedlich, also sind
und verschieden.
10. Es herrscht vollkommene Konkurrenz auf den Märkten. Somit machen die Firmen
Nullgewinne, der Güterpreis entspricht den Herstellungskosten. Die Konsumenten
sind über die Preise in beiden Ländern informiert.
11. Die Güternachfrage ist in beiden Ländern identisch, Herstellungsort des Produkts und
die Einkommenshöhe der Verbraucher spielen keine Rolle.
12. Es besteht die Möglichkeit zu freiem Handel. Zölle und Transportkosten liegen nicht
vor bzw. werden nicht berücksichtigt.
13. Das Lohn bzw. Zinsniveau kann zwischen den beiden Ländern differieren.
2.1. Das Stolper- Samuelson-Theorem
Für ein Land mit gegebener Faktorausstattung untersucht das Heckscher-Ohlin-Modell,
welche Auswirkungen der Außenhandel auf die Industriestruktur dieses Landes hat. Dabei
können auch Aussagen über die Einkommensverteilung getroffen werden.
Die Ausführungen folgen hauptsächlich den Darstellungen von Paul Krugman und Maurice
Obstfeld im 4. Kapitel von ,, International Economics: Theory and Policy".
2
Betrachtet werden im folgenden 2 Länder H und F. Wie in (2.0.) erwähnt seien die
Produktionsfaktoren völlig mobil innerhalb eines Landes, jedoch völlig immobil zwischen
den beiden Ländern. Also kann insbesondere kein Arbeitskräfteaustausch zwischen H und F
erfolgen.
2
P.Krugman, M.Obstfeld: "International Economics", S. 67-92
5
Sei nun die Produktion des Gutes X relativ arbeitsintensiv im Vergleich zur Y-Produktion,
d.h. für das Verhältnis der Inputkoeffizienten gelte:
KX
LX
a
a
>
KY
LY
a
a
und k
X
< k
Y
, wobei k
X
=
X
X
L
K
bzw. k
Y
=
Y
Y
L
K
.
Dann stellt das Stolper-Samuelson-Theorem folgenden Zusammenhang zwischen dem
relativen Güterpreis
Y
X
p
p
und dem Faktorpreisverhältnis von Lohn und Kapitalzins,
r
w
,
heraus:
Eine Steigerung des relativen Preises eines Gutes führt zu einer Steigerung der
Entlohnung jenes Faktors, der intensiv in der Produktion dieses Gutes verwendet wird,
und führt zu einer sinkenden Entlohnung des anderen Faktors.
Beweis:
Wir gehen von Cobb-Douglas-Produktionsfunktionen aus, d.h.
X=
K
X
·
L
X
-
1
, Y=
K
Y
·
L
Y
-
1
. Dabei sind K
x
der Kapitaleinsatz für Gut X und , bzw.
1 , 1- die Produktionselastizitäten für Kapital bzw. Arbeit bei der Herstellung der beiden
Güter. Der Output von Gut X lässt sich schreiben als
X = L
X
· f ( k
X
) (1), und ebenso
Y = L
Y
· h (k
Y
) (2) .
Dies ist möglich, da X =
X
K
-
1
X
L
(
X
L
X
) =
X
K
-
1
X
L
X
L
1
=
(
X
X
L
K
)
,
also X = L
X
f ( k
X
) mit f ( k
X
) = ( k
X
)
.
Die gesamten Produktionskosten für ein Gut sind die Summe aus Lohn- und Kapitalkosten,
betragen also w · L
+ r · K. Division durch L liefert die Gesamtkosten pro Arbeiter:
K
Arbeiter
= w + r · k
i
mit i = X, Y.
6
Für Gut X beträgt der Gesamterlös p
X
· X und für Gut Y ist er gleich p
Y
· Y, wonach der
Gesamterlös je Arbeiter den Wert E
Arbeiter
= p
X
·
Lx
X
bzw. p
Y
·
Ly
Y
hat.
Unter der Nullgewinnbedingung gilt Kosten = Erlöse, also
w + r · k
X
= p
X
·
Lx
X
)
1
(
= p
X
· f (k
X
) (3)
w + r · k
Y
=
p
Y
·
Ly
Y
)
2
(
= p
Y
· h (k
Y
) (4) .
Somit erhält man:
X
p
w
= f (k
X
) -
X
p
r
· k
X
(5) X-Kurve
y
p
w
= h (k
Y
) -
y
p
r
· k
Y
(6),
was in Zeichnung 1 dargestellt ist:
X
p
w
A
X
Y
X
p
r
Zeichnung 1
Die Y-Kurve ist steiler, da das Gut Y annahmegemäß kapitalintensiver ist. Somit muss bei
einer Steigerung von r auf mehr Lohn w verzichtet werden.
7
X
p
w
= f (k
X
)
X
p
r
· k
X
Multiplikation mit p
y
/ p
x
ergibt:
y
p
w
= h (k
Y
)
y
p
r
· k
Y
X
p
w
=
h (k
Y
) · p
y
/ p
x
X
p
r
· k
Y
Falls also p
x
/ p
y
steigt , schiebt sich die Y-Kurve nach unten, da ihr Koordinatenabschnitt
h (k
Y
) · p
y
/ p
x
sinkt.
Die X-Kurve bleibt unverändert, denn Reallohn und Realzins
verändern sich in diesem Sektor gleichmäßig.
Im neuen Punkt A ist der Reallohn höher und der Realzins niedriger als zuvor. Somit wird der
Faktor Arbeit besser entlohnt, falls der Preis des arbeitsintensiven Gutes X relativ gestiegen
ist.
Der Außenhandel verursacht also mächtige Einkommenseffekte und bringt nach dem Stolper-
Samuelson-Theorem einen Interessenkonflikt hinsichtlich der Einkommensverteilung mit
sich. Arbeiter und Kapitaleigner stehen sich gewissermaßen als Gegenspieler gegenüber.
Während eine Preisänderung durch den Außenhandel für die einen das Einkommen erhöht,
führt dies bei der anderen Gruppe zu einem Einkommensverlust.
2.2. Das RybczynskiTheorem
Es gilt nun, eine Aussage zu treffen, wie sich die Industriestruktur (der Output-Mix) eines
Landes verändert, wenn seine Faktorausstattung variiert.
Bezogen auf die Green-CardRegelung stellt sich die Frage, wie eine Zunahme von
qualifizierten Arbeitskräften in Deutschland die Produktionstätigkeit der deutschen Wirtschaft
verändert bzw. verändern kann.
Eine Antwort hierauf gibt das Rybczynski-Theorem. Dieses wird zunächst in Worten,
anschließend formal mit mathematischem Beweis dargestellt.
Es seien die Voraussetzungen aus (2.0.) erfüllt, und die Herstellung des Gutes Y sei in beiden
Ländern kapitalintensiver ( relativ zur Produktion von Gut X ).
8
Das Rybczynski-Theorem besagt:
Wenn die Ausstattung eines Landes mit einem Faktor steigt, während die Ausstattung
mit dem anderen Faktor fix ist, wird der Output jener Güterproduktion steigen, die den
gestiegenen Faktor intensiv nutzt, während der Output des anderen Gutes sinkt.
Angewandt auf obige Voraussetzung bedeutet dies, dass eine steigende Kapitalausstattung in
einem Land zu einem erhöhten Output des kapitalintensiven Gutes Y führt.
Formaler Beweis des Rybczynski-Theorems:
· 2 Güter X, Y
· 2 Produktionsfaktoren K, L
· Y kapitalintensiver, d.h. k
Y
> k
X
mit k =
L
K
Es gilt: X =
X
K
-
1
X
L (1)
Y =
Y
K
-
1
Y
L (2)
mit 0
,
1 und
<
(Cobb - Douglas- Produktionsfunktionen).
L = L
X
+ L
Y
(3)
K = K
X
+ K
Y
(4)
Schreibe wie in Abschnitt (2.1.)
X = L
X
f ( k
X
) (1') und ebenso Y = L
Y
h (k
Y
) (2') .
9
Aus (1') bzw. (2') folgt: L
X
=
)
(
X
k
f
X
(i) bzw. L
Y
=
)
(
Y
k
h
Y
(ii) .
Multipliziert man Gleichung (i) mit K
X
, so erhält man: L
X
K
X
=
)
(
X
k
f
X
K
X
Bei Multiplikation von Gleichung (ii) mit K
Y
erhält man: L
Y
K
Y
=
)
(
Y
k
h
Y
K
Y
.
Somit ist
K = K
X
+ K
Y
=
)
(
X
k
f
X
X
X
L
K
+
)
(
Y
k
h
Y
Y
Y
L
K
=
)
(
X
k
f
X
k
X
+
)
(
Y
k
h
Y
k
Y
(5) .
Dividiert man (5) durch L, so folgt:
k =
)
(
X
k
f
X
·
L
k
X
+
)
(
Y
k
h
Y
·
L
k
Y
(5a) ,
und bei Division von (3) durch L ergibt sich:
L
L
X
+
L
L
Y
=
L
)
k
(
f
X
X
+
L
k
h
Y
Y
)
(
= 1 (6).
Man bestimme nun die Ableitung
dk
L
Y
d
bzw.
dk
L
X
d
, d.h. die Änderung des Outputs von
Gut Y bzw. X bei steigender Kapitalintensität k.
Nach Gleichung (6) ist
L
Y
= ( 1 -
L
)
k
(
f
X
X
)· h (k
Y
) , somit folgt mit (5a):
k =
)
(
X
k
f
X
·
L
k
X
+ ( 1 -
L
)
k
(
f
X
X
) · h (k
Y
) ·
)
(
Y
Y
k
h
k
=
)
(
X
k
f
X
·
L
k
X
+ k
Y
-
L
)
k
(
f
X
X
k
Y
,
also k - k
Y
=
L
)
k
(
f
)
(
X
-
Y
X
k
k
X
.
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Originalausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2000
- ISBN (eBook)
- 9783832450397
- ISBN (Paperback)
- 9783838650395
- DOI
- 10.3239/9783832450397
- Dateigröße
- 4 MB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- Ludwig-Maximilians-Universität München – VWL
- Erscheinungsdatum
- 2002 (Februar)
- Note
- 1,0
- Schlagworte
- spezifische faktoren stolper-samrelson-theorem greencard rybcynski-theorem außenhandel
- Produktsicherheit
- Diplom.de