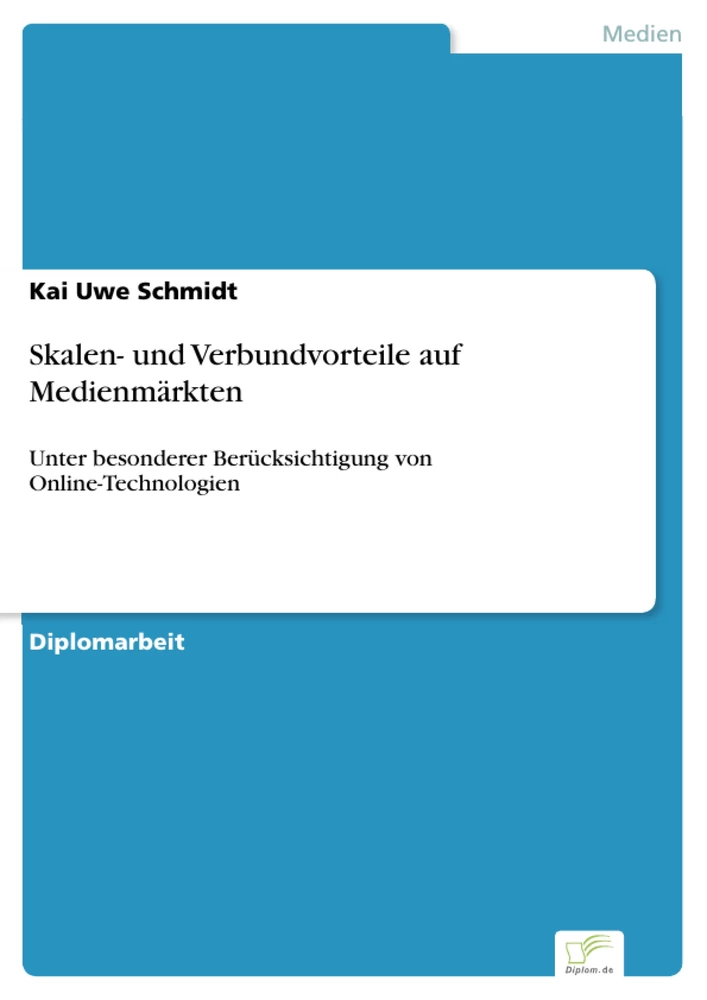Skalen- und Verbundvorteile auf Medienmärkten
Unter besonderer Berücksichtigung von Online-Technologien
Zusammenfassung
Die Sparten des Mediensektors sowie als Summe der gesamte Mediensektor sind traditionell von starken Konzentrationstendenzen in verschiedene Richtungen geprägt. Seit Mitte der 90er Jahre lassen sich medienübergreifendes Angebotsverhalten (cross-publishing), Diversifikationen und Unternehmenszusammenschlüsse nicht nur von und zwischen traditionellen Medienunternehmen beobachten, sondern auch die Märkte für Online-Angebote treten verstärkt in den Fokus. Großes Aufsehen haben etwa die Fusion zwischen TIME WARNER und AOL sowie die Beteiligung von Bertelsmann an der Musiktauschbörse Napster.com erregt.
Analysen von traditionellen Medienunternehmen bzw. -märkten verweisen zur Erklärung von Konzentrationstendenzen vor allem auf Eigenarten der Mediengüter selbst und die Charakteristik von deren Bereitstellung, wie etwa Produktionsprozesse mit typischerweise hohem Fixkostenanteil, die Nichtrivalitätseigenschaft von Mediengütern oder konzentrationsfördernde Spiraleffekte der Werbefinanzierung. Sind nun die oben beschriebenen Vorgänge unter Beteiligung von Online-Anbietern (wie bisweilen gemutmaßt) lediglich durch den Versuch klassischer Medienunternehmen motiviert, Kontrolle über neuartige Distributionskanäle für Medienobjekte zu erlangen, oder lassen sie sich auch oder besonders auf bekannte ökonomische Tatbestände wie Skalenvorteile o.ä. zurückführen?
Der Verfasser hat den Versuch unternommen, für Fernseh-, Print- und Onlineanbieter relevante Größen- und Verbundvorteile als potenzielle Ursachen für intra- und intramediale Konzentrationsprozesse auf Medienmärkten zu identifizieren und darzustellen. Die Gruppe der Online-Inhalteanbieter steht dabei besonders im Mittelpunkt der Betrachtung:
Die Märkte für Online-Inhalte werden als eigene Mediensparte betrachtet
Die zwischenmediale Konzentration wird in einem Mediensektor untersucht, der neben Fernseh-und Presse- zusätzlich die Online-Sparte umfasst.
Bei der Analyse der Implikationen kommt das industrieökonomische Structure-Conduct-Performance-Paradigma als konzeptioneller Rahmen zur Anwendung.
Als ein Teilergebnis der Arbeit stellte sich heraus, daß bedeutende Synergien zwischen traditionellen Medienunternehmen und Online-Anbietern nicht nur in der Produktion/Redaktion von Mediengütern liegen, sondern im Marketing- insbesondere durch die gemeinsame Nutzung von Marken (Markentransfer)- und für das strategische Verhalten der betrachteten Unternehmen von großer Bedeutung […]
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
1.1. Einführung
Der Erkenntnisgegenstand medienökonomischer Untersuchungen ist im Gegensatz zu anderen wirtschaftswissenschaftlichen Disziplinen weniger scharf umrissen. In einer umfassenden Definition beziehen medienökonomische Analysen über betriebs- und volkswirtschaftliche Aspekte von Gütern, Unternehmen und Märkten auch Interdependenzen zwischen ökonomischen Vorgängen und dem gesamten Kommunikations- und Informationssystem einer Gesellschaft mit ein und greifen so auf Fragestellungen von wirtschaftswissenschaftlichen und zusätzlich anderen Teildisziplinen zurück[1]. Innerhalb dieser Arbeit wird allerdings eine ökonomische Analyse, nämlich die Untersuchung von Konzentrationen im Mediensektor unter Verwendung des Begriffsrahmens der sog. Industrieökonomik im Vordergrund stehen.
Gegenstand der Untersuchung sind ausgewählte typisierte Medienunternehmen und die Märkte, auf denen sie handeln. Medienunternehmen lassen sich in Hinblick auf ihre betriebliche Zielsetzung als Betriebe kennzeichnen, die Informationen und andere immaterielle Güter (im folgenden: Inhalte/Inputs) mittels geeigneter Kommunikationstechniken verbreiten[2] ; sie werden in Abhängigkeit vom verwendeten Medium (als Kommunikationstechnik) zu einzelnen Sparten des Mediensektors gruppiert.
Der Wertschöpfungsprozeß solcher Unternehmen läßt sich in einem mehrstufigen Schema abbilden, innerhalb dessen üblicherweise zumindest die Stufen Inhalte-/Inputproduktion, Produktion (sog. publizistische Ebene) und Distribution von Medienobjekten unterschieden werden. Der gesamte Mediensektor wird üblicherweise in einer typischen Matrix dargestellt, wobei die einzelnen Sparten die Spaltenüberschriften und die Wertschöpfungsstufen die Zeilen bilden oder auch vice versa[3].
Nach obiger Definition gehören Presseunternehmen (Verlage) und Veranstalter von Fernsehprogrammen unzweifelhaft dem Mediensektor an[4]. Weiter werden im Rahmen dieser Arbeit solche Unternehmen dem Mediensektor zugerechnet, die das Computernetzwerk Internet als Medium zur Diffusion von Inhalten verwenden. Da die Wertschöpfungskette solcher Unternehmen auf den ersten beiden Stufen dem Aufbau von Verlagen und Rundfunkveranstaltern entspricht, hängt die Zulässigkeit der Klassifizierung dann insbesondere davon ab, ob das Internet als „geeignete Kommunikationstechnik zur Verbreitung von Inhalten" betrachtet werden kann. Weil der Funktionsumfang der Internet-Kommunikation den entsprechenden Umfang bei periodischen Pressemedien und dem Fernsehen teilweise übersteigt[5], wird diese Frage hier bejaht und das Internet als medialer Verwertungsweg, Online-Anbieter als Medienunternehmen und die Märkte, auf denen sie handeln, als Teilmärkte des Mediensektors betrachtet.
Die folgenden Untersuchungen beschränken sich dabei auf Medienanbieter der Sparten Presse (insbesondere Tageszeitungsverlage[6] ), Fernsehen und solche Anbieter, die Inhalte über das Internet und Telekommmunikationsnetze verbreiten (Online-Anbieter). Alle betrachteten Unternehmen bieten interessierten Nachfragern (im folgenden: Konsumenten, Zuschauer oder Nutzer) ihre Objekte auf Märkten an und agieren infolge spezifischer Eigenschaften von Mediengütern i.d.R. auch als Anbieter von Raum zur Veröffentlichung von Anzeigen, Spots oder Bannern auf Werbemärkten. Wenn nicht anders gekennzeichnet, wird im folgenden unter dem Begriff „Medienmarkt“ zunächst die erste Gruppe von Märkten verstanden.
1.2. Die Entwicklung der Online-Märkte
Seit Beginn der 90er Jahre beeinflussen Online-Technologien, allen voran das weltumspannende Computernetzwerk Internet auf verschiedene Weise eine zunehmend größere Zahl von Märkten und Unternehmen. Die Geschwindigkeit, mit der das Internet insbesondere seit der Implementierung des World Wibe Web an Bedeutung für private und kommerzielle Nutzer gewinnt, ist atemberaubend. So hat sich im Zeitraum zwischen 1997 bis 2000 die Zahl der Internet-Nutzer in Deutschland mehr als vervierfacht[7]. Das Geschäftsvolumen der über das Internet getätigten kommerziellen Transaktionen in Europa soll nach Prognosen des Marktforschungsinstituts Forrester Research von 1,2 Mrd. US-$ im Jahr 1998 auf ca. 64 Mrd. US-$ im Jahr 2001 förmlich explodieren[8].
Internet-Unternehmen zeichnen sich teils durch besonders innovative Geschäftsmodelle aus, wobei gängige Bezeichnungen wie „Gateways“, „Content Provider“ oder „Transaction Aggregator“ andeuten, daß die zugrundeliegenden Modelle beispielsweise mit den Geschäftsansätzen der herkömmlichen IT-Dienstleister nicht viel gemein haben. Entsprechend schienen sich die Erfolgsfaktoren solcher Geschäftsmodelle so sehr traditionellen Analyse- und Bewertungsmodellen zu entziehen, daß sich für die Gesamtheit der Geschäftsmodelle Internet-basierter Unternehmen im allgemeinen Sprachgebrauch die Bezeichnung „New Economy“ einbürgerte; parallel zur technologischen Entwicklung bildeten sich auf den Kapitalmärkten neuartige Finanzintermediäre (venture capitals) zur Bereitstellung von Risikokapital heraus. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Arbeit scheinen jedoch bereits aus der "Old Economy" bekannte Marktbereinigungen stattzufinden. So stellte Kevin Ryan, bereits 1998 fest:
„ There are too many products in each sector. How many sites do we need that report NBA scores? There is a natural survival of the fittest..[9] “
Medienunternehmen sind von der zunehmenden Verbereitung des Internet deshalb so stark betroffen, weil durch dessen offene technologische Architektur ein neuer medialer Verwertungsweg an Bedeutung gewinnt, der von ihnen (zunächst) nicht wie die herkömmlichen Verwertungsformen kontrolliert werden kann[10]. Buchstäblich jeder Besitzer eines PC´s mit Internet-Zugang kann zu minimalen Kosten Inhalte verschiedensten Typs selbst erstellen und über das Internet anderen zur Verfügung stellen. Wenn Medienunternehmen als Anbieter von Inhalten nicht den bisweilen als Vergleich herangezogenen Fehler der amerikanischen Bahnlinien des 19. Jahrhunderts wiederholen wollen, vor drohender neuartiger Konkurrenz die Augen zu verschließen -dort Automobile und Flugzeuge, hier neuartige Inhalteanbieter- sind sie gezwungen, sich dieser Herausforderung zu stellen.
1.3. Zielsetzung und Gang der Arbeit
Gegenstand der vorliegenden Arbeit ist der Einfluß von neu als Anbieter von Inhalten via Internet auftretenden Unternehmen auf die intermediäre Konzentration in einem (Teil-)Ausschnitt des Mediensektors, der die Sparten Periodische Presse (insbesondere Tageszeitungen), Fernseh(voll)programme und Online umfaßt.
Im Mittelpunkt steht dabei der Zusammenhang zwischen Größen- und Verbundvorteilen, den auf deren Realisierung ausgerichteten Verhaltensweisen der betrachteten Anbieter sowie den sich ergebenden Rückwirkungen auf die Anbieterstruktur. Im einzelnen werden folgende Fragen gestellt:
1. Welche Größenvorteile liegen auf den einzelnen Teilmärkten (Presse, Fernsehen, Online) vor und welche Maßnahmen werden von Anbietern ergriffen, um die Vorteile auszunutzen?
2. Welche Verbundvorteile liegen zwischen den einzelnen Wertschöpfungsketten der betrachteten Anbieter vor und welche Maßnahmen stehen ihnen zur Realisierung offen?
3. Lassen sich aus den Erkenntnissen aus (1) und (2) Rückschlüsse auf die Entwicklung der Anbieterkonzentration auf den drei Medienmärkten, die intermediäre Konzentration innerhalb des betrachteten Ausschnitts sowie auf das allokative Ergebnis der Märkte ziehen?
Die Arbeit teilt sich dazu in sechs Kapitel auf:
Im Rest des ersten Kapitels wird noch der Begriff der Wertschöpfungskette von der betriebswirtschaftlichen Wertkette abgegrenzt.
Im zweiten Kapitel wird der Begriff der ökonomischen Konzentration näher untersucht, eine Klassifizierung von Konzentrationsprozessen vorgenommen und die Folgen verschiedener Konzentrationen mit einfachen (statischen) allokationstheoretischen Modellen beschrieben. Im Anschluß wird der Zusammenhang zwischen Anbieterkonzentrationen auf Medienmärkten und der sog. Meinungsvielfalt in einem Exkurs betrachtet.
Im dritten Kapitel werden einzelne Faktoren vorgestellt, die im allgemeinen zur Begründung von Konzentrationsprozessen herangezogen werden. Die Ausführungen sind um solche Faktoren zu ergänzen, die eigens auf Medienmärkten zur Erklärung von Konzentrationsprozessen dienen.
Ab dem vierten Kapitel rückt der oben umrissene (erweiterte) Mediensektor in den Blickpunkt. Zunächst werden technische Bedingungen der Bereitstellung von Inhalten der medialen Verwertungsform „online“ charakterisiert. Dann wird eine Systematisierung von Online-Geschäftsmodellen vorgenommen, innerhalb derer eine Teilgruppe (nämlich die als Medienunternehmen klassifizierbaren Inhalteanbieter) einer näheren Betrachtung unterzogen wird.
Im fünften Kapitel werden Größen- und Verbundvorteile detailliert untersucht. Zunächst werden die beiden Begriffe in Anlehnung an formale volkswirtschaftliche Definitionen deutlich gegeneinander abgegrenzt. Die Darstellung von einzelnen Vorteilsquellen wird innerhalb der medienwirtschaftlichen Wertschöpfungskette als ordnendem Rahmen vorgenommen und jeweils im Zusammenhang aufgezeigt, ob und in welcher Form die betrachteten Anbieter solche Vorteile nutzen können. Dabei konzentriert sich die Betrachtung des Verhaltens auf Kooperationen und solche Produktstrategien, die auch in der medienökonomischen Realität betrachtet werden können.
Infolge des verwendeten Schemas wird durch Betrachtung von Kostenstrukturen der typisierten Anbieter auch deutlich, wie stark für sie jeweils Anreize zum Ergreifen einzelner korrespondierender Handlungsmaßnahmen sind. Im abschliessenden sechsten Kapitel werden diese Erkenntnisse dazu verwendet, um Schlüsse über den Wirkungszusammenhang zwischen Größenvorteilen, Anbieterverhalten und Anbieterkonzentrationen sowie allokative Wirkungen zu ziehen.
1.4. Zur Abgrenzung der Wertschöpfungskette von der Wertkette nach Porter
Um vorhandene und/oder potentielle Wettbewerbsvorteile identifizieren zu können, werden Unternehmen z.B. von Unternehmensberatern mittels betriebswirtschaftlicher Wertketten analysiert. Eine Wertkette gliedert ein Unternehmen bzw. die Tätigkeit eines Unternehmens in einer bestimmten Branche in sog. Wertaktivitäten auf, um mittels deren Analyse und der Untersuchung von Wechselwirkungen zwischen einzelnen Aktivitäten geeignete Unternehmensstrategien formulieren zu können. Unter Wertaktivitäten werden physisch und technologisch voneinander unterscheidbare Aktivitäten des Unternehmens verstanden. Mindestens sind Vorgänge abzugrenzen, die verschiedenen ökonomischen Zusammenhängen unterliegen und/oder in einer isolierten Betrachtung den Ausgangspunkt für die Implementierung strategischer Ziele bilden können[11].
Das Begriff der Wertkette und das damit zusammenhängende Konzept sind scharf von dem innerhalb des fünften Kapitels verwenden Konzepts der (medialen) Wertschöpfungskette zu trennen. Diese leitet sich aus der Kontenplandarstellung der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung ab und stellt die Produktion eines beliebigen Gutes anhand von Zwischenprodukten dar, die als Vorleistung in die Wertschöpfung der nachgelagerten Stufe eingehen. Das Endprodukt wird konsumiert, innerhalb der Wertschöpfung anderer Produkte als Faktor eingesetzt oder exportiert[12].
Auf den Stufen einer solchen Wertschöpfungskette werden -in der Terminologie der Wertkettenanalyse- zahlreiche Wertaktivitäten aggregiert, die möglicherweise nicht von allen Produzenten des betrachteten Gutes durchgeführt werden oder bei einzelnen Anbietern einer Branche höchst unterschiedlich gestaltet sein dürften. Für etwa die Identifikation von Wettbewerbsvorteilen und/oder die Formulierung von Strategien ist die Verwendung von Wertschöpfungsketten daher nicht zulässig[13].
Im Rahmen dieser Arbeit wird das Modell einer dreiteiligen medialen Wertschöpfungskette verwendet, weil die volkswirtschaftlichen Definitionen von Konzentrationen an die Definition von Produktionsstufen dieser Kette geknüpft sind.
2. Konzentration
2.1. Formen von Konzentrationen
Der Begriff der Ökonomischen Konzentration charakterisiert auf einem abgrenzbaren Markt bestimmte Marktprozesse oder einen Marktzustand als deren Ergebnis[14].
Konzentrationsprozesse als Folge von internem oder externem Unternehmenswachstum[15] führen zu einer Abnahme der Anbieterzahl (absolute Konzentration) und/oder zur Ballung von Marktanteilen auf eine Teilgruppe der Anbieter (relative Konzentration); sie resultieren in der Erhöhung des Konzentrationsgrades[16] und werden nach ihrer Richtung unterteilt (vgl. Bild 1):
Bild 1: Richtung von Konzentrationsprozessen
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Quelle: eigene Darstellung.
Dargestellt ist ein Branchenausschnitt mit zwei Produkten, deren Wertschöpfungsprozesse jeweils drei hintereinander gelagerte Stufen umfassen. Im Beispiel ist ein Produzent des Produkts A auf der zweiten und dritten Wertschöpfungsstufe tätig und bezieht Vorleistungen von dritten Unternehmen auf der vorgelagerten Stufe 1.
Horizontale Konzentrationsprozesse werden ausgelöst mit dem Zugewinn von Marktanteilen durch Unternehmen auf jenen Wertschöpfungsstufen, auf denen diese bereits tätig sind (im Beispiel also auf der zweiten oder dritten Stufe von A). Als direkte Folge erhöht sich die relative Konzentration des zur Stufe gehörenden Markts (Primäreffekt). Ob auch die absolute Konzentration ansteigt, ist von der Art des Unternehmenswachstums abhängig[17] bzw. in der Folge davon, ob konkurrierende Unternehmen trotz nun geringerer Marktanteile und i.d.R. ungünstigerer Wettbewerbs- und Kostensituation auf dem Markt verbleiben können (Sekundäreffekt)[18].
Dagegen entstehen vertikale Konzentrationsprozesse mit dem Zusammenschluß von Unternehmen (durch Fusionen oder Beteiligungen), die auf vor- oder nachgelagerten Wertschöpfungsstufen des gleichen Produkts tätig sind (Vorwärts- bzw. Rückwärtsintegration, vgl. Bild 1)[19].
Zunächst bleibt die Anbieterstruktur auf den betroffenen Märkten unberührt. Solche Prozesse zielen allerdings auf die Einsparung bestimmter Transaktionskosten (vgl. 3.2.) und/oder sollen die Einflußnahme auf Beschaffungs- oder Distributionsmöglichkeiten von Mitbewerbern ermöglichen[20]. Gelingt dem vertikal integrierenden Unternehmen so eine Verbesserung seiner Kosten- und/oder Wettbewerbssituation, können mittelbar auch aus solchen Prozessen Marktanteilsgewinne und/oder Marktaustritte auf anderen vor- oder nachgelagerten Märkten resultieren.
Aus Marktanteilsgewinnen auf Wertschöpfungsstufen von Produkten, zu denen aus Sicht des integrierenden Unternehmens Produktions- oder Nachfrageverwandtschaft besteht (hier zwischen den Produkten A und B) resultieren diagonale Konzentrationsprozesse (product extension mergers)[21]. Sie weisen in Abhängigkeit davon, ob das betrachtete Unternehmen danach auf zusätzlichen Wertschöpfungsstufen agiert, horizontalen oder vertikalen Charakter auf (vgl. Bild 1)[22]. Das diagonal integrierende Unternehmen verbessert gegenüber seinen Konkurrenten auf den verschiedenen Märkten durch die Realisation von Verbundvorteilen (vgl. 3.1.) möglicherweise seine Kosten- und Wettbewerbsposition und kann dies zum Gewinn zusätzlicher Marktanteile nutzen; auch diagonale Konzentrationsprozesse können also als Sekundäreffekt horizontale Konzentrationstendenzen auslösen.
2.2. Folgen von Konzentrationen
2.2.1. Markt- und Preistheorie versus Industriekökonomik
In den Modellen der Markt- und Preistheorie wird der Zusammenhang zwischen Marktstrukturmerkmalen (wie der Anbieterkonzentration), den Verhaltensweisen der Marktteilnehmer (Anbieter, Nachfrager, Staat) und dem Marktergebnis (insbesondere Preis und gehandelte Mengen) untersucht, wobei ein eindeutig gerichteter Zusammenhang unterstellt wird (vgl. Bild 2). Zur Beurteilung von Marktergebnissen dient als Referenzmodell dabei als Marktform die vollkommene Konkurrenz, wo -infolge u.a. der minimalen Konzentrationen auf beiden Marktseiten- auf dem betrachteten Markt maximale allokative Effizienz erreicht wird[23].
Ein solches Vorgehen stellen Vertreter des sog. „Workable-Competition“-Ansatzes in Frage (insbesondere in Hinblick auf die wettbewerbspolitische Beurteilung realer Marktsituationen).
Unter anderem wurde an preistheoretischen Modellen die Kritik geübt, daß diese (1) sich als Referenzmarktergebnis mit dem Leitbild des Polypols auf einem vollkommenen Markt an einem Optimum orientierten, das in der realen ökonomischen Welt so nicht existieren könne und (2) vernachlässigten diese bei der Definition von Marktstruktur, -verhalten und -ergebnis und der Analyse von Wirkungszusammenhängen wesentliche weitere Elemente.
Als Zielgröße der Beurteilung wird daher innerhalb des „Workable-Competition“-Konzepts das Marktergebnis durch den „funktionsfähigen Wettbewerb“ ersetzt. Dabei sei das Vorliegen eines genügend intensiven Wettbewerbs an der Ausgestaltung diverser Merkmale von Marktform (structure), Marktverhalten (conduct) und Marktergebnis (performance) erkennbar[24].
Die Industrieökonomik, insbesondere die sogenannte Harvard School[25], verwendete diese Dreiteilung zur Modellierung von Kausalzusammenhängen zwischen Marktstruktur, -verhalten und -ergebnis und weiteren Gegebenheiten, wobei ursprünglich (analog zur Preistheorie) von einem eindeutigen Richtung von der Marktstruktur hin zum -ergebnis ausgegangen wurde; der wesentliche Unterschied von industrieökonomischen zu preistheoretischen Modellen bestand zunächst in der höheren Zahl von in die Analyse einbezogenen ökonomischen Variablen.
Als Schema zur Systematisierung von Wirkungszusammenhängen wurde das sogenannte Structure-Conduct-Performance-Paradigma entwickelt[26]. Weil innerhalb dieses Schemas auch rückwärts gerichtete Zusammenhänge (feedbacks) sichtbar werden und diese möglicherweise ebenso starke Wirkungen entfalten wie die Struktur-Verhalten-Ergebnis-Kausalkette, gilt die Konzeption des Schemas, die Ausprägung eines Marktelements aus der Gestalt der vorgelagerten Elemente abzuleiten, als nicht mehr anwendbar[27]. Trotzdem wird dem Schema weiter ein hoher praktischer Nutzen zur Erklärung von Marktzusammenhängen beigemessen[28].
Bild 2: Wirkungsketten: Markt- und Preistheorie vs. Industrieökonomik
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Quelle: Wied-Nebbeling, S.1f.
Um die Wirkungen verschiedener Anbieterkonzentrationen auf das Marktergebnis zu untersuchen, werden im folgenden die Implikationen von einigen statischen Modellen der Markt- und Preistheorie dargestellt; diese treffen Aussagen über den Zusammenhang zwischen zunehmenden Anbieterkonzentrationen und resultierenden allokativen Ineffizienzen im jeweiligen (langfristigen) Marktgleichgewicht. Solche Ineffizienzen machen sich in Form von überhöhten Marktpreisen, geringeren gehandelten Mengen und mangelnder Entsprechung von Angebot und Konsumentenpräferenzen bemerkbar.
2.2.2. Wettbewerbsbeeinträchtigung und allokative Ineffizienzen
Auf oligopolistischen Märkten mit erhöhter horizontaler Konzentration entsteht für die wenigen Anbieter die Notwendigkeit zu strategischem Verhalten, insbesondere zur Prognose der Reaktionen der Konkurrenten auf eigene preispolitische Maßnahmen[29]. Solange die Anbieter ihre Handlungen nicht koordinieren, könnte sich das allokative Marktergebnis (unter sehr restriktiven Annahmen) dem der vollkommenen Konkurrenz annähern[30].
Auf oligopolistischen Märkten herrschen aber naturgemäß die besten Möglichkeiten und die höchste Neigung zu verschiedenen wettbewerbsbeschränkenden Verhaltensweisen. Diese umfassen kollektive Verhaltensweisen und Absprachen mit unterschiedlich starkem Zwangscharakter, die sich auf Preise, Mengen oder andere Parameter beziehen können[31]. Da die Gesamtheit solcher Verhaltensweisen direkt oder indirekt die Etablierung überhöhter Preise oder geringerer Absatzmengen bezweckt, sind allokative Ineffizienzen als unmittelbare Folge zu befürchten.
Darüberhinaus können die wenigen großen Anbieter ihre Marktmacht einsetzen, um Zulieferer oder Anbieter zum Eingehen von Bindungen zu zwingen und so im Rahmen geschlossener Beschaffungs- und Vertriebssysteme Ober- oder Untergrenzen für Beschaffungs- und Verkaufspreise durchsetzen. Primär setzt dies den Preismechanismus auf den Märkten zwischen den entsprechenden Wertschöpfungsstufen außer Kraft, woraus die Gefahr der Fehlallokation von Resourcen erwächst; weiterhin kann ein solches Abschotten von (limitierten) Beschaffungs- oder Absatzkanälen die Grundlage von Behinderungspraktiken gegenüber aktuellen und potentiellen Konkurrenten bilden, die Fehlallokationen und Ineffizienzen nach sich ziehen können[32].
Mit höherer relativer Konzentration werden solche Gefahren noch größer, da sich z.B. Preisabsprachen auf größere Teile des Angebots erstrecken und kleinere Konkurrenten leichter behindert werden können[33]. Für die größer gewordenen Anbieter wird es dann auch leichter, analog zu oben ihre hinzugewonnene Marktmacht auf vor- oder nachgelagerten Märkten zur Bildung von geschlossenen Vertriebs- oder Beschaffungssytemen auszunutzen.
Wird im Extremfall ein maximaler Grad an horizontaler Anbieterkonzentration erreicht (Monopol), so wird der einzige Anbieter seine Preissetzungsmacht zum Setzen eines für ihn gewinnmaximalen Preises oberhalb der Grenzkosten nutzen, was im Modell neben einer Umverteilung auch zum gesamtwirtschaftlichen Verlust von Marktrenten (dead-weight-loss) und damit zu unwiderbringlichen Wohlfahrtseinbußen führt. Weiterhin werden im Gleichgewicht im Vergleich zur vollkommenen Konkurrenz geringere Gütermengen hergestellt und notwendige Produktionsfaktoren nachgefragt, so daß das allokative Ergebnis auf mehreren Märkten zugleich beeinträchtigt wird[34].
Diese Überlegungen lassen sich nicht auf sogenannte natürliche Monopole übertragen, denn dort ist die Existenz und Höhe von Wohlfahrtsverlusten von der Art der Preissetzung abhängig[35].
Mit vertikalen Konzentrationsprozessen können spezifische kollektive Verhaltensformen auftreten, wenn sich als Folge der Integration nun zwei Unternehmen auf verschiedenen Produktmärkten wechselseitig als Anbieter und Nachfrager gegenüberstehen: es besteht dann nachgewiesenermaßen die Neigung zur gegenseitigen Bevorzugung beim Abschluß von Beschaffungs- und Absatzverträgen (reciprocal dealing), wodurch der Preismechanismus auf mehreren Märkten zugleich außer Kraft gesetzt werden kann[36]. Hierdurch können allokative Ineffizienzen ebenso bedingt werden wie durch das Schaffen von geschlossenen Beschaffungs- und Vertriebssystemen, mit deren Hilfe nicht integrierte Konkurrenten diskriminiert oder boykottiert werden können[37].
Somit ist festzuhalten, daß horizontal, vertikal oder diagonal gerichtete Konzentrationsprozesse[38] mit der Gefahr verbunden sind, daß infolge von veränderten Machtverhältnissen insbesondere der Preismechanismus, der die Übereinstimmung von Konsumentenpräferenzen und Zusammensetzung des Angebots gewährleistet, beeinträchtigt wird.
Allerdings führt -auch in einer statischen Betrachtung- eine Abnahme der Anbieterzahl nicht zwangsläufig zu einer Beeinträchtigung des allokativen Marktergebnisses, weil manche Marktstrukturen mehrere verschiedene Verhaltensweisen und resultierende Marktergebnisse ermöglichen. Weiter ist zu beachten, daß innerhalb von solchen statischen Modellen in Hinblick auf das allokative Marktresultat
- unberücksichtigt bleibt, daß die Folgen einer zunehmenden Anbieterkonzentration, insbesondere die Möglichkeiten der Anbieter zur Verhaltensabstimmung, durch höhere Nachfragekonzentrationen (countervailing power)[39] und andere Faktoren[40] gedämpft werden können, und
- dynamische Aspekte wie z.B. die Wirkungen von sich änderndem strategischen Verhaltensweisen der Anbieter bei verschiedenen Marktreifegraden und die Auswirkungen von technischem Fortschritt nicht in die Analyse miteinbezogen werden: die Folgen von intertemporalen Interdependenzen zwischen Marktstruktur, -verhalten und -ergebnis werden nicht berücksichtigt[41].
Damit lassen sich bestimmte Anbieterkonzentrationen eher als notwendige denn als hinreichende Bedingungen für ein bestimmtes Marktresultat betrachten[42], und es ist nicht möglich, pauschal einen kritischen Konzentrationsgrad zu definieren, ab dem die Güter-/Faktorallokation oder andere Funktionen des Wettbewerbs eingeschränkt werden[43].
[...]
[1] Seidel, S.244.
[2] Lahnstein, Sp.2839.
[3] Dabei kann die Zahl der Stufen je nach Darstellungsziel variieren. Vgl. Kruse, S.26 und Seufert (1997), S.260.
[4] So besteht etwa die betriebliche Zielsetzung von Verlagen in dem Herausgeben von Zeitungen oder Zeitschriften. Stahmer, S.9.
[5] Vgl. Neuberger (1999a), S.33f.
[6] Als Zeitungen sind Druckschriften zu verstehen, die „in regelmäßiger Abfolge, allgemein zugänglich, räumlich und zeitlich disponibel aktuelle Informationen vermitteln“ (Sjurts, S.9), während Zeitschriften sich durch eine kontinuierliche Stoffdarbietung auszeichnen (ebenda, S.67).
[7] Van Eimeren/Gerhard, S.339.
[8] Bliemel u.a., S.3.
[9] K. Ryan war im Jahr 1998 Chief Operating Officer der US-amerikanischen Online-Agentur DoubleClick. Vgl. Ryan, S.2.
[10] Vgl. Killius/Mueller-Oerlinghausen, S.141.
[11] Vgl. Porter (1992), Kapitel 2.
[12] Vgl. Zerdick u.a., S.29f.
[13] Innerhalb von strategischen Analysen oder Kostenanalysen von Medienunternehmen ist daher eine wesentlich differenziertere Aufgliederung von medialen Wertschöpfungsprozessen unter Berücksichtigung der hier ständig fortschreitenden technischen Entwicklung notwendig. Vgl. z.B. für digitale Medienangebote Kops, S.6.
[14] Zu Möglichkeiten der Marktabgrenzung vgl. Herdzina, S.79f. Auf das Phänomen der Makrokonzentration, d.h. der Konzentration in einer Volkswirtschaft insgesamt, wird hier nicht näher eingegangen. Vgl. dazu Kaufer (1980), S.113f.
[15] Internes Unternehmenswachstum entsteht durch den überproportionalen Gewinn von Marktanteilen, externes Wachstum durch den Zusammenschluß von zuvor selbständigen Unternehmen (z.B. durch eine Fusion). Die folgenden Ausführungen beziehen sich in Hinblick auf die Zielsetzung der Arbeit auf Anbieterkonzentrationen.
[16] Zur Messung des Konzentrationsgrades werden strukturorientierte und ergebnisorientierte Indikatoren verwendet (z.B. Concentration Ratio (CR), Preis-Grenzkosten-Marge) Vgl. Scherer/Ross, S.70f.
[17] Bei internen Wachstumsprozessen bleibt die Anbieterzahl ja (zunächst) gleich.
[18] Herdzina, S.190.
[19] Nach dieser Definition zählen auch Marktverkettungszusammenschlüsse (Fusionen zwischen Unternehmen, die auf nicht direkt nacheinandergelagerten Stufen der Wertschöpfungskette eines Produktes tätig sind) zu den vertikalen Integrationsprozessen. Die beteiligten Unternehmen streben mit solchen Zusammenschlüssen vor allem Machtvorteile an, da sie nach dem Zusammenschluß gegenüber den Unternehmen der zwischenliegenden Wertschöpfungsstufe als Anbieter und Nachfrager zugleich auftreten können. Vgl. Herdzina, S.192.
[20] Owen/Wildman, S.202f.
[21] Bestehen solche Verwandtschaften nicht, handelt es sich um (echte) konglomerate Fusionen, die insbesondere durch das Bündeln finanzieller Resourcen konzentrationsfördernd wirken können. Diese werden wie auch market extension mergers (Vordringen in neue geographische Märkte) hier nicht näher behandelt. Kaufer (1980), S.93 und Herdzina, S.193.
[22] Kaufer (1980), S.93.
[23] Dort gibt es keine Möglichkeiten zu preispolitischen Maßnahmen und es existierten weder Notwendigkeit noch Möglichkeiten zu strategischem Anbieterverhalten. Herrscht auf allen Märkten einer Volkswirtschaft vollkommene Konkurrenz, ist die Faktor- und Güterallokation pareto-optimal, d.h. es ist nicht mehr möglich, durch Umverteilung von Ressourcen ein Mitglied besser zu stellen, ohne die Lage der anderen zu verschlechtern. Zu einem Überblick über die innerhalb der Markt- und Preistheorie betrachteten Marktformen Wied, S.8f.
[24] Vgl. Scherer/Ross, S.52f und Herdzina, S.10f.
[25] Vgl. Borchert/Grossekettler, S.151f.
[26] Vgl. Scherer/Ross, S.5.
[27] Kaufer (1980), S.8.
[28] Sjurts, S.3, Sennewald, S.45.
[29] Dies resultiert aus der oligopolistischen Interdependenz, d.h. dem Spürbarwerden von preispolitischen Aktionen anderer. Wied, S. 139f.
[30] Vgl. Wied, S.142f.
[31] Vgl. Herdzina, S.147f.
[32] Vgl. ebenda, S.96f.
[33] Vgl. ebenda, S.189.
[34] Vgl. Kaufer (1980), S.287f.
[35] Dazu Wied, S.38f.
[36] Kaufer (1967), S.331.
[37] Herdzina, S.173.
[38] Die Folgen von diagonalen Konzentrationen sind je nach Richtung mit den Folgen der beiden anderen Konzentrationsformen vergleichbar.
[39] Vgl. Kaufer (1980), S.25.
[40] Vgl. Scherer/Ross, Kapitel 8.
[41] Kaufer (1980), S.365f.
[42] Herdzina, S.85f.
[43] Herdzina, S.189.
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Originalausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2001
- ISBN (eBook)
- 9783832445737
- ISBN (Paperback)
- 9783838645735
- DOI
- 10.3239/9783832445737
- Dateigröße
- 551 KB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- Universität zu Köln – Wirtschaftswissenschaften
- Erscheinungsdatum
- 2001 (Oktober)
- Note
- 2,0
- Schlagworte
- internet konzentration größenurteile
- Produktsicherheit
- Diplom.de