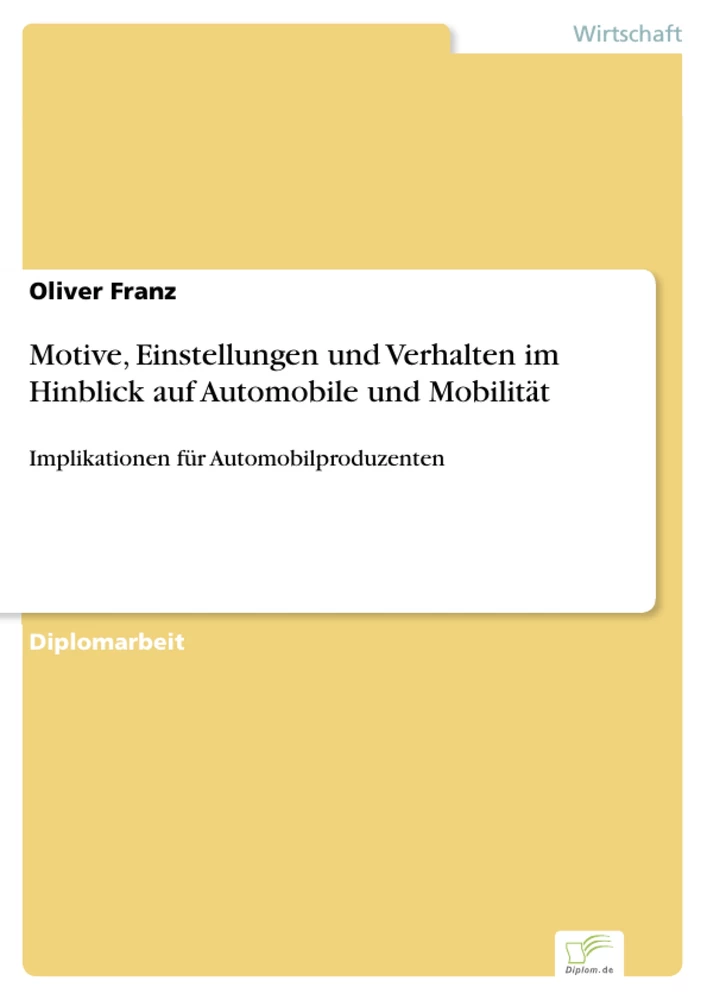Motive, Einstellungen und Verhalten im Hinblick auf Automobile und Mobilität
Implikationen für Automobilproduzenten
Zusammenfassung
Die vorliegende empirische Diplomarbeit mit dem Titel Motive, Einstellungen und Verhalten im Hinblick auf Automobile und Mobilität - Implikationen für Automobilhersteller -, gehört einer Reihe von vier Arbeiten an, die alle aus dem von der weltgrößten Unternehmensberatung Accenture (ehemals Andersen Consulting) initiierten Projekt The Age of Mobility hervorgehen. Grundlage dieser Arbeiten bildet eine deutschlandweit durchgeführte empirische Untersuchung (Kaufprozeß/Mobilität 2000) zu den zwei Themengebieten Kaufentscheidungsprozeß beim Automobilkauf und Mobilität. Diese Untersuchung wurde mit einem Budget von DM 25.000,- im Auftrag von Accenture und der DaimlerChrysler Tochter MCC smart GmbH durchgeführt. Der dazugehörige voll codierte 24-Seiten starke Fragebogen ist im Anhang enthalten.
Diese Diplomarbeit befasst sich, wie der Titel der Arbeit bereits verdeutlicht, mit der Untersuchung von Motiven, Einstellungen und Verhalten von Personen im Hinblick auf Automobile und Mobilität. Ziel ist es, zu ergründen, ob innerhalb der deutschen Gesellschaft unterschiedliche Personengruppen identifiziert werden können, die sich hinsichtlich ihrer Einstellung gegenüber den Verkehrsmitteln Automobil, ÖPNV, Fahrrad und das Zufußgehen unterscheiden. Ein Hauptbestandteil dieser Arbeit ist demnach die Erstellung einer deutschlandweit repräsentativen (Auto-)Mobilitätstypologie (mittels einer Clusteranalyse), deren Ergebnis eine differenzierte Betrachtungsweise von Personengruppen in der Gesellschaft hinsichtlich ihrer Mobilitätsorientierungen zulässt. Weitere zentrale Fragestellungen dieser Arbeit sind z.B., welchen Einfluss neue Technologien (Internet, Navigationssysteme, etc.) und das Verkehrsaufkommen auf das Mobilitätsverhalten haben. Darüber hinaus wird untersucht wie hoch die Umsteigebereitschaft auf zweisitzige Kleinwagen mit Zusatzleistungen (Mobilitätsangeboten) ist und wie (zweisitzige) Kleinwagen beurteilt werden. Die Interpretation und Auswertung der gewonnenen Erkenntnisse, wird unter besonderer Berücksichtigung von Automobilherstellern vorgenommen.
Gang der Untersuchung:
Im ersten Teil der Arbeit werden theoretische Grundlagen zum Thema Mobilität geklärt. Wobei der Begriff Mobilität definiert, die verschiedenen Formen der Mobilität dargestellt und ein Modell zur Erklärung des Mobilitätsverhaltens präsentiert wird. Im Anschluss wird ein Überblick darüber gegeben, welche Faktoren unser Mobilitätsverhalten […]
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Tabellenverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
1. Einführung und methodischer Aufbau
2. Theoretische Grundlagen
2.1 Emotion, Motivation und Einstellung
2.2 Marktsegmentierung
3. Themenspezifische Grundlagen
3.1 Mobilität und Verkehr
3.1.1 Definition des Begriffs Mobilität
3.1.2 Formen der Mobilität
3.1.3 Erklärungsmodell des Mobilitätsverhaltens
3.2 Determinanten des Mobilitätsverhaltens
3.2.1 Technologische Faktoren
3.2.2 Politische Faktoren
3.2.3 Wirtschaftliche Faktoren
3.2.4 Gesellschaftliche Faktoren
3.3 Das Automobil-Leitbild
3.3.1 Definition des Leitbildbegriffs
3.3.2 Die Rennreiselimousine
3.3.3 Der Klein- und Kleinstwagen als Rennreiselimousine
4. Empirische Untersuchung
4.1 Formulierung und Operationalisierung von Hypothesen
4.2 Forschungsdesign
4.3 Durchführung der Feldarbeit
5. Ergebnisse der Feldarbeit
5.1 Identifikation von (Auto-)Mobilitätstypen
5.1.1 Erläuterungen zur Methode
5.1.2 Beschreibung der identifizierten Cluster
5.1.3 Abschließende Beschreibung der identifizierten Cluster
5.1.4 Verknüpfung zu einer bestehenden Typologie
5.2 Hypothesentests
5.2.1 Einstellung und Verhalten
5.2.2 Verkehr
5.2.3 Technik
5.2.4 Individualverkehrsmittel
6. Folgerungen und Ausblick
6.1 Rahmenbedingungen
6.2 Strategien für autoaffine Zielgruppen
6.3 Strategien für nicht autoaffine Zielgruppen
7. Resümee
Literaturverzeichnis
Anhang
Abbildungsverzeichnis
Abbildung 01: Abnehmerbezogene Segmentierungskriterien
Abbildung 02: Erklärungsmodell des Mobilitätsverhaltens
Abbildung 03: Statements zum Thema Autofahren
Abbildung 04: Statements zum Thema Auto
Abbildung 05: Statements zum Thema Straßenbahn bzw. ÖPNV
Abbildung 06: Statements zum Thema Fahrradfahren und Zufußgehen
Abbildung 07: (Auto-)Mobilitätstypen in Deutschland
Abbildung 08: Modal Split – Gesamt –
Abbildung 09: Modal Split aller (Auto-)Mobilitätstypen
Abbildung 10: Wie empfinden Sie das aktuelle Verkehrsaufkommen?
Abbildung 11: Wie häufig sind Sie in der Woche online?
Abbildung 12: Seitdem ich einen Internetanschluß habe, erledige ich viele Dinge von zu Hause aus und erspare mir viele Wege
Abbildung 13: Beurteilung von Klein- und Kleinstwagen
Abbildung 14: Beurteilung von Klein- und Kleinstwagen je (Auto-) Mobilitätstyp
Abbildung 15: Umsteigebereitschaft auf zweisitzige Kleinwagen je (Auto-)Mobilitätstyp
Abbildung 16: Mobilitätsmarken statt Automobilmarken
Tabellenverzeichnis
Tabelle 01: Quotierung nach Alter und Geschlecht
Tabelle 02: Quotierung nach Fahrzeugklassen
Tabelle 03: Stichprobenverteilung nach Alter und Geschlecht
Tabelle 04: Stichprobenverteilung nach Fahrzeugklassen
Tabelle 05: Anzahl der Fälle in jedem Cluster
Tabelle 06: Soziodemographische Merkmale je Cluster
Tabelle 07: Soziodemographische Merkmale je Cluster (Fortsetzung)
Tabelle 08: Autospezifische Merkmale je Cluster
Tabelle 09: Autospezifische Merkmale je Cluster (Fortsetzung)
Tabelle 10: sonstige Merkmale je Cluster
Tabelle 11: (Auto-)Mobilitätstypen
Tabelle 12: Verknüpfung zur PKW-Fahrer Typologie 1999
Tabelle 13: Bereitschaft Mobilitätsdienstleistungen aus dem Internet abzurufen (in % aller Internet-Nutzer)
Tabelle 14: Können Sie sich vorstellen, per Internet die folgenden Mobilitätsdienste zu bestellen, zu buchen oder zu kaufen ?
Tabelle 15: Umsteigebereitschaft auf zweisitzige Kleinwagen
Tabelle 16: Beurteilung des Verkehrsaufkommens, der Benzinpreise und der Betriebskosten je (Auto-)Mobilitätstyp
Tabelle 17: Sehe ich nicht als vollwertiges Auto an
Tabelle 18: Ist lustig anzusehen
Tabelle 19: Ist mir zu klein
Tabelle 20: Würde ich mir kaufen
Abkürzungsverzeichnis
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
1. Einführung und methodischer Aufbau
In allen Lebensbereichen - Arbeit und Freizeit - wollen und müssen wir heute mobil sein. Mobilität betrifft somit alle ganz unmittelbar und findet deshalb ein hohes Maß an öffentlicher Aufmerksamkeit. Die individuelle Mobilität übt seit jeher die größte Faszination unter allen Formen der Mobilität aus. Ihr liegt der menschliche Wunsch zugrunde, selber zu entscheiden, wann, wie und wohin man sich bewegt. Das Automobil wurde im Laufe des 20. Jahrhunderts zum Inbegriff der individuellen Mobilität und zum ständigen Begleiter des Menschen. Es ist ein Produkt, das durch seinen Erfolg eine Industrie geschaffen hat, die als volkswirtschaftliche Schlüsselbranche gilt. Das Automobil gilt allerdings auch, infolge seiner massenhaften Verbreitung, als Verursacher von ökologischen sowie stadt- und raumstrukturellen Schäden. Als zentrale Fragestellung gilt somit für die vorliegende Diplomarbeit, wie Mobilität von den Menschen wahrgenommen wird. Welche Einstellungen haben die Menschen zu den verschiedenen Verkehrsmitteln und was bedeuten diese Einstellungen für die Automobilunternehmen.
Die vorliegende Diplomarbeit gehört einer Reihe von Diplomarbeiten an, die sich mit dem Thema Kaufprozeß und Mobilität beschäftigen. Es handelt sich um jeweils zwei Arbeiten zu den Themen Kaufprozeß und Mobilität, die aus dem von Andersen Consulting initiierten Projekt „The Age of Mobility“ hervorgegangen sind.
Im ersten Teil dieser Arbeit (Kapitel 2 und 3) soll auf die theoretischen Grundlagen zum Thema „Mobilität – Motive, Einstellungen und Verhalten im Hinblick auf Automobile und Mobilität“ eingegangen werden. Im Mittelpunkt dieser Ausführungen steht somit der Begriff Mobilität. Um allerdings zunächst einmal einen Überblick über das Thema zu erhalten, wird im Vorfeld auf die aktivierenden Prozesse des Konsumentenverhaltens, Emotion, Motivation und Einstellung und auf Grundlagen der Marktsegmentierung eingegangen. Im Anschluß daran wird der Begriff Mobilität definiert, die verschiedenen Formen der Mobilität dargestellt, sowie ein Modell zur Erklärung des Mobilitätsverhaltens präsentiert. Danach soll ein Überblick über die Faktoren gegeben werden, die das Mobilitätsverhalten beeinflussen. Im Anschluß daran wird auf das Automobil, insbesondere auf Kleinwagen, im Sinne einer Leitbilduntersuchung eingegangen.
Im zweiten Teil (Kapitel 4) dieser Arbeit werden aus dem theoretischen Teil heraus Hypothesen formuliert, operationalisiert und daraus ein Fragebogen entwickelt. In diesem Zusammenhang wird auch das Untersuchungsdesign vorgestellt.
Der dritte Teil (Kapitel 5) stellt die Ergebnisse der Feldarbeit dar und soll die zuvor aufgestellten Hypothesen auf ihre Richtigkeit überprüfen.
Im vierten Teil (Kapitel 6) wird auf Folgerungen aus dieser Untersuchung unter Berücksichtigung der Automobilwirtschaft eingegangen.
2. Theoretische Grundlagen
2.1 Emotion, Motivation und Einstellung
Emotion, Motivation und Einstellung sind komplexe aktivierende Prozesse. Diese aktivierenden Prozesse werden als menschliche Antriebskräfte verstanden. Sie sind dafür verantwortlich, daß Verhalten zustande kommt.[1]
Emotionen sind innere Erregungsvorgänge, die als angenehm oder unangenehm empfunden und mehr oder weniger bewußt erlebt werden. Motivationen sind Emotionen (und Triebe), die mit einer Zielorientierung in bezug auf das Verhalten verbunden sind. Der Motivation liegen grundlegende Motive des Menschen zugrunde. Man unterscheidet Primärmotive[2] (physiologische Motive) und Sekundärmotive[3] (soziale Motive). Einstellungen sind Motivationen, die mit einer kognitiven Gegenstandsbeurteilung bzw. einer Haltung gegenüber einem Gegenstand (einem Produkt, einer Marke, einer Firma, usw.) verknüpft sind. An den Formulierungen der Definitionen kann man erkennen, daß die drei Begriffe aufeinander aufbauen und eine zunehmende kognitive Anreicherung der Antriebsprozesse anzeigen. Als vierten Begriff in der Reihe kann man die Verhaltensabsicht nennen. Dies bedeutet, daß sich aus einer bestimmten Einstellung meist die Absicht ergibt, etwas zu tun (z.B. Kaufabsicht). Dies ist auch der Grund, warum der Einstellungsbegriff für das Marketing so bedeutsam ist. Aus der Verhaltensabsicht schließlich leitet sich das eigentliche Verhalten ab.
Das tatsächliche Verhalten, z.B. die Kaufabsicht, wird jedoch nicht nur von der Einstellung bzw. der daraus resultierenden Verhaltensabsicht bestimmt, sondern es spielen auch die situativen Rahmenbedingungen (die finanzielle Ausstattung, der Preis, der Händler, die Zeit, usw.) eine wichtige Rolle. Zudem haben sowohl die Ausprägung (positiv bzw. negativ) als auch die Stärke (Intensitätsgrad) der Einstellung einen Einfluß auf das tatsächliche Verhalten. Damit drückt die Einstellung eine gewisse Wahrscheinlichkeit aus, sich in einer bestimmten Weise zu verhalten. Das heißt, eine positive Einstellung ist meist eine notwendige, selten aber eine hinreichende Bedingung für das Verhalten.
Dieser geschilderte Zusammenhang „Einstellungen bestimmen das Verhalten“ wird in der Literatur durch die E-V-Hypothese ausgedrückt.
2.2 Marktsegmentierung
Unter einer Marktsegmentierung versteht man eine Aufteilung des Gesamtmarktes in einzelne Käufergruppen. Zweck der Marktsegmentierung ist die Strukturierung von Nachfragergruppen und die Erhöhung der Markttransparenz. In der Gesamtheit weisen die Käufer erhebliche Unterschiede bezüglich verschiedener Merkmale auf. Daher sollten die Segmente in sich möglichst homogen und untereinander möglichst heterogen sein (vgl. Wöhe, G., 1993, Seite 660).
Im Rahmen des Konsumentenverhaltens beim Automobilkauf sollen hier die abnehmerbezogenen Segmentierungskriterien kurz erläutert werden. Diese teilen sich in die objektiven und die subjektiven Segmentierungskriterien (siehe Abb. 01).
Zu den objektiven Kriterien gehören die soziodemographischen Kriterien, zu denen die demographischen[4], sozioökonomischen[5] und geodemographischen[6] Kriterien gezählt werden. Des weiteren werden die Kriterien des beobachtbaren Kauf- und Informationsverhaltens dazugezählt. Dazu gehört die Kaufintensität, die Marken- und Produktartenwahl, die Wahl des Händlers und/oder der Einkaufsstätte, sowie die Mediennutzung und das Informationsverhalten. Die objektiven Kriterien lassen sich direkt über Befragung und/oder Beobachtung der Konsumenten ermitteln (vgl. Heise, G. 1997, Seite 192).
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb.: 01, Quelle: Eigene graphische Darstellung in Anlehnung an: Heise, G., 1997, Seite 193
Neben diesen objektiv feststellbaren Merkmalen und beobachtbaren Verhaltensweisen der Konsumenten können subjektiv erlebte Produkteigenschaften und damit verbundene Nutzenerwartungen sowie die Persönlichkeit der Menschen selbst als Segmentierungskriterien genutzt werden. Mit diesen subjektiven Segmentierungskriterien, die auch als psychographische[7] Kriterien bezeichnet werden, können die Nachteile soziodemographischer Kriterien überwunden werden (vgl. Heise, G., 1997, Seite 217 f.).
Zu den wichtigsten psychographischen Segmentierungskriterien gehören die Personality-Segmentierung, d. h. die Segmentierung nach Persönlichkeitsmerkmalen wie Motiven, Einstellungen und Werten, die Preference- oder Perceptual-Segmentierung, d. h. die Segmentierung nach Wahrnehmungen, Präferenzen und Kaufabsichten sowie die Benefit-Segmentierung nach Nutzenerwartungen und die Life-Style-Segmentierung nach Lebensgewohnheiten des Konsumenten (vgl. Böhler, H. 1977, Seite 84f). Die subjektiven Kriterien sind nicht direkt und eindeutig zu erheben, sondern müssen über Hilfskonstrukte erfaßt werden (z. B. über AIO-Statements[8] in der Life-Style-Segmentierung) (vgl. Heise, G., 1997, Seite 192).
Die subjektiven psychographischen Kriterien geben ein deutlich plastischeres und umfassenderes Bild vom Konsumenten, als es die objektiven sozioökonomischen und soziodemographischen Kriterien vermögen (vgl. Heise, G., 1997, Seite 315).
3. Themenspezifische Grundlagen
3.1 Mobilität und Verkehr
3.1.1 Definition des Begriffs Mobilität
Der Begriff Mobilität geht auf das lateinische Wort „mobilitas“ zurück und kann mit „Beweglichkeit“ frei übersetzt werden; in welcher Weise und mit welcher Technik diese Beweglichkeit erreicht wird, ist begriffstechnisch offen (vgl. Canzler, W. / Knie, A., „Möglichkeitsräume“, 1998, Seite 30). Mobilität bezeichnet die Beweglichkeit in einem möglichen Raum, der durch verschiedene Dimensionen begrenzt wird. Diesen Raum nennen Canzler, W. und Knie, A. Möglichkeitsraum (ebenda).
Im Kern handelt es sich bei dem Begriff Mobilität also um die Beweglichkeit in Form der Fähigkeit zur Bewegung, nicht jedoch um die Bewegung an sich. Im alltäglichen Sprachgebrauch wird der Begriff Mobilität allerdings meist als Bewegung gebraucht und auch verstanden. Die Bedeutung von Mobilität wird somit mit der Nutzung der Fähigkeit zur Bewegung, also mit dem „Bewegen“ und dem daraus resultierenden Ergebnis, dem Verkehr verwechselt.[9]
Verkehr sollte man allerdings von Mobilität abgrenzen. Wenn Mobilität die Beweglichkeit in möglichen Räumen ist, dann ist Verkehr die Beweglichkeit in konkreten Räumen (vgl. Canzler, W. / Knie, A., „Möglichkeitsräume“ 1998, Seite 11)
3.1.2 Formen der Mobilität
Präzisiert man die eingangs erwähnte Definition, ergibt sich folgendes Bild: der erwähnte Möglichkeitsraum ist mehrdimensional ausgelegt. Die eine Dimension ist die geographische oder horizontale Beweglichkeit, die andere die soziale oder vertikale Beweglichkeit. Soziale Mobilität bezieht sich auf die Beweglichkeit der Individuen innerhalb der Gesellschaftsschichten, räumliche Mobilität in erster Linie auf den Wohnortwechsel der Individuen. Mobilität bezeichnet aber auch jede räumliche Veränderung der Individuen (Schmucki, B., 1999, Seite 97 f.). Bei der sozialen und räumlichen Mobilität handelt es sich um Ausprägungen der Mobilität in klassischer Sicht.
Eine neuartige Ausprägung des Begriffs Mobilität, die in den letzten Jahren an Bedeutung gewonnen hat oder vielmehr zu den bisherigen hinzugekommen ist, ist die virtuelle Mobilität. Unter virtueller Mobilität versteht man die Fähigkeit zur Bewegung in virtuellen Räumen und somit in (weltweiten) Datennetzen.
Diese drei Formen der Mobilität, soziale, räumliche und virtuelle sind nicht isoliert zu betrachten. Vielmehr ist davon auszugehen, daß jede einzelne Ausprägung der Mobilität die anderen beeinflußt und steuert. Man kann annehmen, daß es sich um ein zusammenhängendes und abhängiges System handelt. Wenn beispielsweise die soziale Mobilität ansteigt (aus welchen Gründen auch immer) wird sich auch die räumliche bzw. die virtuelle verändern.
Daß sich das Mobilitätsverhalten der Individuen im Zeitablauf überhaupt ändert, ist hingegen bestritten. Die klassische Verkehrsforschung stützt sich auf Ergebnisse der „Kontinuierlichen Erhebung des Verkehrsverhaltens“ (KONTIV), die in drei Erhebungswellen 1976, 1982 und 1989 durchgeführt wurde. Demnach unternehmen wir alle im Durchschnitt täglich etwas mehr als drei Wege, die in der Regel jeweils etwas länger als 20 Minuten dauern. Diese Werte haben sich über die Zeitachse nicht verändert (vgl. Petersen, R.; Schallaböck K. O., 1995, Seite 67 f.). Was sich allerdings verändert hat, sind die in dieser Zeit zurückgelegten Entfernungen und – bei stabilem Zeitbudget – die Geschwindigkeiten.
Canzler, W., Knie, A., Rammler, S., und andere Vertreter der sozialwissenschaftlichen Verkehrsforschung halten hingegen die Aussagen der klassischen Verkehrsforschung über die Beständigkeit des Verkehrsverhaltens für wenig real. Als Gründe für diese Aussage führen Canzler, W. und Knie, A. in ihrem Buch „Möglichkeitsräume“ (1998) zum einen empirische Fehler bei der Erhebung der Daten an und zum anderen verweisen sie auf die sozial- und kulturgeschichtlichen Veränderungen der Gesellschaft im Zeitablauf.[10]
3.1.3 Erklärungsmodell des Mobilitätsverhaltens
Den Abschluß dieses Kapitels soll ein allgemeines Erklärungsmodell bilden, das tiefere Einblicke in die Ursachen des Mobilitätsverhaltens gewähren soll. Wenn man vom wissenschaftstheoretischen Postulat des Kausalprinzips („alles hat eine Ursache“) ausgeht, müssen sich auch für das Mobilitätsverhalten Bedingungen und Gründe finden lassen, die für die Verhaltensunterschiede bezüglich der Mobilität in verschiedenen Bevölkerungsgruppen verantwortlich sind. Das Mobilitätsverhalten stellt genau genommen ein „Handeln“, ein sinnhaftes „Sich-Verhalten“ im soziologischen Sinne dar. Dieses wird nicht nur durch äußerliche oder strukturelle Bedingungen, den objektiven Bestimmungsfaktoren (Infrastruktur, Alter, Siedlungsstruktur, usw.), sondern auch von subjektiven Gegebenheiten beeinflußt und gesteuert. In der Mobilitätsforschung wird diesen internalen, also subjektiven Bestimmungsfaktoren (Motive, Wertvorstellungen, Präferenzen, usw.) bisher jedoch relativ wenig Rechnung getragen. Dies liegt daran, daß subjektive Bestimmungsfaktoren nur schwer zu erfassen sind.
Nach Büschges, G. (1993), kann der Einfluß von objektiven und subjektiven Faktoren auf das Mobilitätsverhalten wie folgt beschrieben werden: Die objektiven Bedingungen bestimmen die Handlungsmöglichkeiten des Individuums (z.B. der Besitz eines Führerscheins als Voraussetzung für die PKW-Nutzung). Die subjektiven Bedingungen hingegen steuern die Auswahl der konkreten Handlung aus der Menge der verbleibenden Alternativen. Die Handlungen, von denen hier die Rede ist, sind Ortsveränderungen, also z.B. die Fahrt mit dem Auto zur Arbeit. Bereits aus diesem Beispiel wird deutlich, daß eine Ortsveränderung in der Regel durch eine andere Handlung (hier: Arbeiten) hervorgerufen wird. Diese Handlung wiederum ist ihrerseits von den oben erwähnten objektiven und subjektiven Größen abhängig. Diese die Ortsveränderung auslösende Handlung (Arbeiten) wird als Aktivität bezeichnet. Die folgende Grafik soll diese Zusammenhänge noch einmal veranschaulichen. Demnach kann ein Grundmodell des Mobilitätsverhaltens folgendermaßen aussehen:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 02, Quelle: Eigene graphische Darstellung in Anlehnung an: Hauntzinger, H., Pfeiffer, M., (1996), Seite 13
3.2 Determinanten des Mobilitätsverhaltens
3.2.1 Technologische Faktoren
Technologie determiniert das Mobilitätsverhalten unserer Gesellschaft in entscheidender Weise. In diesem Zusammenhang soll hier exemplarisch auf die technologische Entwicklung „Automobil“ eingegangen werden, da „das Automobil die räumliche Mobilität des Menschen (...) in einem Ausmaß gesteigert hat, wie dies vor einem halben Jahrhundert noch nicht vorauszuahnen war.“ (Schmucki, B., 1999, Seite 98 f.). Daneben wird der Einfluß der neuen Medien (I+K Technologien) auf unser Mobilitätsverhalten kurz diskutiert.
Das Automobil brachte in seiner ersten Entwicklungsphase noch keine Revolution der Mobilität mit sich. Vielmehr war es ein Prestigesymbol und Ausdruck sozialer Differenzierung. Erst mit den Möglichkeiten der Fließbandproduktion von Henry Ford und der damit verbundenen Kostenreduktion kam es zu einer massenhaften Verbreitung. Natürlich ist nicht alleine die Fließbandproduktion für den Erfolg des Automobils verantwortlich, sondern eine ganze Reihe von technischen Innovationen, „so etwa (...) die Erfindung des Luftreifens von Dunlop (1890), die Erfindung des Spritzdüsenvergasers von Maybach, die Entwicklung der Kerzenzündung durch Bosch oder die Erfindung eines zweiten Verbrennungsmotors, des (...) Dieselmotors durch Rudolf Diesel (1893)“ (Feldhaus, S., 1998, Seite 181). Seitdem ist fast nichts mehr gleich geblieben. Die Strukturen der Siedlungen, die Strukturen unseres Lebens, der Wirtschaft, wie auch der Wertesysteme der Menschen und der Gesellschaft haben sich in einer Art verändert, wie es unvorstellbar schien.[11]
Neben diesen strukturellen Veränderungen hat das Automobil auch unsere Mobilität verändert. Wer ein Auto benutzt, spart pro Zeiteinheit - im Vergleich zum Zufußgeher - mindestens die Hälfte der Körperenergie ein. Laut Knoflacher H., 1999 Seite 122 ff. ist in erster Linie diese Energieeinsparung für den Erfolg des Automobils verantwortlich. Ein weiterer Aspekt, der schon in Kapitel 3.1.2 kurz erwähnt wurde, ist die zurückgelegte Entfernung, die die Erfindung des Automobils mit sich gebracht hat. Vor 50 Jahren wären heutige durchschnittliche Jahreskilometerleistungen wohl nicht denkbar gewesen. Auch heute als ganz alltäglich angesehene Aktivitäten, wie der regelmäßige Besuch bei der auf dem Lande lebenden Oma, die regelmäßigen Fahrten zum Wochenendhäuschen, die Besuche des weit entfernt liegenden Spaßbades anstelle des fußläufig erreichbaren Schwimmbades, usw. wären ohne Auto nicht machbar (vgl. Knie A., 1999, Seite 131 f.). Diese Aktivitäten sind nicht nur ohne Auto nicht möglich, sondern werden in erheblichem Maße auch vom Auto erzeugt. Das Auto hat laut Knie A., 1999, Seite 131 einen „Kuckucks-Charakter“ der sich aus einer pay-and-drive-Logik, einer nahezu unendlichen Verfügbarkeit und dem vergleichsweise bequemen Handling in einer einheitlichen Systemwelt zusammensetzt. Zusammengefaßt heißt das, daß durch die relativ hohen Anschaffungskosten und durch den hohe Fixkostenblock aus Versicherung, Wartung, Treibstoff und Wertverlust, das Automobil über eine eingebaute Nutzungsdynamik verfügt (vgl. ebenda).
Allerdings muß man sich vor dem Hintergrund steigender Benzinpreise, dem immer höher werdenden Verkehrsaufkommen in Form von Verkehrsstaus und knappem Parkraum die Frage stellen, wann dieser „Kuckucks-Charakter“ kippt. Steigen wir ab einer bestimmten Verkehrsdichte bzw. ab einem bestimmten Kostenniveau auf andere Verkehrsmittel um?
Zusammenfassend läßt sich das Auto folgendermaßen beschreiben: Das Automobil ist ein technisches Instrument, das seinem Nutzer zusätzliche Handlungs-möglichkeiten eröffnet. Es erweitert durch seine freie Verfügbarkeit das Spektrum potentieller Aktivitäten und dehnt den individuellen Möglichkeitsraum aus.[12]
Momentan erleben wir eine weitere Veränderung der Möglichkeitsräume. Während wir früher „mit dem Finger auf der Landkarte“ oder mittels Reiseführer fremde Kulturen entdeckten, verschaffen wir uns heute mittels der modernen
I+K Technologien unmittelbaren Zugang zu fremden Kulturen und Räumen.
Unsere Vorstellungsräume wachsen momentan drastisch, und zwar von jedem möglichen Platz der Erde aus. In diesem Zusammenhang ist zu vermuten, daß bei weiteren Wachstumsschüben, besonders des Internets, die Trennschärfe zwischen möglichen und konkreten Räumen nachläßt.[13] Hieran schließt sich unweigerlich die Frage: Kann durch virtuelle Bewegung tatsächlich Verkehr reduziert werden oder tritt sogar das Gegenteil ein? Treibt die technische Erweiterung der Möglichkeitsräume die Wünsche nach physischer Mobilität an oder werden wir durch virtuelle Mobilität zu Personen, die ihre Umwelt in den eigenen vier Wänden am PC erfahren?
3.2.2 Politische Faktoren
Daß, und wie das Automobil unsere Mobilität verändert hat, ist nun hinreichend beschrieben. Warum aber gerade das Auto und nicht irgendein anderes Verkehrsmittel unsere Mobilität verändert hat, ist allerdings noch nicht geklärt.
Für die massenhafte Verbreitung besonders in der Anfangsphase des Automobils ist in erster Linie der Staat verantwortlich. „In der Anfangsphase des bundesdeutschen Automobilismus war der Nationalstaat der wichtigste proaktive Akteur, er betrieb ungeachtet aller wirtschaftspolitischen Bekenntnisse mit den Mitteln der Steuer- und Infrastrukturpolitik eine Industriepolitik für das Auto.“ (Canzler, W., „Das Zauberlehrlings-Syndrom“, 1996, Seite 107). Seit Mitte der 50er Jahre umfaßte diese politisch-administrative Forcierung des Autos eine Fülle von Maßnahmen und Elementen, die nachfolgend in Ausschnitten beschrieben werden sollen.
Seit dem 01.Januar 1995 trat eine steuerliche Änderung in Kraft, die bis heute eine zentrale Rolle für die private Nutzung von Kraftfahrzeugen spielt: die Einführung der steuerlich abzugsfähigen Kilometerpauschale für Fahrten zwischen Wohnort und Arbeitsstätte. Damit begann eine indirekte Subventionierung der privaten Autonutzung, die vorher nur gewerblichen Nutzern zugute kam (vgl. ebenda). Im gleichen Jahr wurde die Besteuerung umgeschichtet, indem die KFZ-Steuer gesenkt und die Mineralölsteuer moderat angehoben wurde. Diese Umschichtung hatte zur Folge, daß die variablen Kosten zugunsten der fixen stiegen und „in erster Linie den Güterverkehr verteuerten“ (ebenda). Die Einnahmen wurden für den Ausbau der Verkehrsinfrastruktur verwendet. Grundlage dieser Maßnahme war das ebenfalls 1955 verabschiedete Verkehrsinfrastrukturgesetz. Neben diesen Maßnahmen erfolgte ab Mitte der 50er Jahre eine Fülle weiterer politischer Maßnahmen zur Förderung des Autos wie etwa das Gesetz über den Ausbauplan für die Bundesfernstraßen (1957), das Straßenbaufinanzierungsgesetz (1960) und unter anderem der Leber-Plan (1968 – 1972). Mit dem Leber-Plan (benannt nach Verkehrsminister Leber) verpflichtet sich die Politik selber zu einer Schaffung gleicher Mobilitätsverhältnisse in Deutschland, was nichts anderes heißt als „das Auto und die Autobahn für alle“ (ebenda, Seite 115).
Heute ist das Auto allgegenwärtig und es hat eine Verbreitung erreicht, die man als Massenmotorisierung bezeichnen kann. An diesem Zustand ist zum großen Teil der Staat durch fiskal- und verkehrspolitische Maßnahmen verantwortlich.
Gerade in der momentanen Diskussion um die neu eingeführte Ökosteuer und der damit verbundenen Verteuerung der fossilen Brennstoffe wird wieder der Ruf nach dem Staat laut und wirft folgende Frage auf: Ist der Automobilismus mit staatlichen Eingriffen zurückzudrehen (oder nur anzukurbeln), steigt der PKW-Fahrer bei fiskalisch bedingten Kostenerhöhungen auf andere Verkehrsmittel um oder führt die Erhöhung der Kosten bei solchen staatlichen Eingriffen eher zu einer Mobilisierung der Massen in Form von Demonstrationen und Blockaden, wie zuletzt geschehen?
3.2.3 Wirtschaftliche Faktoren
Die wirtschaftliche Entwicklung beeinflußt das Mobilitätsverhalten unserer Gesellschaft in besonderem Maße. Exemplarisch sollen in diesem Kapitel einige Ausprägungen und Größen dieser wirtschaftlichen Entwicklung skizziert werden.[14]
Unternehmen, Behörden, Einkaufszentren usw. sind wesentliche Elemente der Siedlungsstruktur und „ziehen“ entsprechend Arbeits-, Einkaufs- und Freizeitwege an. Ökonomische Strukturentwicklungen, wie etwa die Standortverteilung der Betriebe, haben daher einen wesentlichen Einfluß auf das Verkehrsverhalten. Wenn beispielsweise immer mehr Unternehmen (z.B. Einkaufszentren) aus wirtschaftlichen Gründen auf die „grüne Wiese“ umziehen, weil etwa die räumliche Erweiterungsmöglichkeit fehlt, die Mieten zu hoch sind oder aber wegen einer im Innenstadtbereich verschlechterten Erreichbarkeit mit Individualverkehrsmitteln, so kann dies zu erhöhtem Verkehrsaufkommen durch Zunahme der Wegelängen führen. Die zudem meist schlechtere ÖV-Anbindung solch peripherer Einrichtungen (z.B. Gewerbegebiete) sorgt für einen zusätzlichen Anstieg des PKW-Anteils bei den entsprechenden Wegen. Die Unternehmen ihrerseits erzeugen auch Verkehr durch den Transport von Waren und Gütern, aber auch durch erhöhten Personenverkehr, z.B. in Form von Dienst- und Geschäftsreisen. Gerade innerhalb des reiseintensiven Dienstleistungssektors ist dies zu beobachten. Weitere Treiber des Wirtschaftsverkehrs sind sicherlich in der räumlichen Ausdehnung der Absatzgebiete sowie in der zunehmenden Verflechtung der Unternehmen untereinander zu sehen.
Auch die zunehmend arbeitsteilige Entwicklung der Wirtschaft im europäischen Raum, die durch den europäischen Einigungsprozeß sowie die Öffnung nach Osten mit besonders starker Dynamik abläuft, bewirkt einen erhöhten Mobilitätsbedarf (vgl. Rothengatter, W., 1993, Seite 94). Marktzugangsbarrieren fallen, politische Grenzen verschwinden oder werden durchlässiger, und die Macht der weltweiten Bilder wächst in und mit den elektronischen Medien. In den entstehenden Großwirtschaftsräumen EU (Europäische Union), NAFTA (North American Free Trade Area) oder ASEAN (Association of South East Asian Nations) erschweren wegfallende Zölle oder Währungsschwankungen immer weniger den Handel. Politisch kann sich kein Land „straflos“ abschotten, und kulturell ist die Erde schon längst die „one world“, die auf dem Rio-Gipfel 1992 beschworen wurde. Welche Konflikte und Probleme es im Zuge der Globalisierung noch geben wird, ist ungewiß. Gewiß ist aber, daß der Verkehr von Personen, Gütern und Informationen dynamisch steigen wird. Raumwiderstände werden kleiner. Globalisierung ist eine Einladung für mehr Gütertransporte, Ausbildungsaustausch und Tourismus. Sie ist aber noch mehr, nämlich der weltweite Triumph des westlichen Wirtschafts-, Lebens- und Konsummodells. Und das bedeutet, verkehrstechnisch gesehen, den Triumph des Automobils (vgl. Robertsen, S., 1992, o. S., Altvater, E. / Mahnkopf, B., 1996, o. S., Held, D., 1997, o. S.)
Auch die Arbeits-, Urlaubs- und Öffnungszeiten spielen eine wesentliche Rolle bei der Verkehrsnachfrage und Belastung der Verkehrsinfrastruktur. So bewirken feste Öffnungszeiten von Läden oder Behörden, die Parallelisierung der Arbeitszeiten oder auch das weitgehende Arbeitsverbot an Sonn- und Feiertagen eine beträchtliche Konzentration von Aktivitäten zu bestimmten Tageszeiten oder an bestimmten Wochentagen und damit eine entsprechende Konzentration des Verkehrsaufkommens. Die Folge ist eine vielfache Überbelastung der Infrastruktur zu diesen Zeiten.
Ein weiterer Faktor, der Einfluß auf das Mobilitätsverhalten hat, sind die steigenden Mobilitätsansprüche, insbesondere im Freizeit- und Urlaubsverkehr.[15] Für die Vergangenheit läßt sich sagen, daß die verfügbaren Einkommen und privaten Konsumausgaben in den letzten Jahrzehnten stark angestiegen sind. Mit steigendem Wohlstand hat sich innerhalb der privaten Konsumstruktur eine deutliche Verschiebung der Ausgabenanteile von den Grundbedürfnisgütern (z.B. Nahrungsmittel) zugunsten des sogenannten „gehobenen“ oder „freien“ Bedarfs (z.B. Automobil) ergeben.
Die Abnahme der Tages-, Wochen- und Lebensarbeitszeiten und die damit verbundene Zunahme der Freizeit hat zu einem Bewußtseinswandel in der Bevölkerung geführt. Bei einem gleichzeitigen Anwachsen der Einkommen ist der Drang zu einer sinnvollen Freizeitgestaltung gestiegen (Urlaubsreisen, Ausflüge, Freizeitaktivitäten, usw.). Dies hat zur Folge, daß die Aktivitätenanzahl und somit die räumliche Mobilität ansteigt.
Neben dieser rein quantitativen Zunahme von Freizeit gibt es auch einen qualitativen Aspekt des Verhältnisses Arbeit und Freizeit. Freizeit nimmt zwar dem Umfang nach zu, aber die Arbeitnehmer müssen sich aufgrund wirtschaftlicher Erfordernisse auch immer mehr mit differenzierten Arbeitszeitmodellen (Schicht-, Nacht-, Tele- und Wochenarbeitszeiten - allgemein flexiblere Arbeitszeiten) auseinandersetzen. Zum einen wird durch die Differenzierung der Arbeitszeiten (auch Gleichzeit) sowohl die Bildung von Fahrgemeinschaften als auch die Nutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln erschwert, da deren Nutzung mancherorts am Wochenende oder in der Nacht nur unzureichend ist (vgl. Hildebrand, E., Hielscher, V., 1998, o. S.), und zum anderen haben diese Arbeitszeitmodelle auch Auswirkungen auf die Freizeit. Wer nachts arbeitet, hat tagsüber frei, wer am Wochenende arbeitet, hat unter der Woche frei („Rund-um-die-Woche-Gesellschaft). Die Gelegenheit, Freizeit mit der Familie oder Bekannten zu verbringen, wird erschwert, es müssen individuelle Lösungen gefunden werden, was zu einer wiederum erhöhten Nachfrage nach Mobilität führen kann. Allerdings könnte ein Fortschreiten dieser Entwicklung auch zu einer gleichmäßigeren Auslastung der Verkehrsinfrastruktur führen.
3.2.4 Gesellschaftliche Faktoren
Abschließend soll in diesem Kapitel auf den Trend zur Individualisierung und den Wertewandel eingegangen, und die Folgen auf unser Mobilitätsverhalten kurz erläutert werden.
Unter Individualisierung versteht man eine abnehmende Bindung des einzelnen an Familie, Kollegen, Nachbarschaft und andere längerfristige verbindliche Sozialgefüge. Die Konsequenz davon ist, daß die traditionellen Normalbiographien von Frauen und Männern immer variantenreicher werden und öfters Phasen eines kürzeren oder längeren Alleinseins enthalten (vgl. Hautzinger, H., Peiffer, M., Tassaux-Becker, B., 1994, Seite 66). Dieser Individualisierungsschub führt zu einer Zunahme von Ein- und Zweipersonenhaushalten und somit zu einer Zunahme von Haushalten insgesamt. Es kommt also durch eine Verkleinerung der Haushalte zu einem Anstieg der Haushalte insgesamt und somit zu einer steigenden Motorisierung.
Aber auch die steigende Anzahl von alleinstehenden Frauen, deren PKW-Ausstattung bisher unterdurchschnittlich ist, aber stark anwachsen wird (vgl. Hautzinger, Peiffer, Tassaux-Becker; 1994, Seite 66), führt zu einer erhöhten Nachfrage an Mobilität. Ein weiterer Aspekt ist der, daß Alleinstehende in ihren Wohnungen nur eingeschränkt soziale Kontakte haben und somit diese außerhalb der eigenen vier Wände suchen müssen.[16]
Neben der Individualisierung hängt das Verkehsrverhalten auf gesellschaftlicher Ebene von persönlichen Werthaltungen und sozialen Normen ab. In diesem Zusammenhang wird häufig die postmaterialistische Theorie des Wertewandels von R. Inglehart (1977) herangezogen.[17] Sie besagt, daß in Gesellschaften, in denen die ökonomischen Bedürfnisse größtenteils erfüllt sind, materielle Werte (Leistung, Fleiß, Bescheidenheit, Enthaltsamkeit, usw. ) mehr und mehr durch postmaterialistische Werte (Selbstverwirklichung, Abenteuer, Spannung, Abwechslung, usw.) verdrängt werden. Im allgemeinen kann man diesen Wandel auch als Erlebnisorientierung, „...als Wechsel von einer außenorientierten, auf Existenzsicherung bedachten hin zu einer innenorientierten Lebensweise ...“[18] bezeichnen. In den westlichen Industrienationen und somit auch in Deutschland dürfte ein solcher Zustand erreicht sein. Dieser Wertewandel führt – neben der gestiegenen Freizeit und dem gewachsenen Wohlstandsniveau – zu einem Anstieg des Freizeit- und Einkaufsverkehrs, da die Erlebnisorientierung zu einer verstärkten Nachfrage nach Freizeitaktivitäten führt. Diese Freizeitaktivitäten, egal ob in der freien Natur oder als Erlebniseinkauf, sind meist mit Bewegung in konkreten Räumen verbunden.
3.3 Das Automobil-Leitbild
3.3.1 Definition des Leitbildbegriffs
„Leitbilder bezeichnen Verständigungsprozesse mit hoher Verbindlichkeit und kollektiver Projektionskraft, die für die Träger sinnstiftende Funktionen bieten; sie repräsentieren mit ihrer Bildfunktion den als legitim angesehenen Wissens- und Erkenntnisstand und stecken mit ihrer Leitfunktion die Orientierungsmarken für die Nutzungs- und Verwendungsphase ab, wobei sie der Nutzung einer Technik einen gesellschaftlich gültigen Sinn zuweisen“ (Canzler, W. / Knie, A. / Berthold, O., 1993, Seite 412) .
Der Leitbildbegriff stammt aus der sozialwissenschaftlichen Technikgeneseforschung. Die Technikgeneseforschung will die Entstehung von Technik systematisch analysieren, um die Folgen dieser bestehende Techniken im voraus abzuschätzen (vgl. Canzler, W., „Das Zauberlehrlingssyndrom“, 1996, Seite 58 ff.). Bei dieser Analyse werden immer wieder Leitbilder aufgedeckt, die eine zentrale Rolle in diesem Entstehungsprozeß einnehmen. So hat sich die Technikgeneseforschung im Bereich des Verkehrs bislang mit der technischen und sozialen Konstruktion des Automobils beschäftigt und dabei die zentrale Rolle und Beharrungskraft spezifischer Technikleitbilder aufgedeckt, wie etwa das Leitbild der Rennreiselimousine (vgl. Canzler, W. / Knie, A., „Das Ende des Automobils“, 1994, o.S.) Im weiteren soll auf das Leitbild der Rennreiselimousine genauer eingegangen werden.
3.3.2 Die Rennreiselimousine
Die Vorstellungen der Menschen, die mit dem Begriff Auto assoziiert werden, ähneln sich sehr und implizieren neben einer weitgehenden einheitlichen äußeren Form auch Elemente wie vier Räder, ein Lenkrad und den Auspuff. Wohl kein anderes technisches Artefakt dürfte mit solchermaßen konvergenten bildlichen Repräsentationen bei den meisten Menschen verbunden sein wie das Automobil. Die individuellen Vorstellungen darüber, was ein Automobil ist, wie es aussieht und was es mindestens leisten soll, sind in nahezu allen Regionen und Kulturen sehr ähnlich (vgl. Canzler, W., „Das Zauberlehrlingssyndrom“, 1996, Seite 68). Mit der Wortschöpfung Rennreiselimousine werden diese technischen Basisanforderungen an ein Automobil begrifflich ausgedrückt. Es werden die Begriffe Rennwagen mit denen der Reise und der Limousine zusammengeführt. Daraus kann man vier Bedingungen ableiten, die sich auch in den Aufgaben- und Pflichtenheften der Auto-Ingenieure wiederfinden, und ein vollwertiges Auto auszeichnen:
- hohe Endgeschwindigkeit: Spitzengeschwindigkeiten von über 160 km/h gelten als Maßstab
- gute Beschleunigung: das Fahrzeug soll von 0 auf 100 km/h in höchstens 15 Sekunden beschleunigt werden können
- angemessene Reichweite: hier gelten zur Zeit 500 km als Richtwert
- und ein Platzangebot für mindestens vier Personen sowie Zulademöglichkeiten für Gepäck.[19]
Dieses Anforderungsprofil, das eng mit den Eigenschaften des Verbrennungsmotors verbunden ist, durchzieht die Geschichte des Automobilbaus wie ein roter Faden. Es ermöglicht zwar durchaus verschiedene Spielarten in der Fahrzeuggestaltung; Kombis, Großraumlimousinen und Geländewagen, die nach den gleichen Anforderungen konstruiert werden; allerdings wirkt das Entwicklungskonzept der Rennreiselimousine wie ein Veto, sobald eines oder mehrerer seiner Essentials nicht erreicht werden oder technische Kernelemente für ihre Umsetzung fehlen (vgl. Canzler, W., 1999a, „Zur Adoption freigegeben: Verkehrstelematik und die Zukunft des Autoverkehrs“, Seite 73). Aus diesem Grund hatten alternative Antriebe bislang keine reelle Chance, die Kriterien eines „vollwertigen Autos“ gemäß der skizzierten Mindestanforderungen zu erfüllen (ebenda). Knie, A. / Berhold, O., (1995), Seite 4, verbinden mit dem geäußerten Sachverhalt - die Änderung an der technischen Grundkonfiguration - einen unweigerlichen Verlust des Begriffs Automobil.
Zusammenfassend läßt sich folgendes festhalten: das Leitbild der Rennreiselimousine legt fest was ein Auto zu leisten hat und wie es auszusehen hat. Wenn ein Auto mindestens eine Bedingung des Leitbilds nicht erfüllt, ist es kein Auto bzw. keine Rennreiselimousine mehr. Da das Leitbild sowohl in den Köpfen der Ingenieure als auch in denen der Konsumenten fest verankert ist, werden es neuartige Fahrzeugkonzepte schwer haben, sich auf dem Automobilmarkt durchzusetzen.
Im folgenden Kapitel soll aus diesem Grund kurz die Fahrzeugklasse der Klein- und Kleinstwagen auf ihre Eignung zur Rennreiselimousine untersucht werden.
3.3.3 Der Klein- und Kleinstwagen als Rennreiselimousine
Als Kleinwagen soll in diesem Kapitel der VW Lupo in der TDI-Version als Vertreter der neuen 3-Liter Autos und als Kleinstwagen das Smart City-Coupé als Vertreter des kleinen, auf die individuellen Bedürfnisse zugeschnittenen Stadtautos[20], näher betrachtet werden.
Seit Herbst 1998 schließt der VW Lupo die Lücke im VW-Programm, die durch das Wachsen des Polo entstanden ist. Kurz darauf wurde der Lupo in der Version 3L TDI präsentiert. Dieses Modell war zu diesem Zeitpunkt das einzige in Serie produzierte Auto mit einem Verbrauch von 3 Litern auf 100 km und somit auch das sparsamste Auto der Welt.[21] Diese Sparsamkeit wird durch verschiedene technische Highlights wie die Verwendung von Aluminium bei einigen Karosserieteilen, durch den Einsatz eines speziellen Automatikgetriebes und Dünnglas erreicht. Dementsprechend hoch ist der Preis für dieses Auto. Die moderne Technik muß mit annähernd 30.000 DM erkauft werden. Der Lupo 3L TDI ist dennoch nach den Vorgaben der Rennreiselimousine konzipiert. Er erreicht eine Endgeschwindigkeit von 165 km/h, beschleunigt von 0 auf 100 km/h in 16 Sekunden, erfüllt die geforderte angemessene Reichweite und weist darüber hinaus ein Platzangebot für vier bzw. fünf Personen auf. Der Lupo erfüllt also alle Kriterien der Rennreiselimousine und ist demnach ein vollwertiges Auto.
Das Smart City-Coupé der MCC GmbH ist ebenfalls seit Herbst 1998 auf dem Markt. Allerdings handelt es sich bei diesem Fahrzeug um ein neuartiges Fahrzeugkonzept und nicht nur um ein extrem sparsames Automobil wie der Lupo 3L TDI. Das Smart City-Coupé ist 2,5 Meter lang und verfügt nur über zwei Sitzplätze. Somit ist es das erste in Serie produzierte Auto, das vom Anforderungsprofil der Rennreiselimousine abweicht (vgl. Canzler, W., 1999a, „Zur Adoption freigegeben: Verkehrstelematik und die Zukunft des Autoverkehrs“, Seite 87). Es erfüllt gleich in mehrfacher Hinsicht die geforderten Kriterien nicht. Die Endgeschwindigkeit wird bei 135 km/h elektronisch abgeregelt, die Beschleunigung von 0 auf 100 km/h liegt je nach Motorisierung (30 kw / 33 kw / 40 kw) zwischen 17,5 und 20,8 Sekunden und letztendlich verfügt das Smart City-Coupé nur über zwei Sitzplätze (vgl. Verkaufspropekt MCC Smart GmbH, 2000, Seite 63). Auch die Form ist einzigartig, da im Gegensatz zu herkömmlichen Rennreiselimousinen das sogenannte Frontvolumen, bei dem in konventionellen Autos der Antrieb untergebracht ist, fehlt.[22] Diese Proportionen vermitteln den Eindruck eines Behälters mit maximaler Raumausnutzung, ähnlich wie etwa der klassische Tetrapak (vgl. Bellati, C., 1999, Seite 350). Darüber hinaus löst das scheinbare Fehlen eines Motors in der Allgemeinheit Vorstellungen von alternativen Antriebsarten aus.[23] Der Smart ist somit in keinerlei Hinsicht eine Rennreiselimousine und um der Logik des vorherigen Kapitels zu folgen, muß ein solches Fahrzeug die Bezeichnung Auto verlieren. Die Macher der Einführungskampagne des Smart waren sich dieser Tatsache wohl bewußt.[24] In der sehr aufwendigen Werbe- und Imagekampagne wurde daher der Smart nicht primär als Transportmittel, sondern vielmehr als Lifestyle-Produkt für einen modernen, jugendlichen Alltag in urbanen Räumen konzipiert. Die Leistungsmerkmale eines Autos haben darin keine Rolle gespielt, weder von PS-Stärken noch von Beschleunigungswerten war die Rede (vgl. Verkaufsprospekt MCC Smart GmbH, „reduce to the max“, 1997). Dem Kleinwagen sollte zur eigenen Identität verholfen werden, er sollte die Rennreiselimousine nicht fürchten müssen, da er gar nicht in einen Vergleich mit ihr antrat (vgl. Canzler, W., 1999a, „Zur Adoption freigegeben: Verkehrstelematik und die Zukunft des Autoverkehrs“, Seite 88f). Doch nicht nur das Image und die Produktidentität waren neu: mit dem Kauf des Smart hatte man auch die Möglichkeit eine ganze Reihe von Mobilitätsangeboten, die das zweite Standbein der Einführungskampagne waren, zu erwerben.[25] Trotz oder gerade wegen dieser Werbekampagne blieben die Verkäufe des Smart City-Coupés hinter den Erwartungen zurück. Besonders im Winter 1998/99 sanken sie auf den bisher tiefsten Stand (vgl. Andrikos, A., 1999, Seite 55). Bei der MCC GmbH bestand also Handlungsbedarf. Da kam die Trennung von SMH im April 1999 gerade recht. Als wohl wichtigste Maßnahme wurde die Kommunikation des Smart City Coupés geändert und der Lifestyle zugunsten von harten automobilen Leistungsmerkmalen aufgegeben (vgl. ebenda, Seite 55 f.). Mit dieser Maßnahme hat sich allerdings nicht nur die Kommunikation geändert, sondern vielmehr das ganze Produkt. Seitdem versucht der Smart eine Rennreiselimousine mit Mobilitätsangeboten als Zusatzleistungen zu sein. Folglich muß er auch den Vergleich mit „richtigen“ Autos fürchten. Hier verläßt die MCC GmbH die anfängliche Logik ihrer Kommunikations- und Produktpolitik. Ein Auto, das nach dem Leitbild der Rennreiselimousine kein Auto darstellt, wird nachträglich zu einem solchen gemacht.
Genau in diesem Punkt liegt auch das eigentlich Paradoxe. Die sozialwissenschaftliche Verkehrsforschung mit ihren Vertretern Canzler, Knie, Rammler, usw. propagieren die anfängliche Ausrichtung der Kommunikationspolitik der MCC GmbH mit der damit verbundenen Abkehr von der Rennreiselimousine als die richtige. Knie, A. / Hard, M. schreiben dazu, daß wenn der Smart letztendlich erfolgreich sein wird, dann nur, weil es MCC geschafft hat, die Öffentlichkeit und seine Kunden zu überzeugen, daß der Smart etwas wirklich Neues und nicht nur eine kleine Mercedes A-Klasse ist.[26] Auf der anderen Seite sprechen die Verkaufszahlen eine andere Sprache. Seit der Abkehr vom Lifestyle steigen die Verkaufszahlen des Smart City-Coupés und lagen im Jahr 2000 in einigen Monaten über denen des VW Lupo.[27]
Hieran schließen sich unweigerlich eine Vielzahl von Fragen an: Ist der plötzliche Erfolg des Smart City Coupés auf die Änderung der Kommunikationspolitik zurückzuführen, oder zeigt erst jetzt die anfängliche Kampagne ihre Wirkung? Wie werden zweisitzige Fahrzeuge von potentiellen Kunden wahrgenommen, wird der Smart trotz seiner geringen Größe als vollwertiges Auto bewertet? Kann man durch zusätzliche Mobilitätsdienstleistungen Personen zum Umstieg auf Zweisitzer motivieren und somit fehlende Elemente der Rennreiselimousine ausgleichen?
4. Empirische Untersuchung
4.1 Formulierung und Operationalisierung von Hypothesen
Einstellung und Verhalten (H1) Wenn in einer Gesellschaft die Mobilität vom Auto dominiert wird, dann ist der Zusammenhang zwischen Einstellung und Verhalten bezüglich des Mobilitätsverhaltens gering.
Die Einstellung der Befragten zum Thema Mobilität wird mit Hilfe von 42 Statements zu verschiedenen Verkehrsmitteln ermittelt. Unter Zuhilfenahme einer Clusteranalyse werden Personen in Gruppen zusammengefaßt, deren Antwortverhalten in sich möglichst homogen ist, wobei in die Clusteranalyse 22 Statements zum Thema Auto bzw. Autofahren, 8 Statements zum Thema ÖPNV bzw. Straßenbahn, 7 Statements zum Thema Fahrradfahren und 5 Statements zum Thema Zufußgehen einfließen (vgl. Anhang 1, Fragebogen, Frage 31, 32, 46 bis 48). Bei diesen Statements handelt es sich um Einstellungswerte, die auf Fünfer-Skalen metrisch skaliert sind, wobei die Ausprägung „eins“ einer Zustimmung und die Ausprägung „fünf“ keiner Zustimmung entspricht. Die so ermittelten Mobilitätstypen werden dann hinsichtlich ihres Mobilitätsverhaltens untersucht. Als Indikator für das Mobilitätsverhalten soll die Verkehrsmittelwahl der Befragten dienen. Mit Hilfe der offenen Frage „Welches Verkehrsmittel haben Sie in der letzten Woche an wie vielen Tagen in den folgenden Verkehrssituationen genutzt?“ wird die Verkehrsmittelwahl (Modal Split) abgefragt (vgl. Anhang 1, Fragebogen, Frage 51).
Verkehr
(H2) Wenn Personen das Verkehrsaufkommen (in Form von Verkehrsstaus und Parkplatzproblemen) als hoch empfinden, dann steigen sie eher als andere Personen auf alternative Verkehrsmittel um.
Das subjektiv empfundene Verkehrsaufkommen wird mit der Frage „Wie empfinden Sie das aktuelle Verkehrsaufkommen?“ ermittelt. Die Frage ist auf einer Fünfer-Skala mit den Ausprägungen „sehr hoch“ (1) bis „sehr niedrig“ (5) metrisch skaliert. Mit der Frage 37 (vgl. Anhang 1, Fragebogen) wird die Umsteigebereitschaft abgefragt. Es handelt sich hierbei um eine geschlossene Frage. Als Antwortmöglichkeiten sind für einen Umstieg sieben Alternativen vorgegeben (kleine Fahrzeuge, ÖPNV, zu Fuß gehen, Fahrrad, Bahn, Taxi und keine Umsteigebereitschaft). Mehrfachnennungen sind möglich.
Technik
(H3) Je stärker die Nutzung der I + K Technologien ist, desto geringer wird die
räumliche Mobilität
Bei den Personen, die über einen Internetzugang über PC oder Mobiltelefon verfügen, wird die Nutzungsintensität des Internets mit zwei Fragen untersucht. Bei der ersten handelt es sich um die geschlossene Frage „Wie häufig sind Sie in der Woche online?“. Als Antwortmöglichkeiten kommen „täglich“, „an 4-6 Tagen“, „an 2-4 Tagen“ und „einmal in der Woche“ in Betracht. Ergänzend hierzu ist die zweite Frage zu sehen: “Wie viele Stunden sind das in etwa in der Woche?“ Hierbei handelt es sich um eine offene Frage. Die räumliche Mobilität wird mit dem Statement „Seitdem ich einen Internetanschluß habe, erledige ich viele Dinge von zu Hause aus und erspare mir somit viele Wege“ gemessen. Dieses Statement ist auf einer Fünfer-Skala mit den Ausprägungen „stimme zu“ (1) bis „stimme nicht zu“ (5) metrisch skaliert.
(H4) Personen, die die I + K Technologien häufig nutzen, würden Mobilitäts-
dienstleistungen aus dem Internet eher nutzen als andere Personen
Die Operationalisierung der Nutzungsintensität des Internets ist identisch mit der der vorangegangenen Hypothese. Die Bereitschaft, Mobilitätsdienstleistungen aus dem Internet zu nutzen, wurde mit der Frage „Können Sie sich vorstellen, per Internet die folgenden Mobilitätsdienste zu bestellen, zu buchen oder zu kaufen?“ untersucht. Bei den abgefragten Mobilitätsdienstleistungen handelt es sich um Bahntickets, Mietwagen, Taxis, Parkplatzbuchungen und drei Navigationsdienste. Es wird danach unterschieden, ob diese Dienste bevorzugt mit dem PC bzw. Laptop oder dem Mobiltelefon mit Internetzugang in Anspruch genommen werden wollen. Bei dieser geschlossenen Frage sind Mehrfachnennungen möglich (vgl. Anhang 1, Fragebogen, Frage 50).
(H5) Wenn Personen ein Navigationssystem in ihrem PKW besitzen, dann beurteilen sie das Verkehrsaufkommen geringer als Personen, die diese technische Neuerung nicht besitzen.
Die Ausstattung mit Navigationssystemen wird mit der Frage „Besitzen Sie ein Navigationssystem in Ihrem PKW?“ ermittelt. Es handelt sich dabei um eine geschlossene Frage mit den Antwortmöglichkeiten „ja“ und „nein“. Das Verkehrsaufkommen wird wie in Hypothese H2 operationalisiert.
Individualverkehrsmittel
(H6) Je höher das Verkehrsaufkommen (in Form von Verkehrsstaus und Park-
platzproblemen) subjektiv empfunden wird, desto besser werden Klein- und Kleinstwagen beurteilt.
Die Operationalisierung des empfundenen Verkehrsaufkommens wird wie bei Hypothese H2 vorgenommen. Die Beurteilung von Kleinwagen erfolgt durch die Abfrage von acht Statements zu Klein- und Kleinstwagen. Bei diesen acht Statements handelt es sich sowohl um Aussagen, wie diese Kleinwagen „gefallen“ („finde ich lustig anzusehen“ bzw. „gefallen mir sehr gut“), als auch um Aussagen, die die Handlichkeit, Sparsamkeit und die Preisgünstigkeit von Kleinwagen betreffen. Die verbleibenden drei Statements sind negativ formuliert. Es handelt sich dabei um, „Kleinwagen finde ich zu klein“, „... sehe ich nicht als vollwertige Autos an“ und „... kommen für mich nicht in Frage“. Diese acht Statements sind auf einer Fünfer-Skala mit den Ausprägungen „stimme zu“ (1) bis „stimme nicht zu“ (5) metrisch skaliert (vgl. Anhang 1, Fragebogen, Frage 33).
(H7) Wenn Personen eine ausgeprägte Affinität zum Automobil haben, dann
stehen sie Klein- und Kleinstwagen kritischer gegenüber als Personen mit einem rationalen oder zweckgebundenen Verhältnis zum Auto.
Bei der Autoaffinität bzw. dem rationalen oder zweckgebundenen Verhältnis zum Auto handelt es sich um Einstellungen zum Auto. Die Einstellung der Befragten gegenüber Mobilität wird, wie bei Hypothese H1 schon beschrieben, mittels 22 Statements zum Thema Auto ermittelt. Mittels einer Clusteranalyse werden dann Personen mit ähnlichem Antwortverhalten identifiziert. Es wird vermutet, daß durch diese multivariate Analysemethode mindestens eine autoaffine und eine nicht-autoaffine Gruppe identifiziert werden kann. Diese Gruppen werden dann hinsichtlich ihrer Einstellung zum Klein- und Kleinstwagen untersucht. Wobei es sich bei den Statements zum Klein- und Kleinstwagen um die schon in Hypothese H5 erwähnten Aussagen handelt.
(H8) Die Umsteigebereitschaft auf zweisitzige Klein- und Kleinstwagen mit einem Zusatznutzen ist umso größer, je stärker dieser Zusatznutzen die individuelle Problemlage von bestimmten Personengruppen zu beheben versteht.
Die Umsteigebereitschaft auf zweisitzige Klein- und Kleinstwagen mit einem Zusatznutzen wird mit Hilfe von fünf Statements abgefragt. Die Statements lauten: „Ich würde auf ein zweisitziges Modell umsteigen, wenn ich dadurch Vorteile im Straßenverkehr hätte“, „... ich dadurch speziell für dieses Fahrzeug bereitgestellte Parkplätze in Anspruch nehmen könnte“, „... ich dadurch wesentliche Kostenvorteile hätte“, „... ich bei Bedarf jederzeit auf ein viersitziges Modell zurückgreifen könnte“ und „... mir die Möglichkeit geboten würde, bei längeren Strecken die Bahn vergünstigt zu nutzen“. Diese fünf Statements sind auf einer Fünfer-Skala mit den Ausprägungen „stimme zu“ (1) bis „stimme nicht zu“ (5) metrisch skaliert (vgl. Anhang 1, Fragebogen, Frage 38). Unter der individuellen Problemlage ist das Verkehrsaufkommen bzw. sind die Benzinpreise und die Betriebskosten zu verstehen. Da es sich hierbei um mehrere verschiedene Problemlagen handelt, muß die Hypothese in mehrere Teile aufgeteilt werden.
(H8a) Wenn eine bestimmte Personengruppe das Verkehrsaufkommen als sehr hoch bzw. höher als andere Personengruppen einstuft, dann ist deren Umsteigebereitschaft auf zweisitzige Kleinwagen, unter der Prämisse, daß sie dadurch Vorteile im Straßenverkehr hat, größer als bei Personen, die das Verkehrsaufkommen als weniger hoch einstufen.
Der erste Teil der Hypothese H7 beschäftigt sich mit dem Verkehrsaufkommen, das schon an anderer Stelle operationalisiert wurde. Es werden für den Hypothesentest die identifizierten Cluster in Abhängigkeit des empfundenen Verkehrsaufkommens hinsichtlich ihrer Umsteigebereitschaft auf zweisitzige Klein- und Kleinstwagen untersucht.
(H8b) Wenn eine bestimmte Personengruppe die Kosten für das Auto (in Form von hohen Benzinpreisen und Betriebskosten) als sehr hoch bzw. höher als andere Personengruppen einstuft, dann ist deren Umsteigebereitschaft auf zweisitzige Kleinwagen unter der Prämisse, daß sie dadurch wesentliche Kostenvorteile hat, größer als bei Personen, die das Kostenniveau von Autos als weniger hoch einstufen.
Der zweite Teil der Hypothese H7 beschäftigt sich mit der Beurteilung der Benzinpreise und der Betriebskosten für den PKW. Die Benzinpreise werden mit der Frage „Wie empfinden Sie die aktuellen Benzinpreise?“, die Betriebskosten für den PKW mit der Frage „Wie empfinden Sie die aktuellen Betriebskosten (Versicherung, Steuer, Wartung) für Ihren PKW“ operationalisiert. Bei beiden Fragen kann auf einer Fünfer-Skala die Antwort abgestuft werden, wobei die Ausprägung (1) „sehr hoch“ und die Ausprägung (5) „sehr niedrig“ entspricht. Die identifizierten Cluster werden somit in Abhängigkeit zu den subjektiv empfundenen Benzinpreisen und den Betriebskosten für den PKW hinsichtlich ihrer Umsteigebereitschaft auf zweisitzige Klein- und Kleinstwagen untersucht.
(H9) Wenn bestimmte Automodelle gegen das Leitbild der Rennreiselimousine verstoßen, dann werden sie nicht als vollwertige Autos angesehen.
Als Automodelle werden in dieser Untersuchung das Smart City-Coupé, der Ford Ka, der Renault Twingo und der VW Lupo näher betrachtet. Wobei nur das Smart City-Coupé gegen das im theoretischen Teil dieser Arbeit vorgestellte Leitbild der Rennreiselimousine verstößt. Mit der Aussage „Sehe ich nicht als vollwertiges Auto an“ kann der Befragte seine Meinung zu den vier Automodellen zum Ausdruck bringen. Mehrfachantworten sind möglich. Außerdem kommt als Antwortmöglichkeit auch „keines der 4 Modelle“ in Betracht ( vgl. Anhang 1, Fragebogen, Frage 34). Daneben werden Statements wie „Ist lustig anzusehen“, „Ist mir zu klein“, und „Würde ich mir kaufen“ abgefragt.
4.2 Forschungsdesign
Auf der Grundlage der Operationalisierung der Hypothesen wurde ein standardisierter Fragebogen entwickelt. Neben den in Kapitel 4.1 vorgestellten Hypothesen werden in dem Fragebogen auch Hypothesen aus der zweiten Diplomarbeit zum Thema Mobilität und aus den beiden weiteren Diplomarbeiten zum Thema Kaufprozeß operationalisiert. Der Fragebogen enthält somit Fragen zu den beiden Untersuchungsschwerpunkten Kaufentscheidungsprozeß und Einstellung bzw. Verhalten im Zusammenhang mit Mobilität (vgl. Kapitel 1). Es wurde deshalb eine gemeinsame Stichprobe gewählt, weil so auf Individualniveau Beziehungen zwischen allen gemessenen Größen hergestellt werden können, um eine Autofahrertypologie ableiten und für die Auswertung der Hypothesen nutzen zu können. Aufgrund dieser Themenzusammenführung wird für die Erhebung der Name „Kaufprozeß/Mobilität 2000“ verwendet.
Der Fragebogen enthält neben den üblichen soziodemographischen Kriterien auch Fragen zur Markenpräferenz und zum Markenbesitz, zur Händler- und Markentreue, zum Autokauf und zur Besitzphase von Automobilen. Daneben werden Nutzungsmuster und Einstellungswerte zu verschiedenen Verkehrsmitteln abgefragt und das Potential von Mobilitätskonzepten untersucht. Auf-grund der schon erwähnten gewählten Themenzusammenführung macht nur eine Befragung von Personen Sinn, die über ein Auto verfügen, es regelmäßig nutzen und bereits ein Auto bei einem Händler erworben haben bzw. aktiv am Kaufprozeß beteiligt waren.
Ziel der Untersuchung ist es, einen repräsentativen Querschnitt der deutschen Autokäufer und –nutzer zu erhalten. Es wurde eine Stichprobengröße von 600 Personen angestrebt. Um bei dieser Stichprobengröße repräsentativ zu sein, wurde eine Quotierung bezüglich Geschlecht, Alter, Fahrzeugklassen und Nielsengebiet zugrunde gelegt.
Für Alter und Geschlecht ergibt sich auf der Grundlage von Daten des Statistischen Bundesamtes folgendes Bild:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Tabelle 01, Quelle: Eigene graphische Darstellung in Anlehnung an: Kraftfahrt-Bundesamt (KBA), 1999, Seite 83
Für die verschiedenen Fahrzeugklassen wurde auf der Grundlage von Daten des Kraftfahrt-Bundesamtes (KBA) / Motor-Presse Stuttgart (MPS) folgende Quotierung gewählt: Ausschlaggebend für die Quotierung ist der Anteil der jeweiligen Fahrzeugklassen an allen Neuzulassungen in %. Alle aufgeführten Prozentwerte sind auf- bzw. abgerundet. Die Nischensegmente (Sportwagen, Cabriolets und Off-Road-Fahrzeuge) sind zu einem Segment zusammengefaßt.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Tabelle 02, Quelle: Eigene graphische Darstellung in Anlehnung an: Motor-Presse Stuttgart (MPS), 2000, Seite 58
[...]
[1] Die Ausführungen in diesem Kapitel stützen sich auf Kroeber-Riel, W., Weinberg, P., 1999, Seite 53 – 58 und Trommsdorff, V., (1993), Seite 59 – 65, 111 – 127, 136 – 147.
[2] Primärmotive sind z.B. Versorgungsmotive, Vermeidungsmotive oder Arterhaltungsmotive.
[3] Sekundärmotive sind z.B. das Prestige- und Machtbedürfnis oder das Bedürfnis nach Selbstverwirklichung.
[4] Alter, Geschlecht, Familienstand, Haushaltsgröße, Rassenzugehörigkeit, Nationalität, Religionszugehörigkeit.
[5] Einkommen, Beruf, Ausbildung, Wohnort.
[6] Mikrogeographische Segmentierung: Bildung von regionalen Bezugseinheiten
[7] Die Psychographie geht auf eine Wortkombination aus Demographie und Psychologie zurück.
[8] AIO = Activities, Interests, Opinions. Activities sind beobachtbare Aktivitäten, z. B. in Freizeit und Arbeit. Interests ist emotional bedingtes Verhalten, z. B. gegenüber Medien. Opinions sind Meinungen als kognitive Orientierung, z. B. zu Produkten.
[9] Mobilität wird im gängigen Sprachgebrauch gleichgesetzt mit Verkehr in seinen unterschiedlichsten Formen. (Knell, W., 1998, Seite 212).
[10] als Beispiele für diese Veränderungen nennen Canzler und Knie Veränderungen der Bedürfnisse, der Wertvorstellungen aber auch der Siedlungsstruktur und der Raumordnung. (Canzler, W. / Knie, A., „Möglichkeitsräume“, 1998, Seite 43 ff.).
[11] als Beispiele nennt Knoflacher, H., 1999, Seite 121: „Tief verwurzelte und verankerte Werte, wie der Schutz des Lebens, sind, angesichts der erschreckenden Getöteten und Verletztenzahlen offensichtlich massiv entwertet und relativiert worden.“, oder: „Der Autostau wird zum nationalen Problem hochstilisiert (...).“
[12] vgl. Canzler, W., 1999b, „Der anhaltende Erfolg des Automobils. Zu den Modernisierungsleistungen eines außergewöhnlichen technischen Artefaktes“, Seite 26.
[13] Ausführungen in diesem Absatz beziehen sich auf: Canzler, W. / Knie, A., „Möglichkeitsräume“, 1998, Seite 129 f.
[14] Die Überlegungen dieses Kapitels stützen sich, falls nicht anders ausgewiesen, auf Hautzinger, H., Pfeiffer, M., Tassaux-Becker, B., 1994, Seite 39 ff.
[15] Der Freizeitverkehr ist mit einem Verkehrsaufkommensanteil von 35% (Ergebnis der KONTIV ´89) mittlerweile die bedeutendste Verkehrsart.
[16] Hautzinger, H., Peiffer, M., Tassaux-Becker, B., (1994), Seite 67, sprechen in diesem Zusammenhang davon, daß Alleinstehende das höchste Mobilitätsniveau haben.
[17] ebenda Seite 67.
[18] ebenda Seite 68.
[19] vgl. Knie, A. / Berthold, O., 1995, Seite 4.
[20] „Die durchschnittliche Besetzung eines Autos beträgt heute ca. 1,7 Personen, in der Stadt sind es nur 1,2 Personen.“ Kries, M., 1999, Seite 321.
[21] Auch bei einer schnellen Fahrweise „bleibt der Lupo 3 L mit einem Testverbrauch von rund vier Litern Diesel auf 100 Kilometer das derzeit sparsamste Auto der Welt“ (Stappen, H.-J., 2000, Seite 41).
[22] Das Smart City-Coupé verfügt über einen 3-Zylindermotor, der platzsparend im Heck des Fahrzeugs untergebracht ist.
[23] „Eine der häufigsten Fragen beim Anblick des Smart ist: „Ist das ein Elektroauto?“ (Bellati, C., 1999, Seite 350).
[24] Zu Beginn des Smart-Projekts im Jahr 1994 wurde zwischen der Daimler-Benz AG und SMH (Société Microélectronique et Horlogière) ein Joint-Venture mit dem Namen MCC GmbH (Micro-Compakt-Car GmbH) gegründet. Mercedes war für die Produktion und Entwicklung, SMH für das Produktimage und die Kommerzialisierung verantwortlich (vgl. ebenda, Seite 349 f.). Erst im Verlauf der Zusammenarbeit steigt SMH bei der MCC GmbH aus und verkauft die Anteile an Daimler-Benz.
[25] Das Mobilitätsangebot der MCC GmbH umfaßt vier Bausteine. Die smartmove Assistance (Pannenhilfe), das smartmove Parking (exklusive und reduzierte Parkplätze für Kleinstwagen), das smartmove Reisen (Mitgliedschaft in einem CarSharing-Verband, Vergünstigungen bei dem DB AutoZug und Fährschiffen, das kostenlose bzw. preiswerte Umsteigen auf einen Smart bei Flugreisen oder der Nutzung des ÖPNV in bestimmten Städten) und das smartmove & more-Paket (vergünstigte Tarife bei dem Autovermieter AVIS), (vgl. Verkaufspropekt MCC Smart GmbH, 2000, Seite 10 f.).
[26] „... if the Smart ultimately proves successful, then it will do so because mcc has managed to convince the public and its customers that this vehicle is something truly new and not just an inferior Mercedes A; ...“ Knie, A. / Hard, M., 2000, Seite 17 f.
[27] Im Mai 2000 wurden 4755 Modelle des Smart City-Coupés und 3675 VW Lupo verkauft (vgl. o.V., 2000a, Seite 11). Der Trend setzte sich im Juni 2000 fort. In diesem Monat wurden 4828 Smart und 3767 VW Lupo verkauft (vgl. o.V., 2000b, Seite 11).
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Originalausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2000
- ISBN (eBook)
- 9783832445287
- ISBN (Paperback)
- 9783838645285
- DOI
- 10.3239/9783832445287
- Dateigröße
- 844 KB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- Fachhochschule Westküste Heide – Betriebswirtschaft
- Erscheinungsdatum
- 2001 (September)
- Note
- 1,0
- Schlagworte
- systemmarke automobil verkehr mobilität marktsegmentierung
- Produktsicherheit
- Diplom.de