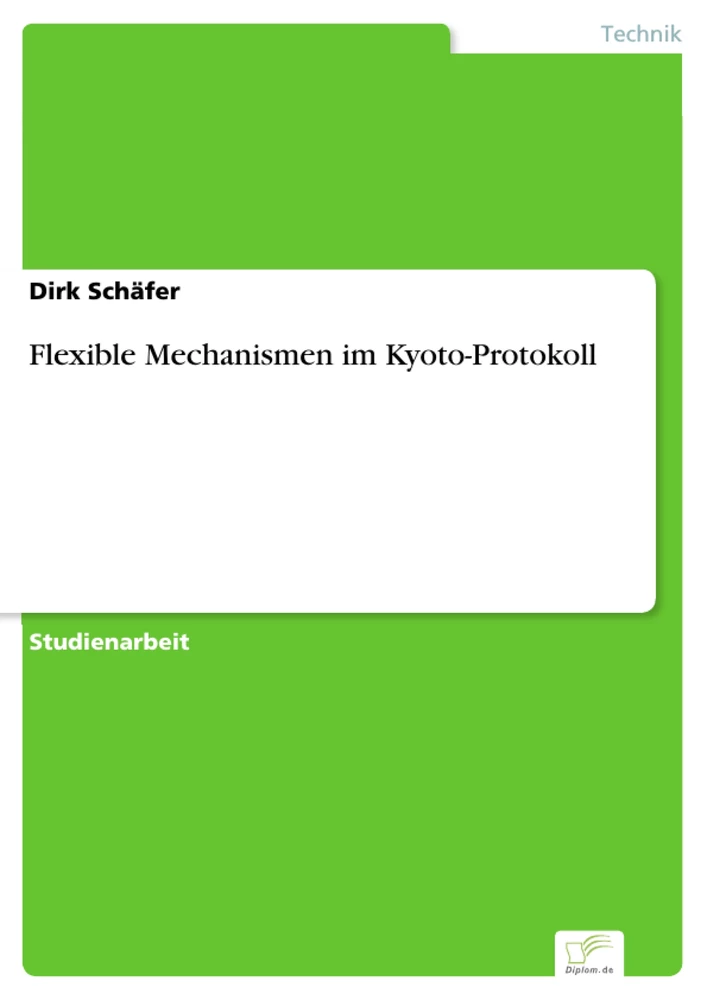Zusammenfassung
Inhaltsangabe:Gang der Untersuchung:
Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit den im Protokoll von Kyoto festgehaltenen flexiblen Mechanismen zur Verminderung der Treibhausgasemissionen, der Politik der Europäischen Union sowie dem ACID-RAIN-Programm in den USA.
Im ersten Kapitel Einleitung wird der Treibhauseffekt und die Wirkung der verschiedenen Treibhausgase näher erläutert. Desweiteren werden mögliche Auswirkungen der globalen Erwärmung dargestellt.
Im nächsten Kapitel Das Protokoll von Kyoto wird zuerst das Protokoll von Kyoto näher vorgestellt und dann in einen zeitlichen Rahmen der Klimaverhandlungen der internationalen Gemeinschaft eingebunden. Danach werden die flexiblen Mechanismen vor dem Hintergrund der aktuellen wissenschaftlichen Diskussion näher dargestellt und gegeneinander abgegrenzt. Dabei werden die Probleme, die beim Einsatz dieser Instrumente auftauchen können, beschrieben und Lösungsmöglichkeiten aufgezeigt.
Das dritten Kapitel Theoretische Aspekte zum Emissionszertifikatehandel befasst sich mit den theoretischen Grundlagen des Emissionszertifikatehandels. Besondere Aufmerksamkeit wird auf die Ziele des Emissionshandels und die Komponenten der Emissionszertifikate gelegt. Auch die Ausgestaltung der handelbaren Zertifikate und die Preisfindung ist hier von Bedeutung. Schließlich werden noch die verschiedenen Möglichkeiten der Verteilung der Zertifikate ermittelt.
Das vierte Kapitel Die Politik zur Umsetzung des Protokolls von Kyoto untersucht die Politik der Europäischen Union und deren weiteres geplantes Vorgehen im Hinblick auf die Ziele des Protokolls. Die dargestellten Elemente einer Implementierungsstrategie für Emissionszertifikate innerhalb der Politik der Europäischen Gemeinschaft bilden den Schluss dieses Kapitels.
In den Kapiteln zwei bis vier werden die theoretischen und politischen Grundlagen eines zukünftigen Handelssystems für Emissionzertifikate vorgestellt. Im Kapitel 5 Praktische Erfahrungen mit dem Handel von Emissionszertifikaten am Beispiel des ACID-RAIN-Programms in den USA soll nun ein Handelssystem dargestellt werden, das schon in die Praxis umgesetzt worden ist. Dazu wird das ACID-RAIN-Programm näher beschrieben und die möglichen Lehren für den Emissionszertifikatehandel auf Grundlage des Protokolls von Kyoto gezogen.
Im letzten Kapitel Ausblick wird die zukünftige Entwicklung der Treibhausgasemissionen gegeben und die Schwierigkeiten bei der Erreichung der Emissionsreduktionsziele […]
Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit den im Protokoll von Kyoto festgehaltenen flexiblen Mechanismen zur Verminderung der Treibhausgasemissionen, der Politik der Europäischen Union sowie dem ACID-RAIN-Programm in den USA.
Im ersten Kapitel Einleitung wird der Treibhauseffekt und die Wirkung der verschiedenen Treibhausgase näher erläutert. Desweiteren werden mögliche Auswirkungen der globalen Erwärmung dargestellt.
Im nächsten Kapitel Das Protokoll von Kyoto wird zuerst das Protokoll von Kyoto näher vorgestellt und dann in einen zeitlichen Rahmen der Klimaverhandlungen der internationalen Gemeinschaft eingebunden. Danach werden die flexiblen Mechanismen vor dem Hintergrund der aktuellen wissenschaftlichen Diskussion näher dargestellt und gegeneinander abgegrenzt. Dabei werden die Probleme, die beim Einsatz dieser Instrumente auftauchen können, beschrieben und Lösungsmöglichkeiten aufgezeigt.
Das dritten Kapitel Theoretische Aspekte zum Emissionszertifikatehandel befasst sich mit den theoretischen Grundlagen des Emissionszertifikatehandels. Besondere Aufmerksamkeit wird auf die Ziele des Emissionshandels und die Komponenten der Emissionszertifikate gelegt. Auch die Ausgestaltung der handelbaren Zertifikate und die Preisfindung ist hier von Bedeutung. Schließlich werden noch die verschiedenen Möglichkeiten der Verteilung der Zertifikate ermittelt.
Das vierte Kapitel Die Politik zur Umsetzung des Protokolls von Kyoto untersucht die Politik der Europäischen Union und deren weiteres geplantes Vorgehen im Hinblick auf die Ziele des Protokolls. Die dargestellten Elemente einer Implementierungsstrategie für Emissionszertifikate innerhalb der Politik der Europäischen Gemeinschaft bilden den Schluss dieses Kapitels.
In den Kapiteln zwei bis vier werden die theoretischen und politischen Grundlagen eines zukünftigen Handelssystems für Emissionzertifikate vorgestellt. Im Kapitel 5 Praktische Erfahrungen mit dem Handel von Emissionszertifikaten am Beispiel des ACID-RAIN-Programms in den USA soll nun ein Handelssystem dargestellt werden, das schon in die Praxis umgesetzt worden ist. Dazu wird das ACID-RAIN-Programm näher beschrieben und die möglichen Lehren für den Emissionszertifikatehandel auf Grundlage des Protokolls von Kyoto gezogen.
Im letzten Kapitel Ausblick wird die zukünftige Entwicklung der Treibhausgasemissionen gegeben und die Schwierigkeiten bei der Erreichung der Emissionsreduktionsziele […]
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
ID 4339
Schäfer, Dirk: Flexible Mechanismen im Kyoto-Protokoll /
Dirk Schäfer - Hamburg: Diplomica GmbH, 2001
Zugl.: Darmstadt, Technische Universität, Studienarbeit, 2001
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte, insbesondere die
der Übersetzung, des Nachdrucks, des Vortrags, der Entnahme von Abbildungen und Tabellen,
der Funksendung, der Mikroverfilmung oder der Vervielfältigung auf anderen Wegen und der
Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen, bleiben, auch bei nur auszugsweiser Verwertung,
vorbehalten. Eine Vervielfältigung dieses Werkes oder von Teilen dieses Werkes ist auch im
Einzelfall nur in den Grenzen der gesetzlichen Bestimmungen des Urheberrechtsgesetzes der
Bundesrepublik Deutschland in der jeweils geltenden Fassung zulässig. Sie ist grundsätzlich
vergütungspflichtig. Zuwiderhandlungen unterliegen den Strafbestimmungen des
Urheberrechtes.
Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in diesem
Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme, dass solche
Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei zu betrachten
wären und daher von jedermann benutzt werden dürften.
Die Informationen in diesem Werk wurden mit Sorgfalt erarbeitet. Dennoch können Fehler nicht
vollständig ausgeschlossen werden, und die Diplomarbeiten Agentur, die Autoren oder
Übersetzer übernehmen keine juristische Verantwortung oder irgendeine Haftung für evtl.
verbliebene fehlerhafte Angaben und deren Folgen.
Diplomica GmbH
http://www.diplom.de, Hamburg 2001
Printed in Germany
Wissensquellen gewinnbringend nutzen
Qualität, Praxisrelevanz und Aktualität zeichnen unsere Studien aus. Wir
bieten Ihnen im Auftrag unserer Autorinnen und Autoren Wirtschafts-
studien und wissenschaftliche Abschlussarbeiten Dissertationen,
Diplomarbeiten, Magisterarbeiten, Staatsexamensarbeiten und Studien-
arbeiten zum Kauf. Sie wurden an deutschen Universitäten, Fachhoch-
schulen, Akademien oder vergleichbaren Institutionen der Europäischen
Union geschrieben. Der Notendurchschnitt liegt bei 1,5.
Wettbewerbsvorteile verschaffen Vergleichen Sie den Preis unserer
Studien mit den Honoraren externer Berater. Um dieses Wissen selbst
zusammenzutragen, müssten Sie viel Zeit und Geld aufbringen.
http://www.diplom.de bietet Ihnen unser vollständiges Lieferprogramm
mit mehreren tausend Studien im Internet. Neben dem Online-Katalog und
der Online-Suchmaschine für Ihre Recherche steht Ihnen auch eine Online-
Bestellfunktion zur Verfügung. Inhaltliche Zusammenfassungen und
Inhaltsverzeichnisse zu jeder Studie sind im Internet einsehbar.
Individueller Service
Gerne senden wir Ihnen auch unseren Papier-
katalog zu. Bitte fordern Sie Ihr individuelles Exemplar bei uns an. Für
Fragen, Anregungen und individuelle Anfragen stehen wir Ihnen gerne zur
Verfügung. Wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit.
Ihr Team der Diplomarbeiten Agentur
I
Inhaltsverzeichnis
INHALTSVERZEICHNIS I
1.
EINLEITUNG 1
1.1.
Aufbau der Arbeit
1
1.2.
Der Treibhauseffekt
2
2.
DAS PROTOKOLL VON KYOTO
4
2.1.
Allgemeiner Überblick zum Protokoll von Kyoto
4
2.2.
Chronologie der Klimaverhandlungen
5
2.3.
Die Mechanismen zur Umsetzung der ökologischen Zielvorgaben
im Protokoll von Kyoto
8
2.3.1. Begriffsabgrenzung
der
Emissionskontingente
8
2.3.2.
Die Komponenten der flexiblen Mechanismen
9
2.3.3.
Der Handel mit Emissionszertifikaten
10
2.3.3.1.
Teilnahme am Handel
11
2.3.3.2.
Zeitpunkt des Emissionshandels
12
2.3.3.3.
Die nationale und die internationale Ebene beim Emissionshandel
nach dem Protokoll von Kyoto
13
2.3.4. Joint
Implementation
(JI)
13
2.3.4.1.
Definition und Wirkungsweise des Joint Implementation
14
2.3.4.2.
Projektorganisation beim Joint Implementation
14
2.3.4.3.
Die zwischenstaatliche Organisation beim Joint Implementation
16
2.3.4.4.
Abgrenzung zu Activities Implemented Jointly (AIJ)
19
2.3.5.
Clean Development Mechanism (CDM)
19
2.3.5.1.
Definition und Wirkungsweise des Clean Development Mechanism
19
2.3.5.2.
Projektorganisation beim Clean Development Mechanism
20
2.3.6. Banking
22
2.3.7. Zielgemeinschaften
22
2.3.8. Senken
23
II
2.4.
Baselines 24
2.4.1.
Bestimmung der Projektwirksamkeit durch Baselines
24
2.4.2. Aufstellen
der
Baselines
26
2.4.3.
Statische und dynamische Baselines
28
2.5.
Probleme bei der Anwendung der flexiblen Mechanismen
28
2.5.1.
Transformationsländer (Hot Air)
29
2.5.2. Entwicklungsländer
(tropische
Luft)
31
2.5.3.
Das Wachstum des internationalen Flug- und Schiffsverkehrs
32
3.
THEORETISCHE ASPEKTE ZUM EMISSIONSRECHTEHANDEL
34
3.1.
Die Ziele des Zertifikatehandels
34
3.1.1.
Die Schaffung von Zertifikatemärkten
35
3.1.2.
Die ökonomische Effizienz des Zertifikatehandels
35
3.1.3.
Die ökologische Effektivität des Zertifikatehandels
36
3.1.4.
Das Funktionieren der Zertifikatemärkte
37
3.1.4.1. Kosten
des
Zertifikatehandels
38
3.1.4.2. Kontrolle
des
Zertifikatemarktes
41
3.1.5.
Der Innovationsanreiz durch den Zertifikatehandel
42
3.2.
Die Komponenten der Emissionszertifikate
43
3.2.1.
Die ökologische Komponente
43
3.2.2.
Die distributive Komponente
45
3.2.3.
Die ökonomische Komponente
46
3.3.
Ausgestaltungformen handelbarer Emissionszertifikate.
47
3.3.1.
Ausgestaltung der Zertifikate nach dem Halter der Zertifikate
47
3.3.2.
Ausgestaltung der Zertifikate nach Vorgabe der Ziele und
Ausübung der Kontrolle.
48
3.3.3.
Die zeitliche Ausgestaltung der Emissionszertifikate
49
3.3.4.
Differenzierte und undifferenzierte Ausgestaltung der Zertifikate
51
3.4.
Die Preisfindung bei Emissionszertifikaten
51
3.5.
Anfangsausstattung mit Emissionszertifikaten
53
3.5.1.
Die anfängliche Ausstattung mit Zertifikaten auf nationaler Ebene
53
III
3.5.1.1.
Die Versteigerung der Zertifikate
53
3.5.1.2.
Der Verkauf zum staatlichen Festpreis
55
3.5.1.3.
Das Verfahren der kostenlosen Verteilung (Grandfathering)
55
3.5.2.
Ein mögliches System der Zertifikateverteilung
56
3.5.3.
Die Anfangsausstattung mit Zertifikaten auf internationaler Ebene
58
4.
DIE POLITIK DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT ZUR
UMSETZUNG DES PROTOKOLLS VON KYOTO
59
4.1.
Das weitere geplante Vorgehen der EU
59
4.1.1.
Ratifizierung des Protokolls von Kyoto
59
4.1.2.
Politische Maßnahmen zur Erfüllung der Emissionsziele des
Protokolls von Kyoto
60
4.1.3.
Politische Maßnahmen zur Vorbereitung der Anwendung der
Kyoto-Mechanismen 62
4.1.4.
Die Überwachung der Emissionen innerhalb der Europäischen Union
64
4.1.5.
Politik zur Senkung der Emissionen aus der Luftfahrt
65
4.2.
Elemente einer Implementierungsstrategie für Emissionszertifikate
innerhalb der Politik der Europäischen Gemeinschaft
66
5.
PRAKTISCHE ERFAHRUNGEN MIT DEM HANDEL VON
EMISSIONSRECHTEN AM BEISPIEL DES ACID-RAIN-PROGRAMMS
IN DEN USA
68
5.1.
Überblick und Ziele des ACID-RAIN-Programms
68
5.2.
Ausgestaltung der SO
2
-Zertifikate 70
5.3.
Verteilung und Überwachung der Zertifikate
70
5.4.
Kontroll- und Sanktionsmechanismen des ACID-RAIN-Programms
72
5.5.
Erfahrungen mit dem ACID-RAIN-Programm
73
5.5.1. Ökonomische
Effizienz
73
5.5.2. Ökologische
Effektivität
74
IV
5.6.
Lehren für den Emissionszertifikatehandel auf der Grundlage
des Protokolls von Kyoto
75
6.
AUSBLICK 77
7.
LITERATURVERZEICHNIS 78
1
1. Einleitung
Die Emissionen der verschiedenen Treibhausgase und der hierdurch verursachte
Treibhauseffekt sind ein Umweltproblem, das eine der größten ökologischen und
ökonomischen Herausforderungen unserer Zeit darstellt. Zur Begrenzung dieses
Problems hat sich die internationale Gemeinschaft im Protokoll von Kyoto auf eine
Reduzierung der anthropogenen Treibhausgasemissionen geeinigt. Die Umset-
zung der Reduktionsziele bis zum ersten Verpflichtungszeitraum von 2008 bis
2012 ist Gegenstand der aktuellen politischen Diskussion.
1.1.
Aufbau der Arbeit
Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit den im Protokoll von Kyoto festgehalte-
nen flexiblen Mechanismen zur Verminderung der Treibhausgasemissionen, der
Politik der Europäischen Union sowie dem ACID-RAIN-Programm in den USA.
Im ersten Kapitel ,,Einleitung" wird der Treibhauseffekt und die Wirkung der ver-
schiedenen Treibhausgase näher erläutert. Des weiteren werden mögliche Aus-
wirkungen der globalen Erwärmung dargestellt.
Im nächsten Kapitel ,,Das Protokoll von Kyoto" wird zuerst das Protokoll von Kyoto
näher vorgestellt und dann in einen zeitlichen Rahmen der Klimaverhandlungen
der internationalen Gemeinschaft eingebunden. Danach werden die flexiblen Me-
chanismen vor dem Hintergrund der aktuellen wissenschaftlichen Diskussion nä-
her dargestellt und gegeneinander abgegrenzt. Dabei werden die Probleme, die
beim Einsatz dieser Instrumente auftauchen können, beschrieben und Lösungs-
möglichkeiten aufgezeigt.
Das dritten Kapitel ,,Theoretische Aspekte zum Emissionszertifikatehandel" befaßt
sich mit den theoretischen Grundlagen des Emissionszertifikatehandels. Besonde-
re Aufmerksamkeit wird auf die Ziele des Emissionshandels und die Komponenten
der Emissionszertifikate gelegt. Auch die Ausgestaltung der handelbaren Zertifika-
te und die Preisfindung ist hier von Bedeutung. Schließlich werden noch die ver-
schiedenen Möglichkeiten der Verteilung der Zertifikate ermittelt.
2
Das vierte Kapitel ,,Die Politik zur Umsetzung des Protokolls von Kyoto" untersucht
die Politik der Europäischen Union und deren weiteres geplantes Vorgehen im
Hinblick auf die Ziele des Protokolls. Die dargestellten Elemente einer Implemen-
tierungsstrategie für Emissionszertifikate innerhalb der Politik der Europäischen
Gemeinschaft bilden den Schluß dieses Kapitels.
In den Kapiteln zwei bis vier wurden die theoretischen und politischen Grundlagen
eines zukünftigen Handelssystems für Emissionzertifikate vorgestellt. Im Kapitel 5
,,Praktische Erfahrungen mit dem Handel von Emissionszertifikaten am Beispiel
des ACID-RAIN-Programms in den USA" soll nun ein Handelssystem dargestellt
werden, das schon in die Praxis umgesetzt worden ist. Dazu wird das ACID-RAIN-
Programm näher beschrieben und die möglichen Lehren für den Emissionszertifi-
katehandel auf Grundlage des Protokolls von Kyoto gezogen.
Im letzten Kapitel ,,Ausblick" wird die zukünftige Entwicklung der Treibhausgas-
emissionen gegeben und die Schwierigkeiten bei der Erreichung der Emissionsre-
duktionsziele von Kyoto betrachtet.
1.2. Der
Treibhauseffekt
Der Treibhauseffekt, der als die Ursache für die stark zugenommene Bedeutung
der internationalen Klimapolitik gelten kann, verdankt seinen Namen der Analogie
zu den Vorgängen in einem Gewächshaus. Genau wie eine Glasscheibe besitzen
bestimmte Gase in der Atmosphäre die Eigenschaft kurzwellige Sonnenstrahlung
ungehindert passieren zu lassen und langwellige Wärmestrahlung zu reflektieren.
Die Gase, die diese Reflexion verursachen, werden deshalb auch Treibhausgase
genannt.
1
Der Treibhauseffekt wird in einen natürlichen und in einen anthropogenen Anteil
unterteilt.
2
Der natürliche Treibhauseffekt sorgt durch die schon immer in der Erd-
atmosphäre vorhandenen Treibhausgase dafür, daß die Erde bewohnbar ist.
3
Ohne ihn läge die Durchschnittstemperatur bei 18°Celsius.
4
Der anthropogene
Treibhauseffekt wird hauptsächlich durch die Verbrennung fossiler Brennstoffe
1
vgl. Bräuer et al. (1999), S. 3
2
vgl. Bräuer et al. (1999), S. 3
3
Es handelt sich dabei um Wasserdampf, Kohlendioxid, Ozon, Distickstoffoxid und Methan.
4
vgl. Bayrisches Staatsministerium für Landesentwicklung und Umweltfragen (2000)
3
und einer veränderten Bodennutzung verursacht, wobei hauptsächlich Kohlendi-
oxid (CO
2
) freigesetzt wird.
5
Aber auch der Einsatz von industriell produzierten
Fluorkohlenwasserstoffen (FCKWs) und photochemisch gebildetes troposphäri-
sches Ozon tragen über 25% zum Treibhauseffekt bei. Die folgende Tabelle gibt
einen Überblick über die Verursacher der Treibhausgasemissionen und deren An-
teil am anthropogenen Treibhauseffekt.
Tabelle 1: Anteile der Verursacher am Treibhauseffekt (Angaben in Prozent),
Quelle: OECD (1991), S. 26
Verursacher
CO
2
FCKW CH
4
trop. O
3
N
2
O Summe
Energiewirtschaft und Verkehr
35
-
4
6
4
49
Chemische Industrie
2
20
-
2
-
24
Waldvernichtung
10
-
4
-
-
14
Landwirtschaft und andere Berei-
che
3
-
8
2
-
13
Anteil am anthropogenen Treib-
hauseffekt
50
20
16
8
6
100
spezifisches Treibhauspotential
1
4000-
6000
58
1800
206
-
Verweildauer (Jahre)
50 -
200
60 - 130
10
0,1
130 -
150
-
Die Folgen des anthropogenen Treibhauseffektes und des dadurch verursachten
Temperaturanstiegs sind voraussichtlich folgende Konsequenzen:
6
·
Ausweitung der Wüstenregionen durch Verschiebung der Klimazonen
·
Verknappung der Wasserresourcen
·
Anstieg der Meeresspiegel
·
Verschlechterung der Ernährungssituation eines Großteils der Weltbevölke-
rung
Dies zeigt, daß die Auswirkungen des Klimawandels alles Staaten betreffen und
sich nicht auf einzelnen Regionen beschränken. Dies ist auf die Wirksamkeit der
Treibhausgase zurückzuführen, die nicht regional eingegrenzt werden kann.
5
vgl. Geres (2000), S. 21f und Scheelhase (1994), S. 11f
6
vgl. Geres (2000), S. 22
4
2. Das Protokoll von Kyoto
Das Protokoll von Kyoto stellt die Umsetzung der Beschlüsse der Klimarahmen-
konvention 1992 in Rio de Janeiro dar. Es setzt erstmals verbindliche Reduktions-
ziele für die Industrie- und Transformationsländer fest. Um diese Ziele zu errei-
chen, werden im Kyoto-Protokoll explizite Mechanismen genannt, deren Umset-
zung noch immer Gegenstand von Verhandlungen ist, und die in sich einige Prob-
leme bergen.
2.1.
Allgemeiner Überblick zum Protokoll von Kyoto
Das Kyoto-Protokoll verpflichtet die Industriestaaten, die Emissionen von insge-
samt sechs Treibhausgasen Kohlendioxid (CO
2
), Methan (CH
4
), Lachgas (NO
2
),
wasserstoffhaltige Fluorkohlenwasserstoffe (FKW), perfluorierte Fluorkohlenwas-
serstoffe (PFC) und Schwefelhexafluorid (SF
6
) zu reduzieren. Um eine Umrech-
nung der verschiedenen Gase in einen vergleichbaren Wert vornehmen zu kön-
nen, ist es nötig sie auf eine gemeinsame Basis umzurechnen. Man hat sich dabei
als Basis auf eine Kohlenstoffäquivalente geeinigt. Die Bildung der Äquivalenzzif-
fern ist auf der Basis der Strahlungsabsorbtion je Masseeinheit und der Verweil-
dauer in der Atmosphäre möglich.
7
CO
2
besitzt dabei die Äquivalenzziffer 1, so
daß sich alle Gase einfach in CO
2
umrechnen lassen. Die Reduktion soll bis zum
Zeitraum 2008-2012 insgesamt 5,2 Prozent betragen. Als Basis wurde das Jahr
1990 gewählt. Allerdings haben sich die Länder nicht auf eine für alle Länder ein-
heitliche Reduktionsverpflichtung geeinigt sondern auf differenzierte Reduktions-
ziele. Die folgende Tabelle zeigt die Reduktionsverpflichtungen der wichtigsten
Länder und Ländergruppen.
7
vgl. Schwarze et al. (1998), S. 12
5
Tabelle 2: Reduktionsverpflichtungen wichtiger Länder und Ländergruppen, Quel-
le: Schmidt (1998), S. 444
Land/Ländergruppe
Reduktionsverpflichtung in %
Europäische Union
-8
USA
-7
Japan
-6
Kanada
-6
Australien
+8
Rußland/Ukraine
0
Mittel und osteuropäische Länder
-8
Die einzelnen europäischen Länder haben dabei im einzelnen für sich sehr unter-
schiedliche Reduktionsziele ausgehandelt: So muß Deutschland seine Treibhaus-
gase um 21 % reduzieren, während industriell schwächere Länder innerhalb der
EU wie Portugal oder Irland ihre Emissionen sogar erhöhen dürfen.
Das Protokoll von Kyoto wird frühestens 90 Tage, nachdem es von 55 Staaten
ratifiziert worden ist, in Kraft treten. Der CO
2
-Ausstoß dieser Länder muß zusam-
men mindestens 55 Prozent der im Jahr 1990 global emittierten Menge ausma-
chen.
2.2.
Chronologie der Klimaverhandlungen
Im Juni 1992 fand die UN-Konferenz zum Thema ,,Umwelt und Entwicklung" (UN-
CED, United Nations Conference on Environment and Development) in Rio de
Janeiro statt. Auf dieser Konferenz wurde die Klima-Rahmenkonvention (KRK)
verabschiedet. Sie bildet die völkerrechtliche Vertragsgrundlage für den internatio-
nalen Klimaschutz.
8
Bisher haben über 160 Staaten die Klima-Konvention ratifi-
ziert. Ihr Ziel ist es, die ,,Stabilisierung der Treibhausgaskonzentration in der Atmo-
sphäre auf einem Niveau zu erreichen, auf dem eine gefährliche anthropogene
Störung des Klimasystems verhindert wird".
9
Die Industriestaaten verpflichten sich
in der KRK, ihre CO
2
-Emissionen bis zum Jahr 2000 auf den Stand von 1990 zu-
rückzuführen.
8
vgl. BMU (1999a), S. 1
9
vgl. Klima-Rahmenkonvention, Artikel 2
6
Seitdem werden auf verschiedenen Vertragsstaatenkonferenzen (VSK, oder auch
Conference of the Parties, COP) die Ziele und Verpflichtungen der KRK erweitert
und präzisiert. Die Vertragsstaatenkonferenz wird nach Artikel 13 Abs. 1 des Kyo-
to-Protokolls als das höchste Gremium der Klima-Rahmenkonvention bestätigt.
10
Sie findet einmal in jedem Jahr statt. Zu ihren wichtigsten Aufgaben zählt die re-
gelmäßige Überprüfung der vertraglich vereinbarten Verpflichtungen der Vertrags-
parteien.
11
Dies ist nötig, da das Kyoto-Protokoll nur ein ,,qualitativer Erfolg" ist. Es
hat den Trend zu immer weiter steigenden Treibhausgasemissionen umgekehrt.
Entscheidend für die tatsächliche Wirksamkeit auf die Klimaentwicklung ist der
Prozeß nach Kyoto, in dem die Reduktionspflichten für alle Länder weiter angeho-
ben werden müssen.
12
Es kann allerdings bezweifelt werden, daß diese Forderung
politisch durchsetzbar ist.
Im März 1995 - ein Jahr nach Inkrafttreten der Klima-Rahmenkonvention - traf sich
die internationale Staatengemeinschaft in Berlin zur 1. Vertragsstaaten-Konferenz
(VSK 1). Die Industrienationen konnten sich nicht auf konkrete Ziele und Fristen
für die Verringerung von Treibhausgas-Emissionen einigen. Man stellte lediglich
fest, daß die Verpflichtungen der Klima-Rahmenkonvention nicht ausreichten.
Daraufhin wurde das "Berliner Mandat" verabschiedet. Dieses sah vor, bis zur drit-
ten Vertragsstaaten-Konferenz 1997 in Kyoto ein verbindliches Protokoll mit Re-
duktionszielen und -fristen für die Industrienationen zu verhandeln. Zu diesem
Zweck wurde eine Arbeitsgruppe (Ad Hoc Group on the Berlin Mandate, AGBM)
ins Leben gerufen.
13
Im Juli 1996 fand die 2. Vertragsstaatenkonferenz (VSK 2) in Genf statt, auf der
aber keine nennenswerten Fortschritte erzielt werden konnten.
14
Nach insgesamt acht offiziellen Vorbereitungstreffen (AGBM 1 - AGBM 8) fand
vom 1. bis 10. Dezember 1997 in Kyoto (Japan) die 3. Vertragsstaatenkonferenz
(VSK 3) statt, auf der das Kyoto-Protokoll gemäß dem bereits erwähnten Berliner
Mandat verabschiedet wurde.
15
Das Protokoll wurde bis jetzt von 84 Staaten, dar-
10
vgl. United Nations (1997a)
11
vgl. UNEP (1999b)
12
vgl. Scheffelhuber et al. (1997), S. 446
13
vgl. Geres, Roland (2000), S. 116
14
vgl. United Nations (1997b)
15
vgl. BMU (1998), S. 1
7
unter alle großen Industriestaaten, unterzeichnet. Bis heute ist das Kyoto-Protokoll
von keinem Industriestaat ratifiziert worden, bisher haben dies lediglich 31 Staaten
getan.
16
Über die Umsetzung des Kyoto-Protokolls wurde im November 1998 auf der 4.
Vertragsstaaten-Konferenz (VSK 4) in Buenos Aires verhandelt. Dort wurde ein
Arbeitsplan verabschiedet, der die nachfolgenden Etappen für die Ausgestaltung
der Klimaschutzmaßnahmen fest vorgibt.
17
Auf der 5. Vertragsstaaten-Konferenz (VSK 5) vom 25.10.1999 bis zum 5.11.1999
in Bonn haben sich die Minister und Delegierten auf einen engen Zeitplan geeinigt,
um die noch offenen Einzelheiten des Kyoto-Protokolls bis November 2000 zu klä-
ren. Darüber hinaus wurden aber auch wichtige inhaltliche Fragen geregelt. Dabei
geht es um die Verbesserung der nationalen Berichterstattung der Industrieländer,
und um wirksamere Richtlinien zur Messung ihres Treibhausgasausstoßes sowie
um die Vermeidung von Engpässen bei der Vorlage und Behandlung nationaler
Berichte der Entwicklungsländer.
18
Ziel der Konferenz war es, die Vereinbarungen
so weit zu bringen, daß sie auf der VSK 6 Ende 2000 in Den Haag verabschiedet
werden können.
19
Auf der 6.Vertragsstaatenkonferenz (VSK 6), die vom 13. - 24. November 2000 in
Den Haag stattfinden wird, geht es darum, die Verhandlungen abzuschließen und
verbindlich festzulegen, wie die Reduktionsverpflichtungen erfüllt werden können.
Die wichtigsten Themen sind die flexiblen Mechanismen, Anrechnung von Sen-
ken, Erfüllungskontrolle, Unterstützung der Entwicklungsländer bei der Anpassung
an den Klimawandel sowie der Kapazitätsaufbau in Entwicklungsländern. Das Ziel
der Konferenz ist die Ratifizierung des Kyoto-Protokolls im Jahre 2002.
20
16
Stand vom 27.09.2000. Für die aktuelle Tabelle, die den Stand der Anzahl der Unterschriften
und der Ratifizierungen des Kyoto-Protokolls enthält siehe die Internetseite der UNFCCC,
http://www.unfccc.int/resource/kpstats.pdf
17
vgl. BMU (1998), S. 1ff
18
vgl. UNIC (1999), S. 1ff, für weitere Informationen siehe Internetseiten der UNFCCC:
http://www.unfccc.de/resource/docs.html
19
vgl. BMU (1999b) S. 1ff
20
vgl. BMU (2000), S. 1ff
8
2.3.
Die Mechanismen zur Umsetzung der ökologischen Zielvorgaben im Pro-
tokoll von Kyoto
Die Kyoto-Mechanismen sind im Kyoto-Protokoll nur in ihrer Struktur angelegt und
sollen den Parteien Flexibilität bei der Umsetzung ihrer Reduktionsziele erlau-
ben.
21
Dies geschieht vor dem Hintergrund der globalen Wirksamkeit der Treib-
hausgasemissionen. Es ist für die Wirkung der Treibhausgasreduktionen also ne-
bensächlich, wo die Emissionsverminderungen vorgenommen werden. Es kommt
nur darauf an, daß die Emissionen überhaupt reduziert werden.
22
2.3.1. Begriffsabgrenzung der Emissionskontingente
Die Transparenz der Diskussion um das Protokoll von Kyoto ist nur dann gege-
ben, wenn die gebrauchten Begriffen auch den gleichen Inhalt zuordnet werden.
Deshalb ist es nötig, an dieser Stelle eine Begriffsabgrenzung vorzunehmen.
Das Kyoto-Protokoll unterscheidet zwischen Emissions Reduction Units (ERU),
Certified Emissions Reductions (CER) und Parts of the Assigned Amounts (PAA)
(vgl. Tabelle 3). Die Bezeichnung Assigned Amount Units (AAU) wird in der Litera-
tur synonym verwendet.
Der Unterschied zwischen den einzelnen Begriffen liegt nicht nur im Gebrauch bei
unterschiedlichen Mechanismen des Kyoto-Protokolls, sondern auch in der Be-
trachtungsweise der Treibhausgasreduktionen. Die ERUs und die CERs beschrei-
ben eine Reduktion der Treibhausgase, während die Ausdrücke PAA oder AAU für
das Reduktionsbudget verwendet werden.
23
Die ERUs und die CERs können nur
dann gehandelt werden, wenn sie in PAAs umgewandelt und so dem Emissions-
budget hinzugefügt werden können.
21
vgl. BMU (1999a), S. 4
22
vgl. Zhang et al. (1999), S. 323
23
Im Sinne des Kyoto-Protokolls kann davon ausgegangen werden, daß die Sichtweise des Emis-
sionsbudgets vorherrschen soll. Daraus kann die Schlußfolgerung gezogen werden, daß nicht
die Emissionsverringerung das Handelsobjekt ist, sondern die Emissionsrechte. (vgl. Dutschke,
et al. (1998), S. 9)
9
Tabelle 3: Bezeichnung der Emissionskontingente
Bezeichnung der Emissions-
Kontingente
Anwendung
Betrachtungsweise
Emissions Reduction Units (ERU) Joint Implementation
Reduktion der Treib-
hausgase
Certified Emissions Reductions
(CER)
Clean Development
Reduktion der Treib-
hausgase
Parts of the Assigned Amounts
(PAA) oder Assigned Amount
Units (AAU)
Emissionshandel
Reduktionsbudget
2.3.2. Die Komponenten der flexiblen Mechanismen
Die flexiblen Mechanismen des Kyoto-Protokolls können in drei Hauptgruppen
eingeteilt werden. Sie unterscheiden sich durch eine sachliche, eine räumliche
sowie eine zeitliche Komponente. Einen Überblick darüber gibt Tabelle 4. Im
Rahmen dieser Arbeit werden nur die flexiblen Mechanismen näher betrachtet, die
Gegenstand der internationalen Diskussion sind. Dies sind alle räumlichen Flexibi-
litäten, der Mechanismus der Senken und Quellen sowie der Mechanismus des
Banking. Für alle diese Mechanismen müssen noch verbindliche Regeln festgelegt
werden.
10
Tabelle 4: Flexibilitäten innerhalb des Kyoto-Protokolls; Quelle: Skea et al. (1999),
S. 357, eigene Darstellung
Art der
Flexibilität
Anwendung
durch
Erklärung der Ansatzes
Korb aus sechs
verschiedenen
Gasen
Die verschiedenen Gase können durch Um-
rechnung in ,,global warming potentials" zu-
sammengerechnet werden.
Sachliche
Flexibilität
Senken und
Quellen
CO
2
kann in Senken gebunden werden und
kann dann von dem Emissionen abgezogen
werden. Bei Quellen ist es umgekehrt.
Bubbels (Blasen)
Emissionen können innerhalb einer Blase unter
den Ländern aufgeteilt werden.
Joint Implemen-
tation
Gemeinsame Projekte innerhalb der Annex 1
Staaten.
Clean Develop-
ment Mechanism
Gemeinsame Projekte der Annex 1 Staaten mit
den Entwicklungsländern
Räumliche
Flexibilität
Emissionshandel
Handel von AAUs zwischen den Annex B Staa-
ten
5-jähriger Ver-
pflichtungs-
zeitraum
Ausgleich von umweltbedingten Schwankungen
beim Treibhausgasausstoß zwischen 2008 und
2012
Wahl des Basis-
jahres
Je nach Art des Treibhausgases und der wirt-
schaftlichen Entwicklung der Länder kann ein
unterschiedliches Basisjahr gewählt werden.
Emissions Ban-
king
Überschüssige Emissionszertifikate können in
spätere Perioden verschoben werden.
Zeitliche
Flexibilität
Clean Develop-
ment Mechanism
CERs aus den Jahren 2000-2007 können in der
Zielperiode 2008-2012 angerechnet werden.
2.3.3. Der Handel mit Emissionszertifikaten
Nach Brockmann et al. ist ,,der Handel mit Emissionsrechten nach Artikel 17 des
Kyoto-Protokolls ... in seinem Grundverständnis als ein Zertifikatesystem zu inter-
pretieren".
24
Im Unterschied zu den anderen Mechanismen ist er nicht projektbe-
zogen. Er ermöglicht es den Vertragsparteien, ihre für den Zeitraum von 2008
2012 verbindlich festgelegten Emissionsbudgets zu unter- oder überschreiten und
überschüssige Zertifikate auf dem internationalen Markt zu verkaufen oder zusätz-
lich benötigte Emissionszertifikate zu erwerben.
25
24
Brockmann et al. (1998), S. 56
25
vgl. Jochem, Anette (1999), S. 350
11
Der Handel mit Emissionszertifikaten wurde erst sehr spät in das Kyoto-Protokoll
eingefügt. Daher sind dort auch keinerlei nähere Angaben dazu gemacht. Im Arti-
kel 17 wird lediglich darauf verwiesen, daß die ,,Konferenz der Vertragsparteien"
die ,,maßgeblichen Grundsätze, Modalitäten, Regeln und Leitlinien, insbesondere
für die Kontrolle, die Berichterstattung und die Rechenschaftslegung" festlegt.
26
2.3.3.1. Teilnahme am Handel
Der Artikel 17 des Kyoto-Protokolls beschränkt die Möglichkeit zur Teilnahme am
Handel auf die Annex B Staaten
27
und weist darauf hin, daß der Handel mit Emis-
sionsrechten nur als Ergänzung ,,zu den im eigenen Land ergriffenen Maßnahmen
zur Erfüllung der quantifizierten Emissionsbegrenzungs - und Reduktionsverpflich-
tungen" anzusehen ist. Grundlage für die Teilnahme am Handel ist die Schaffung
eines nationalen Emissionsinventars nach Artikel 7 des Kyoto-Protokolls bis zum
ersten Verpflichtungszeitraum 2008 bis 2012, mit dem die Länder die jährlichen
Emissionen gegenüber der zuständigen Behörde dokumentieren müssen. Ohne
dieses Inventar wäre die Nachprüfbarkeit der Handelsgrundlagen nicht gegeben.
Um genaue Zahlen zur Schaffung des Inventars zur Verfügung zu haben, soll je-
des Land nach Artikel 5 Abs. 1 ein nationales System zur Berechnung von Treib-
hausgasemissionen und deren Reduzierung durch Senken bis spätestens ein Jahr
vor Beginn des Verpflichtungszeitraums implementieren.
28
In der neueren Auslegung des Artikels 17 wird auch die Teilnahme von ,,autorisier-
ten juristischen Personen" am Handel nicht mehr ausgeschlossen, da der Proto-
kolltext dies nicht explizit ausschließt.
29
Man verspricht sich von der Teilnahme
dieser privaten Akteure einen liquideren und effizienteren Markt, da die Anzahl der
gehandelten Zertifikate dadurch ansteigen wird.
26
vgl. United Nations (1997a)
27
Die Liste der Länder des Annex B ist weitgehend identisch mit der Liste des Annex I der
UNFCCC. Es gibt allerdings sowohl Länder, die im Annex I, aber nicht im Annex B aufgeführt
sind. Dies sind die Türkei und Weißrußland. Umgekehrt sind Länder wie zum Beispiel Kroatien
und Slowenien im Annex B aber nicht im Annex I enthalten (vgl. Schwarze et al. (1998), S. 11)
28
vgl. United Nations (1997a)
29
vgl. OECD (1999a), S. 14
12
2.3.3.2. Zeitpunkt des Emissionshandels
Im Protokoll von Kyoto ist nicht geklärt, ab welchem Zeitpunkt Emissionsrechte
gehandelt werden sollen. Der Handel kann nach Artikel 3 des Kyoto-Protokolls ab
dem Jahr 2008 beginnen, oder jederzeit danach.
30
Vorher ist es nur möglich, Futu-
res auf die Emissionszertifikate zu handeln, falls sich entsprechende Strukturen
bilden. Dazu ist aber das Inkrafttreten des Kyotoprotokolls notwendig.
31
Aus markt-
technischer Sicht betrachtet wird sich der Handel weniger am Anfang der Zielperi-
ode abspielen, sondern sich vielmehr gegen das Ende der Zielperiode hin ver-
schieben. Am Anfang der Zielperiode besteht bei den Marktteilnehmern noch kei-
ne genaue Kenntnis über den tatsächlichen eigenen Bedarf an Emissionszertifika-
ten, was den Handel zu Beginn der Zielperiode nur unter erhöhter Unsicherheit
gestatten wird. Je näher man dem Ende der Zielperiode kommt desto genauer läßt
sich der Bedarf bestimmen.
32
Das bedeutet auch, daß der Zertifikatemarkt zum
Ende der Zielperiode hin immer besser funktioniert und die sich bildenden Preise
wesentlich genauer die Höhe der Grenzvermeidungskosten abbilden werden. Dies
erhöht die ökonomische Effizienz für die Marktteilnehmer (vgl. Kapitel 3.1.2). Es
besteht aber auch die Gefahr von hohen Preisschwankungen und Zertifikatsprei-
sen wenn die Marktteilnehmer am Ende der Zielperiode des Kyoto-Protokolls zu
spät in den Markt eintreten, da zu einem bestimmten Zeitpunkt jeder Emittent im
Besitzt der benötigten Zertifikate sein muß. Dies kann zum Beispiel aus Spekulati-
onsgründen der Fall sein, wenn die Nachfrager auf sinkende und die Anbieter auf
steigende Preise setzen. Eine Möglichkeit diesem Sachverhalt zu begegnen ist,
den fixen Endzeitpunkt, den das Kyoto-Protokoll vorgibt, zu entzerren und eine
Abgleichungsperiode einzuführen.
33
30
vgl. United Nations (1997a)
31
vgl. OECD (1999a), S. 11 und S. 14
32
vgl. Dutschke et al. (1998c), S. 49
33
vgl. Dutschke et al. (1998c), S. 49
13
2.3.3.3. Die nationale und die internationale Ebene beim Emissionshandel nach
dem Protokoll von Kyoto
Es gibt beim Handel mit Emissionsrechten im Rahmen des Protokolls von Kyoto
zwei unterschiedliche Ebenen, zum einen die internationale Ebene und zum an-
deren die nationale Ebene.
Bei dem Handel auf internationaler Ebene zwischen den einzelnen Staaten nach
§17 des Kyoto-Protokolls ist den Staaten mit Reduktionsverpflichtungen gemäß
Annex B des Kyoto-Protokolls der Handel mit Emissionszertifikaten erlaubt. Die
Formulierung des Artikels 17 ist so gewählt, daß eine konkrete Form der Ausges-
taltung des Emissionshandels noch völlig offen ist.
34
Auf dieser Ebene besteht
hinsichtlich des innerstaatlichen Handels zwischen Unternehmen Konsens, daß
die dafür nötigen Entscheidungen die einzelnen Länder zu treffen haben. Die Län-
der bleiben aber nach außen hin alleine für die Zielerreichung verantwortlich. Die
Regeln und der Spielraum für den Handel von Unternehmen aus unterschiedli-
chen Staaten untereinander sind noch völlig unklar und erst im Ansatz diskutiert
worden.
35
Bei dem Handel auf nationaler Ebene innerhalb der einzelnen Staaten und inner-
halb der EU-Blase werden die Zertifikate auch zwischen Unternehmen und ande-
ren juristischen Personen gehandelt was zu einem größeren und damit effiziente-
ren Markt führt (vgl. Kapitel. 3.1.2).
2.3.4. Joint Implementation (JI)
Der Mechanismus des Joint Implementation
36
dient der flexiblen Emissionszieler-
reichung innerhalb der Staaten des Annex 1. Im folgenden sollen die Wirkungs-
weise sowie die Projektorganisation beim Joint Implementation näher erläutert,
und das Joint Implementation gegenüber den Activities Implemented Jointly abge-
grenzt werden.
34
vgl. Schwarze et al. (1998), S. 11
35
vgl. BMU (1999a), S. 5
36
gemeinsame Erfüllung von Verpflichtungen
14
2.3.4.1. Definition und Wirkungsweise des Joint Implementation
Das Kyoto-Protokoll definiert JI ,,als klimapolitische Zusammenarbeit zwischen
Parteien mit Reduktionspflichten und als Handel mit Emissionsgutschriften aus
gemeinschaftlichen Projekten".
37
Man versteht darunter die gemeinsame Umset-
zung (Joint Implementation) projektbezogener Aktivitäten zur Erreichung der Re-
duktionsverpflichtungen.
38
Die ökonomische Grundidee von JI liegt im Bestreben,
die unterschiedlichen Grenzvermeidungskosten in verschiedenen Ländern auszu-
nutzen. Es wird Ländern oder auch privaten Emittenten mit hohen Grenzvermei-
dungskosten ermöglicht, Projekte in Ländern mit geringeren Grenzvermeidungs-
kosten durchzuführen.
39
Das KP regelt diese Aktivitäten im Artikel 6, der ausdrücklich darauf hinweist, daß
solche Projekte nur innerhalb der Staaten des Annex 1 erlaubt sind.
40
Dabei soll ,,ein Investor oder eine Gruppe von Investoren... in Maßnahmen inves-
tieren, um Treibhausgasemissionen zu reduzieren oder die Bildung von CO
2
Sen-
ken zu fördern".
41
2.3.4.2. Projektorganisation beim Joint Implementation
Die Abbildung 1 zeigt das grundlegende Modell des JI. Die eigentliche Projektab-
wicklung zur Emissionsminderung findet dabei zwischen Investor und Empfänger
statt. Bei den Staaten, die hier die Schlüsselinstanzen darstellen, handelt es sich
ausschließlich um Vertragsstaaten des Annex 1 mit mengenmäßig definierten E-
missionsreduktionszielen (QUELROs). Die Staaten sind Mittler zwischen der
UNFCCC und den Akteuren vor Ort. Dies können Unternehmen oder sonstige
staatliche Institutionen sein.
42
Gegenüber der UNFCCC nehmen sie die Rolle des
Vollziehenden an und gegenüber den innerstaatlichen JI-Teilnehmern die Rolle
37
Schwarze et al. (1998), S. 10
38
vgl. Brockmann et al. (1999), S. 13
39
vgl. Brockmann et al. (1999), S. 41
40
vgl. United Nations (1997a)
41
Henrichs, Ralf (1997), S. 326
42
vgl. Banholzer, Kai (1996), S. 15
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Originalausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2001
- ISBN (eBook)
- 9783832443399
- ISBN (Paperback)
- 9783838643397
- DOI
- 10.3239/9783832443399
- Dateigröße
- 625 KB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- Technische Universität Darmstadt – unbekannt, Volkswirtschaftslehre
- Erscheinungsdatum
- 2001 (Juli)
- Note
- 1,7
- Schlagworte
- emissionshandel emissionszertifikate mechanismen kyoto-protokoll umweltpolitik
- Produktsicherheit
- Diplom.de