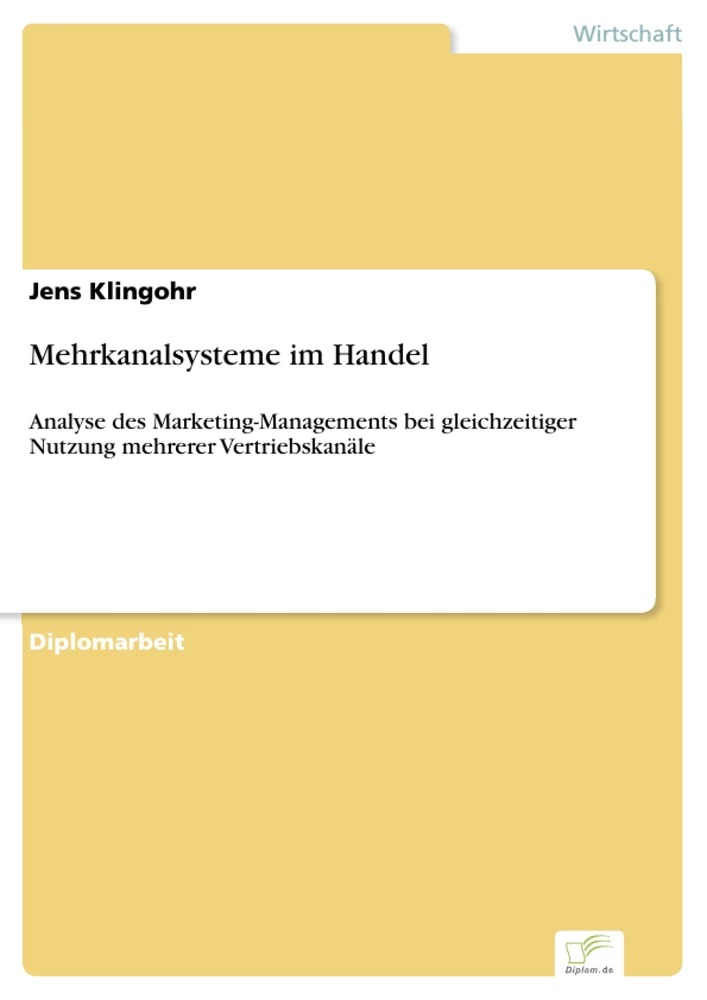Mehrkanalsysteme im Handel
Analyse des Marketing-Managements bei gleichzeitiger Nutzung mehrerer Vertriebskanäle
©2001
Diplomarbeit
116 Seiten
Zusammenfassung
Inhaltsangabe:Einleitung:
Mehrkanalsysteme im Handel auch als Multi Channel Retailing bezeichnet sind heute ein hochaktuelles Thema, reichen aber eigentlich weit in die Vergangenheit zurück. Multi Channel Retailing ist so alt wie Sears, Montgomerey Ward etc., die alle ihr Sortiment über den Katalog parallel zu ihren stationären Geschäften schon seit dem letzten Jahrhundert verkauft haben. In Zukunft wird der Verkauf über virtuelle Geschäfte und der Aufbau einer Online-Beziehung zum Kunden zur Kernfähigkeit traditioneller Handelsunternehmen werden. Mehrkanalsysteme werden in der Zukunft für die Wettbewerbsposition von großer Bedeutung sein.
Ich möchte in dieser Arbeit dieses komplexe Thema analysieren und dabei insbesondere auf den Marketingbereich eingehen. Hierbei sollen verschiedene Vertriebskanäle des Einzelhandels unterschiedlicher Branchen berücksichtigt werden.
Schwerpunkte der Arbeit werden die Entscheidungsfelder, die den Unternehmen in Mehrkanalssystemen zugrunde liegen, sowie die Auswirkungen und die Handlungsmöglichkeiten im Marketing sein. Hierbei möchte ich insbesondere auf das Customer Relationship Management eingehen.
Gang der Untersuchung:
In Kapitel 2 werde ich zunächst Grundlagen und begriffliche Abgrenzungen im Handel ansprechen, die auf der einen Seite die allgemeine Handelslandschaft betreffen, auf der anderen Seite aber auch Auswirkungen auf Mehrkanalsysteme haben.
In Kapitel 3 werden die für das Thema relevanten Trends, Entwicklungen und Rahmenbedingungen betrachtet.
In Kapitel 4 sollen dann die verschiedenen Optionen des Handelsmarketings in Bezug auf einzelne Vertriebskanäle angesprochen werde. Dabei werde ich zunächst auf den allgemeinen Ablauf der Marketingkonzeption im Handel sowie auf die Umsetzungsmöglichkeiten von Handelsmarketinginstrumenten in einzelnen Vertriebskanälen eingehen. Dabei sollen auch relevante Life Cycle Modelle näher untersucht werden, da diese sowohl auf einzelne Vertriebskanäle als auch auf Mehrkanalsysteme Auswirkungen haben.
Kapitel 5 stellt den Hauptteil der Arbeit dar und soll Marketing bei gleichzeitiger Nutzung mehrerer Vertriebskanäle genauer analysieren. In diesem Kapitel soll zuerst eine Annäherung an den Begriff Mehrkanalsystem bzw. Multi Channel Retailing stattfinden. Dazu möchte ich sowohl verschiedene Aussagen und Statements von Wissenschaftlern als auch von Unternehmensvertretern anführen und darauf aufbauend, eine mögliche Definition für Multi Channel Retailing aufstellen. […]
Mehrkanalsysteme im Handel auch als Multi Channel Retailing bezeichnet sind heute ein hochaktuelles Thema, reichen aber eigentlich weit in die Vergangenheit zurück. Multi Channel Retailing ist so alt wie Sears, Montgomerey Ward etc., die alle ihr Sortiment über den Katalog parallel zu ihren stationären Geschäften schon seit dem letzten Jahrhundert verkauft haben. In Zukunft wird der Verkauf über virtuelle Geschäfte und der Aufbau einer Online-Beziehung zum Kunden zur Kernfähigkeit traditioneller Handelsunternehmen werden. Mehrkanalsysteme werden in der Zukunft für die Wettbewerbsposition von großer Bedeutung sein.
Ich möchte in dieser Arbeit dieses komplexe Thema analysieren und dabei insbesondere auf den Marketingbereich eingehen. Hierbei sollen verschiedene Vertriebskanäle des Einzelhandels unterschiedlicher Branchen berücksichtigt werden.
Schwerpunkte der Arbeit werden die Entscheidungsfelder, die den Unternehmen in Mehrkanalssystemen zugrunde liegen, sowie die Auswirkungen und die Handlungsmöglichkeiten im Marketing sein. Hierbei möchte ich insbesondere auf das Customer Relationship Management eingehen.
Gang der Untersuchung:
In Kapitel 2 werde ich zunächst Grundlagen und begriffliche Abgrenzungen im Handel ansprechen, die auf der einen Seite die allgemeine Handelslandschaft betreffen, auf der anderen Seite aber auch Auswirkungen auf Mehrkanalsysteme haben.
In Kapitel 3 werden die für das Thema relevanten Trends, Entwicklungen und Rahmenbedingungen betrachtet.
In Kapitel 4 sollen dann die verschiedenen Optionen des Handelsmarketings in Bezug auf einzelne Vertriebskanäle angesprochen werde. Dabei werde ich zunächst auf den allgemeinen Ablauf der Marketingkonzeption im Handel sowie auf die Umsetzungsmöglichkeiten von Handelsmarketinginstrumenten in einzelnen Vertriebskanälen eingehen. Dabei sollen auch relevante Life Cycle Modelle näher untersucht werden, da diese sowohl auf einzelne Vertriebskanäle als auch auf Mehrkanalsysteme Auswirkungen haben.
Kapitel 5 stellt den Hauptteil der Arbeit dar und soll Marketing bei gleichzeitiger Nutzung mehrerer Vertriebskanäle genauer analysieren. In diesem Kapitel soll zuerst eine Annäherung an den Begriff Mehrkanalsystem bzw. Multi Channel Retailing stattfinden. Dazu möchte ich sowohl verschiedene Aussagen und Statements von Wissenschaftlern als auch von Unternehmensvertretern anführen und darauf aufbauend, eine mögliche Definition für Multi Channel Retailing aufstellen. […]
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
ID 4557
Klingohr, Jens: Mehrkanalsysteme im Handel: Analyse des Marketing-Managements bei
gleichzeitiger Nutzung mehrerer Vertriebskanäle / Jens Klingohr -
Hamburg: Diplomica GmbH, 2001
Zugl.: Saarbrücken, Universität, Diplom, 2001
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte, insbesondere die
der Übersetzung, des Nachdrucks, des Vortrags, der Entnahme von Abbildungen und Tabellen,
der Funksendung, der Mikroverfilmung oder der Vervielfältigung auf anderen Wegen und der
Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen, bleiben, auch bei nur auszugsweiser Verwertung,
vorbehalten. Eine Vervielfältigung dieses Werkes oder von Teilen dieses Werkes ist auch im
Einzelfall nur in den Grenzen der gesetzlichen Bestimmungen des Urheberrechtsgesetzes der
Bundesrepublik Deutschland in der jeweils geltenden Fassung zulässig. Sie ist grundsätzlich
vergütungspflichtig. Zuwiderhandlungen unterliegen den Strafbestimmungen des
Urheberrechtes.
Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in diesem
Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme, dass solche
Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei zu betrachten
wären und daher von jedermann benutzt werden dürften.
Die Informationen in diesem Werk wurden mit Sorgfalt erarbeitet. Dennoch können Fehler nicht
vollständig ausgeschlossen werden, und die Diplomarbeiten Agentur, die Autoren oder
Übersetzer übernehmen keine juristische Verantwortung oder irgendeine Haftung für evtl.
verbliebene fehlerhafte Angaben und deren Folgen.
Diplomica GmbH
http://www.diplom.de, Hamburg 2001
Printed in Germany
Wissensquellen gewinnbringend nutzen
Qualität, Praxisrelevanz und Aktualität zeichnen unsere Studien aus. Wir
bieten Ihnen im Auftrag unserer Autorinnen und Autoren Wirtschafts-
studien und wissenschaftliche Abschlussarbeiten Dissertationen,
Diplomarbeiten, Magisterarbeiten, Staatsexamensarbeiten und Studien-
arbeiten zum Kauf. Sie wurden an deutschen Universitäten, Fachhoch-
schulen, Akademien oder vergleichbaren Institutionen der Europäischen
Union geschrieben. Der Notendurchschnitt liegt bei 1,5.
Wettbewerbsvorteile verschaffen Vergleichen Sie den Preis unserer
Studien mit den Honoraren externer Berater. Um dieses Wissen selbst
zusammenzutragen, müssten Sie viel Zeit und Geld aufbringen.
http://www.diplom.de bietet Ihnen unser vollständiges Lieferprogramm
mit mehreren tausend Studien im Internet. Neben dem Online-Katalog und
der Online-Suchmaschine für Ihre Recherche steht Ihnen auch eine Online-
Bestellfunktion zur Verfügung. Inhaltliche Zusammenfassungen und
Inhaltsverzeichnisse zu jeder Studie sind im Internet einsehbar.
Individueller Service
Gerne senden wir Ihnen auch unseren Papier-
katalog zu. Bitte fordern Sie Ihr individuelles Exemplar bei uns an. Für
Fragen, Anregungen und individuelle Anfragen stehen wir Ihnen gerne zur
Verfügung. Wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit.
Ihr Team der Diplomarbeiten Agentur
2001 Jens Klingohr
I
Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis ...I
Abkürzungsverzeichnis ...IV
Abbildungsverzeichnis ...VI
1 Einleitung ...1
2 Grundlagen
und
begriffliche Abgrenzungen ...2
2.1
Vertriebssystem und Vertriebskanäle...2
2.2
Definitionen und Rahmenbedingungen relevanter Vertriebskanäle...3
2.2.1 Grundlagen ...3
2.2.2 Stationärer
Handel ...3
2.2.2.1 Kleinflächige
Betriebstypen ...3
2.2.2.2 Großflächige
Betriebstypen...4
2.2.3 Virtueller
Handel ...5
2.2.3.1 E-Commerce...5
2.2.3.2 M-Commerce...5
2.2.3.3 TV-Shopping ...7
2.2.4 Versandhandel ...7
3
Ausgewählte Trends, Entwicklungen und Rahmenbedingungen ...8
3.1 Einführung...8
3.2 Konsumententrends ...8
3.3
Trends in der Informationstechnologie ...9
3.4
Trends und Entwicklungen im Handel ...11
4
Optionen des Handelsmarketing...11
4.1
Marketingmanagement im Handel ...11
4.2
Umsetzungsmöglichkeiten von Handelsmarketinginstrumenten in einzelnen
Vertriebskanälen...15
4.2.1 Einführung...15
4.2.2
Lifecycle Modelle im Kundenmanagement ...16
4.2.3 Sortimentspolitik ...18
4.2.4
Preis- und Konditionenpolitik ...23
4.2.5 Kommunikationspolitik...27
5
Marketing bei gleichzeitiger Nutzung mehrerer Vertriebskanäle ...31
5.1
Definition von Mehrkanalsystemen im Handel bzw. von Multi Channel Retailing 31
5.2
Multi Channel Retailing vs. Diversifikation ...34
2001 Jens Klingohr
II
5.3
Generelle Gründe für die Wahl eines Mehrkanalsystems ...34
5.4
Risikofaktoren bei der Wahl von Mehrkanalsystemen...36
5.5 Mögliche
Vertriebskanalkombinationen ...37
5.6
Fokus: Multi Channel Retailing bei Kombination von stationärem Vertrieb mit dem
Vertrieb über das Internet ...38
5.6.1
Determinanten der Wahl dieser Kombination...38
5.6.1.1 Determinanten aus Unternehmenssicht ...38
5.6.1.2 Determinanten aus Kundensicht...39
5.6.2 Grundlegende
Entscheidungsfelder...40
5.6.2.1 Stationärer vs. elektronischer Handel...40
5.6.2.2 Auswahl geeigneter Ergänzungskanäle...41
5.6.2.3 Realisationsformen der Vertriebskanäle...43
5.6.2.4 Nutzungsoptionen
zusätzlicher Vertriebskanäle ...44
5.6.2.5 Bestimmung des Leistungsprogramms...45
5.6.2.6 Bestimmung der Zielgruppe ...47
5.6.2.7 Branding der Vertriebskanäle...49
5.6.3
Strategische Managementprozesse im Multi Channel Marketing...50
5.6.3.1 Aufgabenverteilung
in
Mehrkanalsystemen...50
5.6.3.2 Customer
Relationship
Management in Mehrkanalsystemen ...51
5.6.3.2.1 Grundlagen ...51
5.6.3.2.2 CRM, eCRM und mCRM...52
5.6.3.2.3 Der Customer Relationship Management Cycle ...55
5.6.3.2.4 Das Konzept der Loyalität...56
5.6.3.2.5 Kundeninformationsmanagement über mehrere Kanäle ...58
5.6.3.2.6 Sortiments-und
Preispolitik ...61
5.6.3.2.7 Multikanalkommunikation ...65
5.6.3.2.8 Kanalübergreifende
Kundenkartensysteme...66
5.6.3.2.9 Weitere kanalübergreifende Möglichkeiten im Beziehungsmarketing ..68
5.6.3.2.10 Multi Channel Management im Customer Relationship Management 70
5.6.3.2.11 Besonderheiten eines integrierten CRM...70
5.6.3.3 Category Management in Mehrkanalsystemen ...73
5.6.3.3.1 Grundlagen ...73
5.6.3.3.2 Ziele des Category Management aus Handelssicht ...74
5.6.3.3.3 Organisation im Category Management...76
2001 Jens Klingohr
III
5.6.3.3.4 Kundenorientierung im Category Management ...77
5.6.4
Die Bedeutung der Multi Channel Strategie...78
5.6.4.1 Die Bedeutung der Integration ...78
5.6.4.2 Die wirtschaftliche Bedeutung der Multi Channel Strategie im Vergleich zu
den Pure Plays ...79
6 Fallstudie:
Beispiele
für
Multi Channel Strategien ...86
6.1
Die Multi Channel Strategie der Douglas Holding AG...86
6.2
Die Multi Channel Strategie der Möbel Walther AG...89
6.3
Die Multi Channel Strategie der CoopGruppe ...90
6.4
Die Multi Channel Strategie der Markant Südwest Handels AG...92
7 Fazit ...94
Literaturverzeichnis... VIII
Verzeichnis
der
Gesprächspartner... XV
2001 Jens Klingohr
IV
Abkürzungsverzeichnis
a.M.
am
Main
Abb.
Abbildung
AG
Aktiengesellschaft
Aufl.
Auflage
B2B
Business
to
Business
B2C
Business
to
Consumer
Bed.
Bedingungen
bzw.
beziehungsweise
ca.
circa
CBC
Customer
Buying
Cycle
CD
Compact
Disc
CEO
Chief
Executive
Officer
CM
Category
Management
CRM
Customer
Relationship
Management
d.h.
das
heißt
DHTML
Dynamic Hypertext Markup Language
Diss.
Dissertation
DM
Deutsche
Mark
E-Commerce
Electronic Commerce
ECR
Efficient
Consumer
Response
eCRM
Electronic Customer Relationship Management
E-Mail
Electronic
Mail
ERP
Enterprise
Resource
Planning
etc.
et
cetera
ggf.
gegebenenfalls
GmbH
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
GPRS
General Packet Radio Service
GSM
Global System For Mobile Communications
Hrsg.
Herausgeber
HTML
Hypertext
Markup
Language
i.d.R.
in
der
Regel
i.e.S.
im
engeren
Sinne
i.w.S.
im
weiteren
Sinne
IP
Internet
Protocol
IpnG
Internet Protocol Next Generation
IT
Informationstechnik
IuK-Technologie
Informations- und Kommunikationstechnologie
Jg.
Jahrgang
LEH
Lebensmitteleinzelhandel
M-Commerce
Mobile Commerce
MCR
Multi
Channel
Retailing
mCRM
Mobile Customer Relationship Management
Mio.
Millionen
Mrd.
Milliarden
Nr.
Nummer
NRF
National
Retail
Foundation
o.Jg.
ohne
Jahrgang
o.V.
ohne
Verfasser
PC
Personal
Computer
POS
Point
of
Sale
2001 Jens Klingohr
V
PR
Public
Relations
qm
Quadratmeter
rechtl.
rechtliche
ROM
Read
Only
Memory
S.
Seite
SB
Selbstbedienung
SMS
Short
Message
Service
St.
Sankt
Tab.
Tabelle
TV
Television
u.a.
und
andere
U.S.
United
States
UMTS
Universal Mobile Telephone System
USA
United States of America
USP
Unique
Selling
Position
Vgl.
Vergleiche
VRML
Virtual
Modelling
Language
vs.
versus
WAP
Wireless
Application
Protocol
WS
Wintersemester
WWW
World
Wide
Web
z.B.
zum
Beispiel
ZFP
Zeitschrift für Forschung und Praxis
2001 Jens Klingohr
VI
Abbildungsverzeichnis
Abb. 1: Produkt- und Dienstleistungsauswahl im E-Commerce und M-Commerce ...6
Abb. 2: Anwendungsgebiete neuer Technologien im Handel...10
Abb. 3: Marketingmanagementprozess im Handel ...12
Abb. 4: Marketingzielsystem des Handels ...13
Abb. 5: Marketingstrategien des Handels im Gesamtzusammenhang ...14
Abb. 6: Kundenlebenszyklus...16
Abb. 7: Customers' Life Stage ...17
Abb. 8: Der Customer Buying Cycle ...18
Abb. 9: Bestimmungsfaktoren der Sortimentspolitik...19
Abb. 10: Auswahlkriterien für einzelne Produkte ...20
Abb. 11: Rahmenfaktoren der Preispolitik...23
Abb. 12: Preisabsatzfunktion...24
Abb. 13: Preislagenstruktur verschiedener Betriebstypen des stationären Handels...25
Abb. 14: Entscheidungsbereiche der Präsentationspolitik ...28
Abb. 15: Ziele der Verkaufsraumgestaltung...29
Abb. 16: Die Wahl des Betriebstyps ...40
Abb. 17: Stärken der Vertriebskanäle ...43
Abb. 18: Nutzungsoptionen bei Multi Channel Playern...44
Abb. 19: Sortimentskontinuum ...45
Abb. 20: Sortimentsüberschneidung ...46
Abb. 21: Zielgruppenkontinuum ...47
Abb. 22: Kaufverhalten der drei Kundengruppen ...48
Abb. 23: Fragenkatalog zur Identifizierung möglicher Einkaufssituationen ...48
Abb. 24: Kontinuum der Aufgabenverteilung in Mehrkanalsystemen...50
Abb. 25: Bestandteile eines Customer Relationship Management-Systems...53
Abb. 26: Value-to-Customer Management ...54
Abb. 27: Der Customer Relationship Management-Cycle...55
Abb. 28: The Path to Strategic Customer Care ...56
Abb. 29: From Customer Acquisition to Strategic CRM ...57
Abb. 30: Category-Bewertung bei Coop ...74
Abb. 31: Ziele des Handels im Category Management...75
Abb. 32: Umsatzanteile der Multi Channel Anbieter und der Pure Plays...81
2001 Jens Klingohr
VII
Abb. 33: Performance europäischer Einzelhändler vs. Gesamtmarkt ...82
Abb. 34: Online-Retailer vs. etablierte Einzelhändler...83
Abb. 35: Performance von Peapod vs. Europäischer Einzelhändler ...84
Abb. 36: Quantitative Bewertung von Multi Channel Playern ...84
Abb. 37: Qualitative Bewertung von Multi Channel Playern ...85
Abb. 38: Anlageurteile und Kursziele von Multi Channel Playern...86
Abb. 39: Die Stärken der Douglas Holding AG...87
2001 Jens Klingohr
1
1 Einleitung
Mehrkanalsysteme im Handel auch als Multi Channel Retailing bezeichnet sind heute ein
hochaktuelles Thema, reichen aber eigentlich weit in die Vergangenheit zurück. Multi
Channel Retailing ist so alt wie Sears, Montgomerey Ward etc., die alle ihr Sortiment über
den Katalog parallel zu ihren stationären Geschäften schon seit dem letzten Jahrhundert
verkauft haben.
1
In Zukunft wird der Verkauf über virtuelle Geschäfte und der Aufbau einer
Online-Beziehung zum Kunden zur Kernfähigkeit traditioneller Handelsunternehmen werden.
Mehrkanalsysteme werden in der Zukunft für die Wettbewerbsposition von großer Bedeutung
sein.
Ich möchte in dieser Arbeit dieses komplexe Thema analysieren und dabei insbesondere auf
den Marketingbereich eingehen. Hierbei sollen verschiedene Vertriebskanäle des
Einzelhandels unterschiedlicher Branchen berücksichtigt werden.
Schwerpunkte der Arbeit werden die Entscheidungsfelder, die den Unternehmen in
Mehrkanalssystemen zugrunde liegen, sowie die Auswirkungen und die
Handlungsmöglichkeiten im Marketing sein. Hierbei möchte ich insbesondere auf das
Customer Relationship Management eingehen.
In Kapitel 2 werde ich zunächst Grundlagen und begriffliche Abgrenzungen im Handel
ansprechen, die auf der einen Seite die allgemeine Handelslandschaft betreffen, auf der
anderen Seite aber auch Auswirkungen auf Mehrkanalsysteme haben.
In Kapitel 3 werden die für das Thema relevanten Trends, Entwicklungen und
Rahmenbedingungen betrachtet.
In Kapitel 4 sollen dann die verschiedenen Optionen des Handelsmarketings in Bezug auf
einzelne Vertriebskanäle angesprochen werde. Dabei werde ich zunächst auf den allgemeinen
Ablauf der Marketingkonzeption im Handel sowie auf die Umsetzungsmöglichkeiten von
Handelsmarketinginstrumenten in einzelnen Vertriebskanälen eingehen. Dabei sollen auch
relevante Life Cycle Modelle näher untersucht werden, da diese sowohl auf einzelne
Vertriebskanäle als auch auf Mehrkanalsysteme Auswirkungen haben.
Kapitel 5 stellt den Hauptteil der Arbeit dar und soll Marketing bei gleichzeitiger Nutzung
mehrerer Vertriebskanäle genauer analysieren. In diesem Kapitel soll zuerst eine Annäherung
an den Begriff Mehrkanalsystem bzw. Multi Channel Retailing stattfinden. Dazu möchte ich
sowohl verschiedene Aussagen und Statements von Wissenschaftlern als auch von
Unternehmensvertretern anführen und darauf aufbauend, eine mögliche Definition für Multi
1
Vgl. o.V.: Beyond Multichannel Retail,
http://www.chainstoreage.com/archives/search/summary.cfm?ID=2000%5F03%5F01%5F486%5FCSA%5F000
1&T=000, 30. Dezember 2000.
2001 Jens Klingohr
2
Channel Retailing aufstellen. Anschließend sollen generelle Gründe und Risikofaktoren bei
der Entscheidung für Mehrkanalsysteme sowie mögliche Kombinationen der Vertriebskanäle
in Mehrkanalsystemen aufgezeigt werden.
Aufgrund der großen Bedeutung des virtuellen Vertriebs über das Internet und der häufigen
Praktizierung von Mehrkanalsystemen in dieser Kombination möchte ich in Kapitel 5.6
meinen Fokus auf diesen Schwerpunkt legen. Hierbei werde ich zunächst die Determinanten
der Wahl dieser Kombination abgrenzen und dann grundlegende Entscheidungsfelder für die
Unternehmen besprechen. Anschließend sollen die strategischen Managementprozesse des
Customer Relationship Management und des Category Management untersucht werden,
wobei der Schwerpunkt aufgrund des in der Praxis und Theorie fortgeschritteneren Stadiums
im Bereich Customer Relationship Management liegt.
Die Fallstudien in Kapitel 6 basieren auf den Interviews mit den angegebenen
Gesprächspartnern, auf Unterlagen, die zu Vorträgen erstellt wurden sowie auf
Veröffentlichungen der Unternehmen. Dabei sollen Beispiele zum Multi Channel Retailing
völlig unterschiedlicher Branchen aufgezeigt werden.
In Kapitel 7 sollen letztendlich wichtige Punkte nochmals aufgegriffen und zusammengefasst
werden.
2 Grundlagen und begriffliche Abgrenzungen
2.1 Vertriebssystem und Vertriebskanäle
Die Distributionspolitik lässt sich in die akquisitorische und die physische Distribution
unterteilen. Zur akquisitorischen Distribution zählen Absatzmethoden und kanäle
(Absatzwege, Absatzform, Vertriebssystem) sowie der Distributionsgrad (erlösorientiert). Zur
physischen Distribution, auch als Marketinglogistik bezeichnet, zählen die Logistik
(Transportmittel/-weg, Lager/Verpackung, Standort) sowie der Lieferservice
(kostenorientiert).
2
Zwischen beiden Teilgebieten bestehen Interdependenzen, dennoch ist die
Wahl des Absatzweges als vorgeschaltetes Entscheidungsproblem zu verstehen. In dieser
Arbeit liegt der Schwerpunkt im Bereich Marketing und damit in Bezug auf die verschiedenen
Vertriebskanäle im Bereich der akquisitorischen Distribution.
Die akquisitorische Distribution beschäftigt sich mit allen Maßnahmen und Entscheidungen,
die die Absatzmethoden betreffen. Aufgrund der langfristigen Entscheidungen, die die
anderen marketingpolitischen Instrumente stark beeinflussen, wird auch von strategischer
Distribution gesprochen.
2
Vgl. Neu, Matthias: Marketinggrundlagen, 2. Aufl., (Barabas) Würzburg 1998, S. 96, S. 98.
2001 Jens Klingohr
3
Der Distributionskanal im Handel, auch Vertriebskanal oder Absatzweg genannt, beschreibt
den Weg eines Konsumgutes zum Endverbraucher. Das Vertriebssystem umfasst dabei die
Gesamtheit der Vertriebskanäle. Mit der Entscheidung für ein bestimmtes Vertriebssystem
muss das Unternehmen festlegen, welche Schwerpunkte in den einzelnen Absatzkanälen
gesetzt werden sollen. Neue Vertriebskanäle und die Kombination mit bisherigen
Vertriebskanälen bieten hierbei neue Perspektiven.
2.2 Definitionen und Rahmenbedingungen relevanter Vertriebskanäle
2.2.1 Grundlagen
Im Rahmen der Wahl geeigneter Vertriebskanäle muss das Handelsunternehmen eine
Entscheidung über einen oder mehrere Betriebstypen treffen. Die zahlreichen verschiedenen
Betriebstypen unterscheiden sich durch unterschiedliche Kombinationen von
Strukturmerkmalen und absatzpolitischen Instrumentalvariablen.
Zur Entwicklung sei an dieser Stelle erwähnt, dass traditionelle Vertriebswege die
Handelslandschaft in Zukunft unumstritten weiter dominieren werden. Diese Vertriebswege
sind hauptsächlich dem stationären Handel zuzuordnen. Neuere Vertriebswege gewinnen aber
zunehmend an Bedeutung. Sie sind sowohl dem stationären, durch die Entwicklung in der
Informations- und Kommunikationstechnologie aber auch dem virtuellen Handel zuzuordnen.
Sie unterliegen einer besonderen Entwicklungsdynamik, durch die auf der einen Seite völlig
neue Vertriebswege entstanden sind, aber auch traditionelle Vertriebswege in neuer Form eine
Renaissance erfahren haben.
3
Im Folgenden werden nun die für die Arbeit relevanten Betriebstypen des Einzelhandels
definiert. Die Begriffe Distributions-, Vertriebs- und Absatzkanal bzw. -weg sowie der
Begriff channel werden dabei weitgehend synonym und in einer weiten Auslegung im Sinne
der Angebotsformen an die Endkonsumenten verwendet.
2.2.2 Stationärer
Handel
2.2.2.1 Kleinflächige
Betriebstypen
Zu den kleinflächigen Betriebstypen zählt das Fachgeschäft, das als Einzelhandelsbetrieb mit
branchenspezifischem oder bedarfsgruppenorientiertem Sortiment in großer Auswahl, in
3
Vgl. Zentes, Joachim; Swoboda Bernhard: Neue Vertriebswege aus Sicht des Einzelhandels
Erscheinungsformen, Herausforderungen und Strategieoptionen des Handels, in: Tomczak, Torsten u.a. (Hrsg.):
Alternative Vertriebswege, (Thexis) St. Gallen 1999, S. 41-58, S. 41.
2001 Jens Klingohr
4
unterschiedlichen Qualitäten und Preislagen sowie ergänzenden Dienstleistungen, definiert
werden kann.
4
Ein weiterer Betriebstyp ist der Convenience Store, der häufig auch als Nachbarschaftsladen
bezeichnet wird. Es handelt sich hierbei um einen Einzelhandelsbetrieb mit begrenztem
Sortiment an Lebensmitteln und Haushaltswaren auf eher hohem Preisniveau.
5
Dieser
Betriebstyp sollte nicht mit einem miniaturisierten Supermarkt gleichgesetzt werden.
Convenience lässt sich mit Bequemlichkeit übersetzen und meint den bequemen Einkauf, der
jederzeit, schnell und ohne Belastung durchführbar sein muss. Wesentlicher Aspekt dabei ist
der One-Stop-Shopping-Nutzen. Dabei werden die konsequente Kundenorientierung durch
die Schlüsselfaktoren kundennaher Standort, verbraucherfreundliche Öffnungszeiten und
verzehrnahes Sortiment umgesetzt.
6
Zu den Convenience-Betriebstypen zählen unter anderem
Tankstellen, Kioske und Trinkhallen sowie Bahnhofsläden.
2.2.2.2 Großflächige Betriebstypen
Der Betriebstyp des Fachmarkts ist ein großflächiger Einzelhandelsbetrieb mit einem breiten
und tiefen Sortiment eines Waren-, Bedarfs- oder Zielgruppenbereichs bei einem tendenziell
niedrigen bis mittleren Preisniveau. Die Verkaufsverfahren sind Selbstbedienung und
Vorwahl mit Beratung auf Wunsch des Kunden.
7
Verbrauchermarkt und SB-Warenhaus sind beides großflächige Betriebstypen mit breitem
und tiefem Sortiment an Nahrungs- und Genussmitteln sowie Ge- und Verbrauchsgütern des
kurz- und mittelfristigen Bedarfs mit der Verkaufsmethode der Selbstbedienung. Unterschiede
der beiden Betriebstypen sind hauptsächlich in der Größe und damit auch im Umfang des
Sortiments zu finden. Variiert die Größenordnung bei Verbrauchermärkten zwischen 1.500
qm und 4.999 qm, so spricht man ab 5.000 qm von einem SB-Warenhaus.
8
Neben diesen klassisch zu definierenden Betriebstypen gibt es heute neue
Erscheinungsformen, die sich nicht eindeutig dem einen oder anderen Betriebstyp zuordnen
lassen. Zu nennen wären an dieser Stelle sogenannte Lifestyle-Häuser, wie sie von Douglas in
Frankfurt geführt werden.
4
Vgl. Ausschuss für Begriffsdefinitionen aus der Handels- und Absatzwirtschaft (Hrsg.): Katalog E,
Begriffsdefinitionen aus der Handels- und Absatzwirtschaft, 4. Aufl., (Thiele & Schwarz) Kassel 1995, S. 43.
5
Vgl. Ausschuss für Begriffsdefinitionen aus der Handels- und Absatzwirtschaft (Hrsg.): Katalog E,
Begriffsdefinitionen aus der Handels- und Absatzwirtschaft, 4. Aufl., (Thiele & Schwarz) Kassel 1995, S. 48.
6
Vgl. Gyllenvärd, Udo: Der Convenience-Handel auf dem Weg in das nächste Jahrtausend, in: Tomczak,
Torsten u.a. (Hrsg.): Alternative Vertriebswege, (Thexis) St.Gallen 1999, S. 184-193, S. 185.
7
Vgl. Ausschuss für Begriffsdefinitionen aus der Handels- und Absatzwirtschaft (Hrsg.): Katalog E,
Begriffsdefinitionen aus der Handels- und Absatzwirtschaft, 4. Aufl., (Thiele & Schwarz) Kassel 1995, S. 43.
8
Vgl. Ausschuss für Begriffsdefinitionen aus der Handels- und Absatzwirtschaft (Hrsg.): Katalog E,
Begriffsdefinitionen aus der Handels- und Absatzwirtschaft, 4. Aufl., (Thiele & Schwarz) Kassel 1995, S. 46.
2001 Jens Klingohr
5
2.2.3 Virtueller
Handel
2.2.3.1 E-Commerce
Der Begriff E-Commerce wird bisher noch nicht durchgängig einheitlich verwendet. Eine
mögliche Definition ist jedoch die Vermarktung von Unternehmensleistungen mit Hilfe eines
umfassenden Einsatzes neuer Informations- und Kommunikationstechnologien.
9
In Bezug auf
das Distributionsmanagement ist damit ein umfassend elektronisch gestützter Absatzkanal
gemeint. Sowohl beim E-Commerce als auch beim M-Commerce ist die Dialogform die
Zwei-Wege-Kommunikation, bei der der Kunde unmittelbar online mit dem Lieferanten in
Verbindung treten kann. E-Commerce steht dabei antonym zum Offline-Business.
Das WWW ist eines der wichtigsten Dienste im Internet mit Hypertext- und
Multimediafähigkeit. Durch die Programmierung in HTML wird es möglich, Texte mit
Graphiken, Audio, digitalisierten Bildern und sogar Video zu ergänzen. Durch diese
multimediale Möglichkeit der Darstellung wird das WWW zu einer interessanten Plattform
für Produkt- und Informationspräsentationen.
Bei einer engeren Begriffsabgrenzung bezeichnet Dach Interactive Homeshopping als einen
Teilbereich des E-Commerce, unter dem ,,alle Transaktionen verstanden werden, bei denen
mindestens eine der Transaktionsphasen zwischen Anbieter und Nachfrager elektronisch
gestützt wird."
10
Dies sind Transaktionen, bei denen bis auf die Warendistribution alle
Transaktionsphasen elektronisch abgewickelt werden, die im Bereich der beteiligten
Institutionen zum Business-to-Consumer-Bereich zählen, bei denen interaktive Medien mit
zwei Kommunikationskanälen verwendet werden und in Bezug auf den Ort der Nutzung von
zu Hause oder vom Arbeitsplatz genutzt werden.
2.2.3.2 M-Commerce
M-Commerce ist die Kurzbenennung für Mobile Commerce und stellt einen interaktiven
Kommunikationsdienst dar, der sich mobiler Endgeräte wie WAP-Handys oder WAP-
Handhelds bedient.
11
Mit M-Commerce hat man die Möglichkeit, zu jeder Zeit und an jedem
Ort online Dienstleistungen durch den Einsatz moderner Kommunikationstechnologien auf
9
Vgl. Schögel, Marcus; Birkhofer, Ben; Tomczak, Torsten: Einsatzmöglichkeiten des E-Commerce in der
Distribution, in: Tomczak, Torsten u.a. (Hrsg.): Alternative Vertriebswege, (Thexis) St.Gallen 1999, S. 288 -
308, S. 289.
10
Dach, Christian: Der Wettbewerb der Zukunft: Elektronischer vs. Stationärer Handel, in: Mitteilungen des
Instituts für Handelsforschung an der Universität zu Köln, 51. Jg., 1999, Nr. 3, S. 45 57, S. 46.
11
Vgl. B2B Online GmbH (Hrsg.): M-Commerce,
http://www.cybiz.de/business/weblexikon/pages/index.prl?key=m-commerce, 4. Dezember 2000.
2001 Jens Klingohr
6
einfache und benutzerfreundliche Art und Weise in Anspruch zu nehmen.
12
Das Wireless
Application Protokoll (WAP) ermöglicht das Surfen im WWW mit den mobilen Endgeräten
auf der Basis einer grafisch reduzierten Darstellung. Die Datenübertragungsraten sind bei
momentanem GSM-Standard noch sehr gering, welche sich aber mit der Einführung von
UMTS im Jahr 2003 auf ein bis zu 200-faches erhöhen werden, was wiederum die
Möglichkeiten und die Attraktivität des M-Commerce laut Durlacher Report um ein
Vielfaches erhöhen wird. Nach Schätzungen des Marktforschungsinstituts Datamonitor
werden WAP-fähige Mobiltelefone im Jahr 2004 bis zu einem Anteil von 59 % verbreitet sein
und damit auch der Internet-Zugang per Mobiltelefon in Westeuropa nach Prognosen der
International Data Corporation von ca. 100.000 im Jahr 1999 auf über 77 Mio. im Jahr 2004
ansteigen.
13
Diese Zahlen verdeutlichen das enorme Potential, das dem M-Commerce
prognostiziert wird.
M-Commerce unterscheidet sich jedoch erheblich durch unterschiedliches Nutzerverhalten
sowie durch unterschiedliche Dienstleistungen und Produkte vom E-Commerce. Der mobile
Internetzugang wird eher spontan und vorwiegend in ,,Nischenzeiten" genutzt werden.
14
Wie
Abb. 1 verdeutlichen soll, variiert der Wert für den uneingeschränkten Zugang zum Internet
für bestimmte Produkte und Dienstleistungen.
Abb. 1: Produkt- und Dienstleistungsauswahl im E-Commerce und M-Commerce
Quelle: Dean, David; Ketterer, Hanno; Thiel, Wolfgang: IT-Herausforderungen im M-Commerce, in: IM Die
Fachzeitschrift für Information, Management & Consulting, 15. Jg., 2000, Nr. 4, S. 35.
12
Vgl. Wiedmann, Klaus-Peter; Buckler, Frank; Buxel, Holger: Chancenpotentiale und Gestaltungsperspektiven
des M-Commerce, in: Der Markt, 39. Jg., 2000, Nr.153, S. 84 95, S. 84.
13
Vgl. o.V.: M-Banking in Westeuropa auf dem Vormarsch, in: Die Welt, 20.12.2000, S. WWW2, S. WWW2.
14
Vgl. Dean, David; Ketterer, Hanno; Thiel, Wolfgang: IT-Herausforderungen im M-Commerce, in: IM Die
Fachzeitschrift für Information, Management & Consulting, 15. Jg., 2000, Nr. 4, S. 34 37, S. 35.
Wert des jederzeitigen
Zugriffes an jedem Ort
A
us
w
ahl
-K
omp
lex
ität
Niedrig
Niedrig
Hoch
Hoch
Möbel
Autos Urlaub
PCs
Lebens-
mittel
Geschenke
Bücher/Cds
Reise-Ticket
Unterhaltung
Finanzdienst-
leistungen
Ortsunabhängige
Dienste
E-Chancen
M-Chancen
Wert des jederzeitigen
Zugriffes an jedem Ort
A
us
w
ahl
-K
omp
lex
ität
Niedrig
Niedrig
Hoch
Hoch
Möbel
Autos Urlaub
PCs
Lebens-
mittel
Geschenke
Bücher/Cds
Reise-Ticket
Unterhaltung
Finanzdienst-
leistungen
Ortsunabhängige
Dienste
Wert des jederzeitigen
Zugriffes an jedem Ort
A
us
w
ahl
-K
omp
lex
ität
Niedrig
Niedrig
Hoch
Hoch
Wert des jederzeitigen
Zugriffes an jedem Ort
A
us
w
ahl
-K
omp
lex
ität
Niedrig
Niedrig
Hoch
Hoch
Möbel
Autos Urlaub
PCs
Lebens-
mittel
Geschenke
Bücher/Cds
Reise-Ticket
Unterhaltung
Finanzdienst-
leistungen
Ortsunabhängige
Dienste
E-Chancen
M-Chancen
2001 Jens Klingohr
7
2.2.3.3 TV-Shopping
Unter der grundsätzlichen Begriffsdefinition des TV-Shopping versteht man die elektronische
Einkaufsform, bei der Verkaufsangebote über das Medium Fernsehen abgegeben werden.
15
Bei genauerer Untersuchung können die Formen Direct Response Television-Spots ,
Infomercials und TV-Shoppingsender unterschieden werden, wobei ich den Begriff des TV-
Shopping hier auf TV-Shoppingsender begrenzen möchte. Der erste TV-Shoppingsender
Deutschlands war im Jahr 1995 Home Order Television (H.O.T.), 1996 kam ein zweiter
Sender mit QVC dazu.
Im Gegensatz zum E- oder M-Commerce handelt es sich bisher noch um eine Ein-Weg-
Kommunikation, d.h. es ist nur der mittelbare Dialog über Medien wie Telefon, Fax oder
Brief möglich.
Mit Set-Top-Boxen wird jedoch zukünftig auch eine Zwei-Wege-Kommunikation
ermöglicht.
16
Des Weiteren bietet interaktives Fernsehen, auch als TV-E-Commerce
bezeichnet, durch Breitbandkabelnetze zusätzlich einen Rückkanal zum TV-Sender.
17
In
Pilotprojekten der Bertelsmannn Broadband Group haben Frankfurter Haushalte unter
anderem die Möglichkeit, interaktiv fernzusehen und dabei Video-on-Demand zu nutzen,
Bücher und Filmmusiken zu bestellen.
2.2.4 Versandhandel
Man spricht von Versandhandel, wenn Kataloge, Prospekte und elektronische Medien als
Angebotsform dienen und die Käufer die Ware schriftlich, telefonisch oder mündlich
bestellen können und diese Waren dem Käufer per Post oder sonstiger Transportbetriebe
zugestellt werden.
18
Man unterscheidet zwischen dem Universalfachhandel, der über ein sehr
breites, aber flach strukturiertes Sortiment verfügt und dem Fachversandhandel, der ein enges
und tiefes Sortiment führt, das i.d.R. auf eine Branche oder eine verwandte Produktgruppe
beschränkt ist. Die fehlende Bindung an das Ladenschlussgesetz sowie die hohe
Einkaufsbequemlichkeit sind für den Kunden große Pluspunkte.
15
Vgl. Gruninger-Hermann, Christian: Teleshopping: Absatz- und Programmplanung eines TV-
Shoppingsenders, (Kohlhammer) Stuttgart 1999, S.16, S. 28.
16
Vgl. Plate-Spandau, Carsten von: Online-Shopping im Marketing-Mix, (Döbler&Rössler) Stuttgart 1997, S.
51.
17
Vgl. Mertens, Bernd: Geschäfte übers Fernsehen, in: Impulse, o. Jg., 2000, Nr. 11, S. 178 179, S. 178.
18
Vgl. Ausschuss für Begriffsdefinitionen aus der Handels- und Absatzwirtschaft (Hrsg.): Katalog E,
Begriffsdefinitionen aus der Handels- und Absatzwirtschaft, 4. Aufl., (Thiele & Schwarz) Kassel 1995, S. 51.
2001 Jens Klingohr
8
3 Ausgewählte Trends, Entwicklungen und Rahmenbedingungen
3.1 Einführung
Die Handelslandschaft unterliegt einer ständigen Dynamik. So sind Entwicklungen im Handel
einerseits durch vergangene, aber andererseits auch durch zukünftige Entwicklungen geprägt.
Eine situative Perspektive für Unternehmen ist die Outside-Inside-Perspektive, die
Entwicklungen durch Veränderungen des unternehmerischen Umfelds antrebt.
19
Es werden
organisationale Veränderungen ausgelöst, wodurch die Unternehmen in der Inside-Outside-
Perspektive ihrerseits wieder Wettbewerbsvorteile bzw. strategien in den Markt
transportieren. Neuere Entwicklungen können somit als Wechselspiel von Reaktion und
Aktion betrachtet werden. Auch die Entwicklungen in der Konsumgüterindustrie sind von
Bedeutung für den Handel. Zu nennen wären hierbei die vertikale Kooperation, insbesondere
durch das Category Management, sowie neue Ansätze von Wettbewerbsvorteilen durch das
Customer Relationship Management.
20
Durch neue Angebotsformen und bündelungen
entstehen auch für die Industrie neue Absatzkanäle, die in Form einer vertikalen
Vorwärtsintegration entweder in Kooperation mit dem Handel oder in direkter Konkurrenz
zum Handel verwirklicht werden können.
Nachfolgend sollen nun einige Trends und Umfeldveränderungen herausgegriffen werden, die
in einem interdependenten Zusammenhang stehen und im Hinblick auf die vorliegende Arbeit
von Bedeutung sind.
3.2 Konsumententrends
Durch eine zunehmende Freizeit-, Erlebnis- und Convenience-Orientierung der Konsumenten
entstehen neue Angebotsformen wie das Convenience Shopping z.B. an Tankstellen Shops,
oder das Home Shopping, wozu traditionelle Formen des Versandhandels, aber auch neue
elektronische Varianten wie das Electronic Shopping über das Internet und TV Shopping
gehören.
21
Im Zusammenhang mit den sich wandelnden Tendenzen im Verhalten von Endkunden fallen
häufig Begriffe wie hybrides Käuferverhalten oder Convenience Shopping. Dabei richten sich
die Konsumenten nicht nur nach der Produktkategorie, sondern auch nach den
19
Vgl. Zentes, Joachim; Swoboda, Bernhard: Neuere Entwicklungen im Handelsmanagement,
Umfeldbedingungen und strategische Konzepte, in: Marketing ZFP, 21. Jg., 1999, Nr. 1, S. 75 90, S. 75.
20
Vgl. Hertel, Joachim: Warenwirtschaftssysteme: Grundlagen und Konzepte, (Physica-Verlag) Heidelberg
1999, S. 26.
21
Vgl. Zentes, Joachim; Swoboda, Bernhard: Neuere Entwicklungen im Handelsmanagement,
Umfeldbedingungen und strategische Konzepte, in: Marketing ZFP, 21. Jg., 1999, Nr. 1, S. 75 90, S. 76, S. 77.
2001 Jens Klingohr
9
Verkaufsorten.
22
Die Konzentration erfolgt dabei immer weniger auf einzelne Einkaufsstätten,
sondern auf die bewusste Kombination von Angeboten unterschiedlicher Einkaufsorten. Als
Auslöser hierfür gilt oft das hybride Einkaufsverhalten, d.h. der Wechsel zwischen
verschiedenen Einkaufsorten. Somit ist das Verhalten des Konsumenten schwer
vorherzusagen und pendelt zwischen Erlebnis- und Versorgungseinkauf. Durch den Trend des
Convenience Shopping, d.h. der bequemen Nutzung von Absatzkanälen, werden neue
Einkaufsorte wie das Home Shopping, der Einkauf an der Tankstelle oder am Kiosk
zunehmend attraktiv. Dem Convenience Shopping wird durch die veränderten
Lebensgewohnheiten der Verbraucher in Zukunft ein großes Potenzial zugerechnet. Der
Kunde hat heute die Auswahl zwischen einer Vielzahl von Angeboten in unterschiedlichen
Absatzkanälen und kann sich dabei situativ entscheiden. Somit wird eine einheitliche
Zuordnung zu Konsum- und Kaufverhaltensmustern immer schwieriger. Des Weiteren
entwickelt sich die heutige Gesellschaft immer mehr zur Informationsgesellschaft in Richtung
,,Global Village".
3.3 Trends in der Informationstechnologie
Dieser oben geschilderten schnellen Entwicklung gilt es auch, die zugrundeliegende
Technologie anzupassen. So ist für die Zukunft das ,,Internet Protocol Next Generation" eine
notwendige Umstellung, um den immensen Wachstumsraten und Chancen im E-Commerce
und der Verbesserung der Datensicherheit im Internet gerecht zu werden.
23
Durch den IpnG-
Standard wird auch die Diffusion neuer Technologien, wie die mobile Kommunikation über
das Internet (Radio, TV, Video-on-Demand etc.), verbessert. Dazu entwickelt sich auch die
statische Programmiersprache HTML zur dynamischen DHTML und in Zukunft zur
virtuellen VRML. Da das Internet keinen festgelegten Zweck hat und somit zum offenen
Medium für die Übertragung jeglicher Inhalte wird, die sich in digitaler Form darstellen
lassen, besteht gegenüber klassischen Medien wie Fernsehen und Rundfunk ein großer
Vorteil.
24
Auch die Kommunikationsbeziehung zwischen Handel und Kunde wird durch neue
Technologien revolutioniert, welche damit Potentiale zur Rationalisierung und Profilierung
22
Vgl. Schögel, Marcus; Tomczak, Torsten: Alternative Vertriebswege Neue Wege zum Kunden, in:
Tomczak, Torsten u.a. (Hrsg.): Alternative Vertriebswege, (Thexis) St.Gallen 1999, S. 12-38, S. 14.
23
Vgl. Cleven, Hans-Dieter: Entwicklungspfade und Leistungsperspektiven des Electronic Commerce, in:
Beisheim, Otto (Hrsg.): Distribution im Aufbruch: Bestandsaufnahme und Perspektiven, (Vahlen) München
1999, S. 967 986, S. 968, S. 969.
24
Vgl. Zorn, Dieter: Vom Massenmarketing zur One-to-one-Kommunikation, in: One to One, o. Jg., 1999, Nr.
11, S. 20, S. 20.
2001 Jens Klingohr
10
schaffen. So bieten neue Medien innovative Kommunikationswege, die individuelle und
interaktive Dialoge mit dem Kunden erlauben, und es können damit umfassende
Kundeninformationen gewonnen werden.
25
Die folgende Abbildung soll die zahlreichen
Anwendungsgebiete neuer Technologien im Handel aufzeigen.
Abb. 2: Anwendungsgebiete neuer Technologien im Handel
Quelle: Cleven, Hans-Dieter: Entwicklungspfade und Leistungsperspektiven des Electronic Commerce, in:
Beisheim, Otto (Hrsg.): Distribution im Aufbruch: Bestandsaufnahme und Perspektiven, (Vahlen) München
1999, S. 984.
In Bezug auf das Customer Relationship Management sind der Einsatz von Data Warehouses
in Verbindung mit dem Data Mining von großer Bedeutung. Data Mining ist ein Verfahren,
das dazu dient, große Datenbestände unter Anwendung verschiedener Algorithmen auf
wertvolle Informationen für das Unternehmen zu untersuchen. Diesem Verfahren vorgelagert
ist das Data Warehouse, das sämtliche Daten in einem Unternehmen in einheitlicher Form
zusammenführt und zugänglich macht und somit präparierte Daten für das Data Mining
bereithält.
Des Weiteren unterstützen moderne Workflow-Systeme organisatorische Prozesse in
Unternehmen. Sie dienen der Planung, Steuerung und Überwachung auf dem Gebiet der
Weiterleitung von Informationen über mehrere Stellen.
25
Vgl. Busch, Anina; Belz, Christian: Vom Detailhandel zur Detailkommunikation: Stammkunden aktiv
bearbeiten, in: Thexis, 17. Jg., 2000, Nr. 1, S. 2 9, S. 2.
Multimedia
Interaktives
digitales TV
Virtuelle
Realität
Künstliche
Intelligenz
Tragbare,
kommunikations
fähige PCs
Neue
Speichermedien
Weltweite
Datennetze /
Internet
Mobile
Kommunikation
Neue Technologien
Kundeninformations-
systeme
Ladenbau
Effizienzsteigerung in
der Warenwirtschaft
und innerbetrieblichen
Kommunikation
Freizeitgestaltung,
Erlebniskauf
Neue Infowege
Preisauszeichnung
per Sender
Neue Werbeformen
Weiterbildung
Elektronischer
Verkäufer
Home Entertainment
Pay per View,
Home Shopping
Erreichbarkeit
überall zu jeder Zeit,
Videokonferenzen
Elektronische
Zahlungssysteme
Multimedia
Interaktives
digitales TV
Virtuelle
Realität
Künstliche
Intelligenz
Tragbare,
kommunikations
fähige PCs
Neue
Speichermedien
Weltweite
Datennetze /
Internet
Mobile
Kommunikation
Neue Technologien
Kundeninformations-
systeme
Ladenbau
Effizienzsteigerung in
der Warenwirtschaft
und innerbetrieblichen
Kommunikation
Freizeitgestaltung,
Erlebniskauf
Neue Infowege
Preisauszeichnung
per Sender
Neue Werbeformen
Weiterbildung
Elektronischer
Verkäufer
Home Entertainment
Pay per View,
Home Shopping
Erreichbarkeit
überall zu jeder Zeit,
Videokonferenzen
Elektronische
Zahlungssysteme
2001 Jens Klingohr
11
3.4 Trends und Entwicklungen im Handel
Durch die beschriebenen Konsumententrends entstehen, wie bereits erwähnt, sowohl neue
Angebotsformen als auch neue Angebotsbündelungen wie z.B. bei Internet Angeboten. Diese
Veränderungen bewirken Umsatzverlagerungen zwischen Industrie und Handel, aber auch
innerhalb des Handels als interne Konkurrenz zwischen verschiedenen Standorten,
Betriebstypen und Handelsformen.
26
Weitere Trends und Rahmenbedingungen im Handel sind die zunehmende
Internationalisierung und Globalisierung, hier auf das Global Retailing bezogen, der erhöhte
Margendruck auf die Unternehmen, die Verringerung der Flächenproduktivität sowie
Mehrbetriebstypunternehmen und Betriebstypenvarianten.
27
Unternehmen sind verschärften
Wettbewerbsbedingungen, ausgeprägten Verdrängungsprozessen sowie der zunehmenden
Komplexität des betrieblichen Entscheidungsfeldes ausgesetzt, auf die es entsprechend zu
reagieren gilt.
28
Weitere Trends sind die der Ausweitung der Sortimente und der dadurch
bedingten Ausweitung in Richtung größerer Flächen.
29
Diese Entwicklung wird durch den
Online-Handel weiter verstärkt. Eine zentrale Tendenz zeigt sich heute in einer zunehmenden
Kundenorientierung von Unternehmen, die mit einer innovativen Kundenpolitik beantwortet
werden muss. Marketingaktivitäten bedürfen einer Ausrichtung am gesamten
Kundenlebenszyklus, in dem der Kunde verschiedene Phasen durchläuft und in dieser
dynamischen Entwicklung differenziert behandelt werden muss.
Einer der prägendsten Trends im Handel der nächsten Jahre ist das Konzept des Multi
Channel Retailing, d.h. eine zunehmende Orientierung zum Multi Channel Unternehmen.
30
4 Optionen des Handelsmarketing
4.1 Marketingmanagement im Handel
Die Umsetzungsoptionen der Handelsmarketinginstrumente in den verschiedenen
Vertriebskanälen sind sehr unterschiedlich. Grundsätzlich unterscheiden sich die
Möglichkeiten zur Umsetzung im stationären Handel, im virtuellen Handel und im
26
Vgl. Zentes, Joachim; Swoboda, Bernhard: Neuere Entwicklungen im Handelsmanagement,
Umfeldbedingungen und strategische Konzepte, in: Marketing ZFP, 21. Jg., 1999, Nr. 1, S. 75 90, S. 78.
27
Vgl. Hertel, Joachim: Warenwirtschaftssysteme: Grundlagen und Konzepte, (Physica-Verlag) Heidelberg
1999, S. 27.
28
Vgl. Theis, Hans-Joachim: Handels-Marketing: Analyse und Planungskonzepte für den Einzelhandel,
(Deutscher Fachverlag) Frankfurt a.M. 1999, S. 47.
29
Vgl. Maiwaldt, Jan-Christoph: Wandel der Handelsfunktionen durch E-Commerce Die e-business Strategie
der Douglas Holding AG, in: Müller-Hagedorn, Lothar (Hrsg.): Zukunftsperspektiven des E-Commerce im
Handel, (Deutscher Fachverlag) Frankfurt a.M. 2000, S. 59 71, S. 61.
30
Vgl. Zentes, Joachim: Retail Branding Der Handel als Marke, (Lebensmittel Zeitung) Frankfurt a.M. 2000,
S. 161.
2001 Jens Klingohr
12
Versandhandel, da die Kommunikationswege und damit auch die Möglichkeit zur Interaktion
sehr unterschiedlich sind. Auf einer feineren Ebene betrachtet, gibt es innerhalb dieser groben
Einordnung auch wieder Unterschiede, die im Folgenden ausgehend von den verschiedenen
Handelsmarketinginstrumenten für jeden Vertriebskanal einzeln betrachtet werden sollen.
Zunächst soll jedoch der Prozess des Marketingmanagements kurz beschrieben werden.
Dieser gliedert sich im Handel in drei Bereiche: die Marketingplanung, die
Marketingrealisation und die Marketingkontrolle.
Abb. 3: Marketingmanagementprozess im Handel
Marketingplanung
Marktforschung
Umweltanalyse
Unternehmensanalyse
Makroumwelt Mikroumwelt
Betriebliche
Ressourcen
Markt- u. Wettbe-
werbsbedingungen
! Ökono. Bed.
! Soziokul.Bed
! Technol. Bed.
! Politisch-
rechtl. Bed.
! Physische
Bed.
! Ökolog. Bed.
! Abnehmer
! Konkurrenten
! Lieferanten
! Absatzmittler
! Absatzhelfer
! Finanzmittel
! Sachmittel
! Unternehmensgr.
! Rechtsform
! Kostenstruktur
! ...
! Einzugsgebiet
! Standortverhältnisse
! Imageposition
! Bekanntheitsgrad
! Marktanteil
! ...
Entwicklung der Marketingkonzeption
Zielplanung
Strategieplanung
Positionierungsstrategien Basisstrategien
Instrumentalstrategien
! Segmentstrategien
! Konkurrenzstrategien
! Absatzmethodenstrategien
! Betriebstypenstrategien
! Sortimentsstrategien
! Standortstrategien
! Leistungsstrategien
! Entgeltstrategien
! Kommunikationsstrategien
Maßnahmenplanung (operative Planung)
Leistungspolitik Entgeltpolitik Kommunikationspolitik
Marketingrealisation
Marketingkontrolle
Quelle: Theis, Hans-Joachim: Handels-Marketing: Analyse und Planungskonzepte für den Einzelhandel,
(Deutscher Fachverlag) Frankfurt a.M. 1999, S. 43.
Im Rahmen der Marketingplanung wird in einer ersten Phase Marketingforschung als
Situationsanalyse und Entwicklungsprognose betrieben und dabei sowohl unternehmerische
Stärken und Schwächen als auch marktliche Chancen und Risiken analysiert.
Ergebnis der Marketingplanung ist die Marketingkonzeption, welche aus Marketingzielen, -
strategien und maßnahmen besteht und auf den Ergebnissen der Marketingforschung
2001 Jens Klingohr
13
aufbaut.
31
Zur Sicherung der Existenz und des Wachstums von Handelsunternehmen wird
eine markt- und zukunftsgerichtete strategische Planung und damit auch die
Marketingkonzeption immer wichtiger.
Innerhalb der Marketingkonzeption stellen die Ziele erstrebenswerte Sollzustände dar, die
durch geeignete Strategien erreicht werden sollen. Als Ergebnis dieses Prozesses erhält man
ein breites Spektrum an handelsbetrieblichen Zielen, welches sich in verschiedene Bereiche,
wie die Abbildung 4 zeigt, kategorisiert und sich unter Kenntnis der internen und externen
Situation sowie des individuellen Werte- und Normensystems konkretisieren lässt.
32
Abb. 4: Marketingzielsystem des Handels
Quelle: Theis, Hans-Joachim: Handels-Marketing: Analyse und Planungskonzepte für den Einzelhandel,
(Deutscher Fachverlag) Frankfurt a.M. 1999, S. 470.
Nach Festlegung der marketingstrategischen Ziele gilt es, alternative Marketingstrategien zur
Verwirklichung der Ziele zu entwickeln und auszuwählen. Festzulegende Strategiebereiche
mit unterschiedlicher Priorität, je nach Ausgangssituation und Marketingzielen, sind die
Basis-, die Positionierungs- und die Instrumentalstrategien.
33
31
Vgl. Theis, Hans-Joachim: Handels-Marketing: Analyse und Planungskonzepte für den Einzelhandel,
(Deutscher Fachverlag) Frankfurt a.M. 1999, S. 43.
32
Vgl. Theis, Hans-Joachim: Handels-Marketing: Analyse und Planungskonzepte für den Einzelhandel,
(Deutscher Fachverlag) Frankfurt a.M. 1999, S. 469.
33
Vgl. Theis, Hans-Joachim: Handels-Marketing: Analyse und Planungskonzepte für den Einzelhandel,
(Deutscher Fachverlag) Frankfurt a.M. 1999, S. 481.
Marketingziele
Marketingziele für
Betriebstyp A
Marketingziele für
Betriebstyp B
·Gewinn
·Deckungsbeitrag
·Positionierung
· Bekanntheitsgrad
Marketingziele für
Betriebstyp C
Instrumentalziele
Ziele der
Leistungspolitik
Ziele der
Entgeltpolitik
Ziele der
Kommunikationspolitik
·Kompetenz
·Verbundkäufe
·Qualitätsimage
·Preisimage
·Zeitliche Bedarfslenkung
·Preislagenbildung
·Bekanntheitsgradsteigerung
·Neukundengewinnung
·Verbundkäufe
Instrumentalvariablenziele
Ziele der...
Ziele der...
Ziele der...
·Sortimentpolitik
·Quantitätspolitik
·Überbrückungspolitik
·Sicherungspolitik
·Umsatzdurchführungspolitik
·Sachgüteraufbereitungspolitik
·Preispolitik
·Konditionenpolitik
·Absatzpolitik
·Präsentationspolitik
·Verkaufsförderung
·Product Placement
·Eventmarketing
·Sponsoring
·Public Relations
·Direktmarketing
Marketingziele
Marketingziele für
Betriebstyp A
Marketingziele für
Betriebstyp B
·Gewinn
·Deckungsbeitrag
·Positionierung
· Bekanntheitsgrad
Marketingziele für
Betriebstyp C
Instrumentalziele
Ziele der
Leistungspolitik
Ziele der
Entgeltpolitik
Ziele der
Kommunikationspolitik
·Kompetenz
·Verbundkäufe
·Qualitätsimage
·Preisimage
·Zeitliche Bedarfslenkung
·Preislagenbildung
·Bekanntheitsgradsteigerung
·Neukundengewinnung
·Verbundkäufe
Instrumentalziele
Ziele der
Leistungspolitik
Ziele der
Entgeltpolitik
Ziele der
Kommunikationspolitik
Ziele der
Leistungspolitik
Ziele der
Entgeltpolitik
Ziele der
Kommunikationspolitik
·Kompetenz
·Verbundkäufe
·Qualitätsimage
·Preisimage
·Zeitliche Bedarfslenkung
·Preislagenbildung
·Bekanntheitsgradsteigerung
·Neukundengewinnung
·Verbundkäufe
·Kompetenz
·Verbundkäufe
·Qualitätsimage
·Preisimage
·Zeitliche Bedarfslenkung
·Preislagenbildung
·Bekanntheitsgradsteigerung
·Neukundengewinnung
·Verbundkäufe
Instrumentalvariablenziele
Ziele der...
Ziele der...
Ziele der...
·Sortimentpolitik
·Quantitätspolitik
·Überbrückungspolitik
·Sicherungspolitik
·Umsatzdurchführungspolitik
·Sachgüteraufbereitungspolitik
·Preispolitik
·Konditionenpolitik
·Absatzpolitik
·Präsentationspolitik
·Verkaufsförderung
·Product Placement
·Eventmarketing
·Sponsoring
·Public Relations
·Direktmarketing
Instrumentalvariablenziele
Ziele der...
Ziele der...
Ziele der...
Ziele der...
Ziele der...
Ziele der...
·Sortimentpolitik
·Quantitätspolitik
·Überbrückungspolitik
·Sicherungspolitik
·Umsatzdurchführungspolitik
·Sachgüteraufbereitungspolitik
·Preispolitik
·Konditionenpolitik
·Absatzpolitik
·Präsentationspolitik
·Verkaufsförderung
·Product Placement
·Eventmarketing
·Sponsoring
·Public Relations
·Direktmarketing
·Sortimentpolitik
·Quantitätspolitik
·Überbrückungspolitik
·Sicherungspolitik
·Umsatzdurchführungspolitik
·Sachgüteraufbereitungspolitik
·Preispolitik
·Konditionenpolitik
·Absatzpolitik
·Präsentationspolitik
·Verkaufsförderung
·Product Placement
·Eventmarketing
·Sponsoring
·Public Relations
·Direktmarketing
2001 Jens Klingohr
14
Abb. 5: Marketingstrategien des Handels im Gesamtzusammenhang
Quelle: Theis, Hans-Joachim: Handels-Marketing: Analyse und Planungskonzepte für den Einzelhandel,
(Deutscher Fachverlag) Frankfurt a.M. 1999, S. 481.
Basisstrategien engen den Entscheidungsspielraum in Bezug auf den Warenkreis, die
Absatzmethode, den Standort und den Betriebstyp ein.
Positionierungsstrategien beinhalten Zielgruppenstrategien und die Wettbewerbsstrategien,
d.h. die beabsichtigte Stellung im Markt gegenüber dem Konkurrenzumfeld und den
Konsumenten. Dabei hat das Handelsunternehmen über die Ausrichtung des Marktsegments
zur Mono- oder Multisegmentstrategie sowie zu deren Ausgestaltungsmöglichkeiten zu
entscheiden.
34
Die Instrumentalstrategien umfassen Entscheidungen bezüglich des grundsätzlichen Einsatzes
sowie des geplanten Aktivitätsniveaus bestimmter Marketinginstrumentalvariablen und
bestimmter Marketinginstrumente oder des gesamten Marketinginstrumentariums. Zur
34
Vgl. Theis, Hans-Joachim: Handels-Marketing: Analyse und Planungskonzepte für den Einzelhandel,
(Deutscher Fachverlag) Frankfurt a.M. 1999, S. 503.
Basisstrategien
·Warenkreisstrategien
·Absatzmethodenstrategien
·Aquisitionsstrategien
·Warenkontaktstrategien
·Bedienungsstrategien
·Standortstrategien
·Betriebstypenstrategien
Positionierungsstrategien
·Marktspezialisierung
·Marktstandardisierung
·Marktdifferenzierung
·Marktdiversifikation
·Profilierungsstrategie
·Anpassungsstrategie
·Rückzugsstrategie
·Ausweichstrategie
·Kooperationsstrategie
·Kampfstrategie
Instrumentalstrategien
·Leistungsstrategien
·Entgeltsstrategien
·Sortimentsstrategien
·Preisstrategien
·Quantitätsstrategien
·Konditionen-
strategien
·Überbrückungsstrategien
·Kommunikationsstrategien
·Sicherungsstrategien
·Corporate-
Identity-Strategien
·Umsatzdurchführungsstrategien
·Kommunikations-
prozessstrategien
·Sachgüteraufbereitungsstrategien
Zielgruppenstrategien
Konkurrenzstrategien
Basisstrategien
·Warenkreisstrategien
·Absatzmethodenstrategien
·Aquisitionsstrategien
·Warenkontaktstrategien
·Bedienungsstrategien
·Standortstrategien
·Betriebstypenstrategien
Basisstrategien
·Warenkreisstrategien
·Absatzmethodenstrategien
·Aquisitionsstrategien
·Warenkontaktstrategien
·Bedienungsstrategien
·Standortstrategien
·Betriebstypenstrategien
Positionierungsstrategien
·Marktspezialisierung
·Marktstandardisierung
·Marktdifferenzierung
·Marktdiversifikation
·Profilierungsstrategie
·Anpassungsstrategie
·Rückzugsstrategie
·Ausweichstrategie
·Kooperationsstrategie
·Kampfstrategie
·Marktspezialisierung
·Marktstandardisierung
·Marktdifferenzierung
·Marktdiversifikation
·Profilierungsstrategie
·Anpassungsstrategie
·Rückzugsstrategie
·Ausweichstrategie
·Kooperationsstrategie
·Kampfstrategie
Instrumentalstrategien
·Leistungsstrategien
·Entgeltsstrategien
·Sortimentsstrategien
·Preisstrategien
·Quantitätsstrategien
·Konditionen-
strategien
·Überbrückungsstrategien
·Kommunikationsstrategien
·Sicherungsstrategien
·Corporate-
Identity-Strategien
·Umsatzdurchführungsstrategien
·Kommunikations-
prozessstrategien
·Sachgüteraufbereitungsstrategien
Zielgruppenstrategien
Konkurrenzstrategien
Zielgruppenstrategien
Konkurrenzstrategien
2001 Jens Klingohr
15
Erreichung eines zielgerichteten Retailing-Mix ist eine optimale Abstimmung der
absatzpolitischen Instrumente nach Art, Umfang, Qualität und zeitlichem Einsatz erforderlich.
Die optimale Ausgestaltung des Retailing-Mix erweist sich aufgrund der hohen Anzahl an
Instrumentalvariablen als äußerst schwierig. Durch die bewusste Kombination von mehreren
Vertriebskanälen erhöht sich dieser Komplexitätsgrad noch um ein Vielfaches.
Die festgelegten Marketingziele und -strategien dienen als Handlungsrahmen für die
Ausarbeitung konkreter Maßnahmen und Aktionspläne - der operativen Planung der
Marketinginstrumente. Die konkrete Ausgestaltung der absatzpolitischen Instrumente ergibt
sich aus der betriebsindividuellen Definition der Art und Weise der Erfüllung der
Handelsfunktionen. Abgeleitet aus den Handelsfunktionen lässt sich der absatzmarktpolitische
Instrumentaleinsatz wiederum nach Leistungen, Entgeltbedingungen und
Kommunikationsmaßnahmen systematisieren.
35
Dieser Sachverhalt soll in Kapitel 4.2 in
Bezug auf einzelne Vertriebskanäle genauer betrachtet werden.
Nach Abschluss der Marketingplanung gilt es im Rahmen der Marketingrealisation, die in
Stufe 1 geplante Marketingstrategie mit den geeigneten Maßnahmen umzusetzen.
Letztendlich wird im Rahmen der Marketingkontrolle die beabsichtigte Marketingstrategie
auf gegebenenfalls erforderliche Korrekturmaßnahmen überprüft.
4.2 Umsetzungsmöglichkeiten von Handelsmarketinginstrumenten in einzelnen
Vertriebskanälen
4.2.1 Einführung
Im Folgenden sollen die wichtigsten Handelsmarketinginstrumente in einem
Gesamtzusammenhang dargestellt werden. Ich werde dabei zunächst auf die grundlegende
Bedeutung der einzelnen Instrumente eingehen und anschließend aufzeigen, wie diese in den
verschiedenen Vertriebskanälen umgesetzt werden können, welche Unterschiede und
Besonderheiten sie in den einzelnen Vertriebskanälen aufweisen.
Die folgenden Handelsmarketinginstrumente werden zwar getrennt voneinander betrachtet,
stehen allerdings in einem interdependenten Zusammenhang zueinander. So hat z.B. die
Preislagenbildung im Rahmen der Preispolitik eine direkte Auswirkung auf die
Sortimentstiefe im Rahmen der Sortimentspolitik. Zunächst werde ich nun verschiedene
Lifecycle Modelle vorstellen, die aufgrund dieser komplexen Zusammenhänge auf alle
Marketinginstrumente anwendbar sind.
35
Vgl. Theis, Hans-Joachim: Handels-Marketing: Analyse und Planungskonzepte für den Einzelhandel,
(Deutscher Fachverlag) Frankfurt a.M. 1999, S. 55, S. 56.
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Originalausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2001
- ISBN (eBook)
- 9783832445577
- ISBN (Paperback)
- 9783838645575
- DOI
- 10.3239/9783832445577
- Dateigröße
- 950 KB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- Universität des Saarlandes – unbekannt
- Erscheinungsdatum
- 2001 (September)
- Note
- 2,3
- Schlagworte
- multi-channel-retailing mehrkanalsysteme vertriebskanäle
- Produktsicherheit
- Diplom.de