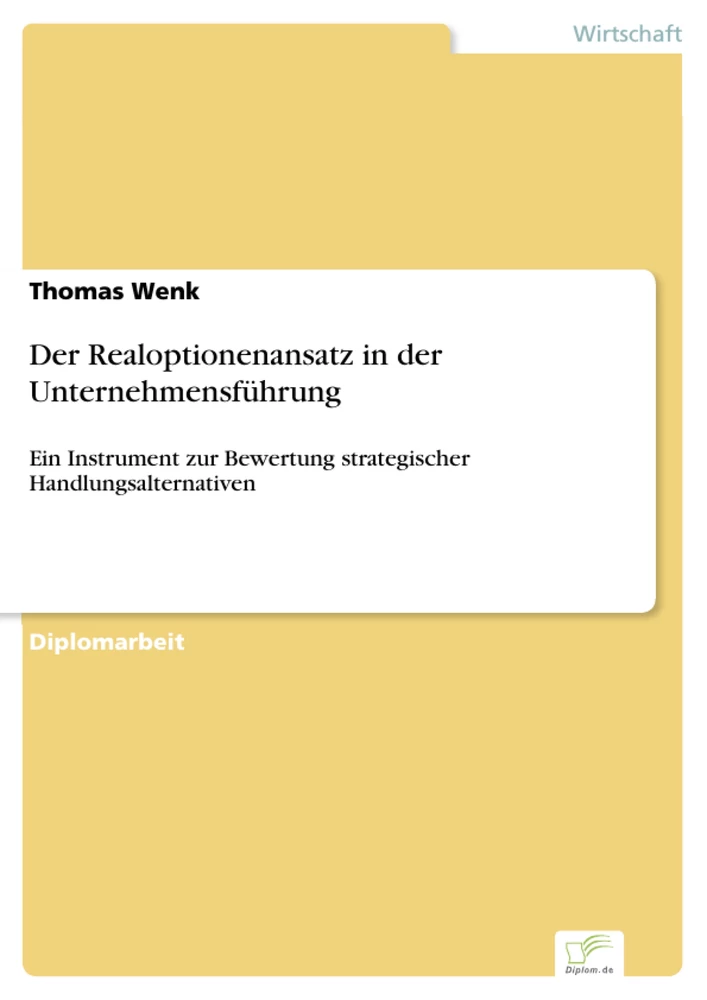Der Realoptionenansatz in der Unternehmensführung
Ein Instrument zur Bewertung strategischer Handlungsalternativen
©2001
Diplomarbeit
72 Seiten
Zusammenfassung
Inhaltsangabe:Einleitung:
Ziel der vorliegenden Arbeit íst es, die Theorie der Realoptionen in ihren Grundzügen darzustellen und deren Einsatzmöglichkeiten als Instrument in der Unternehmensführung aufzuzeigen.
In der betriebswirtschaftlichen Literatur existieren zahlreiche Ausführungen zum Thema Realoptionen im Zusammenhang mit der Bewertung von Unternehmen. Auf diesem Gebiet nimmt die Theorie der Realoptionen einen wichtigen Platz ein, da die Vernachlässigung von Handlungsflexibilitäten des Managements eine Unterbewertung des Unternehmens zur Konsequenz hat.
Eine ausführliche Betrachtung von Realoptionen in Verbindung mit der Unternehmensbewertung und der Untersuchung von Kennzahlen wird in dieser Arbeit nicht vorgenommen. Vielmehr wird beispielhaft ein Instrument der Unternehmensführung mit den Vorzügen und Nachteilen vorgestellt und es werden Möglichkeiten aufgezeigt, wie anhand optionalen Handelns in Form von Realoptionen diese Schwachstellen beseitigt und in der Praxis umgesetzt werden können.
Gang der Untersuchung:
Zu Beginn des zweiten Kapitels wird eine Begriffsbestimmung vorgenommen und die Begriffe in das betriebswirtschaftliche Instrumentarium eingeordnet. Anschließend stellt der Autor das Modell der Balanced Scorecard (BSC) stellvertretend für weitere Instrumente der Unternehmensführung vor. Diese Darstellung umfasst den Aufbau einer Balanced Scorecard, die Vorteile der ganzheitlichen Betrachtungsweise sowie die Kritikpunkte. Aus diesen Kritikpunkten wird überleitend die Notwendigkeit der Ergänzung bestehender Instrumente dargestellt.
Innerhalb des dritten Kapitels wird die Theorie der Realoptionen als Ansatz optionalen Handelns vorgestellt und eine Klassifizierung unterschiedlicher Typen von Realoptionen vorgenommen. Anschließend werden Möglichkeiten hervorgehoben, anhand derer eine Bewertung der Handlungsflexibilitäten durchgeführt werden kann. Hierbei handelt es sich einerseits um grundlegende Instrumente der Investitionstheorie. Andererseits werden spezielle Verfahren der Optionspreisbewertung in ihren Grundzügen vorgestellt und gegenüber herkömmlichen Verfahren abgegrenzt. Aus Gründen der Übersichtlichkeit wird nur auf einzelne exemplarische Verfahren eingegangen, auf die mathematische Darstellung wird komplett verzichtet. Zum Ende des Kapitels werden die Bewertungsverfahren gegenübergestellt und auf ihre Anwendbarkeit überprüft.
Eine Betrachtung optionalen Handelns in verschiedenen Betrachtungsperspektiven und die […]
Ziel der vorliegenden Arbeit íst es, die Theorie der Realoptionen in ihren Grundzügen darzustellen und deren Einsatzmöglichkeiten als Instrument in der Unternehmensführung aufzuzeigen.
In der betriebswirtschaftlichen Literatur existieren zahlreiche Ausführungen zum Thema Realoptionen im Zusammenhang mit der Bewertung von Unternehmen. Auf diesem Gebiet nimmt die Theorie der Realoptionen einen wichtigen Platz ein, da die Vernachlässigung von Handlungsflexibilitäten des Managements eine Unterbewertung des Unternehmens zur Konsequenz hat.
Eine ausführliche Betrachtung von Realoptionen in Verbindung mit der Unternehmensbewertung und der Untersuchung von Kennzahlen wird in dieser Arbeit nicht vorgenommen. Vielmehr wird beispielhaft ein Instrument der Unternehmensführung mit den Vorzügen und Nachteilen vorgestellt und es werden Möglichkeiten aufgezeigt, wie anhand optionalen Handelns in Form von Realoptionen diese Schwachstellen beseitigt und in der Praxis umgesetzt werden können.
Gang der Untersuchung:
Zu Beginn des zweiten Kapitels wird eine Begriffsbestimmung vorgenommen und die Begriffe in das betriebswirtschaftliche Instrumentarium eingeordnet. Anschließend stellt der Autor das Modell der Balanced Scorecard (BSC) stellvertretend für weitere Instrumente der Unternehmensführung vor. Diese Darstellung umfasst den Aufbau einer Balanced Scorecard, die Vorteile der ganzheitlichen Betrachtungsweise sowie die Kritikpunkte. Aus diesen Kritikpunkten wird überleitend die Notwendigkeit der Ergänzung bestehender Instrumente dargestellt.
Innerhalb des dritten Kapitels wird die Theorie der Realoptionen als Ansatz optionalen Handelns vorgestellt und eine Klassifizierung unterschiedlicher Typen von Realoptionen vorgenommen. Anschließend werden Möglichkeiten hervorgehoben, anhand derer eine Bewertung der Handlungsflexibilitäten durchgeführt werden kann. Hierbei handelt es sich einerseits um grundlegende Instrumente der Investitionstheorie. Andererseits werden spezielle Verfahren der Optionspreisbewertung in ihren Grundzügen vorgestellt und gegenüber herkömmlichen Verfahren abgegrenzt. Aus Gründen der Übersichtlichkeit wird nur auf einzelne exemplarische Verfahren eingegangen, auf die mathematische Darstellung wird komplett verzichtet. Zum Ende des Kapitels werden die Bewertungsverfahren gegenübergestellt und auf ihre Anwendbarkeit überprüft.
Eine Betrachtung optionalen Handelns in verschiedenen Betrachtungsperspektiven und die […]
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
ID 4554
Wenk, Thomas: Der Realoptionenansatz in der Unternehmensführung: Ein Instrument zur
Bewertung strategischer Handlungsalternativen / Thomas Wenk -
Hamburg: Diplomica GmbH, 2001
Zugl.: Potsdam, Universität, Diplom, 2001
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte, insbesondere die
der Übersetzung, des Nachdrucks, des Vortrags, der Entnahme von Abbildungen und Tabellen,
der Funksendung, der Mikroverfilmung oder der Vervielfältigung auf anderen Wegen und der
Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen, bleiben, auch bei nur auszugsweiser Verwertung,
vorbehalten. Eine Vervielfältigung dieses Werkes oder von Teilen dieses Werkes ist auch im
Einzelfall nur in den Grenzen der gesetzlichen Bestimmungen des Urheberrechtsgesetzes der
Bundesrepublik Deutschland in der jeweils geltenden Fassung zulässig. Sie ist grundsätzlich
vergütungspflichtig. Zuwiderhandlungen unterliegen den Strafbestimmungen des
Urheberrechtes.
Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in diesem
Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme, dass solche
Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei zu betrachten
wären und daher von jedermann benutzt werden dürften.
Die Informationen in diesem Werk wurden mit Sorgfalt erarbeitet. Dennoch können Fehler nicht
vollständig ausgeschlossen werden, und die Diplomarbeiten Agentur, die Autoren oder
Übersetzer übernehmen keine juristische Verantwortung oder irgendeine Haftung für evtl.
verbliebene fehlerhafte Angaben und deren Folgen.
Diplomica GmbH
http://www.diplom.de, Hamburg 2001
Printed in Germany
Wissensquellen gewinnbringend nutzen
Qualität, Praxisrelevanz und Aktualität zeichnen unsere Studien aus. Wir
bieten Ihnen im Auftrag unserer Autorinnen und Autoren Wirtschafts-
studien und wissenschaftliche Abschlussarbeiten Dissertationen,
Diplomarbeiten, Magisterarbeiten, Staatsexamensarbeiten und Studien-
arbeiten zum Kauf. Sie wurden an deutschen Universitäten, Fachhoch-
schulen, Akademien oder vergleichbaren Institutionen der Europäischen
Union geschrieben. Der Notendurchschnitt liegt bei 1,5.
Wettbewerbsvorteile verschaffen Vergleichen Sie den Preis unserer
Studien mit den Honoraren externer Berater. Um dieses Wissen selbst
zusammenzutragen, müssten Sie viel Zeit und Geld aufbringen.
http://www.diplom.de bietet Ihnen unser vollständiges Lieferprogramm
mit mehreren tausend Studien im Internet. Neben dem Online-Katalog und
der Online-Suchmaschine für Ihre Recherche steht Ihnen auch eine Online-
Bestellfunktion zur Verfügung. Inhaltliche Zusammenfassungen und
Inhaltsverzeichnisse zu jeder Studie sind im Internet einsehbar.
Individueller Service
Gerne senden wir Ihnen auch unseren Papier-
katalog zu. Bitte fordern Sie Ihr individuelles Exemplar bei uns an. Für
Fragen, Anregungen und individuelle Anfragen stehen wir Ihnen gerne zur
Verfügung. Wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit.
Ihr Team der Diplomarbeiten Agentur
Der Realoptionenansatz in der Unternehmensführung I
Inhaltsverzeichnis
Seite
Abbildungsverzeichnis...III
Tabellenverzeichnis... IV
Abkürzungsverzeichnis ... IV
1 Problemstellung und Gang der Untersuchung... 1
2 Unternehmensführung und optionales Handeln ... 3
2.1 Begriffsbestimmung ... 3
2.1.1 Unternehmensführung... 3
2.1.2 Optionales Handeln und Realoptionen... 4
2.2 Synoptische Betrachtung von Finanz- und Realoptionen ... 5
2.3 Balanced Scorecard als ausgewähltes Instrument der Unternehmensführung... 7
2.3.1 Modell der Balanced Scorecard ... 7
2.3.2 Kritische Würdigung... 11
2.4 Notwendigkeit eines Modells zur Berücksichtigung von Handlungsalternativen 12
2.4.1 Schwächen konventioneller Instrumente der Unternehmensführung ... 12
2.4.2 Ansatz zur Steigerung der Flexibilität... 13
3 Realoptionen als Ansatz optionalen Handelns... 15
3.1 Modell der Realoptionen... 15
3.2 Klassifikation von Realoptionen ... 17
3.2.1 Zweck der Option... 17
3.2.1.1 Wachstumsoptionen ... 17
3.2.1.2 Lernoptionen ... 19
3.2.1.3 Versicherungsoptionen... 19
3.2.2 Klassifikation nach aktivseitigen und passivseitigen Optionen ... 20
3.2.2.1 Aktivseitige Optionen ... 20
3.2.2.2 Passivseitige Optionen ... 21
3.3 Möglichkeiten der Bewertung von Realoptionen... 22
3.3.1 Herkömmliche Bewertungsverfahren der Investitionsrechnung... 22
3.3.2 Optionspreistheoretische Bewertungsverfahren... 25
3.3.3 Kritische Würdigung der Bewertungsmethoden ... 27
Der Realoptionenansatz in der Unternehmensführung II
4 Realoptionen und optionales Handeln zur strategischen Steuerung in ver-
schiedenen Betrachtungsdimensionen... 29
4.1 Realoptionen in der Kundenperspektive ... 29
4.1.1 Inhalte der Kundenperspektive... 29
4.1.2 Management von Aktivitäten entlang der Wertschöpfungskette ... 30
4.1.3 Produktentwicklungsstrategien ... 32
4.1.4 Marktentwicklungsstrategien ... 33
4.1.5 Diversifikation... 34
4.2 Realoptionen in der Finanzperspektive ... 35
4.2.1 Inhalte der Finanzperspektive ... 35
4.2.2 Realoptionen in unterschiedlichen Geschäftsfeldphasen ... 36
4.3 Realoptionen in der internen Prozessperspektive... 39
4.3.1 Inhalte der internen Prozessperspektive... 39
4.3.2 Realoptionen und das generische Wertkettenmodell ... 40
4.3.2.1 Realoptionen im Innovationsprozess ... 40
4.3.2.2 Realoptionen im Betriebsprozess... 41
4.3.2.3 Realoptionen im Kundendienstprozess ... 43
4.4 Realoptionen in der Lern- und Entwicklungsperspektive ... 44
4.4.1 Inhalte der Lern- und Entwicklungsperspektive ... 44
4.4.2 Personalpotenziale und der Einsatz von Realoptionen ... 44
4.4.3 Potenziale von Informationssystemen und der Einsatz von Realoptionen ... 47
4.4.4 Motivation und der Einsatz von Realoptionen... 48
4.5 Realoptionen in der Wettbewerbsperspektive... 49
4.5.1 Triebkräfte des Wettbewerbs ... 49
4.5.2 Branchenwettbewerb und Realoptionen... 50
5 Limitationen des Realoptionenansatzes und kritische Würdigung optionalen
Handelns in verschiedenen Betrachtungsdimensionen ... 52
Literaturverzeichnis... 58
Der Realoptionenansatz in der Unternehmensführung III
Abbildungsverzeichnis
Abbildung
1:
Balanced Scorecard als Instrument zur Umsetzung der
Unternehmensstrategie in operative Größen... 8
Abbildung 2:
Führungszyklus von Realoptionen... 14
Abbildung 3:
Veränderte Wertverteilung durch Auswirkungen von Real-
optionen auf die Cash-flow-Struktur... 16
Abbildung 4:
Klassifikation von Realoptionen nach den Zweck... 17
Abbildung 5:
Aktivseitige vs. passivseitige Realoptionen... 20
Abbildung 6:
Ansätze der Investitionsrechnung... 23
Abbildung 7:
Möglichkeiten der Ermittlung des freien Cash-flow... 24
Abbildung 8:
Optionsbasierte Bewertungsverfahren... 25
Abbildung 9:
Produkt-Markt-Matrix (ANSOFF-Matrix)... 29
Abbildung 10:
Wertschöpfungskette von PORTER... 30
Abbildung 11:
Bewertungsbeispiel für eine Kundenanalyse nach der Custo-
mer Lifetime Value Analysis...
32
Abbildung 12:
Generisches Wertkettenmodell... 39
Abbildung 13:
Produktlebenszyklus... 45
Abbildung 14:
Branchenstrukturanalyse nach PORTER... 49
Der Realoptionenansatz in der Unternehmensführung IV
Tabellenverzeichnis
Tabelle 1:
Analogien zwischen Finanzoptionen und Realoptionen... 5
Abkürzungsverzeichnis
BSC... Balanced
Scorecard
CLV... Customer Lifetime Value
CRM... Customer Relationship Management
DCF... Discounted Cash flow
EWG... Europäische
Wirtschaftsgemeinschaft
F&E... Forschung und Entwicklung
GVO... Gruppenfreistellungsverordnung
LKW... Lastkraftwagen
PKW... Personenkraftwagen
ROCE... Return on Capital Employed
ROI... Return on Investment
staatl... staatlich
UMTS... Universal Mobile Telecommunications Systems
Univ... Universität
VW AG... Volkswagen Aktiengesellschaft
WACC... Weighted average cost of capital
Der Realoptionenansatz in der Unternehmensführung 1
1 Problemstellung und Gang der Untersuchung
Ziel der vorliegenden Arbeit íst es, die Theorie der Realoptionen in ihren Grundzügen
darzustellen und deren Einsatzmöglichkeiten als Instrument in der
Unternehmensführung aufzuzeigen.
In der betriebswirtschaftlichen Literatur existieren zahlreiche Ausführungen zum Thema
Realoptionen im Zusammenhang mit der Bewertung von Unternehmen. Auf diesem
Gebiet nimmt die Theorie der Realoptionen einen wichtigen Platz ein, da die
Vernachlässigung von Handlungsflexibilitäten des Managements eine Unterbewertung
des Unternehmens zur Konsequenz hat.
Eine ausführliche Betrachtung von Realoptionen in Verbindung mit der
Unternehmensbewertung und der Untersuchung von Kennzahlen wird in dieser Arbeit
nicht vorgenommen. Vielmehr wird beispielhaft ein Instrument der
Unternehmensführung mit den Vorzügen und Nachteilen vorgestellt und es werden
Möglichkeiten aufgezeigt, wie anhand optionalen Handelns in Form von Realoptionen
diese Schwachstellen beseitigt und in der Praxis umgesetzt werden können.
Zu Beginn des zweiten Kapitels wird eine Begriffsbestimmung vorgenommen und die
Begriffe in das betriebswirtschaftliche Instrumentarium eingeordnet. Anschließend stellt
der Autor das Modell der Balanced Scorecard (BSC) stellvertretend für weitere
Instrumente der Unternehmensführung vor. Diese Darstellung umfasst den Aufbau einer
Balanced Scorecard, die Vorteile der ganzheitlichen Betrachtungsweise sowie die
Kritikpunkte. Aus diesen Kritikpunkten wird überleitend die Notwendigkeit der
Ergänzung bestehender Instrumente dargestellt.
Innerhalb des dritten Kapitels wird die Theorie der Realoptionen als Ansatz optionalen
Handelns vorgestellt und eine Klassifizierung unterschiedlicher Typen von
Realoptionen vorgenommen. Anschließend werden Möglichkeiten hervorgehoben,
anhand derer eine Bewertung der Handlungsflexibilitäten durchgeführt werden kann.
Hierbei handelt es sich einerseits um grundlegende Instrumente der Investitionstheorie.
Andererseits werden spezielle Verfahren der Optionspreisbewertung in ihren
Grundzügen vorgestellt und gegenüber herkömmlichen Verfahren abgegrenzt. Aus
Gründen der Übersichtlichkeit wird nur auf einzelne exemplarische Verfahren
Der Realoptionenansatz in der Unternehmensführung 2
eingegangen, auf die mathematische Darstellung wird komplett verzichtet. Zum Ende
des Kapitels werden die Bewertungsverfahren gegenübergestellt und auf ihre
Anwendbarkeit überprüft.
Eine Betrachtung optionalen Handelns in verschiedenen Betrachtungsperspektiven und
die Überprüfung der Möglichkeiten einer praktischen Umsetzung des
Realoptionenansatzes ist Inhalt des vierten Kapitels. Ausgehend von der mehrdimen-
sionalen Betrachtungsweise, welche in Anlehnung an den Balanced Scorecard Ansatz
erfolgt, werden herkömmliche Instrumente der Unternehmensführung mit dem
Realoptionenansatz verknüpft. Hieraus werden im Anschluss konkrete Realoptionen
identifiziert und deren Relevanz für die Unternehmensführung dargestellt.
Innerhalb der Kundenperspektive werden über eine Portfoliotechnik Möglichkeiten der
Ausrichtung des Unternehmens auf die Kundenwünsche aufgezeigt und mit
Realoptionen kombiniert.
Die Finanzperspektive ist über kausale Beziehungen unmittelbar mit der
Kundenperspektive verbunden. Einführend wird die Bedeutung der Finanzperspektive
für das gesamte Unternehmen hervorgehoben und anschließend Realoptionen für
bestimmte finanzwirtschaftliche Zielrichtungen dargelegt.
Innerhalb der internen Prozessperspektive wird das Wertkettenmodell von
KAPLAN/NORTON zugrundegelegt. Weiterführend werden sowohl für den
Innovationsprozess als auch für den Betriebs- und Kundendienstprozess entsprechende
Realoptionen identifiziert und mit praktischen Beispielen untermauert.
In der Lern- und Entwicklungsperspektive werden drei Hauptkategorien identifiziert,
auf welche sich die Unternehmen meist konzentrieren. Es werden Möglichkeiten
aufgezeigt, wie über den Realoptionenansatz Mitarbeiterpotenziale identifiziert und
genutzt werden können. Darüber hinaus werden Potenziale von Informationssystemen
und Motivationsmöglichkeiten in Verbindung mit dem Realoptionenansatz vorgestellt.
Über die von KAPLAN/NORTON vorgeschlagenen vier Perspektiven hinaus wird als
fünfte Perspektive die Wettbewerbsperspektive vorgestellt. Innerhalb der
Der Realoptionenansatz in der Unternehmensführung 3
Wettbewerbsperspektive werden verschiedene Faktoren bestimmt, welche
maßgeblichen Einfluss auf die Wettbewerbsbedingungen haben. Anschließend werden
für diese Einflussfaktoren Möglichkeiten zur Steigerung der strategischen
Handlungsalternativen beleuchtet.
Als Schlussbetrachtung wird innerhalb des fünften Kapitels eine Beschreibung der
Limitationen des Realoptionenansatzes vorgenommen und bewertet. Als Abschluss
erfolgt eine kritische Würdigung optionalen Handelns in den Betrachtungsperspektiven
und der Anwendung des Realoptionenansatzes als Instrument der Unternehmens-
führung.
2 Unternehmensführung und optionales Handeln
2.1 Begriffsbestimmung
2.1.1 Unternehmensführung
Der Begriff der Unternehmensführung bzw. ,,Management" wird in der
betriebswirtschaftlichen Literatur als Betriebs- und Menschenführung definiert. Der
Betriebsführung liegt ein sachbezogenes Handeln zugrunde, deren Aufgabe darin
besteht, den betrieblichen Ablauf zu gestalten. Der Gestaltungsprozess setzt sich aus
den Einzelschritten Planung, Entscheidung, Steuerung, Durchsetzung und Kontrolle
zusammen. Des weiteren wird zwischen operativer und strategischer Betriebsführung
unterschieden. Die Differenzierung basiert auf einer Untersuchung, welche den
Betriebsführungsprozess anhand unterschiedlicher Dimensionen betrachtet. Anhand
einer zeitlichen Betrachtungsweise können beispielsweise alle Handlungen, welche
langfristig ausgerichtet sind, als strategische Unternehmensführung interpretiert werden.
Alle Tätigkeiten, die eher kurz- bis mittelfristig ausgerichtet sind, werden als operativ
bezeichnet.
1
1
Vgl. Staehle, W. (1999), S. 72, Jung, R./Kleine, M. (1993), S. 23ff.
Der Realoptionenansatz in der Unternehmensführung 4
Die Menschenführung zeichnet sich durch ein personenbezogenes Handeln aus. JUNG
und KLEINE unterscheiden hierbei zwischen generellem Führungsverhalten und
situationalem Führungsstil. Als Besonderheit ist zu beachten, dass bei der
Menschenführung ein Interaktionsprozess zwischen den Mitarbeitern des Unternehmens
und unternehmensexternen Anspruchsgruppen (z.B. Kunden, Lieferanten, staatl.
Einrichtungen etc.) stattfindet.
1
2.1.2 Optionales Handeln und Realoptionen
In der betriebswirtschaftlichen Literatur wird bei optionalen Ansätzen grundsätzlich
zwischen Finanzoptionen und realen Investitionsoptionen (sog. Realoptionen)
unterschieden. Im Allgemeinen wird unter einer Option ein Vertrag zwischen Käufer
und Verkäufer verstanden, welcher den Beteiligten das Recht einräumt, eine bestimmte
Menge eines Gutes (Basisobjekt) zu einem bestimmten Zeitpunkt bzw. bis zu einem
bestimmten Zeitpunkt mit einem vertraglich festgelegten Preis zu kaufen bzw. zu
verkaufen. Kaufoptionen werden als ,,call" und Verkaufsoptionen als ,,put" bezeichnet.
Als amerikanische Option bezeichnet man Optionen, welche jederzeit ausgeübt werden
können. Demgegenüber können europäische Optionen lediglich zu einem bestimmten
Zeitpunkt ausgeübt werden.
2
Eine Option bietet dem Käufer den Vorteil, ein bestimmtes
Risiko zu beschränken. Hierfür bezahlt der Käufer dem Verkäufer der Option eine
Optionsprämie. Das Risiko für den Käufer der Option beschränkt sich auf die gezahlte
Optionsprämie, hingegen sind die Gewinnchancen (theoretisch) unbegrenzt. Für die
Übernahme des Risikos bekommt der Verkäufer der Option die Optionsprämie, sie
entspricht dem maximal zu erzielenden Gewinn. Dieser Gewinn verringert sich, sofern
der Käufer von seinem Ausübungsrecht Gebrauch macht. Das Verlustrisiko für den
Verkäufer der Option ist (theoretisch) unbegrenzt.
In Abhängigkeit vom zugrunde liegenden Gut, auf welches sich die Option bezieht,
wird zwischen Finanzoptionen und Realoptionen unterschieden. Finanzoptionen
beziehen sich auf Basisobjekte wie beispielsweise Aktien, Zinsen, Währungen etc.
Demzufolge erwirbt ein Käufer einer Finanzoption das Recht (aber nicht die
1
Vgl. Jung, R./Kleine, M. (1993), S. 23ff.
2
Vgl. Meise, F. (2000), S. 47.
Der Realoptionenansatz in der Unternehmensführung 5
Verpflichtung), eine bestimmte Aktie zu einem bestimmten Preis innerhalb eines
bestimmten Zeitraumes zu kaufen.
Besteht das zugrunde liegende Basisobjekt aus einer realen Investitionsmöglichkeit, so
handelt es sich um eine sog. Realoption. ,,Realoptionen stellen Handlungsmöglichkeiten
dar, die den Optionsinhaber mit einem unmittelbaren Recht ausstatten, im Rahmen einer
(unbestimmten) Transaktion den Wert der Zahlungsströme eines Basisobjekts gegen
den Wert der Zahlungsströme eines Ausübungsobjekts zu tauschen."
1
Der Vorteil einer
Realoption besteht darin, dass sich ein Unternehmen Handlungsspielräume eröffnen
kann, welche ohne die Realoption nicht vorhanden wären. Diese zusätzliche Flexibilität
kann für ein Unternehmen, vor allem vor dem Hintergrund der zunehmenden
Globalisierung und des härteren Wettbewerbs, einen Wettbewerbsvorteil gegenüber
Konkurrenzunternehmen bedeuten.
2.2 Synoptische Betrachtung von Finanz- und Realoptionen
Bei einer synoptischen Betrachtung von Finanzoptionen und Realoptionen lassen sich
Analogien feststellen. Anhand der nachfolgenden Abbildung soll dies verdeutlicht
werden.
Tabelle 1: Analogie zwischen Finanzoptionen (auf Aktien) und Realoptionen
Optionsterminologie Finanzoption
(Aktie) Realoption
Wert des Basisobjektes
Aktienkurs
Bruttoprojektwert (Barwert der Brutto-Cash-
flows)
Ausübungspreis
Ausübungspreis
Barwert der Investitionsausgaben
Laufzeit
Laufzeit
Zeitspanne, in der die Investitionsmöglichkeit
besteht
Volatilität Standardabweichung
des
Aktienkurses
Standardabweichung des Bruttoprojektwertes
Risikoloser Zinssatz
Risikoloser Zinssatz
Risikoloser Zinssatz
Dividenden Dividenden Entgangene
Brutto-Cash-flows;
Wettbewerbseffekte; Convenience yield
Quelle: Meise, F. (1998), S. 52.
1
Vgl. Koch, C. (1999), S. 71.
Der Realoptionenansatz in der Unternehmensführung 6
PRITSCH zeigt in einer Untersuchung von Realoptionen in der Forschung und
Entwicklung (F&E) der pharmazeutischen Industrie Analogien von Finanz- und
Realoptionen auf. Diese untermauert er anhand von folgenden konstituierenden
Merkmalen:
1
·
Flexibilität
·
Unsicherheit
·
Stufenweise Investition
·
Exklusivität
·
Irreversibilität
Der Käufer einer Finanzoption (Basisobjekt Aktie) erwirbt bei einer Kaufoption (Call)
das Recht, die jeweilige Aktie zu einem bestimmten Preis innerhalb eines definierten
Zeitraums zu kaufen. Der Inhaber einer Realoption hat das Recht, zum Beispiel ein
bestimmtes Investitionsprojekt durchzuführen. Somit hat sich das Unternehmen einen
Handlungsspielraum eingeräumt und kann flexibel auf das Wettbewerbsumfeld
reagieren. Sowohl bei der Finanzoption als auch bei der Realoption handelt es sich
lediglich um ein Recht der Ausübung, nicht jedoch um eine Verpflichtung. Somit ist bei
beiden Optionen die Flexibilität gewährleistet.
2
Auch beim Merkmal der Unsicherheit bestehen Analogien zwischen den beiden
Optionstypen. Bei den Finanzoptionen besteht Unsicherheit bezüglich des ex ante
unsicheren Preises des zugrunde liegenden Basisobjektes (Aktie) und bei der Realoption
besteht Unsicherheit bezüglich der ex ante zu erzielenden Cash-flows aus dem
Investitionsprojekt.
Sowohl die Finanzoptionen als auch die Realoptionen sind durch stufenweise
Investitionen gekennzeichnet. Bei einer Finanzoption (z.B. auf eine Aktie) stellt der
Basispreis ein Vielfaches der Optionsprämie dar. Demzufolge erfolgt die Ausübung ,,in
Stufen". Bei einer Realoption ist der Sachverhalt ähnlich. So übersteigen die gesamten
Investitionskosten i.d.R. bei weitem die Kosten, welche für den Erhalt der Option
notwendig sind. Auch hier findet eine stufenweise Investition statt.
1
Vgl. Pritsch, G. (2000), S. 138.
2
Vgl. Hommel, U./Pritsch, G. (1999b), S. 9f.
Der Realoptionenansatz in der Unternehmensführung 7
Differenzierter sind vermeintliche Analogien hinsichtlich der Merkmalsausprägung
,,Exklusivität" und ,,Irreversibilität" zu betrachten. Eine Exklusivität ist bei
Finanzoptionen tatsächlich gewährleistet. Bei den Realoptionen hingegen ist es auch
möglich, dass sich mehrere Unternehmen die gleichen Realoptionen sichern (z.B. neue
Produkte). Eine Exklusivität der Realoption könnte lediglich bei Patenten (z.B. in der
Pharmaindustrie) etc. vorhanden sein.
Des weiteren wird in der Literatur ein Vergleichbarkeit hinsichtlich der Irreversibilität
von Finanz- und Realoptionen diskutiert.
1
Finanzoptionen haben tatsächlich das
Merkmal der Irreversibilität, denn das Optionsrecht wird mit der Ausübung aufgehoben.
Bei Realoptionen kann das Optionsrecht auch nach der Ausübung weiterhin bestehen.
Dies ist beispielsweise der Fall, wenn eine bestimmte Investition bereits getätigt wurde
(Ausübung). Wird ex post festgestellt, dass die Investition unvorteilhaft war, kann das
Investitionsprojekt abgebrochen werden. Sind die bis dahin geschaffenen Werte nicht
alternativ einsetzbar bzw. veräußerbar, so stellen deren Kosten versunkene Kosten
(,,sunk costs") dar, welche definitionsgemäß nicht rückgängig gemacht werden können.
2.3 Balanced Scorecard als ausgewähltes Instrument der Unternehmensführung
2.3.1 Modell der Balanced Scorecard
Während des Industriezeitalters wurden zur Unternehmensführung vorwiegend
Instrumente verwendet, welche die materiellen Ressourcen eines Unternehmens
abbilden. Das Management beschränkte sich oft auf reine finanzielle Kennzahlen wie
z.B. den Return on Capital Employed (ROCE) und den Return on Investment (ROI)
2
.
Die traditionellen Kennzahlensysteme zeichnen sich dadurch aus, dass sie i.d.R.
retrograd ermittelt werden. Aus dieser Kritik und vor dem Hintergrund, dass die
Steuerung eines Unternehmens nicht durch eine eindimensionale Betrachtung erfolgen
sollte, entstand zu Beginn der 90er Jahre die Balanced Scorecard.
3
Die Grundidee der
Balanced Scorecard besteht darin, aus der Unternehmensstrategie Steuerungsgrößen
1
Vgl. Pritsch, G. (2000), S. 138; Hommel, U./Pritsch, G. (1999b), S. 9.
2
ROI= (Gewinn/Umsatz)*(Umsatz/investiertes Kapital)*100; ROCE= Operating Profit/Capital
Employed
3
Vgl. Georg, Stefan (1999), S. 5; Weber, J./Schäffer, U. (1999), S. 2.
Der Realoptionenansatz in der Unternehmensführung 8
verschiedener Dimensionen abzuleiten und durch entsprechende Maßgrößen geeignete
Handlungsaktivitäten zu generieren. In der von KAPLAN/NORTON vorgeschlagenen
Konzeption besteht die Balanced Scorecard aus der finanziellen Perspektive,
Kundenperspektive, Lern- und Entwicklungsperspektive sowie aus der internen
Prozessperspektive.
Abbildung 1: Balanced Scorecard als Instrument zur Umsetzung der Unternehmens-
strategie in operative Größen
Quelle: Kaplan, R. S./Norton, David P. (1997), S. 9.
Der Grundgedanke bei diesem Konzept besteht darin, dass die Balanced Scorecard
sowohl die monetären als auch die nicht-monetären Einflussfaktoren darstellt. Innerhalb
der vier beschriebenen Dimensionen werden Maßgrößen definiert und darauf aufbauend
Handlungsaktivitäten bestimmt. Die Maßgrößen stellen Erfolgsfaktoren dar, welche
nicht nur rein finanzielle Kennzahlen beinhalten, sondern auch Maßgrößen zur
Abschätzung der jeweiligen Wachstumsmöglichkeiten abbilden.
1
Des weiteren sind die
Maßgrößen durch Kausalbeziehungen miteinander verknüpft, d.h. das sich die
Maßgrößen wechselseitig beeinflussen. So kann beispielsweise die Maßgröße
,,Mitarbeiterzufriedenheit" über Rückkopplungseffekte die Maßgröße ,,Kunden-
zufriedenheit" aus der Kundenperspektive dadurch beeinflussen, dass zufriedene
1
Vgl. Gleich, Ronald (1997b), S. 432.
Strate-
gisches
Ziel
Meßgröße
Operatives
Ziel
Aktivität
Strate-
gisches
Ziel
Meß-
größe
Operatives
Ziel
Aktivität
Strate-
gisches
Ziel
Meß-
größe
Operatives
Ziel
Aktivität
Strate-
gisches
Ziel
Meßgröße
Operatives
Ziel
Aktivität
Wie können
wir flexibel
und ver-
besserungs-
fähig
bleiben?
Lern- und Wachstumsperspektive
Finanzielle Perspektive
Wie sollten
wir aus
Kapital-
gebersicht
dastehen?
Kundenperspektive
Wie sollten
wir aus
Kunden-
sicht da-
stehen?
interne Perspektive
Bei welchen
Prozessen
müssen wir
her-
vorragendes
leisten?
Vision/Strategie
Der Realoptionenansatz in der Unternehmensführung 9
Mitarbeiter eine höhere Qualität der Produkte gewährleisten und somit die Kunden
insgesamt mit dem Produkt und dem Unternehmen zufriedener sind.
·
Finanzperspektive
Die finanziellen Kennzahlen und Ziele der Finanzperspektive bilden die Grundlage zur
Zielbildung der weiteren Perspektiven. KAPLAN und NORTON weisen darauf hin,
dass alle Ziele und Maßnahmen der Kunden-, internen Prozess- sowie der
Mitarbeiterperspektive durch kausale Beziehungen zu einer Verbesserung des
finanziellen Ergebnisses des Unternehmens führen werden.
1
Die Balanced Scorecard ist ein Instrument, mit dessen Hilfe eine Abstimmung zwischen
den Zielen und Strategien der strategischen Geschäftseinheiten und denen des gesamten
Unternehmens gewährleistet werden kann. Hierbei besteht jedoch die Gefahr, dass von
Seiten des Managements des Gesamtunternehmens pauschale Ziele vereinbart werden
(z.B. hat jede Geschäftseinheit eine genau bestimmte, für alle Geschäftseinheiten
geltende Kapitalrendite zu erwirtschaften). Da jedoch jede einzelne Geschäftseinheit in
einem unterschiedlichen Umfeld agieren muss und die Produkte oft nicht vergleichbar
sind (z.B. unterschiedliche Produkt/Marktphasen), kann die Kapitalrendite bei den
einzelnen Geschäftseinheiten u. U. stark differieren.
2
·
Kundenperspektive
Im Mittelpunkt der Kundenperspektive steht die Identifikation der Kunden- und
Marktsegmente. Mittels dieser Perspektive sollen Ziele erreicht werden, die einen
unmittelbaren Einfluss auf die Finanzperspektive haben. Diese Interdependenz wird
deutlich, wenn sie anhand eines Beispiels nachvollzogen werden kann. So könnte z.B.
ein Zusammenhang zwischen einer hohen Kundenzufriedenheit und dem Umsatz
bestehen. Sind die Kunden mit dem Produkt bzw. mit der Dienstleistung zufrieden oder
1
Vgl. Kaplan, R./Norton, D. (1997), S. 46.
2
Vgl. Kaplan, R./Norton, D. (1997), S. 46f.
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Originalausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2001
- ISBN (eBook)
- 9783832445546
- ISBN (Paperback)
- 9783838645544
- DOI
- 10.3239/9783832445546
- Dateigröße
- 652 KB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- Universität Potsdam – unbekannt
- Erscheinungsdatum
- 2001 (September)
- Note
- 2,3
- Schlagworte
- strategie unternehmensführung realoptionen balanced scorecard optionen
- Produktsicherheit
- Diplom.de