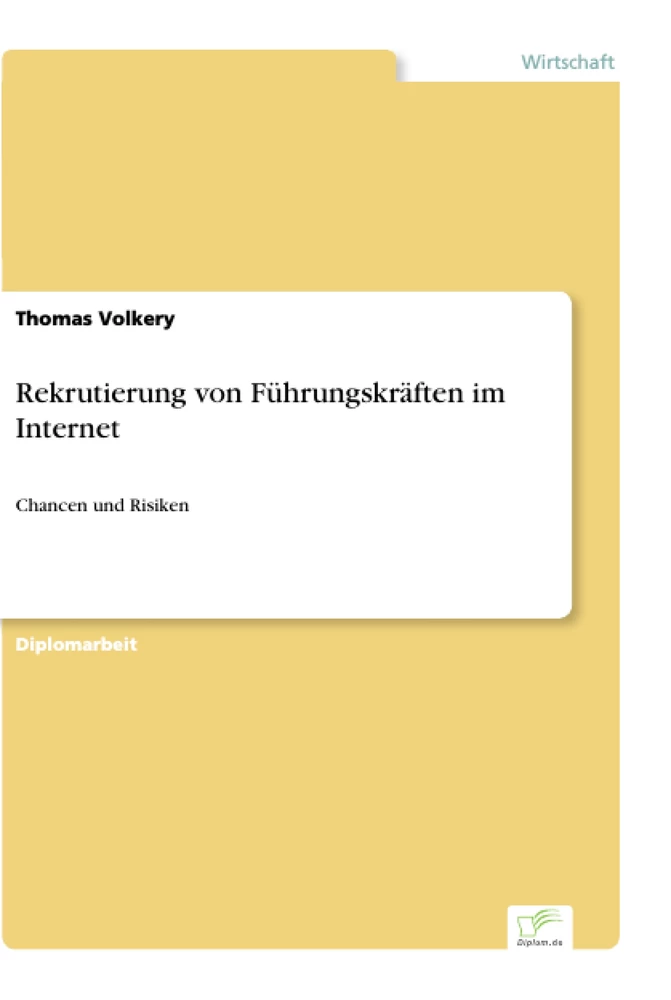Rekrutierung von Führungskräften im Internet
Chancen und Risiken
©2001
Diplomarbeit
108 Seiten
Zusammenfassung
Inhaltsangabe:Einleitung:
Eine junge Frau möchte sich für eine führende Position in einem renommierten Unternehmen bewerben und ruft dazu die entsprechende Unternehmenshomepage auf. Sie klickt zielgerichtet auf den Personalbereich und von dort auf die offenen Stellen. Nachdem sie eine ihr angemessen erscheinende Stellenausschreibung sichtet, beginnt sie den Bewerbungsprozess. Nach Eingabe ihrer persönlichen Daten und eines auf die entsprechende Position gerichteten Bewerbungsanschreibens inklusive Lebenslauf und Lichtbild führt sie das Computerprogramm automatisch zu einem virtuellen Vorstellungsgespräch. Eine erste Hürde ist übersprungen. Entgegen ihren Gewohnheiten kann sie in diesem Gespräch jedoch die ´Waffen einer Frau`, die sie bislang so häufig genutzt hatte, nicht einsetzen. Der virtuelle, mit künstlicher Intelligenz ausgestattete Interviewer verschafft sich einen ´persönlichen` Eindruck von der Bewerberin, wobei er durch ausgesprochene Neutralität und Seriosität besticht. Eignungspotential sowie Interessen und Wünsche der Kandidatin werden durch den virtuellen Gesprächspartner erfasst.
Fiktion oder bereits Wirklichkeit? Dieses Szenario ist zweifelsohne Zukunftsmusik, könnte aber schon bald Realität werden, wenn sich das Medium Internet weiterhin derart rasant entwickelt, wie es in den vergangenen Jahren der Fall war.
Mit dem Internet steht Unternehmen ein Medium zur Verfügung, das zunehmend traditionelle Tätigkeiten wie Kontakte zu Käufern, Kunden und Lieferanten übernimmt. Eine derartige Entwicklung macht auch vor der Personalabteilung nicht halt. So wird immer häufiger versucht, auch den Prozess der Personalbeschaffung auf das Medium Internet zu übertragen.
Fraglich ist jedoch, ob und in wie weit dieses Medium tatsächlich zur Personalrekrutierung geeignet ist. Ziel dieser Arbeit ist es, die derzeitigen Chancen und Risiken der Rekrutierung mit Hilfe des Internets darzustellen. Die Betonung liegt hierbei auf dem Wort derzeit, denn die rasante Entwicklung im Bereich der Internetanwendungen macht langfristige Aussagen nahezu unmöglich. Da die Personalrekrutierung einen Prozess darstellt, werden die einzelnen Prozessschritte auf ihre Chancen und Risiken untersucht. Schwerpunktmäßig geht es um die Rekrutierung von Führungskräften. Zunehmend erkennen große Unternehmen und grundsätzlich alle mit einem Bedarf an hochqualifiziertem Personal, dass diese Zielgruppe in ganz besonderem Maße über das Internet anzusprechen ist. Besondere […]
Eine junge Frau möchte sich für eine führende Position in einem renommierten Unternehmen bewerben und ruft dazu die entsprechende Unternehmenshomepage auf. Sie klickt zielgerichtet auf den Personalbereich und von dort auf die offenen Stellen. Nachdem sie eine ihr angemessen erscheinende Stellenausschreibung sichtet, beginnt sie den Bewerbungsprozess. Nach Eingabe ihrer persönlichen Daten und eines auf die entsprechende Position gerichteten Bewerbungsanschreibens inklusive Lebenslauf und Lichtbild führt sie das Computerprogramm automatisch zu einem virtuellen Vorstellungsgespräch. Eine erste Hürde ist übersprungen. Entgegen ihren Gewohnheiten kann sie in diesem Gespräch jedoch die ´Waffen einer Frau`, die sie bislang so häufig genutzt hatte, nicht einsetzen. Der virtuelle, mit künstlicher Intelligenz ausgestattete Interviewer verschafft sich einen ´persönlichen` Eindruck von der Bewerberin, wobei er durch ausgesprochene Neutralität und Seriosität besticht. Eignungspotential sowie Interessen und Wünsche der Kandidatin werden durch den virtuellen Gesprächspartner erfasst.
Fiktion oder bereits Wirklichkeit? Dieses Szenario ist zweifelsohne Zukunftsmusik, könnte aber schon bald Realität werden, wenn sich das Medium Internet weiterhin derart rasant entwickelt, wie es in den vergangenen Jahren der Fall war.
Mit dem Internet steht Unternehmen ein Medium zur Verfügung, das zunehmend traditionelle Tätigkeiten wie Kontakte zu Käufern, Kunden und Lieferanten übernimmt. Eine derartige Entwicklung macht auch vor der Personalabteilung nicht halt. So wird immer häufiger versucht, auch den Prozess der Personalbeschaffung auf das Medium Internet zu übertragen.
Fraglich ist jedoch, ob und in wie weit dieses Medium tatsächlich zur Personalrekrutierung geeignet ist. Ziel dieser Arbeit ist es, die derzeitigen Chancen und Risiken der Rekrutierung mit Hilfe des Internets darzustellen. Die Betonung liegt hierbei auf dem Wort derzeit, denn die rasante Entwicklung im Bereich der Internetanwendungen macht langfristige Aussagen nahezu unmöglich. Da die Personalrekrutierung einen Prozess darstellt, werden die einzelnen Prozessschritte auf ihre Chancen und Risiken untersucht. Schwerpunktmäßig geht es um die Rekrutierung von Führungskräften. Zunehmend erkennen große Unternehmen und grundsätzlich alle mit einem Bedarf an hochqualifiziertem Personal, dass diese Zielgruppe in ganz besonderem Maße über das Internet anzusprechen ist. Besondere […]
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
ID 4308
Volkery, Thomas: Rekrutierung von Führungskräften im Internet: Chancen und Risiken /
Thomas Volkery - Hamburg: Diplomica GmbH, 2001
Zugl.: Osnabrück, Fachhochschule, Diplom, 2001
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte, insbesondere die
der Übersetzung, des Nachdrucks, des Vortrags, der Entnahme von Abbildungen und Tabellen,
der Funksendung, der Mikroverfilmung oder der Vervielfältigung auf anderen Wegen und der
Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen, bleiben, auch bei nur auszugsweiser Verwertung,
vorbehalten. Eine Vervielfältigung dieses Werkes oder von Teilen dieses Werkes ist auch im
Einzelfall nur in den Grenzen der gesetzlichen Bestimmungen des Urheberrechtsgesetzes der
Bundesrepublik Deutschland in der jeweils geltenden Fassung zulässig. Sie ist grundsätzlich
vergütungspflichtig. Zuwiderhandlungen unterliegen den Strafbestimmungen des
Urheberrechtes.
Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in diesem
Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme, dass solche
Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei zu betrachten
wären und daher von jedermann benutzt werden dürften.
Die Informationen in diesem Werk wurden mit Sorgfalt erarbeitet. Dennoch können Fehler nicht
vollständig ausgeschlossen werden, und die Diplomarbeiten Agentur, die Autoren oder
Übersetzer übernehmen keine juristische Verantwortung oder irgendeine Haftung für evtl.
verbliebene fehlerhafte Angaben und deren Folgen.
Diplomica GmbH
http://www.diplom.de, Hamburg 2001
Printed in Germany
Wissensquellen gewinnbringend nutzen
Qualität, Praxisrelevanz und Aktualität zeichnen unsere Studien aus. Wir
bieten Ihnen im Auftrag unserer Autorinnen und Autoren Wirtschafts-
studien und wissenschaftliche Abschlussarbeiten Dissertationen,
Diplomarbeiten, Magisterarbeiten, Staatsexamensarbeiten und Studien-
arbeiten zum Kauf. Sie wurden an deutschen Universitäten, Fachhoch-
schulen, Akademien oder vergleichbaren Institutionen der Europäischen
Union geschrieben. Der Notendurchschnitt liegt bei 1,5.
Wettbewerbsvorteile verschaffen Vergleichen Sie den Preis unserer
Studien mit den Honoraren externer Berater. Um dieses Wissen selbst
zusammenzutragen, müssten Sie viel Zeit und Geld aufbringen.
http://www.diplom.de bietet Ihnen unser vollständiges Lieferprogramm
mit mehreren tausend Studien im Internet. Neben dem Online-Katalog und
der Online-Suchmaschine für Ihre Recherche steht Ihnen auch eine Online-
Bestellfunktion zur Verfügung. Inhaltliche Zusammenfassungen und
Inhaltsverzeichnisse zu jeder Studie sind im Internet einsehbar.
Individueller Service
Gerne senden wir Ihnen auch unseren Papier-
katalog zu. Bitte fordern Sie Ihr individuelles Exemplar bei uns an. Für
Fragen, Anregungen und individuelle Anfragen stehen wir Ihnen gerne zur
Verfügung. Wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit.
Ihr Team der Diplomarbeiten Agentur
Inhaltsverzeichnis
II
Inhaltsverzeichnis:
1. EINLEITUNG...1
1.1
E
INFÜHRUNG
...1
1.2
Z
IELSETZUNG UND
P
ROBLEMSTELLUNG
...2
1.3
G
ANG DER
U
NTERSUCHUNG
...2
2. BEGRIFFLICHKEITEN ...5
2.1
R
EKRUTIERUNG
...5
2.2
F
ÜHRUNGSKRÄFTE
...7
2.3
I
NTERNET
...10
3. DAS INTERNET...11
3.1
D
IE
G
ESCHICHTE DES
I
NTERNET
...11
3.2
D
IE
D
IENSTE IM
I
NTERNET
...13
3.2.1
Das World Wide Web ...13
3.2.2
FTP...14
3.2.3
Elektronische Post...14
3.2.4
Usenet ...15
3.2.5
Telnet ...15
3.2.6
Internet Konferenzen ...16
4. PERSONALREKRUTIERUNG...18
4.1
P
ROZEß DER
P
ERSONALREKRUTIERUNG
...18
4.1.1
Gewinnung und Analyse personalbeschaffungsrelevanter
Informationen...18
4.1.2
Ermittlung und Bestimmung von Beschaffungswegen und
arten ...20
4.1.3
Personalauswahl ...23
4.1.4
Personalbindung ...27
Inhaltsverzeichnis
III
5. CH@NCEN UND RISIKEN DER REKRUTIERUNG VON
FÜHRUNGSKRÄFTEN IM INTERNET...29
5.1
B
ESCHAFFUNGSARTEN
...29
5.1.1
WWW ...30
5.1.1.1
Firmeneigene Homepage ...30
5.1.1.2
Jobbörsen...40
5.1.2
Newsgroups ...46
5.1.3
E-Mail ...47
5.1.4
Kommunikation zwischen Stellenanbietern und
Stellensuchenden ...48
5.2
P
ERSONALAUSWAHL
...53
5.2.1
Bewerbervorauswahl...53
5.2.2
Bewerberfeinselektion ...60
5.3
P
ERSONALBINDUNG
...65
6. PRAXISBEISPIEL DER GRUPPE DEUTSCHE BÖRSE AG ...67
7. ZUSAMMENFASSENDE PERSPEKTIVISCHE ANALYSE...73
8. LITERATURVERZEICHNIS ...77
9. ANHANG...84
9.1
D
IE GRÖßTEN
J
OBBÖRSEN IN
D
EUTSCHLAND
...84
9.2
B
EITRÄGE AUS WWW
.
NET
-
BUSINESS
.
DE
...86
9.3
B
EITRAG AUS WWW
.
SIGNATURRECHT
.
DE
...95
Abkürzungsverzeichnis
IV
Abkürzungsverzeichnis:
AC Assessment
Center
AG Aktiengesellschaft
APRA
Advanced Research Projekt Agency
Bzw.
Beziehungsweise
DSL
Digital
subscriber
line
E-Mail Electronic Mail
Etc. Et
cetera
Evtl.
Eventuell
f.
(ff.) Folgende
Seite(n)
FAZ
Frankfurter
Allgemeine
Zeitung
FTP
File
Transfer
Protocol
HR Human
Resources
http Hypertext
Transfer
Protocol
I.d.R. In der Regel
IP
Internet Protocol
IRC Internet
Relay
Chat
Jg. Jahrgang
NNTP Network News Transfer Protocol
TCP
Transmission Control Protocol
Techn.
Technisch
U.a.
Unter
anderem
USA United States of America
UUCP Unix-to-Unix Copy Protocol
Vgl. Vergleiche
WWW World Wide Web
Z.B.
Zum
Beispiel
1. Einleitung
1
,,Personalbeschaffung bleibt die Kunst,
Gesichter in der Menge zu finden.
Sachverstand, Hilfsmittel und Glück
sind das Triumvirat des Erfolges!"
Hans-Joachim Kempe, 1990
1.
Einleitung
1.1 Einführung
Eine junge Frau möchte sich für eine führende Position in einem renommier-
ten Unternehmen bewerben und ruft dazu die entsprechende Unterneh-
menshomepage auf. Sie klickt zielgerichtet auf den Personalbereich und von
dort auf die offenen Stellen. Nachdem sie eine ihr angemessen erscheinende
Stellenausschreibung sichtet, beginnt sie den Bewerbungsprozeß. Nach Ein-
gabe ihrer persönlichen Daten und eines auf die entsprechende Position ge-
richteten Bewerbungsanschreibens inklusive Lebenslauf und Lichtbild führt
sie das Computerprogramm automatisch zu einem virtuellen Vorstellungsge-
spräch. Eine erste Hürde ist übersprungen. Entgegen ihren Gewohnheiten
kann sie in diesem Gespräch jedoch die ´Waffen einer Frau`, die sie bislang
so häufig genutzt hatte, nicht einsetzen. Der virtuelle, mit künstlicher Intelli-
genz ausgestattete Interviewer verschafft sich einen ´persönlichen` Eindruck
von der Bewerberin, wobei er durch ausgesprochene Neutralität und Seriosi-
tät besticht. Eignungspotential sowie Interessen und Wünsche der Kandidatin
werden durch den virtuellen Gesprächspartner erfaßt.
Fiktion oder bereits Wirklichkeit? Dieses Szenario ist zweifelsohne Zukunfts-
musik, könnte aber schon bald Realität werden, wenn sich das Medium In-
ternet weiterhin derart rasant entwickelt, wie es in den vergangenen Jahren
der Fall war.
1. Einleitung
2
1.2 Zielsetzung
und
Problemstellung
Mit dem Internet steht Unternehmen ein Medium zur Verfügung, das zuneh-
mend traditionelle Tätigkeiten wie Kontakte zu Käufern, Kunden und Liefe-
ranten übernimmt. Eine derartige Entwicklung macht auch vor der Personal-
abteilung nicht halt. So wird immer häufiger versucht, auch den Prozeß der
Personalbeschaffung auf das Medium Internet zu übertragen.
Fraglich ist jedoch, ob und in wie weit dieses Medium tatsächlich zur Perso-
nalrekrutierung geeignet ist. Ziel dieser Arbeit ist es, die derzeitigen Chancen
und Risiken der Rekrutierung mit Hilfe des Internets darzustellen. Die Beto-
nung liegt hierbei auf dem Wort derzeit, denn die rasante Entwicklung im Be-
reich der Internetanwendungen macht langfristige Aussagen nahezu unmög-
lich. Da die Personalrekrutierung einen Prozeß darstellt, werden die einzel-
nen Prozeßschritte auf ihre Chancen und Risiken untersucht. Schwerpunkt-
mäßig geht es um die Rekrutierung von Führungskräften. Zunehmend er-
kennen große Unternehmen und grundsätzlich alle mit einem Bedarf an
hochqualifiziertem Personal, daß diese Zielgruppe in ganz besonderem Ma-
ße über das Internet anzusprechen ist.
1
Besondere Aufmerksamkeit gilt es
dabei der Tatsache zu schenken, daß die zentrale Kompetenz von Füh-
rungskräften neben der fachlichen und strategischen Eignung in den sozialen
Fähigkeiten liegt. Dies wird bei der folgenden Untersuchung eine bedeutende
Rolle spielen.
1.3 Gang
der
Untersuchung
Für die Darstellung der Chancen und Risiken der Führungskräfterekrutierung
mit Hilfe des Internets bietet sich folgende Vorgehensweise an:
1
Vgl. Konradt, Udo / Fischer, Peter: Personalm@rketing mit Online Assessments, in: Perso-
nalwirtschaft, Sonderheft, 5 (2000), S. 45. [im folgenden zitiert als: Konradt / Fischer, 2000]
1. Einleitung
3
Um für den Gang der Untersuchung ein einheitliches Verständnis zu gewähr-
leisten, werden zu Beginn der Arbeit in Kapitel zwei die zentralen Begriffe
Führungskräfte, Rekrutierung und Internet definiert.
Das dritte Kapitel gibt einen Überblick über die Geschichte des Internet und
die vielfältigen Informations- und Kommunikationsmöglichkeiten, die es sei-
nen Nutzern bietet. Eine derartige Vertiefung der in Kapitel zwei gegebenen
Definition erweist sich als sinnvoll, da das Internet ein recht neues Medium
ist.
In einem vierten Kapitel wird die in Kapitel zwei eingeführte Definition der
Personalrekrutierung vertieft. Es werden die einzelnen Prozeßschritte einge-
hend dargestellt, was notwendig ist, da im folgenden Kapitel die Übertrag-
barkeit dieser Schritte auf das Internet überprüft wird.
In diesem Kapitel fünf steht die Gruppe der Führungskräfte im Mittelpunkt
der Überlegungen. Da der Beschaffungsprozeß im Internet für Führungskräf-
te im wesentlichen vergleichbar ist mit der Rekrutierung anderer Mitarbeiter-
gruppen, wird nicht immer ausdrücklich auf diese Gruppe verwiesen. Viel-
mehr gelten die in diesem Kapitel gemachten Aussagen allgemein für die
Personalbeschaffung über das Internet. Wenn dies nicht der Fall ist und spe-
zielle Bedingungen für Führungskräfte gelten, wird explizit darauf hingewie-
sen.
Es folgt in Kapitel sechs die Darstellung der Rekrutierungspraxis im Internet
eines ausgewählten Unternehmens. Die Deutsche Börse AG wurde dabei
zielgerichtet ausgewählt, da sie einen hohen Bedarf an Führungskräften hat
und bereits auf eine dreijährige Erfahrung im Bereich der digitalen Mitar-
beiterbeschaffung zurückblicken kann.
1. Einleitung
4
Schließlich werden in einem siebten und letzten Kapitel die gewonnenen
Erkenntnisse zusammengefaßt. Darüber hinaus wird ein Ausblick in Zukunft
gewagt.
Es sei erwähnt, daß im Rahmen dieser Arbeit auf eine Geschlechterunter-
scheidung in der Wortwahl zugunsten eines besseren Leseflusses verzichtet
wird. In die männliche Form sei stets die weibliche eingeschlossen.
2. Begrifflichkeiten
5
2.
Begrifflichkeiten
2.1 Rekrutierung
Der Begriff der Rekrutierung ist militärischer Herkunft und kann mit ,,Ergän-
zung der Mannschaft"
2
übersetzt werden. Übertragen auf die Personalarbeit
bedeutet Rekrutierung die Ergänzung des Unternehmens durch neue Mitar-
beiter. Rekrutierung fällt demnach in den unternehmerischen Bereich der
Personalwirtschaft.
3
Ein zentraler Aspekt der Personalwirtschaft ist die Per-
sonalbeschaffung, deren Bestandteil die Rekrutierung ist. Eine Analyse von
verschiedenen Definitionen des Begriffes der Personalbeschaffung zeigt, daß
weder in der Praxis noch in der Wissenschaft ein einheitliches Begriffsver-
ständnis auszumachen ist. Enge Begriffsabgrenzungen verstehen unter Per-
sonalbeschaffung lediglich die Suche und Bereitstellung von Personalres-
sourcen.
4
Demgegenüber versteht Hentze in seinem sehr breiten Definiti-
onsansatz unter Personalbeschaffung einen Prozeß, welcher sich aus den
folgenden vier Phasen zusammensetzt
5
:
1. Phase:
Gewinnung und Analyse personalbeschaffungsrelevanter
Informationen
2. Phase:
Ermittlung und Bestimmung von Beschaffungsarten und
wegen
3. Phase:
Personalauswahl
4. Phase:
Personalbindung
2
Bedürftig, Friedemann: DIE AKTUELLE DEUTSCHE RECHTSCHREIBUNG VON A Z,
Köln: Naumann & Göbel 1996, S. 757[im folgenden zitiert als: Bedürftig, 1996]
3
Vgl. Hentze, Joachim: Personalwirtschaftslehre 1, Grundlagen, Personalbedarfsermittlung,
-beschaffung, -entwicklung und einsatz, 6., überarbeitete Auflage, Stuttgart: Haupt 1994, S.
217. [im folgenden zitiert als: Hentze, 1994]
4
Vgl. Berthel, Jürgen: Personal-Management, Grundzüge für Konzeptionen betrieblicher
Personalarbeit, 5., aktualisierte und korrigierte Auflage, Stuttgart: Schäffer-Poeschel 1997,
S. 167. [im folgenden zitiert als: Berthel, 1997]; Vgl. Harlander, Norbert u.a.: Personalwirt-
schaft, 3., überarbeitete Auflage, Landsberg/Lech: Moderne Industrie 1994, S. 282. [im fol-
genden zitiert als: Harlander, 1994]
5
Vgl. Hentze, 1994, S. 219.
2. Begrifflichkeiten
6
Das Sachziel der Personalbeschaffung besteht nach diesem Ansatz nicht
allein in der Identifizierung mehrerer den Anforderungsprofilen der zu beset-
zenden Stelle entsprechenden Bewerber, sondern ebenso in der Personal-
auswahl und -bindung derselben.
Unabhängig von der gewählten Definition wird grundsätzlich differenziert
zwischen der internen und der externen Personalbeschaffung. Interne Per-
sonalbeschaffung meint die Besetzung von vakanten ,,Stellen aus dem Krei-
se der im Betriebe bereits beschäftigten Mitarbeiter"
6
. Im Gegensatz dazu
liegen bei der externen Personalbeschaffung die aktivierbaren Personalres-
sourcen außerhalb des eigenen Betriebes.
7
Da es sich bei der Rekrutierung
um eine ,,Ergänzung der Mannschaft"
8
handelt, zielt diese Begriffsdefinition
auf die ,,dauernde Erhöhung der Belegschaft durch Abschluß neuer Arbeits-
verträge"
9
ab und ist demnach der externen Personalbeschaffung zuzuord-
nen. Diesem Verständnis des Begriffs der Personalrekrutierung folgt auch
Berthel, der allerdings die Personalbeschaffung lediglich als ,,(...) die Suche
und Bereitstellung menschlicher Arbeitskräfte (...)"
10
definiert.
6
Berthel, 1997, S. 167
7
Vgl. Berthel, 1997, S. 167
8
Bedürftig, 1996, S. 757
9
Bisani, Fritz: Personalwesen und Personalführung, der state of the art der betrieblichen
Personalarbeit, 4., vollständig überarbeitete und erweiterte Auflage, Wiesbaden: Gabler
1995, S. 246
10
Berthel, 1997, S. 166
2. Begrifflichkeiten
7
Methoden der Personalbeschaffung
11
Abb. 1: Methoden der Personalbeschaffung
Im folgenden werden die Begriffe Personalrekrutierung, Rekrutierung und
externe Personalbeschaffung synonym verwendet, wobei ein weites Begriffs-
verständnis der Personalbeschaffung, wie es etwa Hentze postuliert, zugrun-
de liegt.
2.2 Führungskräfte
In der Literatur gibt es zum Terminus der Führungskraft keine einheitliche
Begriffsbestimmung.
Trotz dieser Uneinheitlichkeit werden übereinstimmend in nahezu allen Defi-
nitionen folgende Kriterien einer Führungskraft genannt: Die hierarchische
Position; der Vorgesetztenstatus; das Recht, anderen verbindlich Weisungen
11
Vgl. Berthel, 1997, S. 168.
Personalbeschaffung
intern
extern
Personalentwicklung
Personalrekrutierung
Versetzung
Aufgabenver-
änderung
Personallea-
sing
Abschluß
neuer Ar-
beitsverträge
Anwerbung
Arbeitsvermit
tlung
2. Begrifflichkeiten
8
erteilen zu können; das Ausmaß an Entscheidungsbefugnissen und schließ-
lich der Einfluß auf das Unternehmensgeschehen.
12
Die Definitionen unterscheiden sich dadurch, daß sie jeweils verschiedene
dieser Kriterien in den Mittelpunkt stellen. Enge Abgrenzungen verstehen
unter einer Führungskraft lediglich ,,den Personenkreis, der dispositive Auf-
gaben verrichtet bzw. einem Leitungsgremium angehört"
13
. Auch Welge be-
zieht in seiner engen Definition nur die Mitglieder des Leitungsgremiums wie
Vorstand oder Geschäftsführung mit ein.
14
Derweil zählen breitere Definitio-
nen auch Meister und leitende Angestellte zum Kreis der Führungskräfte.
15
Für Goossens beispielsweise ist eine Führungskraft in einem Unternehmen
,,derjenige, der unternehmerische Aufgaben zu erfüllen hat, und zwar entwe-
der als Vorgesetzter oder selbstverantwortlich als Nichtvorgesetzter"
16
, wobei
Goossens den Vorgesetzten als denjenigen ,,im Unternehmen, der einem
anderen Anordnungen zu erteilen und deren Ausführungen zu überwachen,
kontrollieren und zu beurteilen hat"
17
definiert. Auch Olfert und Rahn vertre-
ten diesen weiten Ansatz. Für sie ist die Führungskraft ,,ein Vorgesetzter, der
die Aufgabe hat, die ihm unterstellten Mitarbeiter so zu beeinflussen, daß sie
erfolgreich arbeiten"
18
.
Zur übersichtlicheren Darstellung des breiten Spektrums hat sich eine Diffe-
renzierung in obere, mittlere und untere Führungskräfte etabliert. Unter
oberen Führungskräften versteht man dabei die Mitglieder der höchsten Un-
ternehmensebene wie Vorstände oder Geschäftsführer. Mittlere Führungs-
12
Vgl. Welge, Martin K.: Führungskräfte, in: Handwörterbuch des Personalwesens, Gaugler,
Eduard / Weber, Wolfgang, 2.Auflage, Stuttgart: Poeschel 1992, S. 937. [im folgenden zitiert
als: Welge 1992]; Weber, Wolfgang u.a.: Grundbegriffe der Personalwirtschaft, Stuttgart:
Schäfer-Pöschel 1993, S. 109. [im folgenden zitiert als: Weber, 1993]
13
Weber, 1993, S. 109 f.
14
Vgl. Welge, 1992, S. 938.
15
Vgl. Weber, 1993, S. 109.
16
Goossens, Franz: Personalleiterhandbuch, 7 neu bearbeitete ergänzte Auflage, Lands-
berg am Lech: Moderne Industrie 1981, S. 69. [im folgenden zitiert als: Goossens, 1981]
17
Goossens, 1981, S. 69.
18
Olfert, Klaus / Rahn, Hans-Joachim: Lexikon der Betriebswirtschaftslehre, 3. Auflage,
Ludwigshafen: Kiehl 2000, S. 357. [im folgenden zitiert als: Olfert 2000]
2. Begrifflichkeiten
9
kräfte sind beispielsweise der Leiter von bestimmten Sachgebieten wie Ver-
kauf, Personal oder Produktion. Die Kräfte der unteren Führungsebene sind
alle sonstigen Vorgesetzten und Mitglieder von Stabspositionen.
19
Grundsätzlich ist diese differenzierte Begriffsbestimmung Bestandteil der fol-
genden Ausführungen. In die Überlegungen des Hauptteils geht indes der
Kreis der oberen Führungsebene nicht ein. Diese Zielgruppe wird fast aus-
schließlich durch die Ansprache durch sogenannte Head Hunter rekrutiert
und hat sich daran gewöhnt, sich nicht eigenständig auf die Suche nach ei-
nem neuen Job zu begeben.
20
Wesentliche Anforderungen an Führungskräfte lassen sich mit dem Begriff
Führungseigenschaften zusammenfassen, die es bei einem Rekrutie-
rungsprozeß zu erfassen gilt. Derartig unverzichtbare Grundeigenschaften
fasst Dichtl unter Sachkompetenz, der Fähigkeit zur Koordination und Leis-
tungsmotivation sowie einem ausgeprägten Urteilsvermögen zusammen.
Sachkompetenz oder auch technical skills sind dabei ein ausgeprägtes
Fachwissen sowie die Fähigkeit zu organisatorischen Vereinfachungen und
zur Rationalisierung. Der zweite Fähigkeitsbereich die sogenannten social
skills steht für Behutsamkeit, Menschenkenntnis und eine positive Einstel-
lung zum Leistungsprinzip. Des weiteren spricht man im Rahmen des Ur-
teilsvermögens von den conceptual skills. Sie beschreiben die Fähigkeit
komplexe, für das Unternehmen wesentliche Vorgänge richtig einschätzen zu
können, das Ganze zu sehen
21
.
19
Vgl. Welge, 1992, S. 938.
20
Gold, Gregor: Mehr Masse als Klasse, in: IT.Service 7(2000), S. 26. [im folgenden zitiert
als: Gold, 2000]
21
Vgl. Dichtl, Erwin / Issing, Otmar: Vahlens großes Wirtschaftslexikon, 2 überarbeitete und
erweiterte Auflage, München: Vahlen 1993, S. 730 f. [im folgenden zitiert als: Dichtl 1993]
2. Begrifflichkeiten
10
2.3 Internet
Das Internet
22
ist ein heterogenes, weltweites Rechnernetz, das zahlreiche
Computernetze und daran angeschlossene Computer miteinander verbin-
det
23
. Ein gemeinsamer Softwarestandard, die sogenannten TCP/IP
Protokolle
24
, ermöglicht die Kommunikation der verschiedenen Rechner
untereinander. Der Aufbau des Internet ist eine Client Server Architektur.
Dies bedeutet, daß den Computern zwei unterschiedliche Aufgaben
zukommen. Während die Server verwalten, speichern und Informationen
verarbeiten, fordert der Client diese Informationen an.
Aufgrund seiner maßgeblichen Bedeutung für diese Arbeit wird das Medium
Internet im folgenden eingehender betrachtet.
22
Der Begriff Internet ist die Kurzbezeichnung für das aus dem Englischen stammende
Wort ´internetworked`. Häufig findet man auch die Kurzbezeichnungen Inet und das Netz.
23
Vgl. Kalmring, Dirk: Internet für Wirtschaftswissenschaftler, Köln: Eul 1996, S. 5. [im fol-
genden zitiert als: Kalmring 1996]
24
Das TCP/IP Protokoll ist das wichtigste und Ursprung aller anderen Protokolle. TCP zer-
legt Dateien in Pakete und setzt sie dann wieder zusammen. IP überträgt die Pakete durchs
Internet.
3. Das Internet
11
3.
Das
Internet
Das Internet hat sich in den letzten Jahren zu einem überaus bedeutenden
und erfolgreichen Kommunikations- und Informationsmedium entfaltet und
entwickelt sich ständig mit rasender Geschwindigkeit weiter. Nahezu jedem
ist das Internet ein Begriff, doch kaum jemand weiß genau, was das Netz
wirklich ist und was es zu leisten vermag. Um bestimmte Vorgänge im Rech-
nernetz und das Verhalten von Nutzern verstehen zu können, ist jedoch die
genaue Kenntnis von Entwicklung und Funktionsweise Voraussetzung.
3.1 Die Geschichte des Internet
Zum exakten Entstehungsjahr des Internet gibt es unterschiedliche Meinun-
gen. Allen gemein ist, daß dessen ´Geburt` in die Zeit der Anfänge des kalten
Krieges fällt, die wesentlich gekennzeichnet war durch die Vorstellung, daß
es im Ost West Konflikt nicht nur um eine Auseinandersetzung zwischen
unterschiedlichen Lebensformen und Gesellschaftssystemen ging, sondern
um einen Kampf um Leben und Tod, welcher beide Seiten existentiell be-
drohte.
Zu dieser Zeit gründeten die USA eine Organisation namens APRA, die die
Führung in der militärischen Anwendung von Wissenschaft und Technologie
erzielen sollte.
25
Die APRA finanzierte mit großem Aufwand ein Projekt, wel-
ches die Kommunikation zwischen Rechnern an unterschiedlichen Standor-
ten ermöglichen sollte. Der Grund für die Verfolgung eines derartigen Projek-
tes war, daß dem amerikanischen Departement of Defense ein Medium zur
Verfügung gestellt werden sollte, daß bei einem atomaren Anschlag eine
Reorganisation des Landes ermöglicht.
26
Für diesen Zweck war eine dezen-
25
Vgl. Rohner, Kurt: Der Internet Guide für Manager, Neue Chancen nutzen, wertvolle In-
formationen sammeln, Produkte und Dienstleistungen optimal vermarkten, Landsberg/Lech:
Moderne Industrie 1997, S. 23. [im folgenden zitiert als: Rohner, 1997]
26
Vgl. Kalmring, 1996, S. 5.
3. Das Internet
12
trale Organisation des Projektes erforderlich; eine Fremdkontrolle/Zerstörung
konnte auf diese Weise nahezu ausgeschlossen werden.
27
Wie gezeigt wurde, ist das Internet militärischen Ursprungs, was um so
erstaunlicher ist, da es häufig als chaotisch und anarchistisch beschrieben
wird.
28
Zur Entstehungszeit des Internets waren Computer im Gegensatz zu
heute ,,Einzelanfertigungen, die leicht mehr als ein Einfamilienhaus kosteten
(und zunächst auch beinahe diese Größe hatten)"
29
und ,,Software war ein
speziell für einen Rechner geschriebenes Einzelstück".
30
Die Arbeit mit ei-
nem Computer war somit enorm zeit- und kostenintensiv.
Im Auftrag der APRA wurden 1969 die ersten Rechner, die Computer von
vier Universitäten in Kalifornien, miteinander verbunden.
31
Dieses erste Netz
wurde nach seinen Entwicklern APRAnet getauft. Es wurde ständig weiter
entwickelt, und Anfang der 80er Jahre wurde der militärische Teil in das so-
genannte Milnet ausgegliedert. Das APRAnet diente von nun an nur noch
dem zivilen, vorerst wissenschaftlichen Zweck. Weltweit entstanden immer
neue Netze, die nun auch untereinander vernetzt wurden, was das eigentli-
che ´Internetworking` darstellt.
1983 setzte sich das TCP/IP Protokoll als Übertragungsprotokoll durch. Es
gewährleistete eine Kommunikation unabhängig vom Übertragungsmedium,
das APRAnet hieß von nun an Internet.
32
Durch den multimedialen Informati-
onsdienst WWW verbreitete sich das Internet ab 1989 mit rasanter Ge-
schwindigkeit, vor allem im kommerziellen und rein privaten Bereich.
33
Mit
27
Vgl. Kalmring, 1996, S. 6.
28
Vgl. Kalmring, 1996, S. 5.
29
Metzger, R. / Funk, C., Bewerben im Internet, Niedernhausen: Falken 1998, S. 13. [im
folgenden zitiert als: Metzger / Funk, 1998]
30
Metzger / Funk, 1998, S. 13.
31
Vgl. Rohner, 1997, S. 24.
32
Vgl. Kalmring, 1996, S. 6.
33
Vgl. Metzger / Funk, 1998, S. 15.
3. Das Internet
13
der Veröffentlichung des ersten Browsers
34
1993, mit dem Bilder, Texte und
Videoclips dargestellt werden konnten, hat das Internet in Form des WWW
endgültig den Durchbruch geschafft. Es wurde nutzerfreundlich und multime-
dial.
35
3.2 Die Dienste im Internet
Gemeinhin wird das Internet mit dem World Wide Web gleichgesetzt, doch
das Netz beinhaltet weit mehr als diesen wohl bekanntesten Dienst. Unter
einem Dienst im Internet versteht man Informations- und Kommunikations-
angebote, die mit einer Datenleitung erreichbar sind.
36
In diesem Kapitel werden nun die unterschiedlichen Dienste, die das Internet
bietet, dargestellt. Diese Darstellung ist für den weiteren Verlauf der Arbeit
bedeutungsvoll, da Unternehmen bei der Rekrutierung von Führungskräften
einen Großteil der angebotenen Dienste in Anspruch nehmen können.
Zu den gängigen online angebotenen Diensten zählen neben dem WWW der
Dateitransfer über FTP, die elektronische Post, Diskussionsforen, Terminal-
verbindungen zu entfernten Internet Rechnern sowie Internet-Konferenzen
über Schriftsprache, gesprochene Sprache und Videokonferenzen.
37
3.2.1 Das World Wide Web
Der bekannteste Dienst, der den einfachsten Zugang zum Internet bietet, ist
das World Wide Web. Dieses weltweite Gewebe ist ein auf Hypertext und
Hypermedia basierendes System zum Aufspüren von Ressourcen im Inter-
34
Ein Browser ist ein Programm, mit dem man Web-Seiten betrachten kann. Die am meisten
verbreiteten Browser sind der Netscape Navigator und der Microsoft Internet Explorer. Sie
beherrschen neben der Darstellung von Web-Seiten auch den Zugriff auf andere Internet-
dienste.
35
Vgl. Metzger / Funk, 1998, S. 16.
36
Vgl. Kalmring, 1996, S. 26.
3. Das Internet
14
net, die durch grafische Browser wie dem Netscape Navigator geöffnet wer-
den.
38
Mit Hypermedia bezeichnet man dabei multimediale, mit Links
ausgestattete Dokumente, deren Bestandteil der Hypertext ist. Der Hypertext
ist derjenige Text, der die Verweise zu anderen Informationen enthält.
39
3.2.2
FTP
Weiterhin stellt das Internet seinen Usern das sogenannte FTP, File Transfer
Protocol, zur Verfügung, auf dessen Basis Daten mit einer hohen Übertra-
gungsrate auf entfernte Rechner gespielt (upload) oder aber Informationen
und Software von entfernt liegenden Rechnern/Servern auf den eigenen
Computer heruntergeladen (download) werden können.
40
Das File Transfer
Protocol basiert auf einer TCP/IP Basis.
41
Für seine Verwendung genügen
moderne Browser wie Netscape oder der Microsoft Internet Explorer.
3.2.3
Elektronische
Post
Die elektronische Post, der sogenannte E-Mail-Dienst, ist die meistgenutzte
Kommunikationsform im Internet. Sie ermöglicht zeitversetzt ähnlich der
Briefpost , schriftliche Nachrichten an einen Empfänger zu versenden und
Mitteilungen zu erhalten. Der große Vorteil gegenüber anderen Kommunika-
tionsmedien im Netz liegt darin, daß die Gesprächspartner nicht zeitgleich
online sein müssen. E-Mails lassen sich in jeder beliebigen Dateiform trans-
portieren und gelangen nahezu immer schneller an ihren Bestimmungsort als
eine auf herkömmlichem Wege versandte Nachricht.
42
Der E-Mail-Dienst er-
37
Vgl. Hanke, Johann-Christian: Internet, Poing: Franzis 1999, S. 14. [im folgenden zitiert
als: Hanke, 1999]
38
Vgl. Rohner, 1997, S. 350.
39
Vgl. Kalmring, D., 1996, S. 164.
40
Vgl. Hanke, J., 1999, S. 179.
41
Vgl. Kronenberg, Friedrich: Das Internet Einmaleins, Düsseldorf und München: ECON
1999, S. 327. [im folgenden zitiert als: Kronenberg, 1999]
42
Vgl. Kronenberg, 1999, S. 203.
3. Das Internet
15
freut sich unter den Internet-Nutzern ständig wachsender Beliebtheit und ist
dabei, den traditionellen Postdiensten ´den Rang abzulaufen`.
43
3.2.4
Usenet
Mit dem Dienst Usenet ermöglicht das Internet seinen Nutzern die Teilnahme
an zahlreichen im Netz vorhandenen Newsgroups, die so etwas wie ein
´schwarzes Brettes` im Internet darstellen. Themenorientiert kann der Use-
netnutzer auf bestimmten Seiten im Internet Informationen veröffentlichen
oder andere veröffentlichte Beiträge lesen. Das Usenet basiert auf den
UUCP oder NNTP-Protokollen, wobei sämtliche hier angebotenen Informati-
onen als öffentlich anzusehen sind. Sie können vor einem fremden Zugriff
nicht geschützt werden.
44
Um die einzelnen Newsgroups über das Usenet zu
erschließen, wird ein spezielles Programm, ein sogenannter Newsreader,
benötigt, welcher etwa im Microsoft Internet Explorer Paket enthalten ist.
45
Im Vergleich mit dem WWW oder dem E-Mail-Dienst ist das Usenet wesent-
lich unbekannter und wird dementsprechend bedeutend weniger frequentiert.
3.2.5
Telnet
Der Telnet Dienst bietet, ähnlich dem File Transfer Protocol, die Möglichkeit,
auf der Basis von TCP/IP entfernte Rechner anzuwählen und aus der Ferne
zu bedienen. Hier handelt es sich indes nicht um einen Down- oder Upload
Vorgang, sondern mit einer Berechtigung kann der User auf dem entfernt
liegenden Rechner Prozesse starten und ausführen.
46
43
Vgl. Kronenberg, 1999, S. 202.
44
Vgl. Rohner, 1997, S. 238.
45
Vgl. Kronenberg, 1999, S. 273.
46
Vgl. Kalmring, 1996, S. 41.
3. Das Internet
16
3.2.6
Internet
Konferenzen
Drei bedeutende Dienste gehören zu der Gruppe der Internet Konferenzen.
Diese sind das Zusammenkommen über Schriftsprache, über gesprochene
Sprache und die Videokonferenz.
Eine Konferenz über Schriftsprache ist der sogenannte Internet-Chat. Die
Begriffe Chat oder auch das Chatten, die aus dem Englischen stammen, be-
deuten übersetzt so viel wie ´plaudern` oder ´tratschen` über das Internet.
Der Chat bietet die Möglichkeit, von Person zu Person oder in einer großen
Gruppe über Texteingabe am Bildschirm nahezu zeitsynchron zu kommuni-
zieren. Notwendige Voraussetzung hierfür ist, daß alle Teilnehmer über ei-
nen Internetzugang verfügen sowie gleichzeitig online sind.
Als Alternative zur schriftlichen Kommunikation gibt es die Kommunikation
über gesprochene Sprache, die besser bekannt ist unter den Begriffen In-
ternettelephonie und Internetaudiokonferenzen. Mit einem multimediafähigen
PC und der entsprechenden Internet-Phone-Software kann man zu relativ
geringen Kosten und annehmbarer, jedoch gegenüber dem Telefon vermin-
derter Qualität, miteinander sprechen.
47
Mit einer geeigneten Software bietet das Internet außerdem die Möglichkeit
der Kommunikation über Videokonferenzen. Bei dieser Form der Verständi-
gung werden Videobilder und Audiodaten über das Netz vermittelt. Hier be-
nötigt man neben der Software einen geeigneten Internetanschluß sowie ei-
ne Kamera, die sich an einen PC anschließen läßt.
48
Der Ablauf der Video-
konferenz ist dem der Internettelephonie vergleichbar. Auch hier müssen sich
47
Vgl. Hanke, 1999, S. 363.
48
Vgl. Hanke, 1999, S. 365.
3. Das Internet
17
beide Telnehmer über den Zeitpunkt einer Konferenz einig sein, wenn eine
Kommunikation zustande kommen soll.
4. Personalrekrutierung
18
4.
Personalrekrutierung
Wie in Kapitel zwei festgelegt, verwendet diese Arbeit einen breiten Definiti-
onsansatz für die Personalbeschaffung. Personalbeschaffung ist demnach
ein Prozeß, der ,,auf die Gewinnung der bedarfsgerechten Anzahl potentiell
für den vorgesehenen Arbeitsplatz geeigneter Personen nach vorgegebenem
Zeitpunkt und Zeitraum auszurichten"
49
ist.
4.1 Prozeß
der
Personalrekrutierung
Der Prozeß der Personalbeschaffung besteht aus den vier Schritten Gewin-
nung und Analyse personalbeschaffungsrelevanter Informationen, Ermittlung
und Bestimmung von Beschaffungsarten und wegen, Personalauswahl und
Personalbindung
50
. Im Hauptteil der Arbeit werden die Chancen und Risiken
einer Übertragbarkeit dieser Schritte auf das Internet untersucht. Dafür ist es
erforderlich, die Teilkomponenten näher vorzustellen.
4.1.1 Gewinnung und Analyse personalbeschaffungsrelevanter
Informationen
Die systematische Gewinnung und Analyse personalbeschaffungsrelevanter
Informationen steht nach Hentze am Anfang eines jeden Personalbeschaf-
fungsprozesses und ist Grundlage für einen zielgerichteten Einsatz beschaf-
fungsrelevanter Instrumentarien.
51
Nur bei Kenntnis der entsprechenden In-
formationen besteht die Möglichkeit einer effektiven und effizienten Bedarfs-
deckung. Mit dem Ende der Informationsbeschaffung und -verarbeitung sollte
feststehen, auf welchen Arbeitsmärkten nach potentiellen Mitarbeitern wel-
cher Zielgruppe und mit welchem Anforderungsprofil zu suchen ist.
49
Hentze, 1994, S. 217.
50
Vgl. Kapitel 2.1.
51
Vgl. Hentze, 1994, S. 219.
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Originalausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2001
- ISBN (eBook)
- 9783832443085
- ISBN (Paperback)
- 9783838643083
- DOI
- 10.3239/9783832443085
- Dateigröße
- 642 KB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- Katholische Fachhochschule Norddeutschland Osnabrück – Wirtschaft
- Erscheinungsdatum
- 2001 (Juli)
- Note
- 2,0
- Schlagworte
- internet personalbeschaffung personalmarketing personalrekrutierung
- Produktsicherheit
- Diplom.de