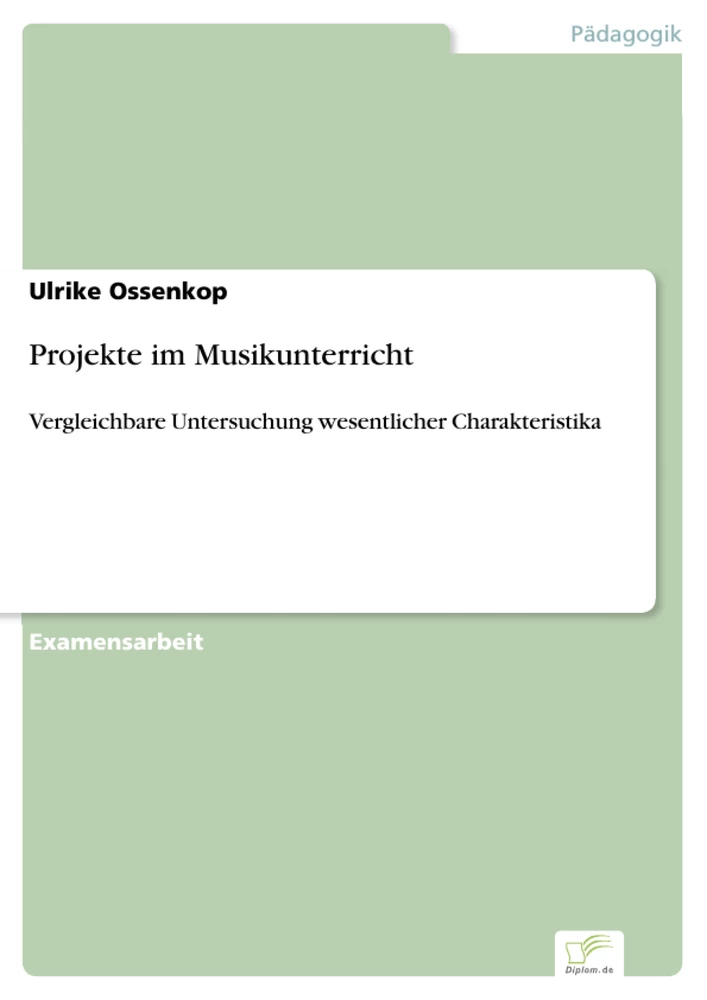Projekte im Musikunterricht
Vergleichbare Untersuchung wesentlicher Charakteristika
Zusammenfassung
Learning by doing heißt die Formel, auf die Deweys Idee des Projektlernens in der Literatur oft verkürzt wird. Flötenspielen lernt man beim Flötenspielen wusste auch schon Aristoteles in der Antike zu sagen. Diese Lernauffassung hat sich also bis heute nicht stark geändert: Projektunterricht ist en vogue, seine zentrale Aufgabe im Unterricht liegt in der Humanisierung und Demokratisierung des Umgangs der Menschen miteinander. Leider aber werden im Zuge seiner Verbreitung die ursprüngliche Idee und das eigentliche Konzept immer stärker verwässert.
Im Vergleich zur Fülle der vorhandenen Literatur zum Projektunterricht (vgl. Handbücher zum Projektunterricht, Unterrichtsbeispiele für Projekte etc.) existiert merkwürdigerweise nur relativ wenig beziehungsweise gar keine Fachliteratur innerhalb der Projektdiskussion, die sich auf den Musikunterricht bezieht abgesehen von wenigen Aufsätzen in den musikpädagogischen Zeitschriften und einigen wenigen sonstigen musikwissenschaftlichen Veröffentlichungen.
Das ist einer der Gründe für die Erstellung diese Arbeit mit musikpädagogischem Ansatz: Sie diskutiert die Projektidee und wendet die Ergebnisse auf den Musikunterricht an: Musik kann in ihren unterschiedlichsten Erscheinungsformen und auf verschiedenen Wegen im Musikunterricht behandelt werden, denn die Verbindlichkeiten für dieses Fach sind heutzutage erheblich gelockert wenn nicht sogar aufgehoben (Weber 1997). Demnach bietet sich der Musikunterricht als Arbeitsfeld für Projekte geradezu an. Darüber hinaus hat er die Möglichkeit, sein Augenmerk stärker auf die individuelle Entfaltung der Kinder zu richten, als nur darauf zu achten, ein gewisses Stoffpensum zu erfüllen.
(1) Die Arbeit gliedert sich in drei große Kapitel, von denen sich das erste mit der Projektidee und deren Begriffswandel auseinandersetzt und versucht, die aktuelle Diskussion sowie die mit ihr zusammenhängenden Schwierigkeiten aufzuzeigen: Was aber ist Projektunterricht, welche semantischen und terminologischen Probleme beinhaltet er? Handelt es sich bei ihm um eine Methode, ein Verfahren oder ein didaktisches Prinzip? Welche Positionen nehmen die Didaktiker und (Musik-)Pädagogen innerhalb der Projektdiskussion ein? Es werden die Aussagen bekannter Autoren wie Dewey, Hänsel, Gudjons und anderer diskutiert. Aber auch Pädagogen wie Kerschensteiner oder Kilpatrick werden nicht außer Acht gelassen.
Als Ergebnis dieser Diskussion werden drei […]
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis
0. Einleitung: Schulische Projektarbeit und Musikunterricht
I. Historische Voruntersuchung und Begriffsbestimmung des Projektunterrichts
1. Theorie und Entwicklung
1.1. Stichwort „Projekt“: ein Definitions-Vergleich (1962-95)
1.2. Rezeption und aktuelle Diskussion:
Begriff und Zielsetzungen im Wandel?
1.3. Was ist Projektunterricht? - Versuch einer Ortsbestimmung
2. Einzelaspekte des Projektunterrichts
2.1. Der Prozess des kreativen Denkens bei Poincaré
2.2. Motivationale Aspekte des Projektlernens
2.3. Komplementarität: Schüler- und Lehrer-Rolle
II. Projekte im Musikunterricht
1. Schwierigkeiten der Projektauswahl
2. Begründung und Darstellung der ausgewählten Projekte
2.1. Klangkörper – Klangräume - Raumerfahrungen (3./4. Klasse)
2.2. Schattentheater (Klassen 1-6)
2.3. „Die Moldau“ von Friedrich Smetana (6. Klasse)
2.4. „West Side Story“ von Leonard Bernstein (4. Klasse)
2.5. „Frau Holle“ – Ein musikalisches Märchen (3. Klasse)
3. Parallelen und Unterschiede - ein synoptischer Vergleich und seine Problematik
III. Die Rolle des Musikprojekts
1. Aufgabenstellung und Projektinhalt
1.1. Fächerübergreifende Aspekte
1.2. „Durststrecken“
1.3. Die Leistungsbeurteilung
2. Die gesellschaftliche Relevanz
3. Der musikunterrichtliche Erfolg
3.1. Kreativität, Improvisation und Komposition – oder:
Das Entdecken musikalischer Fähigkeiten
3.2. Lernerfolge und Lernleistungen der Schüler
3.3. Grenzen des Projektunterrichts im Fach Musik
I. IV. Resümee:
Wesentliche Charakteristika der vorgestellten Projekte
Fazit
V. Literaturverzeichnis
1. Allgemeine Literatur
2. Erfahrungsberichte über schulische Musik-Projekte
0. Einleitung: Schulische Projektarbeit und Musikunterricht
"Learning by doing" heißt die Formel, auf die Deweys Idee des Projektlernens in der Literatur oft verkürzt wird. "Flötenspielen lernt man beim Flötenspielen"[1] wusste auch schon Aristoteles in der Antike zu sagen. Diese Lernauffassung hat sich also bis heute nicht stark geändert.
Projektunterricht ist "en vogue"[2], seine zentrale Aufgabe im Unterricht liegt in der Humanisierung und Demokratisierung des Umgangs der Menschen miteinander. Leider werden im Zuge seiner Verbreitung die ursprüngliche Idee und das eigentliche Konzept immer stärker verwässert.
So führen viele Schulen seit den 80er Jahren z. B. ein- bis zweimal im Jahr Projektwochen durch, die Lehrer und besonders Schüler oft unter der Kategorie "Spaß" und als Schuljahresabschluss -Bonbon ansehen, so dass hier der Eindruck erweckt wird: Das ordentliche Unterrichten und Lernen geht nach den Ferien weiter, dieser Projektunterricht aber wird als "nette Spielweise außerhalb pädagogischer ernstzunehmender Arbeit" betrachtet und irgendwo als "isolierte Variable am Rande des Schullebens" eingeordnet (Duncker 1993, S. 66).
In dieser Zeit haben sich auch so manche Verkürzungen der ursprünglichen Projektintention eingeschlichen, die das Vorurteil vieler Eltern und Lehrer, im Projektunterricht würde nicht "richtig gelernt" werden nur noch unterstreichen (Gudjons 1993, S. 22).
Projektwochen als "dramaturgische Sonderform" des Projektlernens (Duncker 1993, S. 66) und als nur eine Möglichkeit, die Projektidee zu verwirklichen, werden in dieser Arbeit weitgehend außer acht gelassen. Vielmehr soll die Integration des Projektlernens in den alltäglichen Musikunterricht im Vordergrund stehen, um viele erstarrte Methoden des Alltags aufzulockern.
Deshalb soll Projektunterricht als eine "innere Reform" der Schule (Gudjons 1993, S. 16-42) behandelt werden, während auf die von vielen Autoren angestrebte "äußere Reform" (ebd.) nicht eingegangen wird, da dies den Rahmen der Arbeit sprengen würde.
"Musik kann in ihren unterschiedlichsten Erscheinungsformen und auf verschiedenen Wegen im Musikunterricht behandelt werden", denn die Verbindlichkeiten für dieses Fach sind heutzutage "erheblich gelockert wenn nicht sogar aufgehoben" (Weber 1997, S. 4). Demnach bietet sich der Musikunterricht als Arbeitsfeld für Projekte geradezu an. Darüber hinaus hat er die Möglichkeit, sein Augenmerk stärker auf die individuelle Entfaltung der Kinder zu richten, als nur darauf zu achten, ein gewisses Stoffpensum zu erfüllen.
Merkwürdigerweise ist aber der Musikunterricht auch derjenige, welcher in der gesamten mir bekannten Projekt-Literatur nicht als Beispiel – weder positiv noch negativ - angeführt wird.[3]
Was aber ist Projektunterricht, welche semantischen und terminologischen Probleme beinhaltet er? Handelt es sich bei ihm um eine Methode, ein Verfahren oder ein didaktischen Prinzip (vgl. Januschke 1992, S. 4)?
Die Arbeit gliedert sich in drei große Kapitel, von denen sich das erste mit der Projektidee und deren Begriffswandel auseinandersetzt und versucht, die aktuelle Diskussion aufzuzeigen sowie die mit ihr zusammenhängenden Schwierigkeiten.
Anschließend werden drei Aspekte der Projektidee aufgegriffen, die im Zusammenhang mit der Projektliteratur immer wieder genannt, aber oft den Anschein erwecken, dass sie in der Praxis recht unreflektiert verwendet werden.
Diese Auseinandersetzungen mit Theorie, Entwicklung und Teilaspekten des Projektunterrichts bilden das Fundament, um in Kapitel II eine Auswahl der Projekte im Musikunterricht durchführen und diese in Kapitel III anhand einiger Beispiele näher auswerten zu können.
Im zweiten großen Kapitel wird ein Querschnitt existierender Erfahrungsberichte von Musikprojekten in dem Zeitraum der Jahre 1960 bis 1998 aufgrund der in Kapitel I erarbeiteten Kriterien dargestellt sowie fünf ausgewählte Projekte als Unterrichtsbeispiele beschrieben und in einem letzten Schritt sowohl Gemeinsamkeiten und Unterschiede als auch die Problematik des Vergleichs herausgestellt, die diese Projekte aufweisen.
Im dritten großen Kapitel geht es um die Rolle des Musikprojekts und deren Möglichkeiten, die seiner Verwirklichung innerhalb des Schulalltags zur Verfügung stehen wie z. B. das fächerübergreifende Arbeiten oder das Problem der Leistungsbeurteilung.
In einem zweiten Schritt wird versucht werden, die gesellschaftliche Bedeutung aufzuzeigen, die Projekte im Musikunterricht in sich bergen.
Und schließlich soll auf den musikunterrichtlichen Erfolg eingegangen werden. Kann ein solcher in Form des Projekts optimaler als im traditionellen Unterricht – als Vergleich steht hier immer der „Lehrgang“ – erreicht werden?
Gleichzeitig werden hiermit aber auch Grenzen dieser Unterrichtsform deutlich, die nicht verschwiegen werden dürfen, weil sich sonst vom Projektunterricht ein falsches Bild ergäbe.
Im einem abschließenden Resümee sollen noch einmal die für die Musikprojekte typischen Charakteristika herausgestellt sowie ihre Relevanz für den Musikunterricht diskutiert werden.
I. Historische Voruntersuchung und Begriffsbestimmung des Projektunterrichts
1. Theorie und Entwicklung
1.1. Stichwort „Projekt“: ein Definitionsvergleich
Um eine erste Annäherung an den Begriff "Projekt" zu leisten, wurden 13 Artikel aus verschiedenen Lexika der Jahrgänge 1961 bis 1994 verglichen.[4] Eine differenzierte Darstellung der aktuellen Aspekte über die Idee des Projektlernens und ihre gegenwärtige Diskussion sollen in den folgenden Kapiteln (1.2. und 1.3.) einen Schwerpunkt bilden.
Kaiser gibt als einziger Autor eine etymologische Ableitung des "Projekts": Es stammt von dem lateinischen Verb "proicere", was soviel bedeutet wie vorwerfen, entwerfen, hinauswerfen. Die englische Vokabel "project" ist mit der deutschen bedeutungsgleich. Ein Projekt stellt also in seinem semantischen Ursprung einen Plan, Entwurf oder ein Vorhaben dar (in: Lenzen 1989, S. 1272).
Es wird jedoch in mehreren Artikeln darauf hingewiesen, dass der Projektbegriff infolge seiner Rezeption gegen den des – aus der deutschen Reformpädagogik kommenden – "Vorhabens" abzugrenzen und weiter zu fassen ist.[5]
Anhand der ausgewählten Zeitspanne von 33 Jahrgängen (s. o.) ist deutlich feststellbar, dass die Bedeutung des Projektunterrichts besonders seit den Studentenunruhen gegen Ende der 60er Jahre immer mehr zugenommen hat und heute aus dem aktuellen Schulleben kaum mehr wegzudenken ist (vgl. Bonn 1989).
In allen aufgeführten Artikeln herrscht neben der eindeutigen Zielorientierung des Projekts deutliche Einigkeit, wenn John Dewey (1859-1951) und Wiliam H. Kilpatrick (1871-1965) als 'Urväter der Projektmethode' und "bedeutendste Initiatoren des pädagogischen Pragmatismus" genannt werden (Röhrs 1971), deren Ideen ab 1920 Eingang in die deutsche Reformpädagogik fanden (z. B. Aschersleben 1979) und von dort aus besonders auf die Reformbewegungen in Sowjetrussland Einfluss ausübten (Röhrs 1971).
Nur Gudjons weist darauf hin, dass "der historische Ursprung der Projektidee in den Architekturakademien des frühen 18. Jahrhunderts in Frankreich" lag, von wo aus sie über Deutschland die "amerikanischen Technologischen Hochschulen erreichte" (in: Keck / Sandfuchs 1994, S. 249). Trotzdem bezeichnet auch er Dewey als "eigentlichen geistigen Vater und ersten Theoretiker der Projektmethode" (ebd.). Im Gegensatz dazu lässt er allerdings - entgegen der übrigen Artikel - den Projektunterricht der deutschen Reformpädagogik sich selbständig und in gewissem Maße unabhängig von Dewey entwickeln.
Diese historisch-theoretischen Unstimmigkeiten werden anhand der Begriffsuntersuchung "Projekt" in dem folgenden Kapitel ausführlicher erläutert werden.
Die untersuchten Artikel weisen ab dem Jahr 1988 auf die gegenwärtige, wichtige Bedeutung des Projektbegriffs hin. Es fällt auf, dass meistens der Vorgang bzw. die Ausführung des Projekts dargestellt und diskutiert wird, nämlich die Projekt methode selbst und nicht der Projektbegriff und seine Ziele an sich.
Die Lexikonartikel vor 1988 sind eher kurz, beinhalten vage Formulierungen, weisen aber alle in ähnlicher Form auf den "sozialerzieherischen und gesellschaftspolitischen Aspekt der Projektmethode" hin (Aschersleben 1979, S. 19) und lassen Aktualität sowie Lebensnähe des im Unterricht behandelten Themas wichtig erscheinen. Des weiteren werden Ähnlichkeiten zum Gesamtunterricht (vgl. Schneider 1962) oder zum fächerübergreifenden Unterricht (vgl. Odenbach 1974 / Aschersleben 1979) aufgezeigt.
Im Lexikon der Pädagogik von 1971 findet sich sogar der sonst nicht erwähnte Begriff des "Gruppenunterrichtsverfahrens" (Röhrs 1977, S. 353).
Neben seiner für die älteren Artikel ungewöhnlicher Ausführlichkeit bietet die Darstellung im Wörterbuch der Pädagogik von 1977 einen weiteren interessanten Aspekt: Der Autor geht dort nämlich auf die "charakterbildende Funktion" des Projektunterrichts ein (Röhrs 1977, S. 14).
Daneben wird "gegenwärtig der gesellschaftspolitische Aspekt betont" (ebd.). Weiterhin ist der "Projektunterricht auf ein aktives Lernen ausgerichtet, das sich neben seiner gesellschaftlichen Relevanz auch seiner initiierenden Macht bewußt ist" (ebd.).
In vielen älteren Lexika (ca. 1950-1960), die auch nicht in die Literaturliste aufgenommen worden sind, existiert der Begriff "Projekt" nicht einmal.
In den 90er Jahren verblasst er sehr stark aufgrund der häufigen – oft oberflächlichen –Begriffsverwendung (s. u.).
Die Beobachtung über die zunehmende Bedeutung der Beschäftigung mit der Projektidee in der Schule soll auch anhand der ausgewählten "Projekte im Musikunterricht" von 1960 bis 1998 im zweiten Teil der Arbeit aufgezeigt werden. Sie belegen mit ihrer zunehmenden Beliebtheit seit Anfang der 80er Jahre die moderne, beliebte aber auch umstrittene Situation des Projektlernens.
Uneinigkeit herrscht in allen untersuchten Artikeln über das, was ein Projekt - trotz sich gleichender aufgelisteter Merkmale - eigentlich genau ist: Wird der Begriff meistens mit dem der Projektmethode gleichgesetzt, so ist deren Definition noch unschlüssiger: Handelt es sich um eine "Unterrichtsmethode" (Schneider 1962), ist sie eine "Unterrichtsplanung" (Odenbach 1974), geht es um eine "Sonderform der Unterrichtseinheit" (Aschersleben 1979), ist sie "Unterrichtsziel an sich" (Schröder 1992) oder bildet sie nach Klafki, Meyer und Gudjons eine "methodische Groß- oder Grundform des Unterrichts" (in: Keck / Sandfuchs 1994, S. 249), von der man einfach eine "höhere unterrichtliche Effizienz als vom traditionellen Unterricht erwartet"? (Aschersleben 1979).
Durch höhere Schülermotivation (vgl. u. a. Meyer 1988 und Röhrs 1971, S. 325f), die sich vom Projektunterricht versprochen wird, und "stärkere Lebensnähe der Inhalte" (Aschersleben 1979) sollen vor allem die "politischen Bildungsziele [...] erreicht werden" (ebd.). Welche das allerdings sind, bleibt im Detail unbeantwortet.
In allen diesen Darstellungen spiegelt sich Hänsels kritisierende These wider, es habe "eine Verengung der Projektidee zum Problem der Unterrichtsmethode" stattgefunden (Hänsel 1995, S. 16).
Eine Ausnahme bildet hierin allerdings der Artikel von Meierkord, der dieser "Verengung" zu einer bloßen Unterrichtsmethode ebenfalls eher kritisch gegenübersteht (in: Helms / Schneider / Weber 1995).
Die Zielformulierungen - in einigen Artikeln werden sie allerdings erst gar nicht erwähnt oder sind in den Merkmalen 'versteckt' - reichen von der "charakterbildenden Funktion" (s. o. / Röhrs 1977) über "Erziehung zur Selbständigkeit und eigener Verantwortung" (Böhm 1988) und "Selbstorganisation der Lerngruppe" (Bonn 1989) sowie "Durchführung und Beurteilung von Unterricht, Abbau der Lehrerdominanz, problemorientiertes Lernen und Handeln [...], Aufhebung der Isolierung von schulischem und außerschulischem Lernen" (ebd.) bis hin zu "Fähigkeiten entfalten und erproben [...], seine Anliegen artikulieren und vertreten lernen und sich in sachlicher Diskussion üben" (Kaiser 1989, S. 1275) u. a.
Fraglich bleibt, ob diese intendierten Lernziele nur im Projekt unterricht erreicht werden können, und wo die Grenzen dessen liegen, was die Inszenierung dieser Form des Unterrichts bei Schülern erreichen kann.
Fraglich ist auch, inwieweit sich die genannten Formulierungen von der Ursprungsidee Deweys unterscheiden, der das Projekt in einem "politikgeschichtlichen Milieu" (Suin de Boutemard, in: Gudjons 1994, S. 79) mit "politisch-didaktischen Implikationen" schuf (ebd., S. 70), die von der deutschen Reformpädagogik aber nicht beachtet wurden (Ausnahme: Kerschensteiner, s. u.).
Die verschiedenen aufgeführten Aspekte sollen im Verlauf der historischen Untersuchung über die Entwicklung und Zielvorstellungen des Projektbegriffs differenziert geklärt bzw. von verschiedenen Seiten beleuchtet werden, um anhand dessen die ausgewählten Projekte im Musikunterricht diskutieren zu können.
Ob die aufgeworfenen Fragen allerdings eindeutig beantwortet werden können, ist schon anhand des hart umstrittenen Begriffswandels und seiner inhaltlichen Deutung zweifelhaft.
1.2. Rezeption und aktuelle Diskussion: Begriff und Zielsetzungen im Wandel?
Schiller konnte nicht wissen, dass seine Worte in der Didaktik des ausgehenden 20. Jahrhunderts zur Charakterisierung des Projektbegriffs beitragen sollten, als er im Prolog zu "Wallensteins Lager" schrieb: "Von der Parteien Gunst und Haß verwirrt, schwankt sein Charakterbild in der Geschichte."
Deutlicher lässt sich das aktuelle Problem um die Kontroverse des Projektbegriffs nicht formulieren.
Wie schon im vorangegangenen Kapitel angemerkt existieren viele Begriffe um das Stammwort "Projekt": Projektidee, Projekte im Unterricht, Projektunterricht, Projektmethode, projektorientierter oder projektartiger Unterricht, handlungsorientierter Unterricht u. ä..
Dietrich weist auf das grundsätzliche Problem der Einheitlichkeit hin: Der Projekt- begriff wird in Schule, Wirtschaft und auch im Alltag der Umgangssprache verwendet. Dadurch erfährt er subjektive (Aus-)Deutungen oder bekommt willkürliche Merkmale angehängt, die sich hartnäckig im mündlichen Sprachgebrauch halten. Überdies ist er von seinem historischen Grundbegriff aus gesehen einer ständigen Um-Interpretation ausgesetzt (vgl. Dietrich 1977, S. 135).
Und genau an diesem historischen Interpretationsansatz schließt Knoll seit 1991 mit seiner These an: Die Annahmen, von denen die Projekthistoriker ausgehen sind falsch.[6]
Knolls erster Vorwurf besagt: "Die Geschichte der Projektmethode ist weit älter, als die deutschen - und die amerikanischen - Historiker bisher angenommen haben" (Knoll 1993, S. 58).
Der nun folgende historische Exkurs soll dazu dienen, die Diskussionsfronten um den Projektbegriff aufzuzeigen und darzustellen, wie kompliziert die heutigen 'Merkmale' und Ziele (siehe folgendes Kapitel) sich im Laufe der Zeit entwickelt haben und wie veränderbar sie - besonders in den letzten fünf Jahren - gehandhabt worden sind bzw. werden (die Diskussion ist noch längst nicht abgeschlossen!). Oder als Frage formuliert: Kann es anhand von Merkmalen und Zielen überhaupt den Projektunterricht geben?
Knoll, Vertreter der Methode des "praktischen Problemlösens", beginnt seine Kritik geradezu polemisch und mit fast bissiger Ironie, indem er auf die von Suin de Boutemard geprägte Aussage[7] anspielt und sagt: "Es gehört zum pädagogischen Allgemeinwissen, daß die Projektmethode aus den Vereinigten Staaten stammt und eine Geschichte hat, die 'so alt ist wie unser Jahrhundert' [...]" (Knoll 1993, S. 58).
Damit kritisiert er die bisherigen historischen Thesen der Pädagogen wie Gudjons, Bastian, Duncker, Hänsel und den bereits erwähnten Suin de Boutemard - um nur einige namhafte Vertreter des Projektunterrichts zu nennen.
Knolls These besagt, die Projektmethode sei "nicht ein Kind der Demokratie, sondern ein Kind des Absolutismus" (ebd.). D.h. sie stamme aus Europa, denn man müsse ins Italien des 16. Jahrhundert zurückgreifen, um in diesem Land ihren Ursprung zu erfassen. Von der dortigen Academia di San Lucia in Rom ging der Begriff über an die im Jahre 1671 gegründete französische Académie Royale d'Architecture in Paris, auf die auch Gudjons in seinem Lexikonartikel hinweist.[8]
Die Architekturstudenten standen in einem Wettbewerb zueinander, indem sie "projets" oder "progettis" entwarfen. Dabei ging es um das möglichst - gemeinsame oder einzelne - selbständige, phantasievolle und schöpferische Ausführen von Aufgaben, die der Lehrer stellte und anschließend bewertete. Sinn und Zweck dieser Übungen war es, sich mit den Anforderungen des Berufes vertraut zu machen.
Allerdings wurden diese "progettis" nach der Konstruktion nicht realisiert. Sie besaßen also keinen Wirklichkeitsanspruch.
Das oberste Ziel dieser Art der akademischen Bildung war dabei die Entfaltung künstlerischer Kreativität und das Erreichen möglichst origineller Lösungen durch den Einzelnen (Oelkers 1997, S. 14 / Knoll 1993, S. 58).
Dieser historische Anspruch Knolls wird 1993 fast ins Lächerliche gezogen, als Duncker daraufhin meint, wenn man schon 300 Jahre zurückgeht, dann aber bitte gleich in die Antike bis zu Aristoteles (384-322 v. Chr.), der sich bereits wie Dewey mit Demokratie und Erziehung beschäftigte (Duncker 1993, S. 67).
Suin de Boutemard allerdings reicht dieser historische Sprung noch nicht: Er führt den Begriff - sich auf Martin Buber (1878-1965) stützend - bis ins 11. Jahrhundert v. Chr. auf den antiköniglichen Widerstand in Israel zurück.
In diesen Texten des Alten Testaments gehe es bereits um "programmatische Gesichts- punkte der Projektpädagogik", insofern als Fragen nach der "Fremd- und Selbstbestimmung" sowie der "Zentralgewalt und Selbstverwaltung" u. ä. gestellt werden (Suin de Boutemard 1993, S. 71).
Gudjons und Bastian beschwichtigen diese Kontroverse ein wenig und erkennen die Erweiterung der historischen Quellenlage durch Knoll an (vgl. Fußnote 5), warnen aber vor der umstrittenen "Interpretation dieser Quellen" (Gudjons / Bastian 1993, S. 73), denn "dieses Verständnis ist nicht identisch mit heutigen Projektkonzeptionen" (Gudjons 1997, S. 67).
Duncker findet den Blick auf die "italienische Renaissance interessant", aber nicht ausreichend für die Begründung des heutigen Projektlernens (Duncker 1993, S. 67). Immerhin ist es spannend, dass das Streben nach künstlerischer Kreativität bereits im Europa des 17. Jahrhunderts eine wesentliche Rolle spielte, welche der Projektunter- richt auch heute für sich beansprucht.
Trotz der Kontroverse haben neben Bastian und Gudjons auch die übrigen Gegner Knolls mittlerweile seine historischen Thesen zum größten Teil angenommen und auch übergenommen, wie sich auch u. a. bei Hänsel – der Anfang der 90er Jahre wohl erbittertsten Gegnerin Knolls – belegen lässt.
Oelkers schreibt z. B. in dem von ihr herausgegebenen "Handbuch Projektunterricht": "Die Projektmethode hat eine lange Vorgeschichte, die bis ins 17. Jahrhundert zurück- reicht (Knoll 1991)" (Oelkers in: Hänsel 1997, S. 15).
Aufgrund dieser geschichtlichen Quellenlage, die also davon ausgeht, dass der Projektunterricht europäischer Herkunft ist und deshalb auch europäisches Denken beinhaltet (s. o.), kommen Knoll und auch Frey zu einem anderen Interpretationsansatz der Projektkonzeption als Hänsel, Gudjons, Suin de Boutemard u. a., für die Ursprung des Projektbegriffs, wie er sich auf die Schule ausgeprägt hat, am Anfang unseres Jahrhunderts in Amerika um das Jahr 1920 liegt, auch wenn sie die historischen Forschungen Knolls akzeptieren (s. o. / Gudjons 1997, S. 67).
Diesen historischen Diskurs zu klären, kann und soll nicht die Aufgabe dieser Arbeit sein. Ein sinnvoller Kompromiss ist es sicherlich, die historischen Vorbilder nicht nur im Amerika des beginnenden 20. Jahrhunderts, sondern auch im Deutschland dieser Zeit zu suchen (s. u.).
Aber zunächst geht es um die amerikanischen Zielvorstellungen, die mit denen Italiens und Frankreichs nicht viel gemein haben (s. o. / Gudjons 1997, S. 67).
Der amerikanische Pädagoge Bossing schreibt 1942 in seinem Aufsatz "Die Projektmethode", dass als erster Richards den Projektbegriff um 1900 in der amerikanischen Pädagogik gebraucht hat.[9] Er beinhaltete das Ziel, eine selbständige Lösung für im Werkunterricht gestellte Aufgaben zu finden (in: Kaiser / Kaiser 1977, S. 113). Stevenson benutzte diesen Begriff ebenfalls und machte 1908 daraus "Heimprojekte": Das in der Schule in landwirtschaftlichen Kursen Gelernte sollte von den Schülern zu Hause praktisch angewendet werden (ebd., S.114).
Snedden sah 1911 das Projekt als schlichte Anfertigung von Sachen an, die Angelegenheit eines Einzelnen oder der Gemeinschaft waren: "Jede praktische Arbeit in der Berufsschule kann Projekt genannt werden" (ebd., S. 115). Die Durchführung konnte eine Stunde bis mehrere Tage andauern. Die Aufgaben waren hierbei immer so angelegt, dass jeder Schüler das gewünschte Ziel erreichen konnte. Es lag also kein Wirklichkeitsanspruch vor, denn ein Scheitern der Lernenden war nicht mit inbegriffen.
Fernerhin ging es bei Snedden um reine Produktorientierung. Weitere Ziele werden nicht genannt.
Deweys Projektarbeit in der Folgezeit war bestimmt durch "das Ziel menschlicher Entwicklung, das als pädagogisches und politisches gefasst wird" (Hänsel 1995, S. 21). Dewey sieht - wie auch schon Aristoteles seinerzeit (s. o.) - Demokratie und Erziehung des Menschen als notwendig an.[10]
1918 definierte Kilpatrick die Projektmethode neu und erweiterte damit den alten Projektbegriff (Knoll 1993, S. 61). Er setzte den Erfahrungserwerb an die Spitze: Das Kind sollte Schöpferkraft und Urteilsfähigkeit entwickeln und absichtsvoll in einer sozialen Umwelt ohne Anweisung des Lehrers handeln (ebd. / Bossing 1977, S. 116f.). Dieser neu gesetzte Akzent verlangte die Preisgabe der ursprünglichen Bedeutung.
Er trat in krassen Gegensatz zu Dewey, der in seinen Schriften Kindorientierung nicht erwähnt und diese auch nicht praktizierte (Knoll 1993, S. 63).
Kilpatrick entwickelte vier Projekttypen mit jeweils verschiedenen Endzielen (Oelkers 1997, S. 20):
Producer's projects: Projekte, die der Herstellung von etwas dienen.
Consumer's projects: Projekte, die etwas verbrauchen oder in denen etwas genossen wird.
Problem projects: Projekte, die der Problemlösung dienen.
Learning projects: Projekte, die der Aneignung von Wissen dienen.
Obwohl Kilpatrick mit dieser Unterteilung die Kindorientierung stärker betonte und sowohl die Wissenschafts- als auch Produktorientierung in den Hintergrund treten ließ, setzte sich in der Folgezeit nur die erste Methode durch, weil sie im wesentlichen der Arbeitsschule nachgebildet war (ebd., S. 22).
Knoll spricht von "Ironie" (Knoll 1993, S. 63): In der Nachfolge von Kilpatrick wird der Projektbegriff oft so weit gefasst, dass er praktisch alles beinhalten kann, Voraussetzung ist nur, dass der Lehrer kein "Planungsmonopol" besitzt. Dabei sei Kilpatrick ein Außenseiter: Sein Projektbegriff sei in der Folgezeit "unpräzis, ausufernd und inflationär" gebraucht (ebd.).
Dewey, Bossing und Richardson habe man missverstanden. Der Ursprung des Projekts liege in der Professionalisierung eines praktischen Berufs. Der Lernende soll selbständig arbeiten und Theorie mit Praxis verbinden können. Das Ziel ist demnach eine "Konstruktion", eine Sache (ebd.).
Schon an diesen Fakten und den Tatsachen, dass sich Dewey und Kilpatrick damals ebenso wie Knoll und z. B. Suin de Boutemard heute in der Definition des Projekts alles andere als einig waren, zeigt, dass die Projektmethode in keiner gültigen Theorie überlebt hat (ebd., S. 22).
Sie ist ständig weiterentwickelt und mit neuen, zusätzlichen Zielen und Merkmalen versehen worden. Gerade aus diesem Grund sind "historische Rückgriffe auch sehr problematisch" (Oelkers 1997, S. 20), aber notwendig, um das gegenwärtige 'Begriffswirrwarr' zu verstehen.
Einen weiteren interessanten Aspekt liefert Dietrich, indem er feststellt, dass die Projektmethode nach der Definition Kilpatricks zur Lehrmethode degradierte, da nun jede "zielgerichtete, ernsthafte und selbsttätig zu lösende Aufgabe als Projekt" bezeichnet werden konnte (Dietrich 1977, S. 140).
Vielmehr sei das eigentliche Ziel nach Dewey gewesen - was sich bis heute noch gehalten hat -, "durch zweckvolles Handeln die gesellschaftlichen Verhältnisse zu ändern" (ebd., S. 149), wie es z. B. Collings im Jahre 1922 berühmtes Typhus-Projekt zeigt.[11]
Der Reformpädagoge Otto formulierte das Ziel des von ihm konzipierten Gesamtunterrichts dahin, dass die Schüler in einer zusammengeführten "Geistesgemeinschaft" (Dietrich 1977, S. 142) durch ganzheitliches Lernen einen organischen Zusammenhang erkennen sollten. Dies hat sich auch der Projektunterricht zunutze gemacht, wenn er z. B. fächerübergreifend oder überfachlich organisiert wird (vgl. Struck 1980, S. 22f).
Nohl formulierte auf der Basis Fröbels und Pestalozzis die Ziele des Projektunterrichts folgendermaßen: Er sollte kindorientiert sein, an das reale Leben anschließen, dem Schüler Selbsttätigkeit verleihen und ihn sowohl produktiv als auch aktiv an einer konkreten Sache tätig sein lassen sowie seinen sozialen Trieben gerecht werden ("Kooperationsbereitschaft") und die Schulgemeinschaft pflegen.
Hiermit soll das Lernen durch "Veranschaulichung und die Möglichkeit des Handelns" vereinfacht werden (ebd., S. 13).
Allerdings wäre es sinnvoll, zu berücksichtigen, dass ein solches Lernen sehr anstrengend und zeitaufwendig sein kann und das zu behandelnde Thema nicht unbedingt vereinfachen muss. Es kann sogar weniger effizient und erheblich anspruchsvoller als jeder Frontalunterricht sein (vgl. auch Oelkers 1997, S. 26).
Als primär gilt bei den genannten Zielen des Projektunterrichts die "Lösung der in der Realität bestehenden Aufgaben" (Struck 1980, S. 21). Das Thema des jeweiligen Projekts ist eher sekundär - es muss aber im Fragehorizont der Lernenden liegen bzw. in denselben gerückt werden - und steht als "exemplarische Funktion auf dem Weg zu Planungs-, Erkundungs- und Sozialkompetenzen des Schülers" (ebd., S. 26).[12]
Folglich ist es nicht Ziel des Projektunterrichts, der Erweiterung oder Bewältigung fachbezogener Lernziele zu dienen, d.h. nicht zu einer bloßen Unterrichtsmethode zu degradieren. Dieser Unterricht ist vielmehr ein "Erfahrungsfeld" (ebd.), in dem der Schüler - seinen Neigungen und Interessen entsprechend - Themen bestimmt und sich Aufgaben selbst stellt.
In Deutschland hielt sich der Projektbegriff nur in der Weimarer Zeit, konkurrierte aber stark mit den Denkstrukturen der Arbeitsschulbewegung unter Otto, Kerschensteiner und Gaudig. Im Nationalsozialismus wurde er und mit ihm besonders die an Individualität orientierte Kreativität ausgemerzt und aus dem Erziehungsplan verbannt.
Zwar förderten die Nationalsozialisten auch gemeinsames Handeln und Teamgeist im Sinne des Projektunterrichts, aber nur in der Form, dass die Individualität des Menschen nicht zum Tragen kam. D.h., hier findet sich eine merkwürdige dialektische Situation, in der Teamarbeit und individuelle
Tätigkeit im Gegensatz zueinander stehen. Dabei ist gerade dieser Zusammenhang im positiven Sinne für den Projektunterricht von großer Bedeutung (I.2.3.).
Die aufgezeigte Ambivalenz in den Erziehungsidealen des Dritten Reiches könnte daran liegen, dass es den Nationalsozialisten darum ging, die in ganz Europa - nach dem Vorbild Deutschlands - erfolgreiche Arbeitsschulbewegung zu unterdrücken, die ihnen im Zusammenhang von Erziehung und demokratischen Elementen (Kerschensteiner, s. u.) suspekt erschien.
Ziel dieser Herrschenden war es vielmehr, den Teamgeist so stark zu fördern, dass das Individuum im Kollektiv untergeht. Der Begriff der 'Gemeinschaft' wurde so gesehen also missbraucht und für eigene Zwecke verwendet.
Buber bezeichnet diesen Widerspruch und Missstand in seiner Rede über "Charaktererziehung" (1939) als Verlorenheit an einen "kollektiven Moloch", in dem das Individuum der "Hörigkeit von Kollektiven" verfallen ist. Die Entscheidungen dieser Kollektive sind dabei „inappelabel“, der Einzelne braucht sich also nicht der Verantwortung zu stellen (Buber 1962, S. 824).
Seit der Innovationszeit der sechziger und siebziger Jahre, die den Projektgedanken und die Projektpraxis wieder populär gemacht hat (Frey 1995, S. 48f.), indem sie an das reformpädagogische Erbe der Weimarer Zeit anknüpfte, hat im wesentlichen "das Schlagwort gewirkt" (Oelkers 1997, S. 22). Der historische Entstehungszwang wurde vielmehr ausgeblendet und das Projekt konnte somit als das erscheinen, was es nie gewesen ist (ebd.).
Duncker unterstützt diese These: "Es kann nicht darum gehen, den historischen Ursprung als die quasi 'reine' Bestimmung zu wählen, weil auch die pädagogische Theoriebildung dem historischen Wandel unterliegt und sich im Blick auf veränderte gesellschaftliche und kulturelle Bedingungen des Aufwachsens weiterentwickeln muß" (Duncker 1993, S. 67).
Struck führt die niedersächsischen Rahmenrichtlinien der Orientierungsstufe für den Projektunterricht an, bei denen teilweise die Orientierung am Endprodukt eine geringe oder nebensächliche Rolle spielt. Für Dewey und Knoll ist aber das Ergebnis in Form der Herstellung als Sache am Ende wichtig. Demzufolge ist die Frage nach der Emanzipation von Prozess- und Produktorientierung im Projektunterricht eine grundlegende und wesentliche (s. u.).
Nach den von Struck aufgeführten Rahmenrichtlinien sollen die Schüler zielstrebig die Initiative ergreifen, zum Ziel führende Notwendigkeiten entwickeln und selbsttätig durchführen, durch die Entfaltung ihrer Fähigkeiten gleichzeitig ihr Leistungsvermögen kennen lernen, kooperativ handeln, sich in Diskussion üben, Konflikte gemeinsam bewältigen und das Arbeitsergebnis kritisch reflektieren können (Struck 1980, S. 26f).
Suin de Boutemard gibt, Kilpatrick zitierend,[13] als bisher noch nicht genanntes Ziel die Zukunftsorientierung des Kindes an, d.h. dieses muss auf seine "unbestimmte Zukunft vorbereitet" und dabei gleichzeitig sein gegenwärtiges Leben berücksichtigt werden. Aus diesem Grund ist es notwendig zu lernen, das eigene Handeln methodisch und systematisch zu kontrollieren (Kilpatrick, zit. in: Suin de Boutemard 1994, S. 73).
Frey schließlich beruft sich u. a. auf Dewey und sieht als Ziel seiner von ihm seit 1983 weiterentwickelten Projektmethode die "Verringerung der Distanz zwischen Schule und Leben, Wissenschaft und Beruf, Theorie und Praxis" (Frey 1995, S. 33).
Denn dadurch können die Ziele Deweys verwirklicht werden, nämlich die ständige Weiterentwicklung der Demokratie und der Lösungsbeitrag in der Gesellschaft (ebd., S. 41). Gudjons nennt als 'modernes' Ziel des Projektunterrichts noch, "die verkrusteten Formen des Lernens und die erstarrten Organisationen der Schule zu sprengen" (Gudjons 1997, S. 70).
Die Projektmethode hat sich begrifflich und in ihren Zielvorstellungen insofern gewandelt, da man früher danach fragte, wie eine "optimale Bildung für möglichst viele Kinder erreicht" werden würde, heute aber von der Fragestellung ausgeht, ob "die individuelle Entwicklung jedes Kindes" gefördert werden kann (Oelkers 1997, S.23).
1.3. Was ist Projektunterricht? -Versuch einer Ortsbestimmung
Anhand der zuvor aufgezeigten Begriffskontroverse stellt sich jetzt die in der Überschrift genannte Frage. Gleichzeitig wird die Forderung danach größer, eine handfeste Definition zu bekommen - soweit dies möglich ist -, um Projektunterricht in der Schule auch sinnvoll anzuwenden.
Festzuhalten ist aber zunächst, dass es den Projektunterricht an sich, wie er oben diskutiert worden ist, gar nicht geben kann. Es wäre Utopie, anzunehmen, der Unterricht z. B. einer Stunde beinhalte alle Merkmale, die in der Literatur aufgelistet sind, es wäre geradezu "größenwahnsinnig" von dem Lehrer, der dies behauptet (Hänsel 1995, S. 19). Damit wäre aber der Projektunterricht ein abstraktes, unerreichbares Ideal, er verschwände "als ein Phänomen der Unterrichtswirklichkeit" (ebd.). Und der Lernvorgang im oben verstandenen Sinne wäre allerhöchstens 'projektorientiert'. Viele Lehrer benutzen demnach letztere Formulierung und sind damit aus dem Dilemma heraus, in ihrem Unterricht alle Aspekte der Projektidee aufweisen zu müssen.
In diesem Kapitel sollen die - inhaltlich oft sehr disparaten - Merkmalkataloge nicht aufgelistet werden. Ebenso wenig geht es um eine Darstellung der unzähligen Stufeneinteilungen des Projektunterrichts. Denn fixiert man diesen nur anhand von Phasen, so kann er sehr schnell in ein ähnliches Schema wie das der stark kritisierten Herbartianischen Stufenfolge abrutschen.
Die nun folgende – teilweise schwer verständliche – Abhandlung Hänsels gibt ein gutes Beispiel für die Kompliziertheit einerseits der Kontroverse und andererseits des Projektthemas an sich ab.
Hänsel entwickelt eine Theorie, wie Projektunterricht gemacht werden kann. Sie bietet eine Lösung an, indem sie auf Deweys Erziehungsphilosophie und dessen Hauptwerk "Demokratie und Erziehung" von 1916 zurückgreift, um eine plausible - wenngleich auch komplizierte - Antwort auf das zu finden, was Projektunterricht ausmacht und ihn von dem "normalen" Unterricht abgrenzt. Dabei kritisiert Hänsel nicht nur Aussagen ihrer Kontroverse-Gegner wie Frey und Knoll, sondern auch solche von Gudjons, Bossing, Suin de Boutemard u. a.[14]
Eine sinnvolle Ergänzung zu Hänsels Theorie bietet der Aufsatz von Hahne und Schäfer, der die Geschichte des Projektunterrichts seit 1945 aufzeigt und darstellt, in welche Kategorien dieser Unterricht bisher eingeteilt worden ist: Bestimmungsversuche erstrecken sich von Einteilungen nach Merkmalen, Phasen oder Typen über 'als Gegenform zu etwas' bis hin zu der Qualität von Lernprozessen (vgl. Hahne / Schäfer 1997, S. 97-101).
Hänsels Darstellung stützt sich primär auf die Bestimmung der Gegenform in Abgrenzung zum übrigen Unterricht, versucht allerdings - um eine naive Polaritätsdarstellung zu vermeiden - die Bestimmung mit Hilfe von Phasen weiterzuentwickeln, was ihre Abhandlung so schwer verständlich macht.
Aber auch diese Bestimmung kann keinen absoluten Anspruch erheben. Und alle Bestimmungen zusammenzufassen ist ebenso problematisch, weil dann wieder alles oder nichts Projektunterricht sein könnte.
Anlass zu dieser Veröffentlichung gab der Autorin ihre These, dass die aktuelle Diskussion erstens in eine Sackgasse geraten sei, dass zweitens keine befriedigende Antwort darüber bestehe, was Projektunterricht überhaupt ist - also nur die eher konfuse Vorstellung eines Unterrichtsideals dominiere, die nicht konkretisiert werden könne - und schließlich, dass durch diese Kontroverse das Projektproblem zu einer bloßen Unterrichtsmethode verengt worden sei (s. o. / Hänsel 1995, S. 16).
Das einzige, was Hänsel unangefochten für ihre Ausführung übernimmt, sind die "vier Grundformen des Unterrichts" nach Klafki, als da wären der "Projektunterricht", "Lehrgänge", "Unterricht in Gestalt relativ eigenständiger, fachlicher oder fächerüber- greifender Themen" und "Trainingsunterricht" (Klafki 1985, S. 233f, zit. in: Hänsel 1995, S. 32). Mit Hilfe dieser Abgrenzung sucht Hänsel nach dem, was Projektunterricht gegenüber den anderen Formen ausmacht.
Dabei äußerst sie sich zunächst kritisch über die in der unzähligen Projektliteratur seit ungefähr 1975 aufgestellten "Merkmalkataloge" (ebd., S. 17), gesteht aber Bastian und Gudjons den umfassendsten Versuch zu, die Frage nach dem Projektunterricht mit Hilfe dieser Merkmalskataloge beantworten zu wollen (ebd.).
Die Autoren nennen als "einkreisende Umschreibung" (Gudjons 1989, S. 15) die Merkmale Situationsbezug, Orientierung an den Interessen der Beteiligten, Selbstorganisation und Selbstverantwortung, gesellschaftliche Praxisrelevanz, zielgerichtete Projektplanung, Produktorientierung, Einbeziehen vieler Sinne, soziales Lernen und Interdisziplinarität (ebd., S. 16-27).
Hänsel kritisiert diese Merkmale nicht an sich, sie sind notwendig und sinnvoll, eine Identifizierung kann aber nur auf dem "Hintergrund einer umfassenden Bestimmung des Projektunterrichts" geleistet werden (Hänsel 1995, S. 21). Denn kein Unterricht kann - wie oben erwähnt - alle Merkmale beinhalten.
Ginge man aber nur nach der Merkmalsdefinition, so wäre "kein Unterricht" Projektunterricht, zugleich allerdings "jeder Unterricht" projektorientiert (ebd., S. 19). Hierdurch verliert der Projektunterricht seine konkrete didaktische Gestalt und "gerät zum abstrakten Ideal und diffusen Veränderungsprinzip" (ebd., S. 21).
Dass Gudjons diese Kritik, die die Merkmale darüber hinaus als Prinzipien und Ziele entlarvt (s. o.), die keine Antwort auf eine Definition geben, teilweise beherzt aufgenommen hat, zeigt seine jüngste Definition des Projektunterrichts, bei der er die von Hänsel erarbeiteten Kriterien - wie sie weiter unten dargestellt werden - übernommen und ihnen jeweils speziell die hier aufgelisteten Merkmale zugeordnet hat (Gudjons 1997, S. 74-103).
Als zweite Komponente kritisiert Hänsel an der aktuellen Diskussion, dass zur Definition des Projektunterrichts statt Merkmalen Stufen oder Schritte aufgeführt werden, billigt aber Frey den anspruchsvollsten Versuch zu (Frey 1995, S. 18f und S. 71ff). Das allerdings hierbei sichtbar werdende Problem liegt in den Komponenten "Hoch-" und "Kümmerform" des Projektunterrichts (Hänsel 1995, S. 20).
Während die "Kümmerform" als "projektartiges Lernen" angesehen wird (Frey 1995, S. 15), kann die "Hochform" mit den sieben Schritten "Projektinitiative, -skizze, -plan, -durchführung, Beendigung des Projekts, Fixpunkte und Metainteraktionen" (Hänsel 1995, S. 20) im Unterricht sehr "künstlich, verkrampft und lehrergelenkt" (ebd.) wirken, weil Projektlernen hier auf das "Problem der Unterrichtsmethode zurechtgestutzt" wird (ebd., S. 21), während der Lerninhalt keine Rolle mehr spielt. D.h. das Thema ist sekundär, stößt also nicht unbedingt von Seiten der Schüler auf Interesse.
Hiermit wäre Strucks These widerlegt, in Form des Projektes motiviere jedes Thema (Kapitel I.1.2. und Struck 1980, S. 26) .
Hänsel bietet nun eine Lösung im Rückgriff auf Dewey an, die sie einerseits als "viel konkreter und präziser" als die aktuelle Projektliteratur, andererseits als "viel weitreichender" bezeichnet (Hänsel 1995, S. 30). Sie bezieht sich auf diesen amerikanischen Philosophen und Naturwissenschaftler, weil er als der "wichtigste pädagogische Theoretiker der Projektidee" gilt, aber dennoch "weder die reformpädagogische Diskussion in Deutschland noch die aktuelle pädagogische Diskussion um den Projektunterricht tiefgreifend beeinflußt hat" (ebd., S. 15).
Deweys Schriften aber stellen eine Lösung dar, weil sie im Gegensatz zu der aktuellen Diskussion konkrete Handlungsperspektiven bieten und die Verwirklichung des Projektunterrichts nicht an Bedingungen binden, die die Lehrenden selbst nicht herstellen können (ebd., S. 34).
Dewey "insistiert darauf, daß der neue Lernprozeß Unterricht ist" (ebd.) und schließt mit dem Begriff der "Projektmethode" - den Frey, obwohl er sich auf Dewey beruft, in einem völlig anderen Sinne benutzt! - drei Komponenten ein: "das Ziel menschlicher Entwicklung als pädagogisches und politisches, die Methode zur Verwirklichung dieses Ziels und die Konkretisierung dieses Ziel-Methoden-Zusammenhangs im Unterricht der Schule" (ebd., S. 21f).
Die erste Komponente befasst sich mit der - dem philosophischen Dualismus entgegenlaufenden - These von der Wechselwirkung zwischen Mensch und Umwelt. Diese Wechselwirkung als Ziel der Erziehung ist dichotom, indem sie sich in Erziehung, die die "Höherentwicklung des Individuums" bewirken soll, einerseits und in Demokratie als "denkende Erfahrung" andererseits aufteilt, welche als die soziale Umwelt gilt, in der das Individuum handelt. Diese soziale Umwelt gestaltet als Form des Zusammenlebens den Erfahrungsprozess wesentlich mit (ebd., S. 23).
Die zweite Komponente nimmt für die Durchführung der Methode die Schule als Mittel zur Erreichung des dargestellten Ziels.[15] Diese Institution, die eine spezifische soziale Umgebung darstellt, soll nach dem Vorbild der experimentellen Methode gestaltet werden (Dewey war ja primär Naturwissenschaftler!), die wiederum für die Erziehung vereinfacht und geordnet bereitgestellt ist. Diese Erziehung hat "jederzeit ein unmittelbares Ziel [...]: die unmittelbare Umgestaltung der Qualität der Erfahrung" (Dewey 1916, S. 108). Damit ist das Ziel, die "denkende Erfahrung" (s. o.), zugleich die Methode und umgekehrt, wobei beides immer von der Voraussicht auf den Zweck oder Abschluss einer Tätigkeit gerichtet sein muß (Hänsel 1995, S. 25).
Als dritte Komponente vermeidet die Konkretisierung der "Erziehungsmethode" (ebd.) in der Schule die Trennung von Stoff und Methode im Sinne der Deweyschen Erziehungsphilosophie (Dewey 1916, S. 222f), weil ihr ein Prozess der ständigen Wechselwirkung untersteht, so auch jener zwischen Inhalt des Stoffes und Schüler. Es geht also nicht nur um das bloße "Wie des Unterrichts" (ebd., S. 30). Die Methode ist vielmehr eingebettet in einen gesamten Erziehungsprozess, der die "menschliche Höherentwicklung" (ebd., S. 25) erreichen soll.
Die Kinder und Jugendlichen sollen also Lernstoff nicht "in ihrem Geist aufstapeln" (ebd., S. 26), sondern durch "Tun mit dem Dinge" (ebd., S. 144) die "Wechselwirkungen einer sehr großen Vielheit von Kräften" spüren (ebd., S. 222). Hierbei verweist der Projektbegriff auf ein "konkretes, zeitlich und räumlich von anderen abgrenzbares Geschehen" (Hänsel 1995, S. 28), welches als Problem "wie ein Magnet" auf die Schüler wirkt, gemeinsames Lernen von ihnen fordert und "Denken und Tun verknüpft" (ebd., S. 29).
Dewey stellt fünf Merkmale bzw. Phasen seiner Methode auf, die u. a. Erkennung der Sachlage, Problembenennung, Beobachtung, Lösung und Anwendung beinhalten (Dewey 1916, S. 203-218) und die unten aufgeführten Formen des kreativen Denkens widerspiegeln (Kapitel I.2.1.). Mit Hilfe der drei genannten Komponenten und der Merkmale der Projektmethode Deweys unternimmt Hänsel nun den Versuch einer neuen Beantwortung dessen, was Projektunterricht ist.
Dieser soll nämlich nicht als das Ideal eines "anderen Unterrichts" verstanden werden, sondern als "eine besondere Form praktischer pädagogischer Tätigkeit von Lehrern und Schülern oder eine besondere Unterrichtsform, in der die Projektmethode ihren didaktisch konsequentesten Ausdruck findet" (Hänsel 1995, S. 31).
Damit ist projektorientierter Unterricht nicht mehr eine Kümmerform des Projektunterrichts, sondern "Unterricht, der nach den Prinzipien der Projektmethode gestaltet ist" (Hänsel 1995, S. 31).[16] Dieser so verstandene Projektunterricht hat im Gegensatz zu den anderen Formen Klafkis (s. o.) nach Hänsel einen "eigentümlichen Doppelcharakter", der neben Gegenstand, Ziel und methodischer Gestalt sich selbst, d.h. "die geplante Veränderung und Überwindung von Unterricht durch
Unterricht zum Gegenstand hat" (ebd., S. 32/36).
Inhaltlich gesehen wird er als "Unterricht, in dem Lehrer und Schüler ein echtes Problem in gemeinsamer Anstrengung und in handelnder Auseinandersetzung mit der Wirklichkeit zu lösen suchen, und zwar besser als dies in Schule und Gesellschaft üblicherweise geschieht" (ebd., S. 33).
Seine methodische Seite zeigt "Projektunterricht als pädagogisches Experiment mit der Wirklichkeit, das von Lehrern und Schülern in Form von Unterricht unternommen wird, und das zugleich die Grenzen von Unterricht überschreitet, indem es Schule und Gesellschaft durch praktisches pädagogisches Handeln erziehlich zu gestalten sucht" (ebd., S. 33).
[...]
[1] Zit. nach Januschke 1992, S. 5.
[2] Gudjons 1994, S. 14.
[3] Abgesehen von den Aufsätzen in den musikpädagogischen Zeitschriften und den musikspezifischen Büchern von Wittmoser / Schlosser / Hewener 1990, Müllich 1988 und Beckmannshagen 1981.
[4] Siehe Literaturverzeichnis.
[5] Vgl. ausführlich Dietrich, in: Kaiser / Kaiser 1977, S. 135-150.
[6] Vgl. zur Gesamtdiskussion Pädagogik 7-8/93, S. 58ff.
[7] Suin de Boutemard 1977 in: Gudjons 1994, S. 62-77.
[8] Gudjons vertrat erst die ursprüngliche historische These, nahm Knolls aber 1992 als interessanten Aspekt auf, so dass er in dem Lexikonartikel von 1994 darauf hinweisen kann (vgl. Kapitel I.1.1.).
[9] Nach neuesten Erkenntnissen führte William B. Rogers den Projektbegriff bereits um 1885 "in die Sprache der amerikanischen Pädagogik ein" (Gudjons 1997, S. 67).
[10] Gestützt auf die Ausführungen Hänsels findet sich hierzu eine konsequente Interpretation Deweys im Kapitel I.1.3. dieser Arbeit.
[11] Dieses oft zitierte Beispiel kritisiert Knoll allerdings als Propagandabericht. Das Ergebnis eines ursprünglich sorgfältig geplanten Unterrichts, wurde als "Projekt"-Beispiel verwendet, um einen schlagenden Beweis für Kilpatricks Konzept des "herzhaften absichtsvollen Tuns" zu geben, so Knoll (1993, S. 61). Vgl. hierzu auch Hänsels Kritik und Skepsis (1995, S. 37f).
[12] Vgl. hierzu kontrovers Kapitel I.1.3., I.2.2. und Hänsel 1995, S. 20f.
[13] Vgl. auch Gudjons 1997, S. 67: "Die Zukunft ist unbekannt" (Kilpatrick).
[14] Im folgenden wird aus dem Aufsatz von 1995 zitiert (aus: "Projektbuch Grundschule", S. 15-47), den Hänsel 1997 nochmals - mit kaum geändertem Inhalt - in ihrem "Handbuch Projektunterricht" veröffentlicht hat (S. 54-92).
[15] Deweys Hauptwerk "Demokratie und Erziehung" ist zugleich auch sein Haupt ziel.
[16] In diesem Sinn wird das Attribut "projektorientiert" im weiteren Verlauf der Arbeit verwendet werden.
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Originalausgabe
- Erscheinungsjahr
- 1998
- ISBN (eBook)
- 9783832440886
- ISBN (Paperback)
- 9783838640884
- DOI
- 10.3239/9783832440886
- Dateigröße
- 839 KB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- Universität Hildesheim (Stiftung) – Erziehungs- und Sozialwissenschaften
- Erscheinungsdatum
- 2005 (Februar)
- Note
- 1,0
- Schlagworte
- musikdidaktik musikpädagogik projektlernen projektunterricht musikprojekte
- Produktsicherheit
- Diplom.de