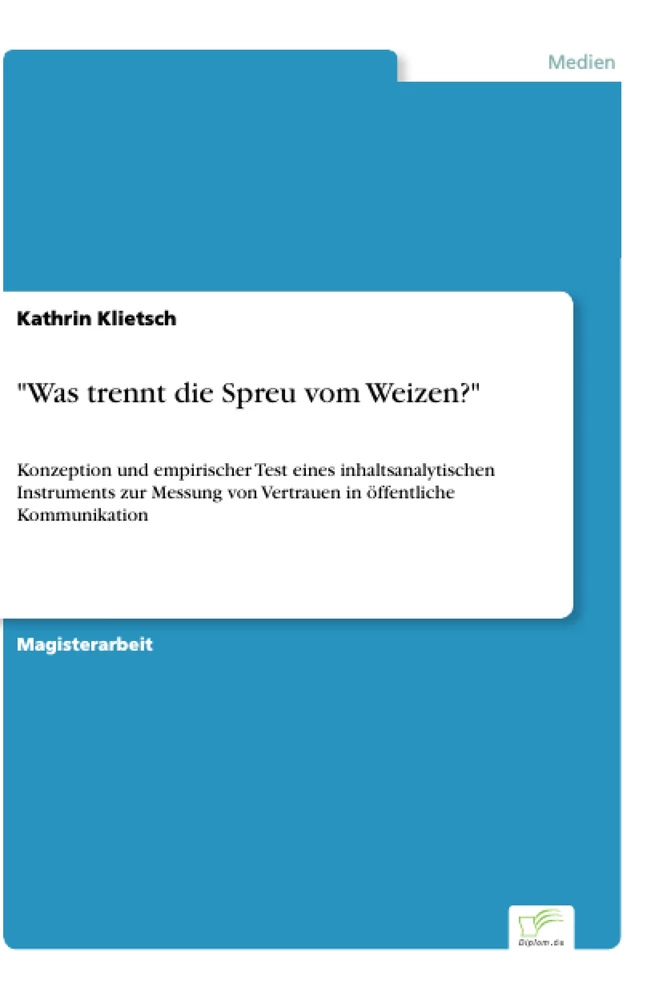"Was trennt die Spreu vom Weizen?"
Konzeption und empirischer Test eines inhaltsanalytischen Instruments zur Messung von Vertrauen in öffentliche Kommunikation
©2004
Magisterarbeit
156 Seiten
Zusammenfassung
Inhaltsangabe:Einleitung:
Zweifelsohne existiert er auch im Journalismus der sprichwörtliche kleine, aber feine Unterschied. Keine Tageszeitung, Zeitschrift oder Nachrichtensendung gleicht der anderen. Egal ob Tagesschau, Spiegel, TLZ oder FAZ was über Gesundheitsreform, Elite-Unis, Arbeitslosigkeit usw. berichtet wird, unterscheidet sich formal und inhaltlich mehr oder minder offensichtlich von Medium zu Medium. Die Entscheidung eines Lesers oder Zuschauers für diese oder jene Tageszeitung oder Nachrichtensendung basiert auf genau diesen Unterschieden. Meist greift er auf solche Zeitungen und Sendungen zurück, welche er bereits kennt, die ihm also längst vertraut sind und die im Unterschied zu anderen am ehesten seinen subjektiven Erwartungen gerecht werden. Diese Erwartungen orientieren sich an einer Vielzahl von Kriterien. Während für den Einen in erster Linie die objektive, vielseitige und umfassende Berichterstattung im Vordergrund steht, spielt es für den Anderen eine größere Rolle, immer über den neusten Stand der Dinge informiert zu werden, möglichst detaillierte und wahrheitsgetreue Informationen zu erhalten. Aus der jeweils spezifischen Zusammensetzung all dieser Kriterien ergibt sich beim Rezipienten eine Einschätzung des konkreten Mediums, welche sich unter dem Begriff des Vertrauens fassen lässt.
In diesem Zusammenhang stellen sich folgende Fragen: Basieren diese Unterschiede im Rezipienten-Vertrauen auch auf wahrnehmbaren Unterschieden der Medien selbst, was ihre Inhalte und Gestaltung anbelangt? Anders ausgedrückt: Läßt sich die subjektive Vertrauenseinschätzung der Leserschaft auch im Inhalt einer Zeitung wiederfinden? Womit lassen sich die unterschiedlichen Vertrauenszuschreibungen einzelner Medien sonst plausibler erklären als anhand konkreter Unterschiede in deren Berichterstattung? Schließlich beziehen sich die angenommenen Kriterien, anhand derer der Rezipient sein Vertrauensurteil fällt, vordergründig auf das, was er Tag für Tag liest oder im Fernsehen präsentiert bekommt sprich den Inhalt selbst. Erst eine Gegenüberstellung der Einschätzungen bestimmter Medien und einer tiefgründigen Auseinandersetzung mit deren Inhalten vermag Antworten auf zumindest einige dieser Fragen zu finden.
Genau dies ist das Thema der vorliegenden Arbeit: das Vertrauen in Journalismus. Damit ist gleichermaßen Vertrauen in öffentliche Kommunikation erfasst. Journalismus stellt der Öffentlichkeit Informationen zur Verfügung, welche damit […]
Zweifelsohne existiert er auch im Journalismus der sprichwörtliche kleine, aber feine Unterschied. Keine Tageszeitung, Zeitschrift oder Nachrichtensendung gleicht der anderen. Egal ob Tagesschau, Spiegel, TLZ oder FAZ was über Gesundheitsreform, Elite-Unis, Arbeitslosigkeit usw. berichtet wird, unterscheidet sich formal und inhaltlich mehr oder minder offensichtlich von Medium zu Medium. Die Entscheidung eines Lesers oder Zuschauers für diese oder jene Tageszeitung oder Nachrichtensendung basiert auf genau diesen Unterschieden. Meist greift er auf solche Zeitungen und Sendungen zurück, welche er bereits kennt, die ihm also längst vertraut sind und die im Unterschied zu anderen am ehesten seinen subjektiven Erwartungen gerecht werden. Diese Erwartungen orientieren sich an einer Vielzahl von Kriterien. Während für den Einen in erster Linie die objektive, vielseitige und umfassende Berichterstattung im Vordergrund steht, spielt es für den Anderen eine größere Rolle, immer über den neusten Stand der Dinge informiert zu werden, möglichst detaillierte und wahrheitsgetreue Informationen zu erhalten. Aus der jeweils spezifischen Zusammensetzung all dieser Kriterien ergibt sich beim Rezipienten eine Einschätzung des konkreten Mediums, welche sich unter dem Begriff des Vertrauens fassen lässt.
In diesem Zusammenhang stellen sich folgende Fragen: Basieren diese Unterschiede im Rezipienten-Vertrauen auch auf wahrnehmbaren Unterschieden der Medien selbst, was ihre Inhalte und Gestaltung anbelangt? Anders ausgedrückt: Läßt sich die subjektive Vertrauenseinschätzung der Leserschaft auch im Inhalt einer Zeitung wiederfinden? Womit lassen sich die unterschiedlichen Vertrauenszuschreibungen einzelner Medien sonst plausibler erklären als anhand konkreter Unterschiede in deren Berichterstattung? Schließlich beziehen sich die angenommenen Kriterien, anhand derer der Rezipient sein Vertrauensurteil fällt, vordergründig auf das, was er Tag für Tag liest oder im Fernsehen präsentiert bekommt sprich den Inhalt selbst. Erst eine Gegenüberstellung der Einschätzungen bestimmter Medien und einer tiefgründigen Auseinandersetzung mit deren Inhalten vermag Antworten auf zumindest einige dieser Fragen zu finden.
Genau dies ist das Thema der vorliegenden Arbeit: das Vertrauen in Journalismus. Damit ist gleichermaßen Vertrauen in öffentliche Kommunikation erfasst. Journalismus stellt der Öffentlichkeit Informationen zur Verfügung, welche damit […]
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
ID 4050
Klietsch, Kathrin: "Was trennt die Spreu vom Weizen?" - Konzeption und empirischer Test
eines inhaltsanalytischen Instruments zur Messung von Vertrauen in öffentliche
Kommunikation
Hamburg: Diplomica GmbH, 2005
Zugl.: Friedrich-Schiller-Universität Jena, Magisterarbeit, 2004
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte,
insbesondere die der Übersetzung, des Nachdrucks, des Vortrags, der Entnahme von
Abbildungen und Tabellen, der Funksendung, der Mikroverfilmung oder der
Vervielfältigung auf anderen Wegen und der Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen,
bleiben, auch bei nur auszugsweiser Verwertung, vorbehalten. Eine Vervielfältigung
dieses Werkes oder von Teilen dieses Werkes ist auch im Einzelfall nur in den Grenzen
der gesetzlichen Bestimmungen des Urheberrechtsgesetzes der Bundesrepublik
Deutschland in der jeweils geltenden Fassung zulässig. Sie ist grundsätzlich
vergütungspflichtig. Zuwiderhandlungen unterliegen den Strafbestimmungen des
Urheberrechtes.
Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in
diesem Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme,
dass solche Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei
zu betrachten wären und daher von jedermann benutzt werden dürften.
Die Informationen in diesem Werk wurden mit Sorgfalt erarbeitet. Dennoch können
Fehler nicht vollständig ausgeschlossen werden, und die Diplomarbeiten Agentur, die
Autoren oder Übersetzer übernehmen keine juristische Verantwortung oder irgendeine
Haftung für evtl. verbliebene fehlerhafte Angaben und deren Folgen.
Diplomica GmbH
http://www.diplom.de, Hamburg 2005
Printed in Germany
Autorenprofil
geboren und aufgewachsen in Hoyerswerda (Sachsen), 1997 Abitur,
Magister-Studium der Medienwissenschaft, Wirtschaftswissenschaften und Soziologie
an der
Friedrich-Schiller- Universität Jena, Studienschwerpunkte Medienwirkungsforschung,
Journalismus, empirische Sozialforschung
längere Auslandsaufenthalte in Australien und Kanada,
journalistische Praktika in verschiedenen Medienunternehmen, u.a. Sächsische Zeitung,
WDV
Wirtschaftsdienstverlag und Deutsche Welle
lebt derzeit in Düsseldorf
II
Inhaltsverzeichnis
Abbildungs- und Tabellenverzeichnis... .......... .IV
Einführung ...1
I
THEORETISCHER TEIL ...4
1
Vertrauen in öffentliche Kommunikation ...4
1.1
Forschungsüberblick ... 4
1.2
Theorie des Vertrauens in Journalismus aus systemtheoretischer Sicht ... 12
1.3
Zielsetzung der Arbeit ... 18
1.4
Zwischenfazit ... 20
2
Methodologische Aspekte der Inhaltsanalyse...21
2.1
Kennzeichen der Methode... 21
2.1.1
Gütekriterien... 24
2.1.2
Methodologische Restriktionen... 27
2.2
Operationalisierbarkeit von Vertrauen ... 29
2.3
Zwischenfazit ... 31
3
Theoretische Aspekte des methodischen Vorgehens...32
3.1
Ausgangspunkt: Befragung zum Vertrauen in ... 32
öffentliche Kommunikation... 32
3.2
Grundlagen einer empirischen Validierung von Vertrauen... 36
3.3
Zwischenfazit ... 38
III
II
EMPIRISCHER TEIL ...39
4
Untersuchungsdesign und methodisches Vorgehen...39
4.1
Anknüpfung einer Inhaltsanalyse an eine Befragung... 39
4.2
Stichprobe der Befragung... 41
4.3
Stichprobe der Inhaltsanalyse... 43
4.4
Reliabilitätsprüfung für die Inhaltsanalyse... 44
5
Operationalisierung der Vertrauensdimensionen...46
5.1
Kategorienfindung... 46
5.2
Exkurs: Vertrauen und Qualität... 48
5.3
Indikatoren für Themenselektivität ... 50
5.4
Indikatoren für Faktenselektivität... 55
5.5
Indikatoren für Richtigkeit von Beschreibungen... 61
5.6
Indikatoren für journalistische Bewertungen ... 67
6
Ergebnisse ...73
6.1
Ergebnisse für Themenselektivität ... 75
6.2
Ergebnisse für Faktenselektivität ... 79
6.3
Ergebnisse für Richtigkeit ... 83
6.4
Ergebnisse für Bewertungen... 86
6.5
Ergebnisse für das Gesamtkonstrukt Vertrauen ... 90
6.6
Validierung der Inhaltsanalyse ... 91
7
Zusammenfassung und Ausblick...97
Literaturverzeichnis... 103
Anhang...113
IV
Abbildungsverzeichnis
Abb. 1: Schematisches Messmodell ,,Vertrauen in Journalismus"
nach Kohring (2003)
15
Abb. 2: Zusammenhang zwischen Inhaltsanalyse und Befragung
35
Abb. 3: Abstimmung der Stichproben von Befragung und Inhaltsanalyse
42
Abb. 4: Häufigkeit der Berichterstattung (pro Kalenderwoche)
78
Abb. 5: Relativer Anteil kontroverser Darstellungsweisen bzw. verschiedener
Blickwinkel (in Prozent)
82
Abb. 6: Relativer Fehler- und Verallgemeinerungsanteil (in Prozent)
85
Abb. 7: Relativer Anteil an Wertungen und Interpretationen
in Kommentaren (in Prozent)
88
V
Tabellenverzeichnis
Tab. 1: Glaubwürdigkeitsdimensionen und Kategorienauswahl
nach Nawratil (1997)
11
Tab. 2: Items pro Vertrauens-Dimension
33
Tab. 3: Berechnungsgrundlage für die Summenindizes und Anova
73
Tab. 4: Index-Werte für die Dimension Themenselektivität
76
Tab. 5: ANOVA für die Dimension Themenselektivität
76
Tab. 6: Index-Werte für die Dimension Faktenselektivität
79
Tab. 7: ANOVA für die Dimension Faktenselektivität
80
Tab. 8: Index-Werte für die Dimension Richtigkeit
83
Tab 9: ANOVA für die Dimension Richtigkeit
84
Tab. 10: Index-Werte für die Dimension Bewertungen
87
Tab. 11: ANOVA für die Dimension Bewertungen
87
Tab. 12: ANOVA für Gesamtvertrauen (3 Dimensionen)
90
Tab. 13: Mittelwerte der Befragung für die Vertrauensdimensionen (Key-Items) 92
Tab. 14: ANOVA der Befragung
93
VI
Danksagung
Mein Dank gilt von ganzem Herzen all jenen Personen, die mich vor und während
des Schreibens dieser Arbeit so tatkräftig unterstützt haben, die Realisierung der
Idee für diese Arbeit vorangetrieben und damit diese anfangs scheinbar so schier
unüberwindlich große Hürde gemeinsam mit mir genommen haben, mir immer
wieder ihre Zeit zum Diskutieren oder Korrekturlesen geopfert und mir in Zeiten
hinderlichen Zweifels mit ihrem scheinbar stets unerschöpflichem Repertoire an
überzeugenden Botschaften den Willen und die Kraft zum Durchhalten gegeben
haben. Ohne diese vielen kleinen Rädchen im Uhrwerk der Vollendung wäre das
Erreichen des großen Ziels - der erfolgreiche Abschluss meines Studiums - defini-
tiv wohl kaum möglich gewesen.
1
Einführung
Zweifelsohne existiert er auch im Journalismus der sprichwörtliche kleine, aber feine
Unterschied. Keine Tageszeitung, Zeitschrift oder Nachrichtensendung gleicht der
anderen. Egal ob Tagesschau, Spiegel, TLZ oder FAZ was über Gesundheitsreform,
Elite-Unis, Arbeitslosigkeit usw. berichtet wird, unterscheidet sich formal und inhaltlich
mehr oder minder offensichtlich von Medium zu Medium. Die Entscheidung eines
Lesers oder Zuschauers für diese oder jene Tageszeitung oder Nachrichtensendung
basiert auf genau diesen Unterschieden. Meist greift er auf solche Zeitungen und Sen-
dungen zurück, welche er bereits kennt, die ihm also längst vertraut sind und die im
Unterschied zu anderen am ehesten seinen subjektiven Erwartungen gerecht werden.
Diese Erwartungen orientieren sich an einer Vielzahl von Kriterien. Während für den
Einen in erster Linie die objektive, vielseitige und umfassende Berichterstattung im
Vordergrund steht, spielt es für den Anderen eine größere Rolle, immer ,,über den neus-
ten Stand der Dinge" informiert zu werden, möglichst detaillierte und wahrheitsgetreue
Informationen zu erhalten. Aus der jeweils spezifischen Zusammensetzung all dieser
Kriterien ergibt sich beim Rezipienten eine Einschätzung des konkreten Mediums,
welche sich unter dem Begriff des Vertrauens fassen lässt.
In diesem Zusammenhang stellen sich folgende Fragen: Basieren diese Unterschiede
im Rezipienten-Vertrauen auch auf wahrnehmbaren Unterschieden der Medien selbst,
was ihre Inhalte und Gestaltung anbelangt? Anders ausgedrückt: Läßt sich die subjekti-
ve Vertrauenseinschätzung der Leserschaft auch im Inhalt einer Zeitung wiederfinden?
Womit lassen sich die unterschiedlichen Vertrauenszuschreibungen einzelner Medien
sonst plausibler erklären als anhand konkreter Unterschiede in deren Berichterstattung?
Schließlich beziehen sich die angenommenen Kriterien, anhand derer der Rezipient sein
Vertrauensurteil fällt, vordergründig auf das, was er Tag für Tag liest oder im Fernsehen
präsentiert bekommt sprich den Inhalt selbst. Erst eine Gegenüberstellung der Ein-
schätzungen bestimmter Medien und einer tiefgründigen Auseinandersetzung mit deren
Inhalten vermag Antworten auf zumindest einige dieser Fragen zu finden.
Genau dies ist das Thema der vorliegenden Arbeit: das Vertrauen in Journalismus.
Damit ist gleichermaßen Vertrauen in öffentliche Kommunikation erfasst. Journalismus
stellt der Öffentlichkeit Informationen zur Verfügung, welche damit zugleich zu Be-
standteilen der öffentlichen Kommunikation werden. Bringt der Rezipient diesen jour-
Einführung
2
nalistisch vermittelten Informationen sein Vertrauen entgegen, so vertraut er gleichzei-
tig in öffentliche Kommunikation.
Ein Hauptinteresse der Wissenschaft liegt bei der empirischen Auseinandersetzung
mit Vertrauen auf der Frage nach dessen bestmöglicher Messbarkeit. Bisher erfolgte der
empirische Nachweis primär bei den Vertrauenssubjekten, d. h. den Rezipienten. Über
getestete Skalen lässt sich direkt beim Rezipienten erfragen, inwiefern seine Erwar-
tungshaltungen vom Journalismus erfüllt wurden und er die Medienberichterstattung als
vertrauenswürdig einschätzt. Rezipientenaussagen können hierbei auch miteinander
verglichen werden, genauso wie Vertrauensunterschiede zwischen einzelnen Medien
offengelegt werden können. Die Befragung ist demzufolge scheinbar die geeignetste
Möglichkeit, subjektive Vertrauenszuschreibungen bzw. Einstellungen zu erfassen. Eine
Analyse manifester Inhalte in Form journalistischer Zeitungsbeiträge wurde bislang
ausgeblendet. Genau einem solchen Versuch einer inhaltsanalytischen Operationalisie-
rung von Vertrauen in öffentliche Kommunikation bzw. Journalismus widmet sich die
vorliegende Arbeit. Die theoretische Basis bildet hierfür der systemtheoretisch fokus-
sierte Ansatz von Kohring (2003). Demnach setzt sich Vertrauen aus vier verschiedenen
Vertrauensdimensionen zusammen, welche wiederum in ihrer Bezeichung jeweils eine
journalistische Selektionsleistung spezifizieren. Diese sind das Vertrauen in Themen-
und Faktenselektivität, in Richtigkeit und explizite Bewertungen. Mit diesem Ansatz
wird die Komplexität des Untersuchungsgegenstandes bisher am erfolgversprechends-
ten eingefangen. Außerdem stellt er eine Operationalisierungsgrundlage für die beab-
sichtigte Inhaltsanalyse zur Verfügung. Das als Beispiel zu untersuchende Thema ist
hierbei die Berichterstattung über Arbeitslosigkeit. Das konkret zur Anwendung ge-
kommene Messmodell wurde im Rahmen des DFG-Projektes ,,Vertrauen in Medien" an
der Friedrich-Schiller-Universität Jena (vgl. Kohring 2003) erstmals empirisch über
Befragungen getestet und validiert.
Die Spezifik der vorliegenden Arbeit besteht in den folgenden zwei Anliegen: Zum
einen in der Suche nach inhaltlichen Vertrauensindikatoren und zum anderen in der
Validierung dieser Indikatoren anhand einer Befragung. Im Zentrum des Erkenntnisinte-
resses der vorliegenden Arbeit steht demnach die Diskussion der Eignung der Inhalts-
analyse konkret für den Untersuchungsgegenstand Vertrauen in Journalismus.
Einführung
3
Die Arbeit gliedert sich in insgesamt sieben Kapitel. In den ersten drei Kapiteln werden
die theoretischen Grundlagen für die inhaltsanalytische Auseinandersetzung mit Ver-
trauen dargelegt. Dabei sollen im ersten Kapitel in hinreichender Form sowohl die
Entwicklung als auch die unter methodischen Gesichtspunkten zentralen Defizite der
bisherigen Forschung zum Medienvertrauen vorgestellt werden. In Abgrenzung davon
werden als Ausgangspunkt der vorliegenden Arbeit der Forschungsansatz zum Vertrau-
en in Journalismus und dessen Kernelement, die vier Vertrauensdimensionen, näher
beleuchtet. Daraus leitet sich auch die zentrale Fragestellung dieser Arbeit ab. Einer
knappen Auseinandersetzung mit den methodologischen Grundlagen und Grenzen der
Inhaltsanalyse im Kapitel 2 folgt die Darlegung der theoretischen Fundierung der Vor-
gehensweise dieser Arbeit (Kapitel 3). Letztlich gilt es daran zu prüfen, ob es tatsäch-
lich möglich und sinnvoll ist, der inhaltsanalytischen Methode für dieses Thema einen
größeren Stellenwert in der Diskussion darüber zuzuweisen, als ihr bisher zuteil wurde.
Im Anschluss folgen die Darlegungen des empirischen Teils. Aus der Anbindung an
eine Befragung auf der Ebene der Operationalisierung von Vertrauensindikatoren ergibt
sich ein spezifisches Untersuchungsdesign. Da die Befragung auch zur Validierung der
inhaltsanalytischen Ergebnisse herangezogen werden sollte, ergeben sich gleichermaßen
Konsequenzen für die Zusammensetzung der beiden Stichproben. Diese werden im
Kapitel 4 eingehender vorgestellt. Besondere Beachtung wird dem Vorgehen bei der
inhaltsanalytischen Operationalisierung der Zuschreibungskategorie Vertrauen ge-
schenkt (5. Kapitel). Es ist anzunehmen, dass sich diese Aufgabe insbesondere für eine
Analyse von (journalistischen) Inhalten als schwierig darstellt und macht demzufolge
eine besondere Ausführlichkeit der Darstellungen erforderlich. Im Rahmen des 6. Kapi-
tels folgt dann die Darstellung der Analysestrategie und der Ergebnisse. Im Fazit wird
die eingangs formulierte Forschungsfrage wieder aufgegriffen und versucht, aus einer
ersten Evaluation der hier durchgeführten Untersuchung Konsequenzen für daran an-
knüpfende, inhaltsanalytische Forschungsvorhaben zu diesem Thema abzuleiten.
4
I
THEORETISCHER TEIL
1
Vertrauen in öffentliche Kommunikation
Die nachfolgenden Ausführungen dienen der Skizzierung des bisherigen Forschungs-
standes zum Medienvertrauen (Kapitel 1.1). Hierzu ist es notwendig, sich neben der
kurzen Vorstellung der verschiedenen Ansätze auch die wissenschaftliche Diskussion
um die methodischen Defizite der Vertrauensforschung vor Augen zu führen. Die dar-
aus abgeleiteten Anknüpfungspunkte, auf welchen die systemtheoretisch konzeptionier-
te Theorie des Vertrauens in Journalismus bzw. öffentliche Kommunikation basiert,
werden im Anschluss daran vorgestellt (Kapitel 1.2).
1.1
Forschungsüberblick
Die theoretischen Betrachtungen wie auch die empirischen Untersuchungen zum Ver-
trauen hatten bis vor kurzem eines gemeinsam: Sie wiesen Vertrauen als Glaubwürdig-
keit aus, welche ursprünglich wiederum ausschließlich als Bestandteil der kommunika-
tionspsychologischen Persuasionsforschung thematisiert wurde (vgl. Matthes/Kohring
2003: 6). Die Beurteilung der Glaubwürdigkeit durch den Rezipienten
1
lässt sich in
erster Linie anhand des Verhaltens des Kommunikators, des Inhalts oder der Quelle
bzw. des Kontexts nachweisen. Zentrale Gegenstände des Glaubwürdigkeitsurteils sind
hierbei die wahrgenommenen Charakteristika von Kommunikationsquellen (vgl. Hov-
land/Weiss 1951; Hovland/Janis/Kelley 1959).
Der folgende Forschungsüberblick bezieht sich in erster Linie auf Studien zur Medien-
glaubwürdigkeit. Einhergehend mit der Zugrundelegung eines konkreten theoretischen
Ansatzes für diese Arbeit (vgl. Kap.1.2) wird eine Klassifikation der verschiedenen
Forschungsrichtungen vorgenommen, welche auch bereits in anderen Arbeiten enthalten
ist (vgl. Matthes 2001; Kohring 2003). Sie gliedert sich folgendermaßen auf: den Ro-
per-Ansatz zur vergleichenden Medienglaubwürdigkeit (1), den faktoranalytischen
Ansatz der Glaubwürdigkeitsforschung (2) und den objektivitätsorientierten Ansatz (3).
1 Der sprachlichen Einfachheit halber wird in dieser Arbeit generell nur das grammatikalische Maskuli-
num verwendet.
Forschungsüberblick
5
Ad (1) Der Roper-Ansatz
Der erste hier vorzustellende Ansatz ist mit der so genannten Roperfrage
2
in der Me-
dienglaubwürdigkeitsforschung bekannt geworden. Dabei wurde direkt und eindimensi-
onal nach dem Ausmaß der Glaubwürdigkeit gefragt, die den einzelnen Medientypen
(Fernsehen, Tageszeitung, Hörfunk) zugeschrieben wird.
Anhand der Ergebnisse zahl-
reicher Umfragen (Westley/Severin 1964; Shaw 1973; Newhagen/Nass 1989; Bentele
1988b) wurde angenommen, dass ein Zusammenhang zwischen dem individuellen
Glaubwürdigkeitsurteil und der Mediennutzung existiert. Diese Annahme basiert u. a.
darauf, dass aufgrund der regelmäßig wiederholten Anwendung dieser Frage seit den
sechziger Jahren ein deutlicher Glaubwürdigkeitsvorsprung des Fernsehens gegenüber
den Printmedien festgestellt wurde. Dieser schien in Deutschland u. a. einherzugehen
mit der bevorzugten und kontinuierlich ansteigenden Nutzung des Fernsehens, welche
u.a. an der zunehmenden Verfügbarkeit von Fernsehgeräten und der Einführung des
privaten Rundfunks lag (vgl. Kohring 2003: 31 f.).
Zusätzlich wurden auch soziodemographische Faktoren, z. B. Alter und Geschlecht
(Westley/Severin 1964) oder der Bildungsgrad (Greenberg 1966) als Erklärung für
dieses Ergebnis angeführt. Außer Acht gelassen wird damit aber die eigentliche Klärung
des Konstruktes Glaubwürdigkeit resp. Vertrauenswürdigkeit, womit die Aussagekraft
der Ergebnisse als mäßig und die daraus gezogene Schlüsse für die Nutzung der einzel-
nen Medientypen als vage einzuschätzen sind. In Deutschland beispielsweise wurde
dieser Eindruck unterstrichen, indem Glaubwürdigkeit im Zusammenspiel mit der Ob-
jektivität und der Wahrheitstreue untersucht wurde (vgl. Berg/Kiefer 1996). Die Ein-
schätzung dieser beiden Aspekte bestätigt zwar ebenfalls den Vorsprung des Fernsehens
gegenüber Tageszeitungen, ist aber dahingehend zu deuten, dass die Fragestellung die
Begriffe nicht immer eindeutig voneinander abgrenzt und stattdessen eine Gleichset-
zung von Glaubwürdigkeit und Wahrheitstreue vorgibt (ebd.: 251).
Die methodische Kritik an der Roperfrage richtet sich vorrangig auf die eindimensio-
nale Erfassung eines multidimensionalen Konstruktes. Die statistische Auslese von
Zufallsfehlern die bei der Untersuchung solch komplexer Phänomene wie Glaubwür-
2 ,,If you got conflicting or different reports of the same story from radio, television, the magazines and
the newspapers, which of the four versions would you be most inclined to believe the one on radio
or television or magazines or newspapers?" (Roper 1985: 5)
Forschungsüberblick
6
digkeit nicht zu vermeiden sind ist damit schwierig (vgl. Schnell/Hill/Esser 1999: 128
f.). Unberücksichtigt blieben ebenfalls das Mediennutzungsverhalten der Befragten und
die Forderung nach Themenspezifik der Antworten. Ausgangspunkt für die Beantwor-
tung der Frage war die hypothetische ,,Gleichbehandlung aller Quellen- bzw. Medienty-
pen" (Jäckel 2002: 166), was ebenso kritisiert werden muss. Auf der Suche nach mögli-
chen Erklärungen für derlei intermediale Unterschiede wurde auch der Aspekt der
tatsächlichen Verfügbarkeit der einzelnen Medien und der finanzielle Aufwand für die
Mediennutzung (Höhe der Rundfunkgebühren bzw. eines Zeitungs-Abonnements) nicht
berücksichtigt.
Um Unterschiede in der Glaubwürdigkeit nachweislich messen zu können, muss die
Messung des Konstrukts auf metrischem Skalenniveau erfolgen. Nur auf diesem Wege
würde das beabsichtigte Ziel der vergleichenden Gegenüberstellung einzelner Medien-
typen erreicht werden. Da die Operationalisierung jedoch nur ordinalskaliert erfolgte,
liegen hier eindeutig Diskrepanzen zwischen der Messung und den geschlussfolgerten
Ergebnissen vor. Die in absoluten Zahlen häufigere Nennung des Fernsehens bei den
Befragten ist demnach nicht gleichbedeutend mit dessen höherer Glaubwürdigkeit,
sondern resultiert in erster Linie aus dem Zwang, sich für einen Medientypus bei der
Beurteilung von Glaubwürdigkeit entscheiden zu müssen (vgl. Kohring 2003: 40).
Die methodologische Kritik an der kommunikationswissenschaftlichen Relevanz dieses
Ansatzes und die Zweifelhaftigkeit der Ergebnisse wird zusätzlich genährt vom fehlen-
den Nachweis der Kriteriums- und Konstruktvalidität und gleichermaßen der fehlenden
Aussagen zur Reliabilität der Messung bzw. zu den hypothetischen Beziehungen der
Variablen zueinander (Matthes 2001: 7 f.).
Ad (2) Faktoranalytischer Ansatz
Studien des faktoranalytischen Ansatzes greifen u. a. die Kritik am Roper-Ansatz erneut
auf und versuchen, Glaubwürdigkeit mehrdimensional zu erfassen. Das Hauptaugen-
merk liegt bei diesem Ansatz nunmehr auf der Skalenentwicklung für die Glaubwürdig-
keitsmessung. Mittels semantischer Skalen und deren Auswertung über explorative
Faktorenanalysen wurden einzelne Dimensionen von Glaubwürdigkeit generiert und im
Anschluss daran inter- bzw. intramedial oder auch zwischen verschiedenen Rezipien-
tengruppen miteinander verglichen (vgl. Kohring 2003: 17). Einige der Studien orientie-
Forschungsüberblick
7
ren sich bei der Entwicklung der Skalen zur Glaubwürdigkeitsmessung
3
primär an Cha-
rakteristiken, die vordergründig personalen Beschreibungen dienlich sind. Die Bewer-
tungen, welche die Rezipienten bzw. Befragten hier vornehmen, beziehen sich auf
Personen (vgl. Markham 1968), Medientypen (vgl. Jacobson 1969) oder -angebote (vgl.
Lee 1978).
4
Systembezogene Charakteristiken werden eher selten verwendet, da sie
schwieriger zu operationalisieren sind.
Die Kritik am faktoranalytischen Ansatz bezieht sich in erster Linie auf das Auswer-
tungsinstrument. Dabei liegt das Hauptaugenmerk auf dem subjektiven Ermessensspiel-
raum bei der Zusammenfassung der Faktoren zu Dimensionen. Das Instrument der
Faktorenanalyse ermöglicht eine immense Vielfalt an Variationen, z. B. in der Zuord-
nung zu Faktoren oder der Anzahl verwendeter Variablen. Auch die Art und Anzahl der
Befragten, das Thema oder der Untersuchungskontext beeinflussen die Ergebnisse.
Derlei Variationen machen eine sorgfältige Dokumentation des Vorgehens erforderlich,
was bei den hierzu zählenden Studien nur unzureichend getan wurde. Insbesondere für
die Entwicklung einer Skala ist dieser Punkt jedoch entscheidend in theoretischer wie
auch methodischer Hinsicht (vgl. Kohring 2003: 26).
Die ermittelte Faktorstruktur des Konstrukts und damit auch die Reliabilität der vor-
genommenen Messung ist jedoch nicht nur abhängig von den eingesetzten Skalen,
sondern ebenso von der zum Einsatz gebrachten Faktorenanalyse-Variante
5
sowie auch
der Benennung der einzelnen Faktoren durch den Forscher (vgl. Jäckel 2002: 162;
Kohring 2001: 19). Aussagen zur Operationalisierung, d. h. beispielsweise zur Auswahl
der Items oder der Anzahl der Faktoren bei der Faktorenanalyse, lassen die Studien
kaum zu. Damit wird einerseits der Vorwurf von Willkürlichkeit bei der Datenauswer-
tung genährt und andererseits die Möglichkeit einer Replikation bzw. Validierung durch
weitere Studien verwehrt (Matthes 2001: 16).
Ebenfalls zur Diskussion steht bei diesem
Ansatz die Güte der Messung. Die verwendeten semantischen Differenziale vermögen
3 Die Vorstellung der Vielfalt der verwendeten Skalenpaare faktoranalytischer Studien bleibt an dieser
Stelle aus Platzgründen ausgeblendet. Ausführlichere Darstellungen dessen sind u. a. in Nawratil
1997: 44-133; Wirth 1999: 49-51 und Kohring 2003: 17-24 nachzulesen.
4 Weitere Studien dieses Forschungszweiges sind die Untersuchungen von Mosier/Ahlgren (1981),
Burgoon/Burgoon/Wilkinson (1981), Gaziano/McGrath (1986) und Meyer (1988).
5 Mittels konfirmatorischer Faktorenanalysen (KFA) wird überprüft, inwiefern Indikatoren für jeden
Faktor zu messende, latente Konstrukte zu erklären vermögen. Explorative Faktorenanalysen (EFA)
hingegen fassen Variablenausprägungen, die überzufällig oft auftreten, zu neuen Faktoren zusam-
men. Während die KFA ein strukturprüfendes Vorgehen ist und eindeutige Festlegungen von Fakto-
ren und Indikatoren des zu messenden theoretischen Konstrukts voraussetzt, bezeichnet die EFA ein
strukturentdeckendes Verfahren. Es kann nicht zur Falsifizierung postulierter Faktorenstrukturen he-
rangezogen werden.
Forschungsüberblick
8
meist allgemeine Charakteristika von Kommunikation zu erfassen. Die Spezifika von
Glaubwürdigkeit und damit deren Mehrdimensionalität werden dagegen nur einge-
schränkt aufgezeichnet. (vgl. Matthes 2001: 7). Dies impliziert das Risiko der Konfun-
dierung (vgl. Wirth 1999: 52).
6
Die Validität der Ergebnisse dürfte damit nur als unzu-
reichend
gewertet werden.
Da
auch dieser Ansatz keine funktionale
Glaubwürdigkeitsdefinition liefert, lässt sich eine Übereinstimmung der subjektiv abge-
leiteten Skalen mit den erhobenen Einschätzungen durch die Befragten nur schwer
nachweislich erklären (Kohring 2003: 27).
Ad (3) Objektivitätsorientierter Ansatz
Die Bezeichnung verweist bereits auf eine Verknüpfung des Konzepts der Glaubwür-
digkeit mit dem Konzept der Objektivität. Damit wurde erstmals auf einen bisher aus-
geblendeten Aspekt Bezug genommen: Journalismustheorie. Der Ausgangspunkt ist
hierbei die Forderung, Journalisten könnten und sollten von sozialer Realität losgelöst
neutral (objektiv) berichten. Je nach Können und Bereitschaft bemesse sich daran ent-
sprechend ihre Glaubwürdigkeit. Zentrale Studien aus dem deutschen Raum sind hierzu
die Arbeiten Nawratils (1997) und Benteles (1988b).
Bentele berücksichtigt die Zentralität der Nichtübereinstimmung von Realität und
Medienrealität und damit zusammenhängend der medienspezifischen Selektionsleistun-
gen für die Glaubwürdigkeits- bzw. Vertrauenseinschätzung. Zentrales Element ist
hierbei der Bezug auf die normative Verpflichtung des Journalisten zur Objektivität.
Objektivität gilt laut Bentele jedoch nur als Forderung für informierende, keineswegs
für interpretierende oder wertende, journalistische Darstellungsformen. Lediglich an-
hand der nachprüfbaren Richtigkeit und Vollständigkeit als zentrale Kriterien für Objek-
tivität gelangen Rezipienten demzufolge theoretisch zu ihrem subjektiven Glaubwür-
digkeitsurteil (vgl. Bentele 1994: 309). Bentele definiert Glaubwürdigkeit als
,,Eigenschaft, die Menschen, Institutionen oder deren kommunikativen Produkten (...)
von jemandem (Rezipienten) in Bezug auf etwas (Ereignisse, Sachverhalte usw.) zuge-
schrieben wird." (ebd.: 297)
6
Dabei würden fälschlicherweise allgemein positive Images und nicht exakte Glaubwürdigkeitsattri-
bute extrahiert.
Forschungsüberblick
9
Die Voraussetzungen für hohe Glaubwürdigkeit einer Person oder Institution sind zum
einen kohärentes kommunikatives Verhalten und das Vertrauen des/der Kommunikati-
onspartner in deren Fähigkeit und Bereitschaft zur adäquaten Beschreibung eines Ereig-
nisses oder Sachverhalts (ebd.).
Neu ist bei Bentele, dass die Glaubwürdigkeit von Medien erstmals als Teilphäno-
men einer Theorie öffentlichen Vertrauens aufgefasst wird (vgl. Bentele 1998b: 305). In
der gesamten Medienglaubwürdigkeitsforschung war es damit Benteles Arbeit, die als
erste journalismus-, glaubwürdigkeit- gesellschafts- und nunmehr auch vertrauenstheo-
retische Aspekte zusammenführte (vgl. Kohring 2003: 47). Überdies berücksichtigte er
bei der Auswertung die Aussagen zur tatsächlichen Mediennutzung.
Die Kritik am objektivitätsorientierten Ansatz konzentriert sich in erster Linie eben-
falls auf den Schritt der Operationalisierung (Matthes 2001: 27). Bei Benteles Untersu-
chung muss das theoretische Konzept von Glaubwürdigkeit aus den vier Bereichen
Kommunikator, Medienrealität, Rezipient und Realität als relativ unzulänglich einge-
schätzt werden (vgl. Bentele 1988a: 421). Bei der Frageformulierung, wie glaubwürdig
und
objektiv die einzelnen Medien beurteilt werden, erfolgt eine Verknüpfung zweier
unterschiedlicher Attributionsleistungen in einer Frage. In theoretischer Hinsicht sind
am objektivitätsorientierten Ansatz die Klassifizierung der Medien als rein passive
Vermittler und die Messung von Objektivität und dementsprechend von so genannten
Verzerrungen (bias) in der Berichterstattung anzumerken. Insbesondere der letztgenann-
te Punkt ist ein Aspekt der Diskussion um die Bedeutung der inhaltsanalytischen Me-
thode für diese Thematik. Weitere Kritikpunkte sind die unzureichende Thematisierung
journalistischer Selektivität, die ausstehende Überprüfung der Konstruktvalidität und
die mangelnde funktionale Verknüpfung mit dem Medienglaubwürdigkeitskonzept.
Im Gegensatz dazu knüpft die Arbeit Nawratils (1997) zwar nicht an diese eben vor-
gestellte Arbeit an, stellt aber dennoch einen ebenfalls objektivitätsorientierten Versuch
einer Annäherung an das Konstrukt Glaubwürdigkeit dar. Dabei nähert sie sich diesem
Untersuchungsgegenstand erstmals mit der Methode der Inhaltsanalyse. Ihre Untersu-
chung basiert auf der Vermutung, dass aus der vergleichenden Betrachtung von Medien-
inhalten (hier: Tageszeitungen) Rückschlüsse über die verschiedenen Aspekte und
Dimensionen dargestellter Glaubwürdigkeit der Medienakteure möglich sind. Anhand
der Untersuchung von drei medial thematisierten Skandalen sollte gezeigt werden,
welche Rolle die Glaubwürdigkeit der beteiligten Akteure bei der Berichterstattung
Forschungsüberblick
10
spielt (vgl. Nawratil 1997: 187).
7
Es wurde hier erstmalig nach einer Möglichkeit ge-
sucht, anhand von inhaltsanalytisch operationalisierten Kriterien für Glaubwürdigkeit
einen Zusammenhang mit der Beurteilung der Kommunikationspartner durch die Leser
der untersuchten Zeitungen herzustellen. Überdies griff die Arbeit die so genannte
Zeitungswissenschaftliche Kommunikationstheorie auf, welcher zufolge zwischen den
Kommunikationspartnern (und deren -rollen) ein Vermittlungsprozess abläuft, in dem
Vermittler und Rezipienten gleichermaßen Vermittlungsrollen erfüllen (vgl. Wagner
1978). Geleitet vom Anspruch, objektiv, fair und vollständig zu berichten, leisten Ver-
mittler somit einen Beitrag zur Orientierung der Rezipienten und zu deren Glaubwür-
digkeitsurteil über die Ausgangspartner (vgl. Nawratil 1997: 187). Wichtig ist hierbei
die Unterscheidung zwischen journalistischen, d. h. neutralen, und publizistischen (von
Eigeninteressen geleiteten) Vermittlern (vgl. Wagner 1977).
Nawratil operationalisiert dafür Glaubwürdigkeit auf drei Ebenen: den Ausgangspart-
nern, den (personalen und sachlichen) Kommunikations- bzw. Bewertungsobjekten
sowie den Charakterisierungen von Kommunikationsobjekten (Kennungsebene) (vgl.
Tab. 1). Journalistische Beiträge werden dabei auf das Vorhandensein von Faktoren wie
Kompetenz, Vertrauenswürdigkeit, Dynamik, soziale Billigung und Sympathie unter-
sucht. Die Entscheidungskriterien, nach welchen die Zuordnung dieser Faktoren zu den
Dimensionen erfolgte, werden dabei nicht offen gelegt.
Da insbesondere für die Kennungsebene die Zuschreibung von Eigenschaften rele-
vant wird, greift Nawratil für ihre Untersuchung hierfür auf eine Sammlung so genann-
ter Bedeutungshöfe im Sinne umfassender Polaritätenprofile einzelner Einschätzungen
und Bewertungen zurück.
8
Ähnlich den semantischen Differenzialen im faktoranalyti-
schen Ansatz ergibt sich bei der Auswertung ein jeweils spezifisches Glaubwürdig-
keitsprofil der untersuchten Kommunikationspartner (vgl. Nawratil 1997: 194).
Hervorzuheben ist an dieser Stelle Folgendes: Der Nachweis der Glaubwürdigkeit von
Kommunikationspartnern ließe sich dieser Untersuchung und dem zugrunde gelegten
Zeitungswissenschaftlichen Ansatz entsprechend anhand der vermittelten Informationen
erbringen. Zur Folge hätte eine solche Betrachtungsweise, dass sowohl unabhängig von
den Vermittlern der Information als auch den Kommunikationsobjekten eine Glaubwür-
7 Für ihre Untersuchung wählte Nawratil die so genannte ,Briefbogen-Affäre' (J. W. Möllemann), die
,Putzfrauen-Affäre' (G. Krause) und die ,Pfeiffer- bzw. Barschel-Affäre' (vgl. Nawratil 1997: 189).
8 Diese insgesamt 80 Bedeutungshöfe dienen der Strukturierung des Untersuchungsmaterials und
fassen alle im Inhalt vorkommenden Synonyme/sinnverwandte Attribute unter einer Leitkennung (i.
d. R. semantisch gegensätzliche Adjektivpaare) zusammen.
Forschungsüberblick
11
digkeitseinschätzung ermöglicht würde eine Sichtweise, die theoretisch wie metho-
disch weitreichende Konsequenzen haben dürfte. Die nähere Auseinandersetzung mit
dieser Annahme zeigt jedoch, dass sich jedoch auch für diese Untersuchung einige
methodische Unzulänglichkeiten nachweisen lassen.
Tab. 1: Glaubwürdigkeitsdimensionen und Kategorienauswahl nach Nawratil (1997)
Dimension von
Glaubwürdigkeit
Partner-Ebene
Objekt-Ebene
Kennungs-Ebene
Kompetenz
Herkunfts-
kompetenz
Aussagerelevanz
Expertenstatus
Kompetenz
Fähigkeiten
Realitätsnähe
Vertrauenswürdig-
keit
Detailliertheit
Logische Konsistenz
Konstanz
Übereinstimmung
Aussagesituation
Rechtschaffenheit
Reinheit der
Motive
Ehrlichkeit
Fairness
Verantwortungs-
bewusstsein
Glaubwürdigkeit
Vertrauenswürdig-
keit
Dynamik
Mimik
Gestik
Stimmhöhe
Aktivität
Stärke
Aggressivität
Soziale Billigung
Berufung auf andere
Beziehung zum
Skandalierten
Akzeptanz
Ablehnung
Integration
Achtung
Bejahung
Sympathie
Sympathie
Beliebtheitsgrad
Attraktivität
Quelle: eigene Darstellung, in Anlehnung an Nawratil 1997: 206
Eine von Nawratil selbst erwähnte, wichtige Einschränkung, ist die Tatsache, dass
die so genannten ,Bedeutungshöfe' ,,...offene Ränder aufweisen, oder sich an ihren
Rändern gelegentlich überlappen. (J)eder ,Bedeutungshof'" (ist) nicht theoretisch-
allgemein, sondern pragmatisch (...) definiert." (Wagner 1986: 106) Damit können nur
begrenzt eindeutige Codierergebnisse erreicht werden. Überdies lässt sich die Zuwei-
sung einzelner Kennungsaspekte zu den angenommenen Glaubwürdigkeits-
Dimensionen ohne jegliche theoretische Fundierung nur schwer aufrecht erhalten. Sich
ergebende Mehrdeutigkeiten der verwendeten Begriffe verdeutlichen das Problem: Die
beiden Bedeutungshöfe ,Vertrauenswürdigkeit' und ,Glaubwürdigkeit' werden als
Indikatoren in der Dimension ,Vertrauenswürdigkeit' aufgeführt. Es bleibt jedoch offen,
Forschungsüberblick
12
ob und wie Vertrauenswürdigkeit direkt in manifestem Inhalt gemessen wird, ob die
einzelnen Dimensionen in ihrer Relevanz und Zusammensetzung für das Gesamtkon-
strukt Glaubwürdigkeit zu gewichten oder gar miteinander zu verknüpfen sind. Diese
Punkte sind u. a. für die Klärung der Messbarkeit und damit der Konstruktion einer
Skala zur exakten Messung von Glaubwürdigkeit von Vertrauen entsprechend zu be-
rücksichtigen.
Da Nawratil selbst ihre Ergebnisse im Hinblick auf die Wirkung einer Glaubwürdig-
keitszuschreibung relativiert (Nawratil 1997: 190 f.), bleibt die Frage nach der tatsächli-
chen Eignung der Inhaltsanalyse als adäquate Messmethode für latente Konstrukte und
Zuschreibungen wie Glaubwürdigkeit hier unbeantwortet. Offen bleibt ebenso die Ein-
schätzung der Validität der Messung, d. h. inwieweit die Einschätzung der Glaubwür-
digkeit der Kommunikationspartner durch die Rezipienten tatsächlich mit den hier
gemessenen Glaubwürdigkeitsprofilen konform ist.
Gerade diese Punkte verdeutlichen, worin sich die vorliegende inhaltsanalytische Ar-
beit von Nawratils Untersuchung unterscheidet: Die theoretische Grundlage bildet
nunmehr eine explizite Theorie von Vertrauens in Journalismus, bei welcher Glaubwür-
digkeit als Teilaspekt von Vertrauen hergeleitet und operationalisiert wurde (vgl. Kap.
1.2). Da für diese Theorie bereits ein empirischer Nachweis durch eine Befragung er-
folgte, besteht hierfür auch erstmals ein Validitätsnachweis des Konstruktes Vertrauen.
Diesen Nachweis nun ebenso für die Methode der Inhaltsanalyse zu erbringen, ist eine
der Aufgaben der vorliegenden Arbeit (vgl. Kap. 1.3).
1.2
Theorie des Vertrauens in Journalismus aus systemtheoretischer Sicht
Wie aufgezeigt wurde, bestehen sowohl auf theoretischer Ebene als auch auf der Ebene
der empirischen Umsetzung wesentliche Mängel der kommunikationswissenschaftli-
chen Auseinandersetzung mit dem Vertrauensbegriff. Die Notwendigkeit, die beiden
Begriffe Glaubwürdigkeit und Vertrauen lösgelöst voneiander zu betrachten und gleich-
wohl Vertrauen als mehrdimensionales Konstrukt kenntlich zu machen, führt dazu, nach
geeigneteren Ansatzpunkten für eine Theorie des Vertrauens in Medien, genauer gesagt
in Journalismus, zu suchen. Im Zusammenhang mit der Forderung nach einem empiri-
schen Nachweis von Vertrauen erscheint die Systemtheorie dafür erst auf den zweiten
Theorie des Vertrauens in Journalismus aus systemtheoretischer Sicht
13
Blick geeignet zu sein. Denn aufgrund der Tatsache, dass hierbei auf der abstrakten
System- und nicht der Akteursebene argumentiert wird, war dessen empirische Nicht-
Nachweisbarkeit bisher der wohl größte Kritikpunkt.
Dennoch hat eine systemtheoretische Herangehensweise an die Thematik durchaus
Berechtigung. Ausgehend von der funktionalen Ausdifferenzierung der Gesellschaft,
gilt es, die spezifischen Funktionen und Leistungen eines Systems
9
in dem Fall Jour-
nalismus in den Mittelpunkt der Betrachtungen zu rücken. Bevor speziell auf die
Theorie des Vertrauens in Journalismus eingegangen wird, welche das theoretische
Grundgerüst dieser Arbeit bildet, werden kurz die wesentlichen Begriffe eingeführt, die
zu dessen Verständnis notwendig sind.
Als Leistungssystem der Öffentlichkeit (vgl. Hug 1997; Görke 1999) stellt Journa-
lismus Abbilder der sozialen Realität bereit, die für sämtliche an einem System Beteilig-
ten gemeinsam wahrnehmbar sind. Der Journalismus wählt spezifische Ereignisse aus,
welche für die Ausbildung von Umwelterwartungen Relevanz besitzen (könnten) und
damit mehrsystemzugehörig sind (vgl. Weischenberg 1994: 42; Kohring/Hug 1997: 21).
Diese vermittelt er der Öffentlichkeit als Themen für die öffentliche Kommunikation
(vgl. Merten 1994: 427). Die Funktion journalistischer (und damit auch öffentlicher)
Kommunikation ist damit das Beobachten der wechselseitigen Abhängigkeits- bzw.
Interdependenzverhältnisse der Gesellschaft, denn jedes System erlangt mit seiner ihm
eigens spezifischen Funktion für die Gesellschaft mehr Autonomie. Im Gegenzug steigt
jedoch ebenso die Abhängigkeit der Systeme voneinander (vgl. Kohring/Hug 1997: 18
f.).
10
Journalisten sammeln und verarbeiten demzufolge Nachrichten, von denen sie an-
nehmen, damit öffentliches Interesse zu wecken (vgl. Dovifat 1976: 38). Da die Aus-
wahl von Ereignissen für die öffentliche Kommunikation keineswegs nach objektiven
Relevanzkriterien erfolgt, sondern aus subjektiven Selektionsentscheidungen resultiert,
ist journalistische Gesellschaftsbeschreibung stets mit Risiken verbunden (vgl. Ronne-
9 Systeme sind zu verstehen als theoretische Konstrukte bzw. Beobachterinstrumente (vgl. Schmidt
1989: 28) bzw. Sinnzusammenhänge, welche sich durch Selektionsprozesse bilden und von der Um-
welt abgrenzen (vgl. Kiss 1990: 30). Ihre Funktion besteht darin, Komplexität als ,,Zahl der Mög-
lichkeiten, die durch Systembildung ermöglicht werden" (Luhmann 1989: 4) zu erfassen und gleich-
wohl zu reduzieren.
10 Dafür gibt es drei Gründe: 1. Nur so können sie eigene, auf die Selektivität anderer Systeme bezoge-
ne Erwartungen ausbilden. 2. Sie können so gegebenenfalls kontinuierlich modifiziert werden. 3. Ü-
berdies bewahren sie so ihre Handlungsfähigkeit. Der Begriff der Erwartung findet im Zusammen-
hang mit Vertrauen speziell bei Barber (1983) ausführlich Berücksichtigung.
Theorie des Vertrauens in Journalismus aus systemtheoretischer Sicht
14
berger 1977: 139, Kohring 2001: 82). Indem Journalismus also Themen für öffentliche
Kommunikation bereitstellt, wird aus Sicht der Öffentlichkeit Komplexität reduziert.
Gleichzeitig jedoch werden diese Selektionsleistungen von der Öffentlichkeit als kon-
tingent und damit riskant wahrgenommen.
11
Ein Lösungsansatz für derlei Risikoprobleme ist Vertrauen (vgl. Luhmann 1989: 16).
Vertrauen bezeichnet ,,die selektive Verknüpfung von Fremdhandlungen mit Eigen-
handlungen unter der Bedingung einer rational nicht legitimierbaren Tolerierung des
wahrgenommenen Risikos." (Kohring 2003: 111). Vertrauen stellt ,,eine bestimmte
Relation zwischen sozialen Akteuren und nicht eine Einschätzung von bestimmten
(erlernbaren) Eigenschaften des Vertrauensobjektes durch das Vertrauenssubjekt" dar
(Kohring 2003: 104). Es kann als Handlung (Vertrauenserklärung) oder als Einstellung
(Vertrauensbereitschaft) thematisiert werden (vgl. Kohring 2002a: 109). Sowohl die
Erklärung als auch die Bereitschaft zum Vertrauen werden unter dem Begriff der Ver-
trauenswürdigkeit
als Gründe für Vertrauensbereitschaft erfasst. Vertrauen wird somit
am ehesten über die Aufrechterhaltung von Vertrauenswürdigkeit motiviert (Hardin
2002: 30 f.).
Die Kennzeichen von Vertrauen konzentrieren sich auf folgende Punkte: Es basiert
auf unvollständigem Wissen und bedarf einer zeitlichen, sachlichen und sozialen Spezi-
fizierung. Je nach Bezugspunkt kann sich Vertrauen auf Personen, Institutionen oder
Gesellschaften richten (=sozial) und/oder auf einen unterschiedlichen Zeithorizont
beziehen.
Systemtheoretisch betrachtet bezieht sich Vertrauen nicht mehr wie beim objektivi-
tätsorientierten Forschungsansatz auf Objektivität bzw. Wahrheit, sondern auf die Se-
lektivität des Systems Journalismus. Es ist nunmehr als mehrdimensionales Konstrukt
zu verstehen, welches den Begriff der Glaubwürdigkeit mit dem Vertrauensbegriff
verknüpft (vgl. Matthes/Kohring 2003: 10). Mit der journalistischen Bereitstellung von
Themen für die öffentliche Kommunikation ist auch die Übernahme der Verantwortung
für deren Behandlung und Darstellung verbunden (vgl. Luhmann 1970). Welche Infor-
mationen selektiert werden, wie sie formal und inhaltlich aufbereitet werden, ist ge-
11 Der Begriff Kontingenz bezeichnet die grundsätzliche Ungewissheit, die aus beobachterabhängiger
Selektivität resultiert. Sie führt zur Herausbildung von Erwartungsstrukturen, um so die Anschlussfä-
higkeit noch zukünftiger Handlungen aufrecht zu erhalten. Da sowohl psychische als auch soziale
Systeme durch Kontingenz (aufgrund unzureichender Informationen) gekennzeichnet sind, verdop-
pelt sich Ungewissheit. Aus der Wahrnehmung dieser doppelten Kontingenz resultiert Vertrauen
(vgl. Kohring 2001: 55 f.).
Theorie des Vertrauens in Journalismus aus systemtheoretischer Sicht
15
meinhin das, was letztlich Medieninhalte kennzeichnet. Jeder Rezipient beurteilt nach
persönlichen Relevanzstrukturen (Erwartungen, Wissen, Erfahrungen etc.) anhand
dieser Kennzeichnung und Unterschiedlichkeit der Medienberichterstattung die Ver-
trauenswürdigkeit eines Mediums. Er selektiert Nachrichten, welche ausschließlich
durch die journalistische Selektion (der Mehrsystemzugehörigkeit eines Ereignisses)
kausal ermöglicht, d. h. veröffentlicht wurden und erlangt so Handlungsfähigkeit. Mit
der auf diese Handlung (Selektion) bezogenen Einstellung liegt eine Vertrauensrelation
mit Bezug auf Journalismus vor (vgl. Kohring 2002a: 109). Daraus wiederum resultie-
ren die so genannten Medienwirkungen. Die Abbildung 1 weist diese als ,,Vertrauen in
Journalismus" bezeichneten hierarchischen Faktor zweiter Ordnung aus (vgl. Kohring
2003: 172).
Abb. 1: Schematisches Messmodell ,,Vertrauen in Journalismus" nach Kohring (2003)
Quelle: Kohring 2003: 172
Das Kernelement dieses Ansatzes bilden bilden die so genannten Faktoren erster
Ordnung, d. h. die vier Vertrauensdimensionen Themenselektivität, Faktenselektivität,
Richtigkeit
und Bewertungen. Sie verweisen auf die spezifische Funktion des
Vertrauensobjekts, im Fall des Journalismus auf journalistische Selektivität.
Die Dimension Themenselektivität richtet ihr Hauptaugenmerk darauf, ob und in
welchem Umfang (zeitlich und formal) ein Ereignis dargestellt wird. Diese Selektion
bezieht sich folglich auf die journalistische Auswahl von Themen der Berichterstattung.
Vertrauen in
Journalismus
Vertrauen in
Themen-
selektivität
Vertrauen in
Fakten-
selektivität
Vertrauen in
Richtigkeit von
Beschreibungen
Vertrauen in
explizite Be-
wertungen
V
11
, V
12
, ... V
1X
V
21
, V
22
, ... V
2X
V
31
, V
32
, ... V
3X
V
41
, V
42
, ... V
4X
Theorie des Vertrauens in Journalismus aus systemtheoretischer Sicht
16
Insbesondere geht es bei deren Untersuchung um die Schwerpunkte der Berichterstat-
tung, welche Themen die Aufmerksamkeit des Rezipienten auf sich ziehen können und
entsprechende Relevanz für die öffentliche Kommunikation besitzen. Das bislang
kommunikationswissenschaftlich gebräuchliche Konzept, welches die Thematisierungs-
funktion des Journalismus beinhaltet, ist der Agenda Setting-Ansatz. Hiernach ist Ver-
trauen in Themenselektivität gleichermaßen Vertrauen in den Agenda Setting-Prozess
der Medien (vgl. Kohring 2002a: 106).
Das Vertrauen in die journalistische Faktenselektivität bezieht sich demgegenüber
auf speziellere Themenaspekte bzw. die Art und Weise der Kontextualisierung des
Themas. Hier leitet die Frage, ob ein Ereignis hohe Relevanz besitzt, zu der Frage über,
w i e
ein Ereignis dargestellt und beurteilt wird. Dies hilft dem Rezipienten, die einem
Ereignis zugeschriebene Bedeutung ,,für die Ausbildung oder Veränderung eigener
Umwelterwartungen einzuschätzen" (Kohring 2001: 86). Der bisher in der Kommunika-
tionswissenschaft verwendete Begriff des Framings
12
skizziert diesen Modus der Fak-
tenselektion gleichermaßen, weshalb auch von Vertrauen in Framing gesprochen wird
(ebd.). Es ist davon auszugehen, dass infolge der Themenselektion auch die dazugehöri-
gen Fakten und so genannte Hintergrundinformationen nach verschiedenen Kriterien
selektiert bzw. ,,gerahmt" werden. Um dies kurz anhand eines Beispiels zu erläutern,
wird das gewählte Untersuchungsthema der vorliegenden Arbeit Arbeitslosigkeit
herangezogen. Für eine Einschätzung der Faktenselektivität ist es hierbei also bei-
spielsweise ein wahrnehmbar großer Unterschied, ob ,,nur" die Präsentation des Hartz-
Berichts bzw. die Kompetenz des Hartz-Teams thematisiert wird oder der inhaltliche
Schwerpunkt eher auf die Realisierbarkeit der Vorschläge und damit verbundene Ver-
änderungen bzw. Anforderungen an Arbeitnehmer gelegt wird.
Die dritte Dimension bildet das Vertrauen in die Richtigkeit der Berichterstattung.
Dieses beinhaltet Kohring zufolge die Frage nach der nachprüfbaren Richtigkeit darge-
stellter und selektierter Fakten. Richtig zu selektieren, beurteilt demnach, inwieweit die
Beschreibungen und Bezeichnungen objektiv bestimmbar bzw. konsentierbar sind
(Matthes/Kohring 2003: 11). Durch Konsens zu einer Einschätzung der Richtigkeit
dessen zu gelangen, schließt mit ein, dass Richtigkeit eine variable Größe darstellt und
damit auch selektiv ist. Mit dieser Charakterisierung entspricht Vertrauen in Richtigkeit
12 Zur vertiefenden Auseinandersetzung mit dem Framing-Konzept sei an dieser Stelle auf Entman
(1993) und Scheufele (1999, 2003) verwiesen.
Theorie des Vertrauens in Journalismus aus systemtheoretischer Sicht
17
dem Konzept der Glaubwürdigkeit in der Medienglaubwürdigkeitsforschung, da beide
Begriffe das gleiche Bezugsobjekt haben die ,,richtigen" semantischen Bezeichnungen
getroffener Unterscheidungen (vgl. Kohring 2003: 150). Damit ist hier auch die Be-
zeichnung Vertrauen in Glaubwürdigkeit möglich. Glaubwürdigkeit ist als zugeschrie-
bene Eigenschaft einer Person oder eines Textes ein Teilkonzept von Vertrauen (vgl.
Bentele 1998: 305).
13
Der vierte Vertrauenstypus ist letztlich das Vertrauen in die journalistischen Bewertun-
gen
. Gängige und allgemein anerkannte Norm journalistischen Handwerks ist, dass
keine Bewertungen außerhalb von wertenden Darstellungsformen enthalten sein sollten
(Gebot der Trennung von Nachricht und Meinung). Allein durch den Fakt der Bedeut-
samkeit der Selektion für das Vertrauen erscheint diese Norm in einem neuen Licht.
Bereits die Selektion eines spezifischen Themas als auch die Selektion diesbezüglicher
Fakten und die damit einhergehende Selektion von bestimmten Beschreibungen
und/oder Einschätzungen stellen Prozesse der Bewertung dar. Der Rezipient erhält
durch solche expliziten Bewertungen in Kommentaren, z. B. in Form von Handlungs-
anweisungen bzw. bewertungen oder der Zuschreibung von Verantwortlichkeit, Hin-
weise darauf, wie er das selektierte Thema, die Fakten und die dafür wiederum selek-
tierten Bezeichnungen von Unterscheidungen einordnen und gegebenenfalls gewichten
muss (vgl. Kohring 2002b: 97).
Die zentralen Kennzeichen dieses vierfaktoriellen Vertrauensmodells sind folgende: Die
Dimensionen bedingen und beeinflussen sich gegenseitig, d. h. sie sind interdependent
(vgl. Kohring 2001: 87). Mit Ausnahme der Dimension Bewertungen ergibt sich für die
Relevanz der ersten drei Dimensionen eine hierarchische Ordnung. Die Dimension
Bewertungen
beschränkt sich dagegen nur auf eine konkrete journalistische Darstel-
lungsform, weswegen die Frage nach der hierarchischen Verortung hierfür obsolet wird.
Sind einem Rezipienten beispielsweise die Themen eines konkreten Mediums zum
Thema Arbeitslosigkeit vertraut bzw. besteht diesbezüglich bei ihm in dieser Dimension
(Themenselektivität) eine hohe Vertrauensbereitschaft, kann davon ausgegangen wer-
den, dass damit ebenfalls dessen Einschätzung der Faktenselektivität und der Richtigkeit
13 Bentele (1998) weist Glaubwürdigkeit als intrarelationale Dimension (Imagedimension, z. B. bezüg-
lich einer Tageszeitung), und Vertrauen als interrelationale Dimension von öffentlicher Kommunika-
tion aus (Beziehungsdimension, z. B. zwischen Lesern und einer mehr oder weniger regelmäßig ge-
nutzten Tageszeitung) (S. 305).
Theorie des Vertrauens in Journalismus aus systemtheoretischer Sicht
18
der Beschreibungen positiv ausfällt. Weiterhin sind diese Vertrauensdimensionen an
zeitgleiches Auftreten geknüpft.
1.3
Zielsetzung der Arbeit
Die Einschätzung der Vertrauensforschung und der markanten Merkmale öffentlicher
Kommunikation hat verdeutlicht, dass der beabsichtigte Zugewinn der vorliegenden
Arbeit für das Thema und die Kommunikationswissenschaft im Allgemeinen in erster
Linie empirischer Natur ist. Die Thematik Vertrauen in öffentliche Kommunikation soll
auf diesem Weg methodisch neu abgesteckt und das daraus Resultierende kritisch be-
leuchtet und eingeordnet werden. Zentral ist hierfür sowohl die Auseinandersetzung mit
der Inhaltsanalyse und deren Restriktionen als auch mit der Frage der Implementierbar-
keit dieser Methode für die Vertrauensthematik. Daraus ergibt sich die folgende, zentra-
le Forschungsfrage dieser Arbeit:
Ist die Operationalisierung von Vertrauen in öffentliche Kommunikation in-
haltsanalytisch möglich und unter methodologischen Gesichtspunkten anderen
empirischen Forschungsmethoden vorzuziehen?
Da die vorliegende Arbeit der empirischen Überprüfung eines bestehenden, theoreti-
schen Konstrukts dient und obendrein explorativen Charakter besitzt, erscheint der
Rückgriff auf ausschließlich eine Forschungsfrage als durchaus gerechtfertigt.
Der Schwerpunkt dieser Arbeit liegt auf der Operationalisierung der Indikatoren für die
vier Vertrauensdimensionen (vgl. Kap. 1.3). Im Hinblick auf die Ergebnisse wird hier
die Erörterung wesentlicher methodologischer Aspekte der Vertrauensthematik relevant.
Nachfolgende Fragen spielen dafür eine wichtige Rolle: Welche Vertrauensindikatoren
lassen sich für die einzelnen Dimensionen operationalisieren? Können die methodologi-
schen Anforderungen an ein inhaltsanalytisches Kategoriensystem bei Vertrauen konse-
quent eingehalten werden? Worin zeigen sich Grenzen der Operationalisierbarkeit einer
subjektiven Zuschreibungsleistung anhand als objektiv klassifizierter Textinhalte?
Welche Schwierigkeit birgt der zu operationalisierende, systemtheoretische Ansatz von
Vertrauen für die Inhaltsanalyse?
Zielsetzung der Arbeit
19
Die Relevanz dieser Untersuchung wird nicht nur im Hinblick auf den bisherigen
allgemeinen Mangel der Auseinandersetzung mit Vertrauen in der Kommunikations-
wissenschaft deutlich. Sie zeigt sich auch in der Hervorhebung der Vorteile einer In-
haltsanalyse gegenüber Befragung, Beobachtung und Experiment. Die eigentliche Her-
ausforderung besteht darin, dass einzig auf eine bestehende Befragung zurückgegriffen
werden kann, die diesen theoretischen Ansatz bereits operationalisiert und dessen Kon-
struktvalidität geprüft hat. Demzufolge sind die zu findenden Vertrauensindikatoren
hieraus induktiv herzuleiten, da bis auf Nawratils Untersuchung (1997) bislang keine
inhaltsanalytischen Studien zum Vertrauen resp. Glaubwürdigkeit zur Verfügung ste-
hen. Zum anderen geht es darum, zu zeigen, inwiefern eine Zuschreibungsleistung
(Wirkung) sich tatsächlich inhaltsanalytisch nachweisen lässt. Folgt man den methodo-
logischen Grundlagen einer Inhaltsanalyse, dürften Inferenzen auf Wirkungen als Be-
standteil nichtmanifesten Kontextes ohne Weiteres möglich und damit auch latenten
Konstrukten zugänglich sein (vgl. Kap. 2.1).
Unter Berücksichtigung des Aspektes des methodischen Arbeitsaufwands ist die In-
haltsanalyse im Vergleich zu den anderen empirischen Forschungsmethoden als min-
destens ebenso effizient einzuschätzen. Sollte sich dieses Verfahren bei der Untersu-
chung von Vertrauen als überhaupt durchführbar und obendrein methodisch reliabel und
valide erweisen, wäre es beispielsweise möglich, sich die Vorteile der Inhaltsanalyse
(Replizierbarkeit, Unabhängigkeit von Erscheinungszeitpunkten und orten) zu Nutze
zu machen und so u. a. historisch zurückliegende Dokumente hinsichtlich ihrer Wirkung
und Vertrauenseinschätzung auszuwerten und zu vergleichen.
20
1.4
Zwischenfazit
Das erste Kapitel dieser Arbeit diente der Darstellung begrifflicher Grundlagen und
Zusammenhänge. Um die wissenschaftliche Bearbeitung der Vertrauensthematik nach-
vollziehen zu können, wurde der bisherige Forschungsstand skizziert und methodische
Kritikpunkte aufgezeigt.
Vertrauen konnte hierbei als zentraler Bestandteil sozialen Handelns herausgestellt
werden. Im Prozess öffentlicher Kommunikation ermöglicht das Vertrauen eine Viel-
zahl von Handlungsoptionen. Es kommt durch die Herausbildung spezifischer Erwar-
tungshaltungen bezüglich der zu erfüllenden Funktionen des Journalismus zustande. Die
Nicht-Erfüllung dieser Erwartungen bezüglich der Berichterstattung über Themen von
öffentlichem Interesse wirkt sich i. d. R. auch auf das Vertrauen in den Gegenstand der
Berichterstattung aus.
Es ist deutlich geworden, dass sich Vertrauen in öffentliche Kommunikation als äußerst
komplexes und mit Risiken verbundenes Konstrukt erweist. Wie die Ausführungen zum
Stand der Vertrauensforschung zeigten, wurde oftmals nicht eindeutig zwischen journa-
listischem Vertrauensobjekt und inhalt unterschieden, was Kritik an der methodischen
Operationalisierung herbeiführte.
Das theoretische Fundament dieser Arbeit bildet eine systemtheoretisch begründete
Theorie des Vertrauens in Journalismus, welche sich primär auf soziologische Ansätze
stützt und mit einer Theorie des Journalismus verknüpft wurde. Die systemtheoretische
Herangehensweise lässt nicht nur komplexere Betrachtungen und Erklärungsversuche
von Konstrukten wie Vertrauen zu. Sie trägt auch entscheidend zur Annäherung an das
Verständnis von öffentlicher Kommunikation bei. Vertrauen als Erwartung an journalis-
tische Berichterstattung richtet sich dabei auf spezifische Selektionsleistungen. Für die
Einschätzung der Vertrauenswürdigkeit der formalen und inhaltlichen Darstellung wird
Vertrauen in Journalismus in vier Faktoren unterschieden: die Auswahl von Themen
(Themenselektivität), die Auswahl relevanter Informationen zu selektierten Themen
(Faktenselektivität), die Richtigkeit von Beschreibungen (Glaubwürdigkeit) und explizi-
te Bewertungen.
21
2
Methodologische Aspekte der Inhaltsanalyse
Der Skizzierung der systemtheoretisch fokussierten Theorie zum Journalismus-
Vertrauen folgt nun die genauere Auseinandersetzung mit der Frage nach dessen empi-
rischen Messbarkeit. Diese Arbeit konzentriert sich konkret auf die Inhaltsanalyse.
Deshalb werden zuerst das Ziel, die Funktionen und Merkmale dieser Methode vorge-
stellt (Kap. 2.1). Die Eignung einer Methode für bestimmte Untersuchungsgegenstände
wird jedoch weniger anhand dieser Aspekte beurteilt, sondern primär anhand von Güte-
kriterien einer Messung (Kap. 2.1.1). Unmittelbar im Zusammenhang damit resultieren
meist aus der Methode selbst Restriktionen, welche als hinreichende Erklärungen für
Einschränkungen der Güte geltend gemacht werden können (Kap. 2.1.2). Dessen Impli-
kationen für den Untersuchungsgegenstand Vertrauen werden im Anschluss daran
erläutert, in dem eine explizite Übertragung auf die hier beabsichtigte, empirische Um-
setzung erfolgt (Kap. 2.2).
2.1
Kennzeichen der Methode
Die Gesamtheit menschlicher Kommunikationsprozesse gilt als wesentlicher Gegens-
tandsbereich der Sozialwissenschaften insgesamt und ist im Speziellen der Untersu-
chungsgegenstand einer konkreten, sozialwissenschaftlichen Methode: der Inhaltsanaly-
se. Ihr Ausgangspunkt ist die Tatsache, ,,...dass der Mensch ein bedeutungs- bzw.
sinngenerierender Organismus ist..." (Groeben/Rustemeyer 1995: 523). Er besitzt also
die Fähigkeit, Zeichen zu produzieren und mit deren Hilfe Kommunikation zu verste-
hen. Diese Fähigkeiten beziehen sich nicht ausschließlich auf sprachlichen Textinhalt,
sondern ebenso auf Filme, Bilder oder Musik.
Dass die Inhaltsanalyse als Methode bezeichnet wird, schließt mit ein, dass deren
Vorgehensweise sich an bestimmten Wissenschaftsstandards messen lässt. Das sind
zum einen Objektivität bzw. intersubjektive Nachvollziehbarkeit und zum anderen
systematisches, d. h. theoriegeleitetes Vorgehen (vgl. Früh 2001: 37). Beides zielt dar-
auf ab, den Erkenntnisprozess möglichst transparent zu machen. Dies kann nur erreicht
werden, sofern das Untersuchungsobjekt von verschiedenen Personen wahrnehmbar und
Kennzeichen der Methode
22
reproduzierbar ist und bezüglich der Erkenntnisstrategien im Verlauf der Untersuchung
bewusst keine Variationen vorgenommen werden (ebd.: 120).
Eine weitere Anforderung an inhaltsanalytisches Vorgehen ist das Vermeiden so ge-
nannten ,,Zwischen-den-Zeilen-Lesens" (vgl. Atteslander 2000: 210; Bonfadelli 2002:
81). Bereits Berelson (1952) griff diesen Aspekt in seiner Definition auf, indem er sagt,
Inhaltsanalyse sei ,,a research technique for the objective, systematic, and quantitative
description of the manifest content of communication" (Berelson 1952: 18). Die Krite-
rien Objektivität und Systematik bemessen sich hierbei vordergründig am Einsatz des
untersuchungsspezifisch zu entwickelnden Kategoriensystems, welches der Reduzie-
rung komplexer Kommunikationszusammenhänge auf Wesentliches dient und das
Kernelement einer Inhaltsanalyse bildet (vgl. Titscher et al. 1998: 78; Smith 2000: 320).
Kritische Einwände an der Definition Berelsons beziehen sich vordergründig auf die
Ausgrenzung des latenten Inhalts, da die Fähigkeiten des Codierers zur konsequenten
Trennung beider Ebenen im Analyseprozess begrenzt sind (vgl. Kap. 2.1.2). Um eben
jenen Interpretationsspielraum zwischen latenter und manifester Dimension eines Tex-
tes möglichst gering zu halten, werden dem Codiervorgang eindeutige Regeln zugrunde
gelegt, welche die empirische Verlässlichkeit gewährleisten sollen (vgl. Früh 2001:
106).
Auch Merten (1995: 59) greift den Aspekt manifester Inhalte in seiner Definition auf
und klassifiziert die Inhaltsanalyse als ,,Methode zur Erhebung sozialer Wirklichkeit,
bei der von Merkmalen eines manifesten Textes auf Merkmale eines nichtmanifesten
Kontextes geschlossen wird." Das Grundprinzip inhaltsanalytischen Vorgehens ist
demzufolge, Aussagen über die Beziehung zwischen Sender, Stimulus und Rezipient
aus dem Inhalt zu treffen. Als Relikt von Kommunikationsprozessen ist der Inhalt von
Texten folglich strukturierten Analysen zugänglich, die der Lasswell-Formel
14
entspre-
chen (vgl. Titscher et al. 1998: 76).
Als Grundlage der vorliegenden Arbeit dient die Definition Frühs (2001). Inhaltsana-
lyse ist demzufolge ,,eine empirische Methode zur systematischen, intersubjektiv nach-
vollziehbaren Beschreibung inhaltlicher und formaler Merkmale von Mitteilungen;
(häufig mit dem Ziel einer darauf gestützten interpretativen Inferenz)." (Früh 2001: 25)
Diese Definition wird hierfür favorisiert, weil sie einerseits Wert auf die Verknüpfung
inhaltlicher und formaler Merkmale legt und andererseits ausdrücklich auf die Interpre-
14 ,,Who says what in which channel to whom with what effect?" (Lasswell 1948: 37)
Kennzeichen der Methode
23
tierbarkeit und mögliche subjektive Abweichungen hinweist. Insbesondere Inferenzen
auf den Rezipienten bzw. die Wirkung bei ihm können zwar Zweck, aber keineswegs
Bestandteil einer Inhaltsanalyse sein. Dafür wäre es notwendig, Rezeptions- bzw. Pro-
duktionstheorien zu integrieren (vgl. Früh 2001: 185 f.).
Das Ziel der Inhaltsanalyse ist die Entwicklung eines gegenstandsgerechten Instru-
ments zur Beantwortung einer vorher festgelegten Fragestellung und die ,,...Reduktion
der Komplexität und Vielfalt der Menge der vorliegenden Information..." (Dahin-
den/Hättenschwiler 2001: 510; Bonfadelli 2002: 79 f.). Daraus lassen sich gleicherma-
ßen die Funktionen der Inhaltsanalyse ableiten. Neben formaler Informationsbeschrei-
bung und -raffung wird der Methode auch eine generierende und prognostizierende
Funktion zugewiesen. Informationen zu generieren, schließt wiederum an die Möglich-
keit von Rückschlüssen von Indikatoren manifesten Inhalts auf den Kontext oder Rezi-
pienten an. Die Prognosefunktion wird z. B. bei Längsschnittuntersuchungen durch
Trendaussagen ersichtlich (Merten 1995: 351).
15
Der klare Vorteil der Methode gegenüber Experimenten oder Befragungen ist dessen
Nicht-Reaktivität, d. h. die Nicht-Beeinflussung des Untersuchungsgegenstands. Damit
bedarf das zu untersuchende Material keiner Vorstrukturierung und kann jederzeit,
allerorts und beliebig oft analysiert werden. Im Zusammenhang damit steht zugleich das
Ziel der intersubjektiven Übereinstimmung, weshalb nach explizierten Regeln vorge-
gangen und dieser Prozess exakt dokumentiert wird.
Computergestützt durchgeführte Inhaltsanalysen (CUI) können zwar diesen Erhe-
bungs- und Auswertungsaufwand erheblich verringern (vgl. Galliker/Pousaz 2000). Das
Finden geeigneter Kategorien ist aber hier ebenso ausschließlich manuell möglich und
unterliegt damit subjektiven Einschätzungen. Rückschlüsse auf den Kontext können
somit auch hier nur begrenzt gezogen werden (vgl. Laatz 1993: 24).
Da das Raster stets selektiv im Hinblick auf die konkrete Fragestellung ist, müssen
bei der Erstellung des Kategoriensystems formale Kriterien berücksichtigt werden (vgl.
Holsti 1969). Diese Kriterien lauten Eindeutigkeit, Trennschärfe, Vollständigkeit, Un-
abhängigkeit, Eindimensionalität und theoretische Ableitung (vgl. Atteslander 2000:
211, Smith 2000: 321).
15 Früh (2001) thematisiert als theoretische Funktionen der Inhaltsanalyse ausschließlich das Selekti-
ons- (Komplexitätsreduktion) und Abstraktionsinteresse (Inferenzen) des Forschers. Das reine Be-
schreiben bzw. Klassifizieren hat hingegen bei Früh geringe Bedeutung (ebd.: 52 f.).
Kennzeichen der Methode
24
Eindeutige und trennscharfe Kategorieninhalte erfordern klar definierte Ausprägun-
gen jeder Kategorie. So geht bei der Datenerhebung keinerlei Informationsgehalt verlo-
ren. Damit einher geht die Forderung nach Unabhängigkeit. Wäre das Vorhandensein
einer Kategorie an das Vorhandensein einer weiteren geknüpft, würde das auf Verzer-
rungen bei der Auswertung verweisen.
Die Forderungen nach Vollständigkeit und theoretischer Ableitung dienen der Absi-
cherung der vollständigen Erfassung der Forschungsfrage und der Hypothesen (vgl.
Früh 2001: 84). Beide Prinzipien beziehen sich darauf, dass auf der Begriffsebene und
der Ebene des Datenmaterials das zu untersuchende Kommunikationsmerkmal in allen
interessierenden Bedeutungsdimensionen zu erfassen ist. Sie sind selektiv und nur in
Abhängigkeit von der Fragestellung erfüllbar (vgl. Atteslander 2000: 212).
Da die Kategorien das Kernstück der Inhaltsanalyse bilden, sollten die an die gestell-
ten Anforderungen im Hinblick auf die Güte der Ergebnisse keinesfalls verletzt werden.
Über diese Kriterien hinausgehend sind die verwendeten Kategorien jedoch u. a. auch
stets hinsichtlich ihres Abstraktionsgrades und dem beabsichtigten Inferenzniveau zu
beurteilen (vgl. Smith 2000: 321).
Für die Kommunikationswissenschaft besitzt die Inhaltsanalyse den größten Stellen-
wert unter den sozialwissenschaftlichen Erhebungsmethoden. Die Auseinandersetzung
damit, welche Inhalte mit welcher Referenz zur Realität durch Zeitungsartikel oder
Fernsehbeiträge vermittelt werden, ist sowohl der Wissenschaft wie auch der Öffent-
lichkeit dienlich. Sie soll darüber Aufschluss geben, ob Inhalte erstens eine Wirkung
erzielen können und wenn ja, welche und zweitens zur Beschreibung und Erklärung der
Medienrealität beitragen (vgl. McQuail 2001: 305; Bonfadelli 2002: 12 ff.).
2.1.1 Gütekriterien
Die Güte jeder sozialwissenschaftlichen Methode bemisst sich in erster Linie an dessen
Objektivität, Reliabilität und Validität. Sowohl Reliabilität als auch Validität können
durch konkrete Korrelationskoeffizienten beschrieben werden, die jedoch immer nur für
eine konkrete Bezugsmenge, hingegen nicht für das Messinstrument selbst Geltung
besitzen (vgl. Koolwijk 1976: 72). Aufgrund ihrer zentralen Bedeutung für die Messung
Kennzeichen der Methode
25
latenter Konstrukte wird an dieser Stelle beispielhaft für alle Kriterien ausschließlich die
Gültigkeit (Validität) näher erläutert.
Die Forderung nach Validität geht davon aus, dass der Sozialwissenschaftler
bestimmen kann, in welchem Ausmaß empirische Indikatoren ein gegebenes theoreti-
sches Konzept exakt widerspiegeln. Validität ist demnach das Maß für die Gültigkeit
einer Messung. Scheuch definiert es als ,,Eigenschaft eines Ergebnisses, auch das wie-
derzugeben, was man bei der Interpretation von ihm glaubt, dass es dies wiedergibt."
(Scheuch 1973: 134). Um das Bezugsobjekt der Validität eindeutig zu kennzeichnen,
erscheint diese Definition zu vage, denn Glaube allein ist zu wenig, um wissenschaftli-
che Erklärungen zutage zu fördern.
Nach Kriz (1981: 47) hingegen besteht mit Gültigkeit
,,... die Forderung, dass die gewählten Operationalisierungen den begriffli-
chen Merkmalsbereich hinreichend erschöpfend erfassen, dass die Ergebnisse
mit dem theoretischen Bezugsrahmen grundsätzlich in Einklang zu bringen
sind, und dass sie als Prognosekriterium für die von der Theorie vorhergesag-
ten (und empirisch feststellbaren) Phänomene dienen können."
Die hier genannten Anforderungen spiegeln deutlich wieder, dass die oberste Priorität
einer Messung generell auf einer hinreichenden Operationalisierung der untersuchungsre-
levanten Merkmale, der Übereinstimmung mit dem theoretischen Bezugsrahmen und
einer grundsätzlichen Einschätzung der Gültigkeitsbedingungen für die Messung liegen
sollte.
Je nach Bezugsobjekt können verschiedene Validitätsarten überprüft werden. Sie
beziehen sich dabei z. B. auf ein bestimmtes Kriterium, den Untersuchungsinhalt oder
das zu überprüfende Konstrukt (vgl. Bortz/Döring 1995: 185).
Bei der Kriteriumsvalidität ist das zu messende Konstrukt anhand externer Kriterien
überprüfbar. Sie erlaubt Inferenzen sowohl von theoretischer Ebene ausgehend als auch
der Operationalisierungsebene (vgl. Brewer 2000: 6). Für das Beispiel der Religiösität
wäre u. a. ein mögliches Außenkriterium die Anzahl und Regelmäßigkeit der Kirchgän-
ge. Selten, insbesondere bei latenten Untersuchungsgegenständen wie Vertrauen oder
Intelligenz, ist das Kriterium jedoch bestimmbar oder kann nicht ohne eine weitere
Messung festgelegt werden. Damit besteht das Risiko, möglicherweise eine Validierung
mit nicht validen Kriterien vorzunehmen (vgl. Gehring/Weins: 60 f.).
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Originalausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2004
- ISBN (eBook)
- 9783832440503
- ISBN (Paperback)
- 9783838640501
- Dateigröße
- 1.1 MB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- Friedrich-Schiller-Universität Jena – Sozial- und Verhaltenswissenschaften
- Note
- 1,0
- Schlagworte
- journalismus medienwirkungsforschung inhaltsanalyse
- Produktsicherheit
- Diplom.de