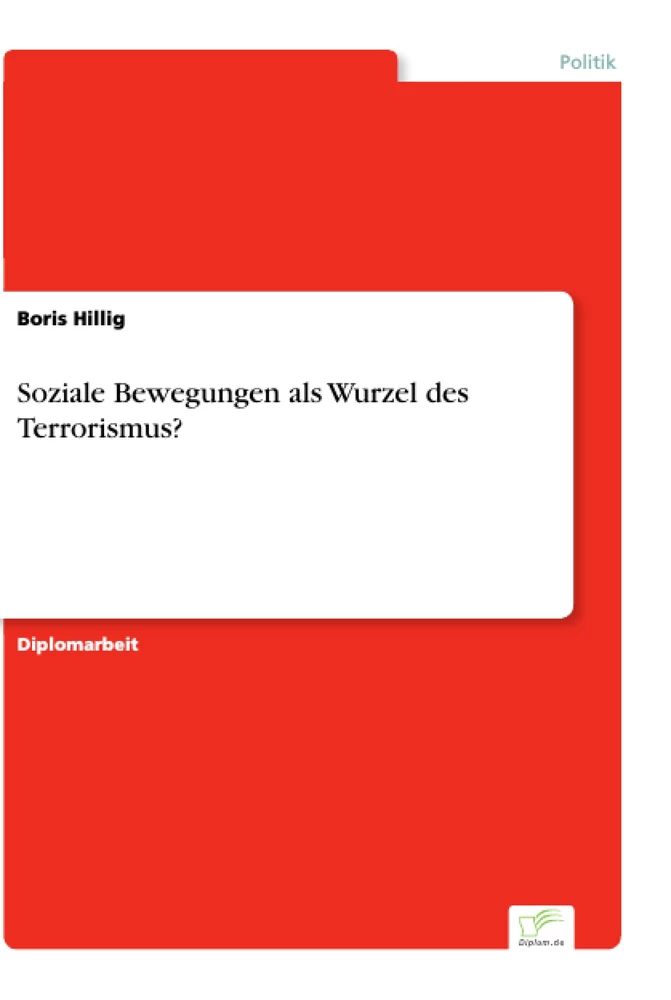Soziale Bewegungen als Wurzel des Terrorismus?
©2003
Diplomarbeit
122 Seiten
Zusammenfassung
Inhaltsangabe:Einleitung:
Soziale Bewegungen sind in den Gesellschaften, in denen sie aufkommen, störende Ereignisse. Was sie wollen, überschreitet das Selbstverständliche und läßt sich dem Common sense schlecht erklären. Hinzu kommt das Unheimliche ihrer Form. Sie besitzen keine feste Gestalt. Soziale Bewegungen schwellen oft ganz unvermittelt an, explodieren auch manchmal, sind dann wieder lange still, zerrinnen gleichsam. Und ob sie danach wiederkommen oder aber schon zu Ende sind, das läßt sich nur unzuverlässig ausrechnen.
Auch wenn der Grundstein der sozialen Bewegung wohl schon in der Französischen Revolution gelegt wurde (´mouvement social´), so hat sich die Soziologie der sozialen Bewegung die Bewegungsforschung erst innerhalb der letzten gut zwanzig Jahre als eigenständiger Forschungsbereich entwickelt und etabliert. Doch hat Lorenz von Stein bereits 1921 angemerkt, ( ) daß für den wichtigsten Teil Europas die politische Reform und Revolution zu Ende ist; die soziale ist an ihre Stelle getreten, und überragt alle Bewegungen der Völker mit ihrer furchtbaren Gewalt und ihren ernsten Zweifeln. Auch wenn ich die Meinung von Lorenz von Stein bezüglich der Bedeutungslosigkeit politischer Reformen nicht teile, so weist dieses Zitat doch auf die potenzielle Kraft und Bedeutung einer sozialen Bewegung hin, welche ihr spätestens zu Beginn des zwanzigsten Jahrhunderts zugewiesen wurde.
Die Fragen, die sich zunächst einmal stellen, sind die Folgenden: Was genau ist eine soziale Bewegung? Die so genannten 68er-Bewegungen? Faschistische Bewegungen? Gibt es demnach linke und rechte soziale Bewegungen? Wo ist der Unterschied zwischen Protesten, Aufständen, Warnstreiks, Demonstrationen, Mobs, Revolutionen, Volksunruhen und sozialen Bewegungen?
Waren oder sind die weltweiten Friedensdemonstrationen dieses Jahres gegen den Irak-Krieg eine soziale Bewegung? Welches sind die Entstehungsgründe? Wer ist der Initiator bzw. die Initiatoren? Wer nimmt an einer sozialen Bewegung teil und warum (oder warum nicht)? Wie erfolgen die Rekrutierung und die Mobilisierung der Mitglieder einer sozialen Bewegung? Folgt die gesamte Bewegung einem einheitlichen und nur einem Kollektivgedanken?
Wovon hängt der Erfolg der sozialen Bewegung ab? Ist es so, wie Saint-Simons behauptet, nämlich dass die soziale Bewegung vom Kampf zwischen der produktiven und der nicht-produktiven Klasse in Gang gehalten wird? Welchen Einfluss haben die Gesellschaft, die Politik auf […]
Soziale Bewegungen sind in den Gesellschaften, in denen sie aufkommen, störende Ereignisse. Was sie wollen, überschreitet das Selbstverständliche und läßt sich dem Common sense schlecht erklären. Hinzu kommt das Unheimliche ihrer Form. Sie besitzen keine feste Gestalt. Soziale Bewegungen schwellen oft ganz unvermittelt an, explodieren auch manchmal, sind dann wieder lange still, zerrinnen gleichsam. Und ob sie danach wiederkommen oder aber schon zu Ende sind, das läßt sich nur unzuverlässig ausrechnen.
Auch wenn der Grundstein der sozialen Bewegung wohl schon in der Französischen Revolution gelegt wurde (´mouvement social´), so hat sich die Soziologie der sozialen Bewegung die Bewegungsforschung erst innerhalb der letzten gut zwanzig Jahre als eigenständiger Forschungsbereich entwickelt und etabliert. Doch hat Lorenz von Stein bereits 1921 angemerkt, ( ) daß für den wichtigsten Teil Europas die politische Reform und Revolution zu Ende ist; die soziale ist an ihre Stelle getreten, und überragt alle Bewegungen der Völker mit ihrer furchtbaren Gewalt und ihren ernsten Zweifeln. Auch wenn ich die Meinung von Lorenz von Stein bezüglich der Bedeutungslosigkeit politischer Reformen nicht teile, so weist dieses Zitat doch auf die potenzielle Kraft und Bedeutung einer sozialen Bewegung hin, welche ihr spätestens zu Beginn des zwanzigsten Jahrhunderts zugewiesen wurde.
Die Fragen, die sich zunächst einmal stellen, sind die Folgenden: Was genau ist eine soziale Bewegung? Die so genannten 68er-Bewegungen? Faschistische Bewegungen? Gibt es demnach linke und rechte soziale Bewegungen? Wo ist der Unterschied zwischen Protesten, Aufständen, Warnstreiks, Demonstrationen, Mobs, Revolutionen, Volksunruhen und sozialen Bewegungen?
Waren oder sind die weltweiten Friedensdemonstrationen dieses Jahres gegen den Irak-Krieg eine soziale Bewegung? Welches sind die Entstehungsgründe? Wer ist der Initiator bzw. die Initiatoren? Wer nimmt an einer sozialen Bewegung teil und warum (oder warum nicht)? Wie erfolgen die Rekrutierung und die Mobilisierung der Mitglieder einer sozialen Bewegung? Folgt die gesamte Bewegung einem einheitlichen und nur einem Kollektivgedanken?
Wovon hängt der Erfolg der sozialen Bewegung ab? Ist es so, wie Saint-Simons behauptet, nämlich dass die soziale Bewegung vom Kampf zwischen der produktiven und der nicht-produktiven Klasse in Gang gehalten wird? Welchen Einfluss haben die Gesellschaft, die Politik auf […]
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
ID 4042
Hillig, Boris: Soziale Bewegungen als Wurzel des Terrorismus?
Hamburg: Diplomica GmbH, 2005
Zugl.: Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main, Diplomarbeit, 2003
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte,
insbesondere die der Übersetzung, des Nachdrucks, des Vortrags, der Entnahme von
Abbildungen und Tabellen, der Funksendung, der Mikroverfilmung oder der
Vervielfältigung auf anderen Wegen und der Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen,
bleiben, auch bei nur auszugsweiser Verwertung, vorbehalten. Eine Vervielfältigung
dieses Werkes oder von Teilen dieses Werkes ist auch im Einzelfall nur in den Grenzen
der gesetzlichen Bestimmungen des Urheberrechtsgesetzes der Bundesrepublik
Deutschland in der jeweils geltenden Fassung zulässig. Sie ist grundsätzlich
vergütungspflichtig. Zuwiderhandlungen unterliegen den Strafbestimmungen des
Urheberrechtes.
Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in
diesem Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme,
dass solche Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei
zu betrachten wären und daher von jedermann benutzt werden dürften.
Die Informationen in diesem Werk wurden mit Sorgfalt erarbeitet. Dennoch können
Fehler nicht vollständig ausgeschlossen werden, und die Diplomarbeiten Agentur, die
Autoren oder Übersetzer übernehmen keine juristische Verantwortung oder irgendeine
Haftung für evtl. verbliebene fehlerhafte Angaben und deren Folgen.
Diplomica GmbH
http://www.diplom.de, Hamburg 2005
Printed in Germany
- II -
,,Der Terrorismus, für die meisten ein Übermaß von
wahnsinnigem Blutdurst, war eine durchaus natürliche
Entwicklung auf der einmal betretenen Bahn, wie die
Krisis in der Krankheit, so furchtbar sie auch sein mag.
Seine Erklärung aber liegt in dem Vorhergehenden."
Lorenz von Stein (1959), S. 292.
- III -
Inhaltsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis...V
Tabellenverzeichnis...VI
Abkürzungsverzeichnis...VII
1 Einleitung ...1
1.1 Problemstellung...1
1.2 Aufbau der Arbeit...3
2 Terminologische Begriffe und wichtige Staatsaufgaben ...4
2.1
Kollektiv und kollektives Handeln...4
2.2 Zum Begriff
Konflikt ...4
2.3 Das Verhältnis von
Recht, Macht, Gewalt und Herrschaft...6
2.4 Die Schutzaufgaben des Staates ...8
3 Zum Begriff des Terrorismus...11
3.1 Definition des Terminus
Terrorismus ...11
3.2 Abgrenzung des Terrorismus zu verwandten Erscheinungsformen ...12
3.2.1 Terrorismus, Krieg und Kriminalität...12
3.2.2 Terrorismus und Guerilla ...13
3.3 Formen von Terrorismus ...14
3.3.1 Repressiver Terrorismus ...14
3.3.2 Revoltierender Terrorismus...16
3.3.3 Internationaler Terrorismus...18
4 Die soziale Bewegung ...20
4.1 Definition des Terminus
soziale Bewegung ...20
4.2 Ursachen der sozialen Bewegung...25
4.2.1 Einführung...25
4.2.2 Strukturanalytischer Ansatz ...26
4.2.3 Sozialpsychologischer Ansatz...27
4.2.4 Interaktionistischer Ansatz...28
4.3 Ziele der sozialen Bewegung...28
4.4 Typologisierung der sozialen Bewegung...30
4.4.1 Formen von sozialen Bewegungen...30
4.4.2 Beispiele sozialer Bewegungen...32
4.4.2.1 Beispiel Hattinger ArbeiterInnenbewegung...32
4.4.2.2 Die deutsche StudentInnenbewegung und die APO ...34
4.5 Die Entwicklungsstadien einer sozialen Bewegung sowie ihre elementaren
Begleiterscheinungen ...36
4.5.1 Die soziale Bewegung und ihr gesellschaftlicher Kontext...36
4.5.2 Der Ursprung einer beginnenden Bewegung...38
- IV -
4.5.3 Die Rekrutierung neuer Mitglieder und die Mobilisierung der Bewegung...40
4.5.4 Entwicklungsstadien der sozialen Bewegung ...45
4.5.5 Soziale Bewegungen und die Rolle der Medien ...47
5 Zur Interaktion zwischen der Dynamik kollektiver Aktionen und dem Auftreten
terroristischer Vereinigungen ...49
5.1 Das Ende der Bewegung
oder Die Reaktion des Staates ...49
5.2 Die soziale Bewegung auf dem Weg zur terroristischen Vereinigung? ...54
5.2.1 Ausgangsbasis ...54
5.2.2 Institutionalisierung von Forderungen ...54
5.2.3 Verschiedene Erklärungsebenen für den Wandel gewaltloser Bewegungs-
teilnehmerInnen zum gewaltbereiten Militanten...56
5.2.3.1 Erklärungsansatz der makro-sozialen Ebene ...56
5.2.3.2 Erklärungsansatz der meso-sozialen Ebene ...58
5.2.3.2.1 Theoretische Grundlagen: Begrenzte Regelverletzung,
Provokation, Überreaktion und Beschleunigungsfaktoren.58
5.2.3.2.2 Empirie: Die Ereignisse des 2. Junis...63
5.2.3.2.3 Institutionalisierung des Terrorismus...65
5.2.3.3 Erklärungsansatz der mikro-sozialen Ebene ...68
5.2.3.3.1 Die Theorie des Karriere-Modells...68
5.2.3.3.2 Empirische Belege zur politischen Gewaltbereitschaft...72
5.2.3.3.3 Das Karriere-Modell in empirischer Anwendung auf
einzelne RAF-Gründungsmitglieder ...74
5.2.3.3.3.1 Ausgangsbasis...74
5.2.3.3.3.2 Ulrike Meinhof...75
5.2.3.3.3.3 Gudrun Ensslin und Andreas Baader ...82
5.2.4 Entstehungshintergründe diverser terroristischer Vereinigungen ...86
5.2.4.1 Deutschland:
Revolutionäre Zellen...86
5.2.4.2 Deutschland:
Otte-Gruppe ...87
5.2.4.3 Spanien: Die baskische
ETA ...88
5.2.4.4 Italien:
Rote Brigaden ...90
5.2.4.5 Korsika:
Front de libération nationale de la Corse...91
5.2.4.6 Russland:
Narodnaja Wolja...92
5.2.4.7 Islamismus eine soziale Bewegung?...93
5.2.4.8 Kaschmir:
Jammu und Kashmir Liberation Front...96
5.2.4.9 USA:
Terrorismus und Black-Power-Movement ...97
6 Zusammenfassung...101
7 Anhang ...103
Literaturverzeichnis...105
- V -
Abbildungsverzeichnis
Abbildung 1: Eine Explikation der Perspektive der Ressourcenmobilisierung ...41
Abbildung 2: Korrelation zwischen Ressourcenverfügbarkeit und Bewegungsgröße...45
Abbildung 3: Phasen der sozialen Bewegung ...46
- VI -
Tabellenverzeichnis
Tabelle 1: Der Terrorismus ...19
Tabelle 2: Anreiz für das individuelle Engagement an Ökologiebewegungen. ...39
- VII -
Abkürzungsverzeichnis
APO
Außerparlamentarische Opposition
BLA
Black Liberation Army
BPP
Black Panther Party
CSU
Christlich-Soziale Union
CDU
Christlich-Demokratische Union
DDR
Deutsche Demokratische Republik
ETA
Euzkadi Ta Azkatasuna Baskenland und Freiheit
FALN
Fuerzas Armada de Liberacion Nacional Puertorriquena
FLNC
Front de libération nationale de la Corse
JKLF
Jammu und Kashmir Liberation Front
NPD
Nationaldemokratische Partei Deutschlands
NSDAP/AO
Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei Ausländerorga-
nisation
PFLP
Volksfront für die Befreiung Palästinas
PKK
Arbeiterpartei Kurdistans
PLO
Palästinensische Befreiungsfront
PNV
Partido Nacionalista Vasco Baskische Nationalistische Partei
RAF
Rote Armee Fraktion
RM
Ressource Mobilisation
RZ
Revolutionäre Zellen
SDS
Sozialistische Deutsche Studentenbund
SPD
Sozialdemokratische Partei Deutschlands
WUO
Weather Underground Organization
- 1 -
1 Einleitung
1.1 Problemstellung
,,Soziale Bewegungen sind in den Gesellschaften, in denen sie aufkommen, störende
Ereignisse. Was sie wollen, überschreitet das Selbstverständliche und läßt sich dem
Common sense schlecht erklären. Hinzu kommt das Unheimliche ihrer Form. Sie besit-
zen keine feste Gestalt. Soziale Bewegungen schwellen oft ganz unvermittelt an, explo-
dieren auch manchmal, sind dann wieder lange still, zerrinnen gleichsam. Und ob sie
danach wiederkommen oder aber schon zu Ende sind, das läßt sich nur unzuverlässig
ausrechnen."
1
Auch wenn der Grundstein der sozialen Bewegung wohl schon in der Französischen
Revolution gelegt wurde
(´mouvement social´), so hat sich die Soziologie der sozialen
Bewegung die Bewegungsforschung erst innerhalb der letzten gut zwanzig Jahre als
eigenständiger Forschungsbereich entwickelt und etabliert.
2
Doch hat Lorenz von Stein
bereits 1921 angemerkt, ,,(...) daß für den wichtigsten Teil Europas die politische Re-
form und Revolution zu Ende ist; die soziale ist an ihre Stelle getreten, und überragt alle
Bewegungen der Völker mit ihrer furchtbaren Gewalt und ihren ernsten Zweifeln."
3
Auch wenn ich die Meinung von Lorenz von Stein bezüglich der Bedeutungslosigkeit
politischer Reformen nicht teile, so weist dieses Zitat doch auf die potenzielle Kraft und
Bedeutung einer sozialen Bewegung hin, welche ihr spätestens zu Beginn des zwanzigs-
ten Jahrhunderts zugewiesen wurde.
Die Fragen, die sich zunächst einmal stellen, sind die Folgenden: Was genau ist eine
soziale Bewegung? Die so genannten 68er-Bewegungen? Faschistische Bewegungen?
Gibt es demnach linke und rechte soziale Bewegungen? Wo ist der Unterschied zwi-
schen Protesten, Aufständen, Warnstreiks, Demonstrationen, Mobs, Revolutionen,
Volksunruhen und sozialen Bewegungen? Waren oder sind die weltweiten Friedensde-
monstrationen dieses Jahres gegen den Irak-Krieg eine soziale Bewegung? Welches sind
die Entstehungsgründe? Wer ist der Initiator bzw. die Initiatoren? Wer nimmt an einer
1
Neidhardt (1985), S. 193.
2
Vgl. Hellmann (1998), S. 9 ff., und Rammstedt (1978), S. 33 f.
3
Lorenz von Stein (1959), S. 112.
- 2 -
sozialen Bewegung teil und warum (oder warum nicht)? Wie erfolgen die Rekrutierung
und die Mobilisierung der Mitglieder einer sozialen Bewegung? Folgt die gesamte Be-
wegung einem einheitlichen und nur einem Kollektivgedanken? Wovon hängt der Er-
folg der sozialen Bewegung ab? Ist es so, wie Saint-Simons behauptet, nämlich dass die
soziale Bewegung vom Kampf zwischen der produktiven und der nicht-produktiven
Klasse in Gang gehalten wird?
4
Welchen Einfluss haben die Gesellschaft, die Politik auf
soziale Bewegungen? All jene Fragen sollen mit vorliegender Arbeit beantwortet wer-
den. Dabei ist die eigentliche Aufgabe dieser Arbeit aber noch nicht erschöpft. Sehr viel
mehr sollen die eben genannten Fragen auch auf das Zustandekommen des Terrorismus
angewandt werden. Dabei wird vor allem der Frage nachgegangen, ob und wenn ja in
wie weit eine Verbindung zwischen einer sozialen Bewegung und dem Terrorismus be-
steht. Eine Kausalität in der Art, ob eine terroristische Vereinigung aus einer sozialen
Bewegung resultieren kann (die Möglichkeit der umgekehrten Kausalität ob eine sozi-
ale Bewegung aus einer bestimmten Form des Terrorismus erwachsen kann wird in die-
ser Arbeit vernachlässigt). Wird diese Antwort bejaht, so müssten sodann die Hinter-
gründe und ,,Motoren" erarbeitet werden, welche für solch eine Entstehungsgeschichte
verantwortlich wären.
Dabei muss die Dynamik der Gewalt von einer friedlichen Protestbewegung zu einer
militanten Bewegung oder gar zur terroristischen Vereinigung als ein Prozess von
Reiz und Reaktion verstanden werden, als ein Konfliktprozess zwischen der Protestbe-
wegung und den Instanzen der sozialen Kontrolle, dem politischen System.
5
Diese Fra-
gen sollen mit der vorliegenden Arbeit beantwortet werden. Wie dabei vorgegangen
wird, ist dem folgenden Kapitel zu entnehmen.
4
Vgl. Saint-Simon, indirekt zitiert nach Rammstedt (1978), S. 43.
5
Vgl. Karstedt-Henke (1980), S. 171.
- 3 -
1.2 Aufbau der Arbeit
In Kapitel 2 werden zunächst einmal kurz die für diese Arbeit wichtigen Termini erläu-
tert. Dabei handelt es sich vor allem um soziologische Begriffe, aber auch um die
Schutzaufgaben des Staates.
Kapitel 3 definiert den Terminus
Terrorismus und nennt mögliche Erscheinungsformen.
Die Abgrenzung des Terrorismus zu Krieg oder Guerilla wird dabei ebenso vollzogen.
Die soziale Bewegung, von der Definition über die Entstehungsursachen bis hin zu den
verfolgten Zielen, Phasen und möglichen Formen werden ausführlich in Kapitel 4 be-
handelt. Dabei werden auch Rekrutierungs- und Mobilisierungsmaßnahmen sowie die
Medien eine Rolle spielen.
Kapitel 5 bildet den Schwerpunkt dieser Arbeit. Ausgehend von der sozialen Bewegung
aus Kapitel 4 wird gezeigt werden, wieso und in welcher Weise soziale Bewegungen zu
ihrem Ende kommen können und welche Faktoren dabei eine Rolle spielen. Die haupt-
sächliche Frage ist jedoch, unter welchen Bedingungen eine soziale Bewegung ihr Ende
finden und mehr oder weniger gleichzeitig den Beginn des Terrorismus markieren kann.
Dabei werden unterschiedliche Erklärungsebenen betrachtet, welche knapp ein Drittel
dieser Arbeit einnehmen. Zu Beginn wird kurz auf die makro-soziale Ebene eingegan-
gen, gefolgt von den ausführlichen Darlegungen der meso- und mikro-sozialen Erklä-
rungsebenen für die Entstehung des Terrorismus. Innerhalb des Kapitels der mikro-
sozialen Ebene wird auf einzelne RAF-Mitglieder zurückgegriffen, um zu zeigen, wie
diese zur RAF kamen bzw. was sie zu deren Entstehung beigesteuert haben. Nach mak-
ro-, meso- und mikro-sozialer Erklärungsebene schließen kurz diverse Beispiele von
Gründungsgeschichten terroristischer Vereinigungen an. Diese werden zumeist auf
meso-sozialer, teilweise auch auf makro-sozialer Ebene dargelegt. Dabei soll gezeigt
werden, inwieweit diese Terrororganisationen mit sozialen Bewegungen zusammenhän-
gen bzw. zusammenhingen.
Kapitel 6 fasst die wichtigsten Erkenntnisse der Theorie der Erklärungsebenen für die
Entstehung des Terrorismus noch einmal zusammen und nennt wünschenswerte Ent-
wicklungen der soziologischen Forschung in Bezug auf die Wandlung sozialer Bewe-
gungen hin zum Terrorismus.
- 4 -
2 Terminologische Begriffe und wichtige
Staatsaufgaben
2.1
Kollektiv
und
kollektives Handeln
Der Begriff des
Kollektivs beschreibt in der Soziologie eine nicht näher definierte An-
zahl von Personen, welche gemeinsam bestimmte Werte und Normen haben und dar-
über hinaus ein Zusammengehörigkeitsgefühl (Wir-Bewusstsein) besitzen und dennoch
nicht miteinander interagieren.
6
Die soziale Bewegung als eine spezielle Form des Kollektivs zielt auf ein
kollektives
Verhalten und Handeln
7
sozialer AkteurInnen ab, die ein allen gemeinsam geteiltes Ziel
(kollektiv geteiltes Wissen bzw. kollektiv geteilter Sinn des Handelns) verfolgen.
8
Smelser definiert kollektives Verhalten als
,,Mobilisierung aufgrund einer Vorstellung,
die soziales Handeln neu definiert"
9
. Soziales Handeln wiederum basiert auf Orientie-
rungsleistungen (Normen und Werte, Wirklichkeitsbeschreibungen, Identitäten), Res-
sourcen (Motive, Erfahrungen, Kompetenz, Sicherheit, Beweglichkeit) sowie Hand-
lungsleitenden Systemen (Ertragserwartungen, Thematisierung und Aktivierung, Recht-
fertigungssysteme, Organisation und soziale Unterstützung, Ausdrucksmedien).
10
Nach
McCarthy/Zald ist die soziale Bewegung als
kollektives deviantes Verhalten stigmati-
siert.
11
2.2 Zum Begriff
Konflikt
Die sozialen Bewegungen sind mit den Begriffen
Protest, Widerstand, Aktion, Aufruhr
und eben auch
Konflikt, um nur die wichtigsten zu nennen, eng verbunden.
12
Soziolo-
gisch werden Konflikte als Kämpfe um die Herrschaft, als Abweichung von Werten und
6
Vgl. Reinhold (2000), S. 338.
7
Zur ausführlichen Darlegung kollektiven Verhaltens und Handelns siehe bspw. Smelser
(1972).
8
Vgl. Reinhold (2000), S. 561.
9
Smelser (1972), S. 31.
10
Zur Ausführlichkeit sozialen Handelns vgl. Schmidtchen/Uehlinger (1983), S. 111 ff.
11
Vgl. McCarthy/Zald (1973), S. 2.
12
Vgl. Schumacher (2001), S. 19.
- 5 -
Normen oder aber auch als rational-strategisches Handeln betrachtet.
13
Dabei werden
Konflikte als
operationalisierte, Kommunikation gewordene Widersprüche bezeichnet,
welche auf Probleme aufmerksam machen und daher eine gewisse Zukunftssensibilität
aufweisen.
14
Nach Dahrendorf besitzen soziale Konflikte zum Beispiel die positive Funktion, den
sozialen Wandel und die ,,gute" Weiterentwicklung einer Gesellschaft voranzutreiben.
15
Auch Coser besetzt den Begriff
Konflikt positiv.
16
Dagegen haben soziale Konflikte
nach Parsons einen dysfunktionalen Charakter, nach Hobbes gefährden sie sogar die
Gesellschaft.
17
Ganz elementar kann beim Konfliktbegriff von
Differenzen zwischen Personen gespro-
chen werden, welche diese gegebenenfalls versuchen miteinander zu klären.
18
Konflikte
lassen sich in
latente und manifeste, also bewusste Problemlösungsaktivitäten unter-
scheiden.
19
Mit Konflikten sind Konflikt auslösende Differenzen, Problemfolgen, An-
triebsrichtungen und Lösungsstrukturen verbunden.
20
Um Konflikte auszutragen oder
gar zu lösen sind Kommunikations- bzw. Interaktionsleistungen vonnöten. Worin der
Konflikt bei sozialen Bewegungen und auch dem Terrorismus liegt und mit welchen
Interaktionsleistungen er ausgetragen wird, wird im Folgenden gezeigt werden. Sollte es
aber wahr sein, dass die soziale Bewegung aus Konflikten heraus entsteht und der Ter-
rorismus gegebenenfalls wiederum aus sozialen Bewegungen, so kann man wohl ohne
Übertreibung behaupten, dass ein Konflikt
eskaliert
21
ist.
13
Vgl. z. B. Krysmanski (1971), und Schumacher (2001), S. 171 ff.
14
Vgl. Luhmann (1988), S. 537.
15
Vgl. Schumacher (2001), S. 172.
16
Vgl. Schumacher (2001), S. 175.
17
Vgl. Schumacher (2001), S. 172.
18
Vgl. Krysmanski (1971), S. 222.
19
Vgl. z. B. Bader (1991), S. 338 ff., und Krysmanski (1971), S. 222.
20
Vgl. Krysmanski (1971), S. 222 f.
21
Zur Eskalation vgl. z. B. Bader (1991), S. 348 ff.
- 6 -
2.3 Das Verhältnis von
Recht, Macht, Gewalt
und
Herrschaft
Im Zusammenhang mit sozialen Bewegungen wie auch dem Terrorismus, ist es überaus
wichtig, die (soziologischen) Begriffe des
Rechts sowie der Macht zu definieren und zu
erläutern. Denn obwohl an dieser Stelle noch nicht auf die soziale Bewegung und den
Terrorismus eingegangen worden sind, sollte evident sein, dass beide Gruppen auf
welche Art auch immer mit der ihnen zur Verfügung stehenden ,,Macht" ihr geglaub-
tes ,,Recht" erreichen wollen. Die zu ,,bekämpfende gegnerische Seite" zum Beispiel
der Staat verfügt aber ihrerseits über Macht und Recht (Legitimation).
Zum Begriff des Rechts
Nur militärisch und wirtschaftlich starke Staaten, welche zudem das Vertrauen der Be-
völkerung genießen, können das Recht entfalten und erhalten.
22
Dabei ist das Vertrauen
der Bevölkerung eminent um die Souveränität eines Staates zu gewährleisten; polizeili-
che Apparate und militärische Präsenz wie in so manchem totalitärem Staat der Fall
genügen eben nicht, um das in den Staat verloren gegangene Vertrauen wieder herzu-
stellen.
23
Den BürgerInnenn einer Demokratie ist das
Recht auf Gewissens-, Meinungs- und Ver-
sammlungsfreiheit sowie die freie Entfaltung der Persönlichkeit garantiert.
24
So ermahn-
te Gustav Heinemann in seiner Osteransprache von 1968 Polizei und Justiz, dass zu den
Grundrechten auch das Recht zur Demonstration gehöre.
25
Wichtig erscheint mir hier
aber, dass Gerichte manches Mal
,,keine strafrechtlichen Um- und Irrwege scheuen, um
den zivilen Ungehorsam als eigeninteressierte instrumentelle Nötigungshandlung miß-
zuverstehen und ihrer symbolischen Bedeutung zu entkleiden"
26
. Somit erscheint das
Recht bisweilen auch als Auslegungssache zum Wohlwollen bzw. zum Nachteil einer
bestimmten Partei, vor allem im Zusammenhang mit Protestbewegungen. Dabei kann
die Rechtsordnung des Rechtsstaats aber nur dann ihre, die Freiheit schützende Kraft
22
Vgl. Fleiner-Gerster (1995), S. 169 f.
23
Vgl. Fleiner-Gerster (1995), S. 409 f., und Rohrmoser/Fröhlich (1981), S. 311.
24
Vgl. Wassermann (1991), S. 542.
25
Vgl. Wassermann (1991), S. 540.
26
Vgl. Frankenberg (1991), S. 534.
- 7 -
bewahren, wenn sie respektiert und nur im Falle ihrer Verletzung durchgesetzt wird.
27
So gesehen wird es interessant und im Verlauf der Arbeit noch zu zeigen sein, welche
Umstände vorliegen müssen oder gar vom Staat herbeigeführt werden können, um
rechtlich und damit mit Legitimation gegen soziale Bewegungen oder den Terrorismus
vorzugehen. Denn der Staat muss auf eine nicht durch den Staat legalisierte Gewaltaus-
übung entweder mit Abdankung oder aber mit Gegengewalt, um sein Machtmonopol zu
behaupten, reagieren.
28
Macht und Gewalt
Die Bedeutung der Macht ergibt sich aus der grundlegenden Beziehung zwischen zwei
oder mehreren Personen;
29
ein isoliertes Individuum ohne die grundlegendste Beziehung
zu einem oder mehreren Individuen kann niemals über Macht verfügen. Die Macht be-
ruht demnach auf der Überlegenheit der einen Seite bei gleichzeitiger relativer Abhän-
gigkeit und Schwäche einer anderen Seite.
30
Nach Fleiner-Gerster (1995) lässt sich die
staatliche Macht in die Staatsautorität sowie
in die eigentliche
Staatsgewalt unterscheiden (vgl. auch im Folgenden Fleiner-Gerster
(1995), S. 167 f.). Nur der Staat verfügt über das Gewaltmonopol; Gewalt ist die An-
wendung von physischen Zwangsmitteln. (Wassermann versteht dagegen unter Gewalt
weniger die physische Gewalt als eher die Herrschafts- und Machtausübung)
31
. Somit
obliegt es von Rechtswegen nur den staatlichen Organen, Gewalt im Rahmen von Ge-
setzen, etwa in Form der Freiheitsbeschränkung, anzuwenden, da der Staat über das
Gewaltmonopol verfügt, nicht aber über das Machtmonopol. Damit die vom Staat aus-
gehende
Gewalt kontrolliert werden kann, existiert in der Bundesrepublik Deutschland
die Gewaltenteilung in Legislative, Exekutive und Judikative. Die Gewaltenteilung er-
möglicht also im Gegensatz zu totalitäre Staaten die gegenseitige unabhängige
Überprüfung der jeweils anderen. Interessant ist hier vor allem, dass das Gewaltmono-
pol in der Bundesrepublik im Bezug auf etliche soziale Bewegungen (Beispiel: Start-
bahn-West) der letzten zwanzig Jahre nicht eingesetzt wurde, um eine möglichst friedli-
27
Vgl. Wassermann (1991), S. 539.
28
Vgl. Rohrmoser/Fröhlich (1981), S. 311.
29
Vgl. Fleiner-Gerster (1995), S. 168.
30
Vgl. Fleiner-Gerster (1995), S. 168.
31
Vgl. Wassermann (1991), S. 552.
- 8 -
che Konfliktlösung herbeizuführen, sondern vielmehr um bestimmte parlamentarische
Mehrheitsinteressen durchzusetzen.
32
Zum Begriff der Herrschaft
Abgesehen von den drei reinen Typen legitimer Herrschaft nach Max Weber
33
die ra-
tionale, die traditionale und die charismatische kann diese allgemein auch als ,,jede
soziale Über- und Unterordnung, die für die Betroffenen Anordnungsbefugnisse und
Befolgungszwänge mit sich bringen" definiert werden.
34
Wiederum nach Weber ist die
Herrschaft eine spezielle Form von legitimer Macht, die durch die von der Ausübung
Betroffenen als legitim anerkannt wird.
35
Auch steht die Herrschaft in einem Spannungsverhältnis zur individuellen Freiheit und
zur sozialen Ordnung.
36
So wurde in der Bundesrepublik Deutschland die durch das
Volk legitimierte Staatsherrschaft beispielsweise durch allerlei Bewegungen (Beispiel:
Friedens-, Umwelt und StudentInnenbewegung) wie auch durch die außerparlamentari-
sche Opposition (APO) oder die RAF herausgefordert.
37
2.4 Die Schutzaufgaben des Staates
Für Jean-Jacques Rousseau ist der Staat ein Verband, der zum Schutz seiner BürgerIn-
nen existiert.
38
Um diesen Schutz zu gewährleisten, werden Gesetze erlassen, welche
zum Wohl der BürgerInnen dienen und daher am so genannten Gemeinwillen (volonté
générale) ausgerichtet sein müssen. Die für diese Arbeit wichtigen Aufgaben des Staates
werden im Folgenden kurz erläutert.
Der Schutz nach außen
Gemäß der Charta der Vereinten Nationen bestehen die Schutzaufgaben der zuständigen
Organe des Staates darin, die Verteidigung der eigenen Souveränität zu gewährleisten
32
Vgl. Narr (1990), S. 61 f.
33
Vgl. Weber (1988), S. 475 ff.
34
Vgl. Reinhold (2000), S. 258.
35
Vgl. Reinhold (2002), S. 258
36
Vgl. Sahner (2002), S. 215.
37
Vgl. Sahner (2002), S. 215.
38
Vgl. Fleiner-Gerster (1995), S. 441.
- 9 -
sowie den Frieden und die Solidarität unter den einzelnen Staaten aufrecht zu erhalten.
39
Nach Artikel 2, Abs. 4, und Artikel 51 der Charta der Vereinten Nationen ist dabei die
Verteidigung des Staates mit militärischen Mitteln erlaubt, der Angriff auf andere Län-
der jedoch untersagt.
40
Der Schutz nach innen
Ebenso wie der Schutz des Staates nach außen, so ist auch der Schutz der BürgerInnen
vor inneren Gefahren eine der ursprünglichen Aufgaben des Staates.
41
So sollen und
müssen die BürgerInnen beispielsweise vor RäuberInnen, DiebInnen oder anderen
ÜbeltäterInnen geschützt werden.
42
Dazu existieren in der Bundesrepublik Deutschland
Institutionen wie Polizei, Landeskriminalamt, Bundeskriminalamt, Bundesgrenzschutz
oder Bundesanwaltschaft. Dabei hat die Institution der Polizei aber nicht nur die Aufga-
be die Bevölkerung vor Kriminellen zu beschützen (Kriminalpolizei). Die Aufgaben
sind viel komplexer und die BürgerInnen sind von einer Vielzahl möglicher Gefahren
betroffen; so existieren beispielsweise Einrichtungen wie die Baupolizei, die Lebensmit-
telpolizei, die Gewässerschutzpolizei oder auch die Umweltschutzpolizei.
43
Eine Studie des Instituts Infratest Sozialforschung München auf die an anderer Stelle
noch ausführlicher eingegangen wird kam 1980 anhand einer Befragung von 5.000
Personen zwischen 16 und 35 Jahren zu dem Ergebnis, dass vor allem das Parlament,
das Rechtssystem und die Polizei als Bewahrer der Freiheit in der Bundesrepublik
Deutschland betrachtet wurden und dass Links- und Rechtsextremisten als Bedrohung
für die Freiheit angesehen wurden.
44
So bedarf wohl keiner weiteren Erklärung, dass
Kriminelle, Autonome
45
und TerroristInnen eine Bedrohung für den Staat und das Ge-
39
Vgl. UNO (Hrsg.): Charta der Vereinten Nationen,
http://www.uno.de/charta/charta.htm#2
,
(01. 05. 03).
40
Vgl. UNO (Hrsg.): Charta der Vereinten Nationen,
http://www.uno.de/charta/charta.htm#2
,
(01. 05. 03).
41
Vgl. Fleiner-Gerster (1995), S. 407.
42
Vgl. Kenyon, indirekt zitiert nach Fleiner-Gerster (1995), S. 407.
43
Vgl. Fleiner-Gerster (1995), S. 409.
44
Vgl. Schmidtchen/Uehlinger (1983), S. 135 ff.
45
Da Autonome eine macht- und herrschaftsfreie Gesellschaft anstreben (vgl. Schumacher
(2001), S. 60 ff.), kann ein Gewährenlassen dieser Gruppen nicht im Interesse des Staates
als Kontrollmacht sein.
- 10 -
meinwohl darstellen können und deshalb ,,bekämpft" werden müssen. Ob das auch für
die TeilnehmerInnen einer sozialen Bewegung gilt, wird im Laufe dieser Arbeit noch zu
klären sein. Dabei ist die
staatliche soziale Kontrolle, welche formalisiertem Recht und
Gesetzen zu folgen hat (Legitimationsprinzip) in eine
repressive und eine präventive
soziale Kontrolle zu unterscheiden.
46
Während erstere sich auf die Verfolgung und Ahn-
dung begangener Regelverletzungen beschränkt (Judikative) und damit an der Vergan-
genheit orientiert ist, ist die repressive staatliche soziale Kontrolle (Exekutive) darauf
aus, zukünftigen Regelverletzungen zuvor zu kommen und damit potenzielle Regelver-
letzungen abzuwenden (präventive Aufgabe; Gefahrenabwehr).
47
Da eine potenzielle
Regelverletzung, eine ,,Gefahr", aber immer einen Zustand vor dem Eintritt des Ereig-
nisses darstellt, sollte evident sein, dass die präventive staatliche Kontrolle risikobelastet
ist, weswegen sie auch dem verfassungsrechtlich verankerten und rechtstaatlich gebote-
nem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit der Mittel folgen muss (,,Übermaßverbot")
48
.
Dass es dabei aber auch gerade die präventive staatliche soziale Kontrolle der zu berei-
nigten ,,gefährlichen" Situationen ist, welche unter Verwendung von Taktiken und Stra-
tegien solche ,,gefährlichen" Situationen aber geradezu erst herstellten,
49
belegen bei-
spielsweise die Ereignisse des 2. Juni 1967;
50
auch wird auf solche Taktiken und Strate-
gien der Polizei noch an anderer Stelle dieser Arbeit eingegangen werden.
Das notwendige Eingreifen des Staates
Bei der Antwort nach der Frage,
wann der Staat bei welcher Gefahr mit welchen Mitteln
eingreifen darf oder muss, wird an dieser Stelle das Grundgesetz der Bundesrepublik
Deutschland herangezogen. Dabei wird die Notwendigkeit des staatlichen Eingreifens
von den Grundwerten einer Gesellschaft bestimmt. Beispiele hierfür sind die Men-
schenwürde oder auch das Recht auf freie Entfaltung des Individuums. Im Verteidi-
gungsfall kann sich die Bundesregierung auf den Artikel 115 des deutschen Grundgeset-
zes berufen.
51
In Artikel 115a, Abs. 1, steht zum Beispiel: ,,Die Feststellung, daß das
46
Vgl. Sack (1984), S. 71.
47
Vgl. Sack (1984), S. 71 f. und 170.
48
Vgl. Sack (1984), S. 71 f.
49
Vgl. Sack (1984), S. 76 f.
50
Vgl. z. B. Sack (1984), S. 199 f.
51
Vgl. Bundesregierung: Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland,
http://www.bundes
regierung.de/Gesetze/ Grundgesetz-,4234/Xa.-Verteidigungsfall.htm
, (01 .05. 03).
- 11 -
Bundesgebiet mit Waffengewalt angegriffen wird oder ein solcher Angriff unmittelbar
droht (Verteidigungsfall), trifft der Bundestag mit Zustimmung des Bundesrates"
52
. Des
Weiteren ist in Artikel 115b geregelt, dass im Falle der Verkündigung des Verteidi-
gungsfalls die Befehls- und Kommandogewalt über die Streitkräfte auf den Bundes-
kanzler übergeht.
53
Auch müssen einzelne Gewaltakte gegen Sachen oder Personen auch
deshalb strafrechtlich verfolgt werden, weil das staatliche Gewaltmonopol, das sich nur
mittels konsequenter Durchsetzung seine friedensstiftende Funktion erhält, verletzt wur-
de.
54
3 Zum Begriff des Terrorismus
3.1 Definition des Terminus
Terrorismus
Das, was als Terrorismus bezeichnet wird, hängt meist vom Standpunkt des Betrachters
ab.
55
Eine allgemein verbindliche Definition des Begriffs Terrorismus existiert nicht.
56
So definieren nicht nur verschiedene Autoren den Begriff jeweils anders,
57
auch einzelne
Institutionen innerhalb eines Landes das Federal Bureau of Investigation (FBI), das
US-Verteidigungsministerium, das US-Außenministerium oder das US-Strafrecht als
Beispiel für die Vereinigten Staaten verstehen unter Terrorismus bisweilen etwas an-
deres.
58
Umso wichtiger ist es, eine Arbeitsdefinition für diese Arbeit auszuwählen, die
auch in Übereinstimmung mit Scheerer (2002) das Phänomen Terrorismus eindeutig
52
Bundesregierung: Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland,
http://www.bundesregierung.de/Gesetze/ Grundgesetz-,4234/Xa.-Verteidigungsfall.htm
,
(01. 05. 03).
53
Vgl. Bundesregierung: Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland,
http://www.bundesregierung.de/Gesetze/ Grundgesetz-,4234/Xa.-Verteidigungsfall.htm
,
(01. 05. 03).
54
Vgl. Voß (1990), S. 138.
55
Vgl. z. B. Hess (1988), S. 55.
56
Vgl. z. B. Bundesministerium des Innern:
http://www.bmi.bund.de/dokumente/Lexikon-
Modul/ix_21433.htm
(17. 05. 03), Scheerer (2002), S. 20, und O. V.: ,,Terrorismus. Im Zeitalter
der Globalisierung", in: Studiengesellschaft für Friedensforschung e. V.,
http://www.studienge
sellschaft-friedensforschung.de/da_46.htm
(17. 05. 03).
57
Vgl. z. B. Hess (1988), S. 59, Münkler (2002), S. 177, Schiller (2002), S. 4, und Waldmann
(1998), S. 10.
58
Vgl. Scheerer (2002), S. 21 f.
- 12 -
beschreibt, ohne es dabei jedoch zugleich als illegitim, illegal, falsch, unmoralisch oder
in anderer Art und Weise negativ zu bewerten.
59
Im Folgenden wird daher die Definition von Waldmann (1998) zugrunde gelegt:
,,
Terrorismus sind planmäßig vorbereitete, schockierende Gewaltanschläge
gegen eine politische Ordnung aus dem Untergrund. Sie sollen allgemeine
Unsicherheit und Schrecken, daneben aber auch Sympathie und Unterstüt-
zungsbereitschaft erzeugen."
60
Im Gegensatz zu Münkler (2002), Hess (1988) und Schiller (2002) ist die Definition
Waldmanns um das Attribut
,,aus dem Untergrund" reicher. Meiner Meinung nach ist
lediglich das Attribut
,,gegen eine politische Ordnung" ein wenig ungeschickt gewählt,
da ein (repressiver) Staatsterrorismus gegen die eigene Bevölkerung wie bspw. in der
Definition Schillers vorhanden darin keine explizite Berücksichtigung findet. Unge-
achtet, ob man nun den repressiven Terrorismus zu Waldmanns Definition noch hinzu-
zählt oder nicht, oder ob man beispielsweise die Definition Münklers betrachtet terro-
ristische Aktionen verdienen nur dann ihren Namen, wenn sie (unter anderem) auf poli-
tischen Motiven beruhen.
61
Auf jeden Fall muss der Terrorismus auch als eine Art
Kommunikationsstrategie verstanden werden; Inhalte der Botschaften sind beispielswei-
se die Macht der TerroristInnen oder der Ruf nach Unterstützungswilligen.
62
Abzusehen
bleibt aber, in wie weit die so genannten
sozialen Bewegungen mit dem (politischen)
Terrorismus zusammenhängen können.
3.2 Abgrenzung des Terrorismus zu verwandten
Erscheinungsformen
3.2.1
Terrorismus, Krieg und Kriminalität
Der Terrorismus scheint weder eine Form von
Krieg noch von Kriminalität zu sein (vgl.
auch im Folgenden Waldmann (1998), S. 14 ff.). Ebenso wie Staatsstreiche oder politi-
59
Scheerer (2002), S. 24.
60
Waldmann (1998), S. 10.
61
Vgl. z. B. Münkler (2002), S. 175 f.
62
Vgl. z. B. Karstedt-Henke (1980), S. 183, Kepel (2002), S. 10 f., Münkler (2002), S. 177,
Scheerer (2002), S. 24 ff., und Waldmann (1998), S. 12 f.
- 13 -
sche Aufstände ist der Terrorismus einem dritten Typus zuzurechnen, der die politischen
Machtverhältnisse in Frage stellt. Dennoch stufen vom Terrorismus betroffene Staaten
diesen oft entweder als eine Form von Kriminalität oder als eine Form von Krieg ein.
Erstere degradiert TerroristInnen zu Kriminellen, was bedeuten soll, der Staat habe das
Problem im Griff. Wird der Terrorismus jedoch der Bedrohung eines Krieges gleichge-
setzt, so soll der Öffentlichkeit zum einen der Ernst der Lage verdeutlicht werden, um
zum anderen jedes Mittel gegen dessen Bekämpfung zu rechtfertigen. Beispielsweise
wurde im Mai dieses Jahres darüber nachgedacht, die ,,Sahara-TerroristInnen", welche
unter anderem mehrere Deutsche in ihrer Gewalt haben, von TerroristInnen zu Krimi-
nellen zu ,,degradieren", damit der algerische Staatschef Bouteflika den Deutschen
zuliebe mit den Entführern verhandeln kann, was ihm beim ,,TerroristInnenstatus"
aufgrund seiner Politik verwehrt bliebe.
63
So kann es also durchaus auch vorkommen,
dass Staaten, welche sich über viele Jahre hinweg mit dem Problem des Terrorismus
konfrontiert
sahen,
dessen
Einstufung
zum
Ziele
dessen
(Nicht-)Bekämpfung vom Terrorismus zur Gewalttat oder Kriminalität wechseln und
vice versa.
64
3.2.2
Terrorismus und Guerilla
Der Terrorismus muss jedoch auch von dem Guerillakampf abgegrenzt werden. Letzte-
rer ist eine militärische Strategie, bei der es sich um die Belästigung, allmähliche Ein-
kreisung und letztlich die Vernichtung des Feindes handelt.
65
Der erfolgreiche Guerilla-
kampf ist dabei aber nur mit der Unterstützung der Bevölkerung zu verwirklichen.
66
Bleibt solch eine Unterstützung aus, ist der Kampf nur noch mittels terroristischer Akti-
onen möglich, welche die Unterstützung von Teilen der Bevölkerung aus der psychi-
schen Einschüchterung der Machthaber aufgrund der Terroraktionen rekrutieren soll.
67
Die RAF ist ein gutes Beispiel für einen von deren Mitgliedern gewollten
(Stadt-)Guerillakrieg, der aufgrund der mangelnden Unterstützung seitens der Bevölke-
63
Vgl. Mascolo/Schlamp (2003), S. 26.
64
Vgl. Waldmann (1998), S. 15.
65
Vgl. Fetscher/Münkler/Ludwig (1981), S. 98, und Waldmann (1998), S. 17.
66
Vgl. Fetscher/Münkler/Ludwig (1981), S. 26 und 106 f.
67
Vgl. Fetscher/Münkler/Ludwig (1981), S. 26.
- 14 -
rung aber im Terrorismus endete.
68
Eine mögliche Erklärung, warum die Bevölkerung
die RAF nicht unterstützte gab RAF-Mitglied Horst Mahler, in dem er sagte:
,,Der (ge-
meint ist der Staat, Anm. d. Verf.)
ist nämlich nicht nur Apparat, der ist auch Bewusst-
sein in den Köpfen der Leute selbst und indem man den Staat so unvermittelt angreift,
mobilisiert man in den Köpfen der Leute die Identifizierung mit dem Staat."
69
Warum
aber die RAF-Gründer keine Gewalt scheuten, zeigt Kapitel 5.2.3.3. Der Sinn des Terro-
rismus ist demnach u. a. die Erreichung von Kommunikation durch die Berichterstat-
tung der Massenmedien. In Anlehnung an Wördemann will der Guerillero also den
Raum besetzen, der/die TerroristIn dagegen das Denken.
70
Vielleicht liegt es in der Sichtweise der Guerilleros KombattantInnen von ZivilistIn-
nen bei ihrem Guerillakampf zu unterscheiden (und damit ZivilistInnen im Prinzip zu
verschonen) die den Guerilleros prinzipiell eine eher positive Assoziation zukommen
lässt, ganz im Gegenteil zur negativen der TerroristInnen.
71
Was genau unter Terroris-
mus zu verstehen ist, erklärt das nun folgende Kapitel.
3.3 Formen von Terrorismus
3.3.1
Repressiver Terrorismus
Der repressive Terrorismus lässt sich in einen der staatlichen Apparate sowie einen wei-
teren durch para-staatliche oder nicht-staatliche Gruppen unterscheiden.
Der repressive Terrorismus staatlicher Apparate
Der durch staatliche Apparate und Machthaber ausgeführte Terrorismus ist der quantita-
tiv und qualitativ bedeutsamste, sowohl in der Zukunft als auch in der Vergangenheit
(Bsp.: Hitler, Stalin, Pinochet, Papadopoulos).
72
68
Vgl. Fetscher/Münkler/Ludwig (1981), S. 27, 95 ff. und 121.
69
Horst Mahler, zitiert nach Tornow (1979), S. 196 f. (bei Tornow nicht kursiv).
70
Vgl. Waldmann (1998), S. 17.
71
Vgl. Waldmann (1998), S. 18.
72
Vgl. Hess (1988), S. 62, und Scheerer (2002), S. 30 f
.
- 15 -
Die Notwendigkeit terroristischer staatlicher Akte ergibt sich aus dem Fakt, dass sich
die Herrschaft nicht auf Legitimität stützen kann und somit die Bevölkerung mit Zwang
niedergehalten werden muss (vgl. auch im Folgenden Hess (1988), S. 62 ff.). Da der
Zwang sich aber nicht immer und auf alle BürgerInnen gleichzeitig durchführen lässt,
müssen sporadisch wieder kehrende Gewalttaten gegen einzelne die psychische Wir-
kung der Einschüchterung entfalten. Der repressive Terrorismus staatlicher AkteurInnen
ist somit relativ rational und verständlich, da der Fortbestand der staatlichen Macht ohne
Terrorismus wohl nicht aufrecht zu halten wäre. Die den Terror Ausführenden können
dabei recht ,,gewissenlos" agieren, können sie sich doch jederzeit auf den Befehl ,,von
oben" berufen.
Der repressive Terrorismus para-staatlicher bzw. nicht-staatlicher Gruppen
Dieser Typ des Terrorismus ist vor allem in jenen Ländern oder Regionen vorzufinden,
in denen es den nicht privilegierten Schichten und Gruppen einer Gesellschaft gelungen
ist, bestimmte Privilegien (Beispiel: Wahlrecht, Streikrecht etc.) der herrschenden
Schichten durch einen gewissen Druck auf den Staat zu beschneiden (vgl. auch im Fol-
genden Hess (1988), S. 64 ff.). Die Privilegierten sind jedoch noch nicht ,,besiegt", sie
verteidigen weiterhin ihren Stand und versuchen ihn aufrecht zu halten. Dies geschieht
unter zu Hilfenahme privater Kampfmittel. So bestanden die so genannten Todes-
schwadronen von Sao Paulo und Rio aus Polizisten, die in ihrer Freizeit ,,handelten".
Auch die Verwicklung des italienischen Geheimdienstes in Bombenanschläge der neo-
faschistischen Gruppen sowie das Verhalten von Polizei und Justiz ist beispielhaft für
solch einen repressiven Terrorismus. Ziel ist zum einen die Einschüchterung der
GegnerInnen, zum anderen aber auch der Appell an reaktionäre Kräfte (die Armee), die
einen Staatsstreich bewirken sollen. Weitere Beispiele eines Terrorismus dieses Typus
sind die Mafia in Sizilien, der Ku Klux Klan in den USA oder auch die Patria y Libertad
in Chile.
- 16 -
3.3.2
Revoltierender Terrorismus
Der revoltierende Terrorismus lässt sich in einen der nationalen Art (Unabhängigkeits-
terrorismus, nationalistisch-separatistischer Terrorismus) und einen der sozialrevolutio-
nären Art unterscheiden.
73
Der Unabhängigkeitsterrorismus
Unter diesem Terrorismus-Typ sollen all die Formen verstanden werden, welche die
nationale Selbstbestimmung des Volkes zum Ziel haben und die sich zu deren Verwirk-
lichung des Terrorismus bedienen (vgl. auch im Folgenden Hess (1988), S. 66 f.). So
können beispielsweise separatistische oder regionale Bewegungen wie auch Befreiungs-
bewegungen dazu gezählt werden. Konkret wären dies z. B. die Mau Mau in Kenia, die
palästinensische Gruppe Schwarzer September, die IRA oder die ETA.
Dabei beruht der revolutionäre Terrorismus nationaler Art auf einem Konflikt zwischen
einer sozialen Gruppe und einer nationalen Macht. Die soziale Gruppe fühlt sich als
eigenes Volk, lebt auf einem relativ geschlossenen Gebiet zusammen und hat vor allem
eine eigene Sprache und eine historisch zurückreichende Gemeinschaftserfahrung. Die
überlegene Macht überlagert die soziale Gruppe politisch, wirtschaftlich, kulturell und
ggf. auch religiös und entmündigt diese damit. Das Ziel der Macht muss es sein, die
Anführer der sozialen Gruppe zu besiegen, die jugendliche Intelligenz in die herrschen-
de Sprache und Kultur zu integrieren und ihr somit zumindest eine scheinbare politische
Beteiligung zu gewähren. Geschieht dies nicht, so besteht die Gefahr, dass die oppositi-
onelle Intelligenz mit der Wiederbelebung der eigenen Sprache und Kultur beginnt, wel-
che schließlich in einer religiösen (und politischen) Bewegung resultiert. Will die
überlegene Macht die im Grunde genommen friedlichen Selbstständigkeitsbewegungen
blockieren, resultieren daraus aufgrund der militärischen Unterlegenheit terroristische
Aktionen der sozialen Gruppe. Auch hier ist dem terroristischen Akt wieder eine Kom-
munikationsfunktion inne; die Situation der sozialen Gruppe soll zum einen in das Be-
wusstsein der Weltöffentlichkeit getragen werden, zum anderen soll an das Selbst- und
Widerstandsbewusstsein der sozialen Gruppe appelliert werden. Wichtig bei dieser
Form von Terror ist die Tatsache, dass die Terrorakte ein Forderungskatalog der sozia-
73
Vgl. z. B. o. V.: ,,Terrorismus. Im Zeitalter der Globalisierung", in: Studiengesellschaft für
Friedensforschung e. V.,
http://www.studiengesellschaft-friedensforschung.de/da_46.htm
(17. 05. 03).
- 17 -
len Gruppe an die Macht begleitet. Laut Hess ist dieser Form von Terror der Rationali-
tätsanspruch nicht abzusprechen, vor allem deshalb, weil die Resonanz der Weltöffent-
lichkeit oft groß ist und damit die erhofften Ziele auch erreichbar sind. Auch kann der
revoltierende Terrorismus nationaler Art aufgrund der Unterstützung der eigenen sozia-
len Gruppe leicht in die Form eines Guerillakrieges übergehen.
Der sozialrevolutionäre Terrorismus
Das strategische Ziel dieses Terrorismus-Typs stellt die radikale, politische und soziale
Veränderung des bestehenden Gesellschaftssystem dar (vgl. auch im Folgenden Hess
(1988), S. 67 ff.). Beispiele für einen Terrorismus dieses Typus waren oder sind z. B.
die südamerikanischen Tupamaros, die japanische rote Armee oder die RAF in der
Bundesrepublik Deutschland. Das Paradox an der Diskussion über den sozialrevolutio-
nären Terrorismus ist dabei Folgendes: Einerseits ist diese Form von Terrorismus die
am wenigsten rationale und die zugleich am wenigsten effektive überhaupt. Andererseits
erfährt der sozialrevolutionäre Terrorismus in der Diskussion aber eine enorme überpro-
portionale Aufwertung und wird als eine allseits bedrohende Gefahr für Staat und Ge-
sellschaft verstanden. Dies ist nur damit zu erklären, dass dieser terroristische Typus vor
allem für diejenigen Personen eine ernsthafte Bedrohung darstellt, welche eine gehobe-
ne Position in Staat oder Wirtschaft einnehmen. Daraus folgen notwendige Schutzma-
ßahmen der betreffenden Personen sowie deren mediale Ausschlachtung, woraus sich
wiederum eine ,,allgemeine (mediale) Bedrohungslage" ergibt. Andererseits wird die
vom sozialrevolutionären Terrorismus ausgehende Gefahr auch deshalb so hochgespielt,
damit von anderen, ernsthafteren Problemen abgelenkt werden kann. Die Folge der me-
dialen Terrorismusfurcht ist das kollektive Bedürfnis nach Sicherheit, welches man sich
am ehesten von einer konservativen Partei verspricht. Letztlich dient das ,,Gespenst des
Terrorismus" damit der Legitimation einer verschärften und die Privatsphäre einschrän-
kenden Macht.
Nach Scheerer
ist
der Terrorismus eine Waffe
gegen die Macht als auch eine Waffe der
Macht (vgl. auch im Folgenden Scheerer (2002, S. 30 ff.). Der repressive Terrorismus
will seine Macht stabilisieren und somit den Widerstand lähmen. Der Aufwand des
Staatsterrorismus ist gering und wenig riskant. Der revoltierende Terrorismus dagegen
ist hochriskant, da er die Machthaber zu Aktionen provozieren will, welche langfristig
weitere revoltierende TerroristInnen auf den Plan rufen werden, um letztlich die Staats-
- 18 -
macht zu schwächen, damit sich die Machtverhältnisse ändern. Somit sind selbst erfolg-
reiche Aktionen der revolutionären TerroristInnen zunächst nur Etappenerfolge; ob das
finale Ziel erreicht wird, bleibt unklar. Der repressive Terrorismus kann dagegen alles
Erdenkliche tun, ohne dabei Gefahr zu laufen, zur Verantwortung gezogen zu werden.
3.3.3
Internationaler Terrorismus
Der Terminus
internationaler Terrorismus meint die Involviertheit von Menschen un-
terschiedlicher Nationalität an einem terroristischen Anschlag.
74
Dennoch können mit
dem internationalen Terrorismus unterschiedliche Sachverhalte gemeint sein (vgl. im
Folgenden Waldmann (1998), S. 18 f.):
·
Verschiedene, aber auf nationaler Ebene fungierende terroristische Gruppen o-
der Verbände kooperieren miteinander durch die Gründung einer supranationa-
len Koordinationszentrale.
·
Der zu terrorisierende Staat wird von außerhalb angegriffen (Beispiel: Flug-
zeugentführungen, Attentate auf Botschaften etc.).
·
Eine Regierung sponsort terroristische Gruppen, um einen verhassten Drittstaat
,,aus dem Untergrund anzugreifen", da eine direkte kriegerische Konfrontation
zwischen beiden Staaten für die Sponsoring betreibende Regierung aufgrund de-
ren militärischer Unterlegenheit aussichtslos wäre. Dieses Phänomen wird auch
als Staatsterrorismus bezeichnet.
An dieser Stelle sei noch erwähnt, dass generell zwischen vier Gruppen von
TerroristInnen (bzw. dem Terrorismus) unterschieden werden können: (1) Revolutionäre
Gruppen, welche politische oder soziale Veränderungen mit Gewalt herbeiführen wollen
(Bsp.: RAF, PLO); (2) ethische oder politische Minderheiten, welche gewaltsam für ihre
Autonomie in einem Staat kämpfen (Bsp.: PKK); (3) Religiöse oder pseudo-religiöse
74
Vgl. Waldmann (1998), S. 19.
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Originalausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2003
- ISBN (eBook)
- 9783832440428
- ISBN (Paperback)
- 9783838640426
- Dateigröße
- 1.1 MB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main – Gesellschaftswissenschaften
- Note
- 2,3
- Schlagworte
- soziale bewegung terrorismus rote armee fraktion black panther karriere modell
- Produktsicherheit
- Diplom.de