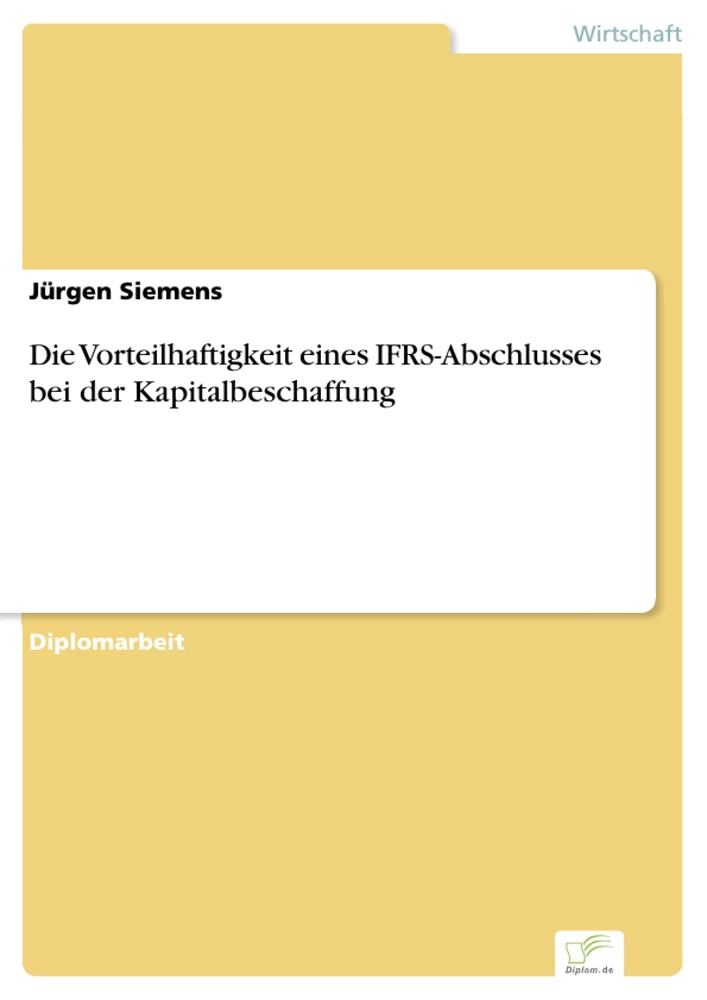Die Vorteilhaftigkeit eines IFRS-Abschlusses bei der Kapitalbeschaffung
©2005
Diplomarbeit
68 Seiten
Zusammenfassung
Inhaltsangabe:Einleitung:
Die Globalisierung der Kapitalmärkte und die damit verbundene wachsende Konkurrenzfähigkeit stellen die Unternehmen vor immer neue Herausforderungen.
Die Beschaffung von Kapital und die große Bedeutung günstiger Finanzierungskosten zum Erhalt der Wettbewerbsfähigkeit führen die Unternehmen dazu, ihre Bilanzierung zukünftig stärker auf die Informationsbedürfnisse der Investoren auszurichten.
Die Bilanzierung nach HGB mit ihren starken Einflüssen auf Ausschüttungs- und Steuerbemessung der Handelsbilanz und den hohen Gläubigerschutzaspekten wird von den großen deutschen Unternehmen in Anbetracht der Offenlegung von geeigneten Informationen oft vernachlässigt.
Die neuen gesetzlichen Anforderungen (Mindestanforderungen an das Kreditgeschäft) und eine unzureichende Vorbereitung auf das neue Rating-Verfahren nach Basel II machen eine mögliche Bilanzierung nach internationalen Gesichtspunkten auch für kleine und mittelständische Unternehmen interessant.
Im Zuge der Harmonisierung der internationalen Rechnungslegung sind die kapitalmarktorientierten Unternehmen laut EU-Verordnung ab dem Jahre 2005 zu einer Bilanzierung im Konzernabschluss nach IFRS verpflichtet. Des Weiteren sieht diese Verordnung ein Wahlrecht vor, dass es den Mitgliedsstaaten überlässt, die Anwendung der IFRS sowohl im Konzernabschluss der übrigen Unternehmen als auch im Einzelabschluss aller Unternehmen vorzuschreiben oder zu gestatten.
Vor diesem Hintergrund kann man davon ausgehen, dass sich im Verlauf der nächsten Jahre die Jahresabschlüsse aller Unternehmen europaweit annähern werden.
Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, herauszuarbeiten, inwieweit die Bilanzierung nach IFRS den Unternehmen Vorteile bei der Kapitalbeschaffung verschafft.
Dafür werden die Anforderungen der jeweiligen Adressaten an den Abschluss aufgezeigt und hinterfragt. Letztendlich soll durch die Zusammenfassung der Vorteile und Nachteile die Zweckmäßigkeit einer Einführung der IFRS für alle Marktteilnehmer erörtert werden.
Die Bilanzierungspraxis hat im Laufe der letzten Jahre einige grundlegende Veränderungen durchlaufen. Die Anwendung der IFRS ist ab dem 01.01.2005 Pflicht für alle kapitalmarktorientierten Unternehmen. Hinzu kommt die Möglichkeit für nicht kapitalmarktorientierte Unternehmen, freiwillig nach IFRS zu bilanzieren.
Im zweiten Kapitel wird eine kurze Übersicht über Entwicklungen und Möglichkeiten gegeben, die zum Übergang auf einen IFRS-Abschluss beigetragen […]
Die Globalisierung der Kapitalmärkte und die damit verbundene wachsende Konkurrenzfähigkeit stellen die Unternehmen vor immer neue Herausforderungen.
Die Beschaffung von Kapital und die große Bedeutung günstiger Finanzierungskosten zum Erhalt der Wettbewerbsfähigkeit führen die Unternehmen dazu, ihre Bilanzierung zukünftig stärker auf die Informationsbedürfnisse der Investoren auszurichten.
Die Bilanzierung nach HGB mit ihren starken Einflüssen auf Ausschüttungs- und Steuerbemessung der Handelsbilanz und den hohen Gläubigerschutzaspekten wird von den großen deutschen Unternehmen in Anbetracht der Offenlegung von geeigneten Informationen oft vernachlässigt.
Die neuen gesetzlichen Anforderungen (Mindestanforderungen an das Kreditgeschäft) und eine unzureichende Vorbereitung auf das neue Rating-Verfahren nach Basel II machen eine mögliche Bilanzierung nach internationalen Gesichtspunkten auch für kleine und mittelständische Unternehmen interessant.
Im Zuge der Harmonisierung der internationalen Rechnungslegung sind die kapitalmarktorientierten Unternehmen laut EU-Verordnung ab dem Jahre 2005 zu einer Bilanzierung im Konzernabschluss nach IFRS verpflichtet. Des Weiteren sieht diese Verordnung ein Wahlrecht vor, dass es den Mitgliedsstaaten überlässt, die Anwendung der IFRS sowohl im Konzernabschluss der übrigen Unternehmen als auch im Einzelabschluss aller Unternehmen vorzuschreiben oder zu gestatten.
Vor diesem Hintergrund kann man davon ausgehen, dass sich im Verlauf der nächsten Jahre die Jahresabschlüsse aller Unternehmen europaweit annähern werden.
Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, herauszuarbeiten, inwieweit die Bilanzierung nach IFRS den Unternehmen Vorteile bei der Kapitalbeschaffung verschafft.
Dafür werden die Anforderungen der jeweiligen Adressaten an den Abschluss aufgezeigt und hinterfragt. Letztendlich soll durch die Zusammenfassung der Vorteile und Nachteile die Zweckmäßigkeit einer Einführung der IFRS für alle Marktteilnehmer erörtert werden.
Die Bilanzierungspraxis hat im Laufe der letzten Jahre einige grundlegende Veränderungen durchlaufen. Die Anwendung der IFRS ist ab dem 01.01.2005 Pflicht für alle kapitalmarktorientierten Unternehmen. Hinzu kommt die Möglichkeit für nicht kapitalmarktorientierte Unternehmen, freiwillig nach IFRS zu bilanzieren.
Im zweiten Kapitel wird eine kurze Übersicht über Entwicklungen und Möglichkeiten gegeben, die zum Übergang auf einen IFRS-Abschluss beigetragen […]
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
ID 4286
Siemens, Jürgen: Die Vorteilhaftigkeit eines IFRS-Abschlusses bei der Kapitalbeschaffung
Hamburg: Diplomica GmbH, 2005
Zugl.: Carl-von-Ossietzky-Universität Oldenburg, Diplomarbeit, 2005
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte,
insbesondere die der Übersetzung, des Nachdrucks, des Vortrags, der Entnahme von
Abbildungen und Tabellen, der Funksendung, der Mikroverfilmung oder der
Vervielfältigung auf anderen Wegen und der Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen,
bleiben, auch bei nur auszugsweiser Verwertung, vorbehalten. Eine Vervielfältigung
dieses Werkes oder von Teilen dieses Werkes ist auch im Einzelfall nur in den Grenzen
der gesetzlichen Bestimmungen des Urheberrechtsgesetzes der Bundesrepublik
Deutschland in der jeweils geltenden Fassung zulässig. Sie ist grundsätzlich
vergütungspflichtig. Zuwiderhandlungen unterliegen den Strafbestimmungen des
Urheberrechtes.
Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in
diesem Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme,
dass solche Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei
zu betrachten wären und daher von jedermann benutzt werden dürften.
Die Informationen in diesem Werk wurden mit Sorgfalt erarbeitet. Dennoch können
Fehler nicht vollständig ausgeschlossen werden, und die Diplomarbeiten Agentur, die
Autoren oder Übersetzer übernehmen keine juristische Verantwortung oder irgendeine
Haftung für evtl. verbliebene fehlerhafte Angaben und deren Folgen.
Diplomica GmbH
http://www.diplom.de, Hamburg 2005
Printed in Germany
Inhaltsverzeichnis
I
Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis ... I
Abbildungsverzeichnis ... III
Abkürzungsverzeichnis... IV
1. Ausgangslage, Hypothese und Ziel der Untersuchung ...1
1.1 Ausgangslage...1
1.2
Hypothese und Ziel der Untersuchung ...2
1.2.1 Hypothese ...2
1.2.2
Ziel der Untersuchung ...2
1.3
Gang der Untersuchung...2
2. Der Übergang auf einen IFRS-Abschluss...4
2.1
Harmonisierung der Rechnungslegung in Deutschland ...4
2.1.1 Gesetzgeberische
Initiativen zur Erweiterung des HGB ...4
2.1.2
Die Anwendung internationaler Rechnungslegungsstandards lt. EU-
Verordnung vom 14.09.2002 ...5
2.2
Ausgestaltung und Unterschiede ...6
2.2.1
Entwicklung der IFRS und Ausgestaltung ...6
2.2.2
Grundlegende Unterschiede zwischen IFRS und HGB...7
2.3
Ziele des IFRS-Abschlusses im Vergleich zum HGB-Abschluss...8
2.3.1
Erhöhung der Transparenz ...8
2.3.2
Verbesserung der Vergleichbarkeit ...9
2.3.3 Vereinfachung
grenzüberschreitender Investitionen und Kapitalflüsse...10
2.4
Ausbreitung der IFRS im deutschen Kapitalmarkt ...11
3. Kapitalbeschaffung und die Rolle der Unternehmensdarstellung...13
3.1
Rahmenbedingungen und Entwicklungen...13
3.1.1
Neue Wege in der Kapitalbeschaffung...13
3.1.2
Umbruch in der Finanzierungspraxis ...14
3.1.2.1 Einführung der MaK...14
3.1.2.2 Neuregelungen nach Basel II...14
3.1.2.3 Die neue Bedeutung des Rating...15
3.2 Finanzierungsformen...16
3.2.1
Systematik der Finanzierungsformen ...16
3.2.1.1 Eigenkapitalgeber ...16
3.2.1.2 Fremdkapitalgeber...17
3.2.1.3 Mischformen...17
3.2.2
Unterschiede zwischen den Interessensgruppen?...17
3.3
Adressaten und Funktionen des Abschlusses ...19
3.3.1
Grundsatz der Abschlusserstellung ...19
3.3.2
Ausgewählte Adressaten und die Relevanz des Abschlusses...19
3.3.2.1 Kreditinstitute ...19
3.3.2.2 Kapitalmarkt ...20
3.4 Zusammenfassung:
Anforderungen
bei der Kapitalbeschaffung an den
Abschluss...21
Inhaltsverzeichnis
II
4. Überprüfung der Anforderungen auf Vorteilhaftigkeit ...23
4.1 Gläubigerschutz...23
4.1.1
Gläubigerschutz und Anlegerschutz...23
4.1.2
Die Rolle des Gläubigerschutzes im Sinne der EU-Rechnungslegung ...24
4.1.3
Institutioneller und informationeller Gläubigerschutz ...24
4.1.4
Konzernabschluss und Einzelabschluss ...24
4.1.5 Zusammenfassung ...25
4.2 Tatsächliche
Lage...26
4.2.1 Wahlrechte
und
Ermessensspielräume ...26
4.2.2
Bilanzpolitische Spielräume der IFRS ...27
4.2.3
Grenzen der bilanzpolitischen Spielräume ...28
4.2.4 Zusammenfassung ...29
4.3 Prognosefähigkeit ...30
4.3.1
Anwendung von Prognosen bei der Unternehmensbewertung...30
4.3.1.1 Begriff
und
Grundlage...30
4.3.1.2 Arten und Ziele der Prognose...30
4.3.2
Grundvoraussetzungen für eine zuverlässige Prognose ...31
4.3.3 Zusammenfassung ...32
4.4 Vergleichbarkeit ...33
4.4.1
Grundsatz der Vergleichbarkeit...33
4.4.1.1 Zwischenbetrieblicher
Vergleich...33
4.4.1.2 Zeitlicher
Vergleich...34
4.4.2
Grenzen durch uneinheitliche Anwendung ...34
4.4.3
Rating auf Basis eines HGB/IFRS-Abschlusses ...35
4.4.4 Zusammenfassung ...36
4.5 Unternehmensführung ...36
4.5.1
Veränderungen durch die Umstellung auf IFRS ...36
4.5.2
Verbesserungen im internen Rechnungswesen ...37
4.5.2.1 Controlling...37
4.5.2.2 Risikomanagement ...37
4.5.2.3 Strategische
Unternehmensführung...38
4.5.3 Zusammenfassung ...38
5. Zusammenfassung der Ergebnisse, Überprüfung der Hypothese und Ausblick .40
5.1
Zusammenfassung der Ergebnisse...40
5.2 Sonstige
Aspekte ...42
5.2.1
Anforderungen an das Management...42
5.2.2
Zeit und Kosten ...42
5.3
Überprüfung der Hypothese ...43
5.4 Ausblick...44
Anhang...46
Literaturverzeichnis ...53
Abbildungsverzeichnis
III
Abbildungsverzeichnis
Abbildung 1: Gang der Untersuchung... 2
Abbildung 2: Zukünftige Rechnungslegungsvorschriften in Deutschland... 6
Abbildung 3: Grundlegende Unterschiede zwischen HGB und IAS/IFRS... 8
Abkürzungsverzeichnis
IV
Abkürzungsverzeichnis
Abb.
Abbildung
ABS
Asset Backed Securities
akt.
aktuelle
AktG
Aktiengesetz
Anm.
Anmerkung
Aufl.
Auflage
BB
Betriebs-Berater
(Zeitschrift)
bzw.
beziehungsweise
DB
Der
Betrieb
(Zeitschrift)
DStR
Deutsches Steuerrecht (Zeitschrift)
erw.
erweitete
EG
Europäische
Gemeinschaft
EStG
Einkommenssteuergesetz
EU
Europäische
Union
ggf.
gegebenenfalls
GmbHG GmbH-Gesetz
GoB
Grundsätze
ordnungsgemäßer
Buchführung
HGB
Handelsgesetzbuch
Hrsg.
Herausgeber
IAS
International Accounting Standard(s)
IASB
International Accounting Standards Board
IASC
International Accounting Standards Committee
IASCF
International Accounting Standards Committee Foundation
i.d.R.
in der Regel
IFRIC
International Financial Reporting Interpretations Committee
IFRS
International Financial Reporting Standards
KI Kreditinstitut
KPMG
Klynveld Peat Marwick Goerdeler
KWG
Kreditwesengesetz
lt. laut
MaK
Mindestanforderungen an das Kreditgeschäft der Kreditinstitute
o. g.
oben genannte(n)
Abkürzungsverzeichnis
V
PublG
Publizitätsgesetz
S. Seite
SIC
Standard
Industrial
Classifications (Index)
u. und
u. a.
unter anderem
überarb. überarbeitete
US-GAAP
United
States-Generally Accepted Accounting Principles
vgl.
vergleiche
vollst.
vollständig
Wpg
Die
Wirtschaftsprüfung
(Zeitschrift)
§ Paragraph
Ausgangslage, Hypothese und Ziel der Untersuchung
1
1. Ausgangslage,
Hypothese
und Ziel der Untersuchung
1.1 Ausgangslage
Die Globalisierung der Kapitalmärkte und die damit verbundene wachsende
Konkurrenzfähigkeit stellen die Unternehmen vor immer neue Herausforderungen.
Die Beschaffung von Kapital und die große Bedeutung günstiger Finanzierungskosten
zum Erhalt der Wettbewerbsfähigkeit führen die Unternehmen dazu, ihre Bilanzierung
zukünftig stärker auf die Informationsbedürfnisse der Investoren auszurichten.
Die Bilanzierung nach HGB mit ihren starken Einflüssen auf Ausschüttungs- und
Steuerbemessung der Handelsbilanz und den hohen Gläubigerschutzaspekten wird von
den großen deutschen Unternehmen in Anbetracht der Offenlegung von geeigneten
Informationen oft vernachlässigt.
Die neuen gesetzlichen Anforderungen (Mindestanforderungen an das Kreditgeschäft)
und eine unzureichende Vorbereitung auf das neue Rating-Verfahren nach Basel II
machen eine mögliche Bilanzierung nach internationalen Gesichtspunkten auch für
kleine und mittelständische Unternehmen interessant.
Im Zuge der Harmonisierung der internationalen Rechnungslegung sind die
kapitalmarktorientierten Unternehmen laut EU-Verordnung ab dem Jahre 2005 zu einer
Bilanzierung im Konzernabschluss nach IFRS verpflichtet. Des Weiteren sieht diese
Verordnung ein Wahlrecht vor, dass es den Mitgliedsstaaten überlässt, die Anwendung
der IFRS sowohl im Konzernabschluss der übrigen Unternehmen als auch im
Einzelabschluss aller Unternehmen vorzuschreiben oder zu gestatten.
Vor diesem Hintergrund kann man davon ausgehen, dass sich im Verlauf der nächsten
Jahre die Jahresabschlüsse aller Unternehmen europaweit annähern werden.
Ausgangslage, Hypothese und Ziel der Untersuchung
2
1.2 Hypothese und Ziel der Untersuchung
1.2.1 Hypothese
Entsprechend der in Kapitel 1.1 beschriebenen Ausgangslage lautet die Hypothese,
welche durch die nachfolgende Untersuchung überprüft werden soll, wie folgt:
,,Die Verwendung eines IFRS-Abschlusses erweist sich bei der Kapitalbeschaffung als
vorteilhaft."
1.2.2 Ziel der Untersuchung
Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, herauszuarbeiten, inwieweit die Bilanzierung nach
IFRS den Unternehmen Vorteile bei der Kapitalbeschaffung verschafft.
Dafür werden die Anforderungen der jeweiligen Adressaten an den Abschluss
aufgezeigt und hinterfragt. Letztendlich soll durch die Zusammenfassung der Vorteile
und Nachteile die Zweckmäßigkeit einer Einführung der IFRS für alle Marktteilnehmer
erörtert werden.
1.3 Gang
der
Untersuchung
Für den Gang der Untersuchung wurde folgender Ablauf gewählt:
Abbildung 1: Gang der Untersuchung
1. Ausgangslage,
Hypothese und
Zielstellung
2. Der Übergang auf einen
IFRS-Abschluss
3. Kapitalbeschaffung und
die Rolle der
Unternehmensdarstellung
5. Zusammenfassung der
Ergebnisse, Überprüfung der
Hypothese und Ausblick
4. Überprüfung der
Anforderungen auf
Vorteilhaftigkeit
Ausgangslage, Hypothese und Ziel der Untersuchung
3
Die Bilanzierungspraxis hat im Laufe der letzten Jahre einige grundlegende
Veränderungen durchlaufen. Die Anwendung der IFRS ist ab dem 01.01.2005 Pflicht
für alle kapitalmarktorientierten Unternehmen. Hinzu kommt die Möglichkeit für nicht
kapitalmarktorientierte Unternehmen, freiwillig nach IFRS zu bilanzieren.
Im zweiten Kapitel wird eine kurze Übersicht über Entwicklungen und Möglichkeiten
gegeben, die zum Übergang auf einen IFRS-Abschluss beigetragen haben.
In den zentralen Kapiteln drei und vier erfolgt eine genauere Untersuchung der
Kapitalbeschaffung und der Rolle der Unternehmensdarstellung. Zunächst werden
Entwicklungen in der Kapitalbeschaffung aufgezeigt und die Finanzierungsformen
näher betrachtet. Darauf aufbauend werden die verschiedenen Adressaten eines
Abschlusses und ihre jeweiligen Anforderungen an diesen herausgestellt.
Im vierten Kapitel werden die verschiedenen Anforderungen an den Abschluss auf
Basis der IFRS hinsichtlich der Aspekte Gläubigerschutz, tatsächliche Lage,
Prognosefähigkeit, Vergleichbarkeit und Nutzen für die Unternehmensführung
analysiert und getestet.
Kapitel fünf fasst die Erkenntnisse aus der Überprüfung der Anforderungen zusammen.
Hierbei wird diese Betrachtung um sonstige Aspekte ergänzt.
Anhand der Ergebnisse wird die eingangs aufgestellte Hypothese überprüft, ob die
Anwendung von IFRS den Unternehmen in Bezug auf die Kapitalbeschaffung
tatsächlich Vorteile bringen kann.
Mit einem Ausblick auf die zukünftige Entwicklung soll die Arbeit abgeschlossen
werden.
Der Übergang auf einen IFRS-Abschluss
4
2.
Der Übergang auf einen IFRS-Abschluss
2.1 Harmonisierung der Rechnungslegung in Deutschland
2.1.1 Gesetzgeberische Initiativen zur Erweiterung des HGB
Die Rechnungslegung wird in vielen kontinentaleuropäischen Ländern
1
umfassend
durch den Gesetzgeber geregelt. So beruht der Rahmen der deutschen Rechnungslegung
weitgehend auf den Normen des HGB.
Spätestens nach Verabschiedung und Umsetzung der 4., 7. und 8. EG-Richtlinie in den
achtziger Jahren
2
durch den deutschen Gesetzgeber nach europäischen Vorgaben
3
wurde offensichtlich, dass neben der handelsrechtlichen Rechnungslegung die
kapitalmarktorientierte Rechnungslegung bei vielen Unternehmen eine immer größere
Rolle spielen sollte.
4
Um diesen Ansprüchen gerecht zu werden und den Irritationen und
Abweichungen der dualen Rechnungslegung
5
entgegenzutreten, verabschiedete der
Gesetzgeber verschiedene Gesetze, die zur Harmonisierung der Rechnungslegung mit
internationalen Standards beitragen sollten.
Zu diesen Maßnahmen zählen unter anderem die Einführung des
Kapitalaufnahmeerleichterungsgesetzes (KapAEG) und die Einfügung des bis 2004
befristeten § 292a HGB, des Gesetzes zur Kontrolle und Transparenz im
Unternehmensbereich (KonTraG)
6
und dem neu eingefügten § 342 HGB mit Gründung
des Deutschen Rechnungslegungsstandards (DRSC), des Kapitalgesellschaften- und
Co-Richtlinien-Gesetzes (KapCoRiLiG) sowie des Gesetzes zur weiteren Reform des
Aktien- und Bilanzrechts, zu Transparenz und Publizität (TransPuG).
7
1
Das kontinentaleuropäische Bilanzierungssystem wird oftmals ,,code law" genannt und u. a. in
Deutschland und Frankreich, aber auch Japan angewandt, vgl. z. B. Ammann, H./Müller, S.: IFRS,
2004, S. 65; Pellens, B.: Internationale Rechnungslegung, 2001, S. 415.
2
Zur detaillierteren Ausgestaltung und Umsetzung der EG-Richtlinien vgl. z. B. Achleitner, A.-
K./Behr, G.
:
International Accounting Standards, 2003, S. 29-30; Auer, K. V.
:
Rechnungslegungsstandards, 1996, S. 59-69; Glaum, M./Mandler, U.: Rechnungslegung, 1996, S.
11.
3
Vgl. u. a. Ammann, H./Müller, S.: IFRS, 2004, S. 49; Stahl, A. B.: IAS/IFRS, 2004, S. 43-50.
4
Vgl. Pellens, B.: Internationale Rechnungslegung, 2001, S. 531. Von einer grundlegenden
Neuorientierung der deutschen Rechnungslegungsvorschriften spricht Busse von Colbe, W.:
Paradigmenwechsel, 2002, S. 161.
5
Vgl. Ammann, H./Müller, S.: IFRS, 2004, S. 49.
6
Zu den Auswirkungen des KapAEG und des KonTraG vgl. Pellens, B./Bonse, A./Gassen, J.:
Konzernrechnungslegung, 1998, S. 785-792.
7
Zur genauen Zielsetzung der jeweiligen Gesetze vgl. u. a. Ammann, H./Müller, S.: IFRS, 2004, S.
50-59; Förschle, G./Glaum, M./Mandler, U.: Internationale Rechnungslegung, 1998, S. 2281. Zum
TransPuG vgl. Ammann, H./Hucke, A.: Modernisierung, 2002, S. 689.
Der Übergang auf einen IFRS-Abschluss
5
2.1.2 Die Anwendung internationaler Rechnungslegungsstandards lt. EU-
Verordnung vom 14.09.2002
Der europäische Gesetzgeber hat im Jahre 2002 eine neue Richtung in der Entwicklung
des Bilanzrechtes eingeschlagen, indem er die Verordnung Nr. 1606/2002 zur
Anwendung internationaler Rechnungslegungsstandards (IAS-Verordnung)
verabschiedet hat
8
. Nach dieser Verordnung sind kapitalmarktorientierte Unternehmen
in den europäischen Mitgliedsstaaten ab dem Jahre 2005 zur Anwendung der
International Financial Reporting Standards (IFRS)
9
verpflichtet. Diese grundsätzliche
IFRS-Pflicht gilt jedoch zuerst nur für den Konzernabschluss.
10
Der Bundestag hat im Rahmen des am 29. Oktober 2004 verabschiedeten
Bilanzreformgesetzes (BilReG) erlassen, dass auch nicht kapitalmarktorientierte
Unternehmen ihre Konzernabschlüsse freiwillig auf IFRS umstellen können.
11
Ergänzend hierzu haben laut IAS-Verordnung alle europäischen Mitgliedsstaaten die
Möglichkeit, die Anwendung der internationalen Rechnungslegung auch auf den
Einzelabschluss kapitalmarktorientierter oder sogar aller Unternehmen zu erweitern.
12
In Deutschland bildet der HGB-Abschluss hierbei weiter die Ausschüttungs- und
Steuerbemessungsgrundlage
13
, die Unternehmen können jedoch das IFRS-Wahlrecht
auch beim Einzelabschluss wahrnehmen. Die Rechnungslegung nach IFRS läuft dann
parallel zum HGB-Abschluss und dient Informationszwecken.
14
Abbildung 2 fasst die Möglichkeiten zusammen:
8
Vgl. z.B. Federmann, R. /IASCF-London: IAS/IFRS-stud., 2004, S. 12; Ernst, C.: Auswirkungen,
2003, S. 1487.
9
Unter IFRS versteht man die früheren IAS-Vorschriften und die jetzigen IFRS-Vorschriften. Im
folgenden Verlauf der Untersuchung wird der aktuelle Begriff IFRS verwendet. Zur Entwicklung der
IAS/IFRS und der am Entwicklungsprozess beteiligten Institutionen vgl. z. B. Achleitner, A.-
K./Behr, G.: International Accounting Standards, 2003, S. 28-51; Ammann, H./Müller, S.: IFRS,
2004, S. 65-70; Kirsch, H.: Internationale Rechnungslegung, 2003, S. 3-13.
10
Vgl. Mandler, U.: Mittelstand, 2004, S. 1.
11
Vgl. Hahn, K.: Bilanzen, 2004, S. 20.
12
Vgl. Kirsch, H.-J./Dohrn, M./Wirth, J.: Rechnungslegungs- und Prüfungspraxis, 2002, S. 1218.
13
Vgl. Ernst, C.: Auswirkungen, 2003, S. 1489.
14
Vgl. u. a. Ammann, H./Müller, S.: IFRS, 2004, S. 60-61; Federmann, R. /IASCF-London:
IAS/IFRS-stud., 2004, S. 12; Mandler, U.: Mittelstand, 2004, S. 1.
Der Übergang auf einen IFRS-Abschluss
6
Abbildung 2: Zukünftige Rechnungslegungsvorschriften in Deutschland
15
2.2 Ausgestaltung
und
Unterschiede
2.2.1 Entwicklung der IFRS und Ausgestaltung
Die IFRS, als internationale Rechnungslegungsstandards, werden als Regelungen des
privatrechtlich organisierten IASC verstanden, welches 1973 in London gegründet
wurde. Auch nach seiner Restrukturierung im Jahr 2001 verfolgt das jetzige IASB die
Aufgabe des Standard Setters
16
, der die Harmonisierung der internationalen
Rechnungslegung durch ein praxisnahes, flexibles und schnelles Regelungswerk
vorantreibt.
17
Das IFRS-System besteht aus drei Teilbereichen
18
, die im Anhang 2 wiedergegeben
werden. Das Regelwerk der IFRS wird als Oberbegriff angesehen und umfasst die
älteren IAS und die neueren IFRS.
19
Derzeit besteht es aus 41 (davon 33 aktuell
gültigen) Standards.
20
15
Entnommen aus Buchholz, R.: Jahresabschluss, 2004, S. 10. Vgl. auch Mandler, U.: Mittelstand,
2004, S. 111; ergänzend hierzu auch Anhang 1.
16
Vgl. Müller, S.: Management-Rechnungswesen, 2003, S. 71.
17
Zur detaillierteren Darstellung der Entwicklung der IAS/IFRS und des IASB vgl. u. a. Ammann,
H./Müller, S.: IFRS, 2004, S. 65-67; Mandler, U.: Mittelstand, 2004, S. 21-27; Schierenbeck, H.:
Betriebswirtschaftslehre, 2003, S. 525-529; Stahl, A. B.: IAS/IFRS, 2004, S. 23-27; Wöhe, G.:
Betriebswirtschaftslehre, 2000, S. 1007.
Einen Gesamtüberblick über das aktuelle Arbeitsprogramm des IASB erhält man unter
www.iasb.org.uk bzw. www.iascf.com (Stand 01.11.2004).
18
Zu Erläuterungen der genauen Ausgestaltung der drei Teilbereiche vgl. z. B. Buchholz, R.:
Jahresabschluss, 2004, S. 211-213.
19
Vgl. Buchholz, R.: Jahresabschluss, 2004, S. 211.
20
Vgl. z. B. Ammann, H./Müller, S.: IFRS, 2004, S. 67. Die aktuell gültigen Standards sind im Anhang
3 aufgelistet.
Konzernabschluss Einzelabschluss
Kapitalmarktorientierte Pflicht für IFRS
· Grundsätzlich HGB
Unternehmen
(EU-Verordnung)
·
Unternehmenswahl-
recht
für
IFRS-
Offenlegung
Übrige Unternehmen
Wahlrecht für IFRS
(Nationales Gesetz)
Der Übergang auf einen IFRS-Abschluss
7
Ergänzend hierzu hat der der IASB im Juni 2003 den IFRS 1 veröffentlicht, der die Art
und Weise der erstmaligen Anwendung der IAS/IFRS bei der Umstellung auf die
internationale Rechnungslegung regelt.
21
Hinzu kommen ständig neue IFRS-Standards, die vom IASB-Board entwickelt,
überprüft und dann veröffentlicht werden.
22
2.2.2 Grundlegende Unterschiede zwischen IFRS und HGB
Die IFRS-Rechnungslegung dient gemäß Framework.12 der Bereitstellung von
Informationen, die für die wirtschaftlichen Entscheidungen der verschiedenen
Jahresabschlussadressaten relevant sind.
Die IFRS erfüllen demnach ausschließlich eine Informationsfunktion. Häufig wird in
diesem Zusammenhang auch von einer investorenorientierten Rechnungslegung
gesprochen.
23
Der Bereitstellung von entscheidungsrelevanten Informationen (decision
usefulness)
24
liegen in der IFRS-Rechnungslegung die Konzepte von periodengerechter
Gewinnermittlung (Periodenabgrenzung) und der Unternehmensfortführung (Going
Concern) zu Grunde.
Aus diesen Grundsätzen lassen sich verschiedene qualitative Anforderungen an einen
IFRS-Abschluss ableiten. Hierzu zählen die Verständlichkeit, Relevanz, Verlässlichkeit
und Vergleichbarkeit von Informationen.
25
Kapitel 2.3 geht näher auf diese Ziele ein.
Die grundsätzlichen Unterschiede
26
zwischen IFRS und HGB bestehen jedoch in der
Zielsetzung der jeweiligen Rechnungslegungsordnungen. Die IFRS verfolgen das
primäre Ziel, den Jahresabschlussadressaten einen Einblick in die tatsächlichen
Verhältnisse zu verschaffen (Monozielsetzung).
21
Vgl. Mandler, U.: Mittelstand, 2004, S. 42.
22
Bis zum Dezember 2004 hat das IASB-Board die IFRS 2-6 veröffentlicht (Stand 20.12.2004). Zu
aktuellen Entwicklungen und den Inhalten neuer Standards vgl. z. B.
www.standardsetter.de/drsc/news/news.php.
23
Vgl. Kirsch, H.: Internationale Rechnungslegung, 2003, S. 19.
24
Vgl. z. B. Kirsch, H.: Internationale Rechnungslegung, 2003, S. 19; Schierenbeck, H.:
Betriebswirtschaftslehre, 2003, S. 527.
25
Zur genaueren Betrachtung der allgemeinen Grundsätze der IFRS vgl. z. B. Kirsch, H.: Internationale
Rechnungslegung, 2003, S. 19-29; Risse, A.: International Accounting Standards, 1996, S. 100-103.
26
Zu den genaueren Unterschieden zwischen IFRS und HGB-Konzept vgl. z. B. Jebens, C.: IAS, 2003,
S. 1-3.
Der Übergang auf einen IFRS-Abschluss
8
Die HGB-Bilanzierung kennt dagegen mehrere Zwecke, wobei die
Informationsfunktion mit der (vorsichtigen) Ausschüttungsbemessung und
Steuerbemessungsfunktion in Konflikt geraten kann (Multizielsetzung)
.
27
Folgende Abbildung
28
stellt die offensichtlichen Unterschiede dar:
Abbildung 3: Grundlegende Unterschiede zwischen HGB und IAS/IFRS
2.3 Ziele des IFRS-Abschlusses im Vergleich zum HGB-Abschluss
2.3.1 Erhöhung
der
Transparenz
Die Rechnungslegung nach IFRS verfolgt das Prinzip des ,,true-and-fair-view" bzw. der
,,fair presentation".
29
Dies unterstützt die Monozielsetzung der IFRS, den jeweiligen
Interessensgruppen des Abschlusses alle entscheidungsrelevanten Informationen
27
Vgl. Mandler, U.: Mittelstand, 2004, S. 9-11.
28
Vgl. Glaum, M./Mandler, U.: Rechnungslegung, 1996, S. 28; Mandler, U.: Mittelstand, 2004, S. 13.
29
Vgl. u. a. Ammann, H./Müller, S.: IFRS, 2004, S. 67; Auer, K. V.: Rechnungslegungsstandards,
1996, S. 109. Zum Konflikt zwischen IFRS und HGB bzw. true and fair view und Erfüllung von
Gesetzesnormen vgl. z. B. Castan, E.: Rechnungslegung, 1993, S. 19-20.
HGB
IAS/IFRS
Rahmenbedingungen
Entstehungszusammenhang
Bankendominierte
Finanzmarktorganisation
Globalisierung der
Kapitalmärkte
Normensetzende Instanz
Gesetzgeber
(kodifiziertes Bilanzrecht)
private Rechnungs-
legungsinstitution (IASB)
Bedeutung des Steuersystems
Handels- und Steuerrecht
eng verbunden
(Maßgeblichkeitsprinzip)
Handels- und Steuerrecht
getrennt
Rechnungslegung
Dominierender Grundsatz
Vorsichtsprinzip
,,Informationsnützlichkeit"
(true and fair view)
Bilanzpolitik
Gewinn
Offenlegungsanforderungen
Zahlreiche Bilanzierungs-
und Bewertungswahlrechte
weitgehender Verzicht auf
Wahlrechte angestrebt
(relativ) gering
(relativ) hoch und volatil
begrenzt
sehr umfangreich
Der Übergang auf einen IFRS-Abschluss
9
bereitzustellen.
30
Hierbei wird auf vollständige Dokumentation und Information
zurückgegriffen.
31
Der IFRS-Abschluss dient im Vergleich zum HGB-Abschluss weder der
Ausschüttungsregelung noch stellt er Grundlage für die Steuerbemessung dar, sodass er
fast ohne Verzerrungen
32
einen Überblick über die tatsächliche Vermögens-, Finanz-
und Ertragslage sowie Veränderungen in der Vermögens- und Finanzlage des
jeweiligen Unternehmens geben kann.
33
Die Informationen, die durch den IFRS-Abschluss vermittelt werden, müssen nach den
zu Grunde liegenden Annahmen der internationalen Rechnungslegung verschiedene
qualitative Anforderungen erfüllen. Die Verständlichkeit der jeweiligen Informationen,
deren Relevanz, Verlässlichkeit und Vergleichbarkeit unterstützen den
Transparenzeffekt.
34
Feststellend lässt sich sagen, dass der IFRS-Abschluss aufgrund der Betonung der
Informationsfunktion und der Orientierung an Investorenzielen anders ausgerichtet ist
als der HGB-Abschluss. Dies führt zu Unterschieden in den
Rechnungslegungsprinzipien und der Bilanzierung einzelner Posten.
35
2.3.2 Verbesserung der Vergleichbarkeit
Die Verbesserung der Vergleichbarkeit durch einen IFRS-Abschluss spiegelt sich in
zwei Arten der Vergleichbarkeit wieder.
Zum einen lassen sich durch eine übereinstimmende Art der Rechnungslegung
verschiedene Unternehmen besser miteinander vergleichen. Mussten früher HGB-
Abschlüsse in aufwendigen Verfahren unter Berücksichtigung der vielen Wahlrechte
30
Vgl. Ammann, H./Müller, S.: IFRS, 2004, S. 68.
31
Vgl. Buchholz, R.: Jahresabschluss, 2004, S. 215.
32
Die IFRS können trotz des Grundsatzes der fair presentation Verzerrungen bei der Abbildung von
stillen Reserven nicht komplett ausschließen. Vgl. Ammann, H./Müller, S.: IFRS, 2004, S. 75.
33
Vgl. z. B. Ammann, H./Müller, S.: IFRS, 2004, S. 68-69; Born, K.: Rechnungslegung, 2001, S. 12;
Buchholz, R.: Jahresabschluss, 2004, S. 215-216;
34
Zu einer genaueren Darstellung der allgemeinen Grundsätze der IFRS vgl. z. B. Kirsch, H.:
Internationale Rechnungslegung, 2003, S. 19-29.
35
Vgl. Buchholz, R.: Jahresabschluss, 2004, S. 216.
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Originalausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2005
- ISBN (eBook)
- 9783832442866
- ISBN (Paperback)
- 9783838642864
- DOI
- 10.3239/9783832442866
- Dateigröße
- 611 KB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- Carl von Ossietzky Universität Oldenburg – Diplom-Wirtschaftswissenschaften
- Erscheinungsdatum
- 2005 (April)
- Note
- 1,3
- Schlagworte
- international basel abschluss ifrs kredit
- Produktsicherheit
- Diplom.de