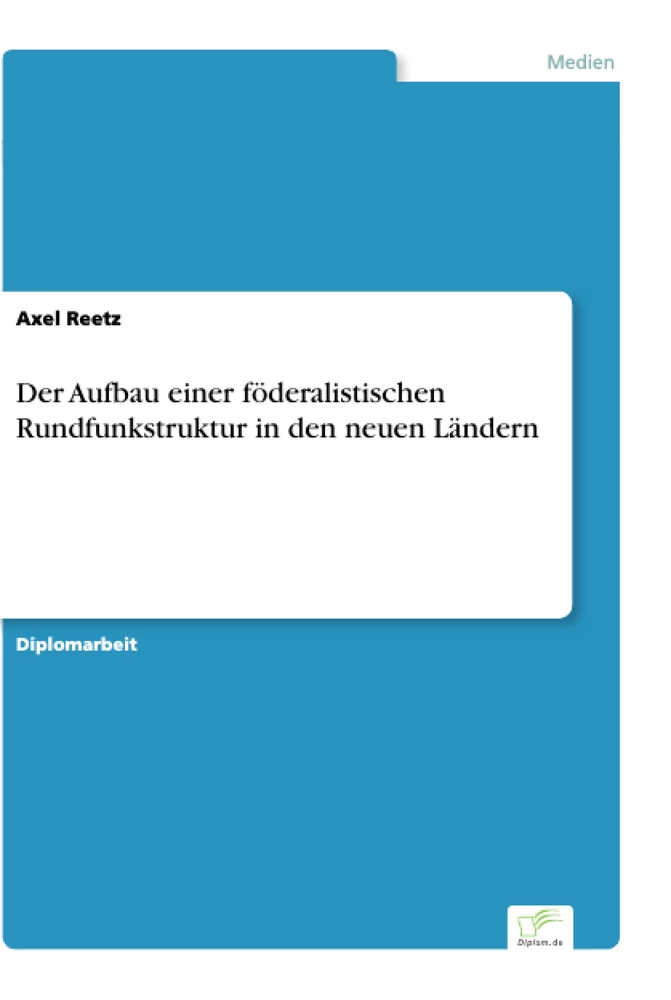Der Aufbau einer föderalistischen Rundfunkstruktur in den neuen Ländern
©1993
Diplomarbeit
120 Seiten
Zusammenfassung
Inhaltsangabe:Problemstellung:
Der Beitritt der DDR zum Geltungsbereich des Grundgesetzes bedeutete die komplette Übernahme des Institutionssystems der Bundesrepublik Deutschland. Was wie zu reformieren oder wie der Volksmund sagte abzuwickeln war, wurde im Einigungsvertrag festgelegt. Dessen Artikel 36 verlangte die Liquidierung des zentralisierten DDR-Rundfunks und die Gründung von Landesrundfunkanstalten.
Dieses Politikfeld gilt schon lange im Westen wegen der Macht der Publizistik als stark dem Einfluss der politischen Parteien ausgesetzt. Und weil die Medienpolitik eine der wenigen Domänen der Landespolitik ist, gilt dieser Bereich als Spielwiese der Landesfürsten. Der Einigungsvertrag wurde auf Seiten der DDR jedoch durch die Regierung Lothar de Maizières ausgehandelt und nicht durch die Landesregierungen der neuen Länder. Die Landtagswahlen fanden dort erst am 14. Oktober, knapp zwei Wochen nach dem Tag der Vereinigung, statt.
Das institutionelle Vakuum, welches zunächst die SED und schließlich die vornehmlich aus Geistlichen bestehende Regierung der DDR hinterlassen hatten, füllten die Parteien auf Grund ihres organisatorischen Vorsprungs schnell aus, da sie als einzige - das gilt insbesondere für die gewendeten Blockparteien - keine neuen Apparate zu implementieren brauchten. Haben die Parteien deshalb leichteres Spiel gehabt, die Diskussionen in Ostdeutschland während der Aufbauphase der neuen Rundfunkanstalten zu dominieren?
Wieso sich die Regierungen der neuen Länder nicht darauf einigen konnten, sich mit einem gemeinsamen Staatsvertrag für die billigste aller Lösungen zu entscheiden, nämlich aus dem ehemaligen DDR-Rundfunk eine gemeinsame Anstalt zu machen und eine Vielzahl von populären Formaten und Sendungen wie Ein Kessel Buntes, Elf 99 oder das Jugendradio DT64 zu erhalten, wird in der Diplomarbeit nachgezeichnet.
Dabei sind Tendenzen damaliger parteipolitischer Strukturen zu konstatieren, die etwa drei CDU-geführte Länder (Sachsen, Thüringen und Sachsen-Anhalt) den MDR gründen ließen. Aber nicht nur. Landsmannschaftliche Konkurrenz spielte ebenso eine bedeutende Rolle, allem voran die Angst der neuen Länder vor dem Koloss Berlin und seiner im Westen bereits existierenden Rundfunkanstalt. Umstände, die das damals ebenfalls CDU-regierte Mecklenburg-Vorpommern in die Hände des als links geltenden NDR trieben.
Der durch die in Artikel 36 festgelegte Befristung entstandene Zeitdruck während der Neuordnung des ostdeutschen […]
Der Beitritt der DDR zum Geltungsbereich des Grundgesetzes bedeutete die komplette Übernahme des Institutionssystems der Bundesrepublik Deutschland. Was wie zu reformieren oder wie der Volksmund sagte abzuwickeln war, wurde im Einigungsvertrag festgelegt. Dessen Artikel 36 verlangte die Liquidierung des zentralisierten DDR-Rundfunks und die Gründung von Landesrundfunkanstalten.
Dieses Politikfeld gilt schon lange im Westen wegen der Macht der Publizistik als stark dem Einfluss der politischen Parteien ausgesetzt. Und weil die Medienpolitik eine der wenigen Domänen der Landespolitik ist, gilt dieser Bereich als Spielwiese der Landesfürsten. Der Einigungsvertrag wurde auf Seiten der DDR jedoch durch die Regierung Lothar de Maizières ausgehandelt und nicht durch die Landesregierungen der neuen Länder. Die Landtagswahlen fanden dort erst am 14. Oktober, knapp zwei Wochen nach dem Tag der Vereinigung, statt.
Das institutionelle Vakuum, welches zunächst die SED und schließlich die vornehmlich aus Geistlichen bestehende Regierung der DDR hinterlassen hatten, füllten die Parteien auf Grund ihres organisatorischen Vorsprungs schnell aus, da sie als einzige - das gilt insbesondere für die gewendeten Blockparteien - keine neuen Apparate zu implementieren brauchten. Haben die Parteien deshalb leichteres Spiel gehabt, die Diskussionen in Ostdeutschland während der Aufbauphase der neuen Rundfunkanstalten zu dominieren?
Wieso sich die Regierungen der neuen Länder nicht darauf einigen konnten, sich mit einem gemeinsamen Staatsvertrag für die billigste aller Lösungen zu entscheiden, nämlich aus dem ehemaligen DDR-Rundfunk eine gemeinsame Anstalt zu machen und eine Vielzahl von populären Formaten und Sendungen wie Ein Kessel Buntes, Elf 99 oder das Jugendradio DT64 zu erhalten, wird in der Diplomarbeit nachgezeichnet.
Dabei sind Tendenzen damaliger parteipolitischer Strukturen zu konstatieren, die etwa drei CDU-geführte Länder (Sachsen, Thüringen und Sachsen-Anhalt) den MDR gründen ließen. Aber nicht nur. Landsmannschaftliche Konkurrenz spielte ebenso eine bedeutende Rolle, allem voran die Angst der neuen Länder vor dem Koloss Berlin und seiner im Westen bereits existierenden Rundfunkanstalt. Umstände, die das damals ebenfalls CDU-regierte Mecklenburg-Vorpommern in die Hände des als links geltenden NDR trieben.
Der durch die in Artikel 36 festgelegte Befristung entstandene Zeitdruck während der Neuordnung des ostdeutschen […]
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
ID 3179
Reetz, Axel: Der Aufbau einer föderalistischen Rundfunkstruktur in den Neuen Ländern /
Axel Reetz - Hamburg: Diplomica GmbH, 2001
Zugl.: Konstanz, Universität, Diplom, 1993
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte,
insbesondere die der Übersetzung, des Nachdrucks, des Vortrags, der Entnahme von
Abbildungen und Tabellen, der Funksendung, der Mikroverfilmung oder der
Vervielfältigung auf anderen Wegen und der Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen,
bleiben, auch bei nur auszugsweiser Verwertung, vorbehalten. Eine Vervielfältigung
dieses Werkes oder von Teilen dieses Werkes ist auch im Einzelfall nur in den Grenzen
der gesetzlichen Bestimmungen des Urheberrechtsgesetzes der Bundesrepublik
Deutschland in der jeweils geltenden Fassung zulässig. Sie ist grundsätzlich
vergütungspflichtig. Zuwiderhandlungen unterliegen den Strafbestimmungen des
Urheberrechtes.
Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in
diesem Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme,
dass solche Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei
zu betrachten wären und daher von jedermann benutzt werden dürften.
Die Informationen in diesem Werk wurden mit Sorgfalt erarbeitet. Dennoch können
Fehler nicht vollständig ausgeschlossen werden, und die Diplomarbeiten Agentur, die
Autoren oder Übersetzer übernehmen keine juristische Verantwortung oder irgendeine
Haftung für evtl. verbliebene fehlerhafte Angaben und deren Folgen.
Diplomica GmbH
http://www.diplom.de, Hamburg 2001
Printed in Germany
INHALT
A
BKÜRZUNGEN
V
I. E
INLEITUNG
1
I.1. Untersuchungsfragen
3
I.2. Vorgehensweise
4
I.3. Aufbau der Arbeit
5
I.4. Rahmenbedingungen der Rundfunkpolitik
6
I.4.1. Länderhoheit
6
I.4.2. Rundfunkfreiheit
7
I.4.2.1. Anspruch der Meinungsfreiheit
7
I.4.2.2. Umsetzung in der Rundfunkgesetzgebung
7
II. D
IE
R
UNDFUNKPOLITIK DER
DDR
9
II.1. DDR-Rundfunk als dritte Anstalt?
9
II.2. Regionalisierung des DDR-Rundfunks
10
II.3. Kooperationsmodelle zwischen Ost und West
10
II.4. Einigungsvertrag statt Rundfunküberleitungsgesetz
11
III. D
IE RUNDFUNKPOLITISCHE
N
EUORDNUNG
13
III.1. Der neue ZDF-Staatsvertrag
13
III.1.1. Die Ausdehnung des ZDF auf die neuen Länder
13
III.1.2. Querelen um die Gremienbesetzung
14
III.1.3. Resümee
15
III.2. Die Gründung des MDR
16
III.2.1. Die Entscheidung für eine Drei-Länder-Anstalt
16
III.2.2. Übernahme von Personal der Einrichtung
17
III.2.3. Ratifizierung des Staatsvertrages
17
III.2.3.1. Bedenken der thüringischen FDP
17
III.2.3.2. Verabschiedung des Staatsvertrags
18
III.2.4. Ist der MDR-Stattsvertrag verfassungswidrig?
19
III.2.5. Resümee
20
II
III.3. Alternativen der nordostdeutschen Rundfunkpolitik
21
III.3.1. Die Empfehlungen des Regionalausschusses
21
III.3.2. Nordostdeutsche Lösung?
22
III.3.2.1. Der 3+1-Vorschlag
23
III.3.2.2. Übernahme von Mitarbeitern der Einrichtung
24
III.3.2.3. Rundfunkpolitik im Bundeskanzleramt
24
III.3.3. Das Chaos der nordostdeutschen Rundfunkpolitik
25
III.3.3.1. SPD-Fraktion kontra Landesregierung in Brandenburg
25
III.3.3.2. Koalitionszwist in Mecklenburg-Vorpommern
26
III.3.3.3. Die Akzeptanz von SFB und NDR
27
III.3.3.4. Die NOR-Einigung
28
III.3.3.4.1. Gegenstand der Kompromißlösung
28
III.3.3.4.2. Gomolka kontra Goldbeck
28
III.3.3.4.3. Reaktionen in Berlin und Brandenburg
30
III.3.3.5. Erneute Chance für den NOR?
32
III.3.3.5.1. Das Mikat-Gutachten
32
III.3.3.5.2. Brandenburger Gesetzesvorlage
33
III.3.3.6. Das Scheitern der NORA
34
III.3.3.6.1. Wachsender Widerstand in Berlin
34
III.3.3.6.2. Eklat in Schwerin
35
III.3.3.6.3. Das Hybrid-Modell
36
III.3.4. Resümee
37
III.3.5. Getrennte Wege der nordostdeutschen Rundfunkpolitik
39
III.3.5.1. NDR-Beitrittsverhandlungen
39
III.3.5.2. Die Gründung des ORB
40
III.3.5.2.1. Birthler kontra von Sell
40
III.3.5.2.2. Novellierung des brandenburgischen Rundfunkgesetzes
41
III.3.5.2.3. Die Verwaltungsratswahl
42
III.3.5.3. Die Zukunft des SFB als Hauptstadtsender
42
III.3.5.4. Kooperation zwischen Berlin und Brandenburg
43
III.3.5.4.1. Öffentlich-rechtliche RIAS 2-Fortführung
43
III.3.5.4.2. Kooperation im dritten Fernsehprogramm
44
III.3.5.4.3. Kooperation im Hörfunk
46
III.3.5.4.4. Die Staatsvertragsverhandlungen
48
III.3.5.4.5. Verfassungsklage von SFB und ORB
49
III.3.6. Resümee
51
III
III.4. Der Kampf um den Erhalt des Jugendradios DT64
53
III.4.1. Wird DT64 privatisiert?
53
III.4.2. Einfallsreiche Macher erhalten lebhaftes Echo
54
III.4.3. Ignoranz der Politik gegenüber DT64
55
III.4.4. Der "heisse DT64-Herbst"
56
III.4.5. Die spektakulären Aktionen der DT64-Fans
57
III.4.6. Die plötzliche MDR-Übernahme
58
III.4.7. Erhalt von DT64 als Frequenzokkupation?
59
III.4.8. Zwiespältige Zukunft von DT64
60
III.4.9. Resümee
60
III.5. Der nationale Hörfunk
61
III.5.1. Die Betroffenen Sender erarbeiten Erhaltungskonzepte
61
III.5.2. Erste Verhandlungsrunde
62
III.5.2.1. Das Engholm-Streibl-Papier
62
III.5.2.2. Reaktion der RIAS-Intendanz
63
III.5.2.3. Positionen von ARD und ZDF
64
III.5.2.4. Die Position des DLF
64
III.5.2.5. Das "Tohuwabohu" der Interessen
65
III.5.3. Zweite Verhandlungsrunde
66
III.5.3.1. Die Sender ergreifen die Initiative
67
III.5.3.2. Position des ZDF
67
III.5.4. Dritte Verhandlungsrunde
68
III.5.4.1. Fünf Modelle der Ministerpräsidenten
68
III.5.4.2. Reaktionen der Medienlandschaft
68
III.5.4.3. Das "PARKEN" von DS Kultur
69
III.5.4.4. Wird DS Kultur doch eingestellt?
70
III.5.5. Vierte Verhandlungsrunde
70
III.5.6. Fünfte Verhandlungsrunde
71
III.5.6.1. Sachsens DLF-"Coup"
72
III.5.6.2. Meinungsaustausch
73
III.5.6.3. SPD-Position
73
III.5.6.4. ARD und ZDF verständigen sich
74
III.5.6.5. Entscheidung in weiter Ferne
75
III.5.7. Sechste Verhandlungsrunde
75
III.5.7.1. Disput über Gremienorganisation
75
IV
III.5.7.2. Nun doch weniger Programme?
78
III.5.8. Siebte Verhandlungsrunde
78
III.5.9. Resümee
79
IV. S
CHLUSSBETRACHTUNG
82
IV.1. Die Akteurskonstellation
82
IV.2. Welche Konzepte vertraten die Akteure?
82
IV.2.1. Auflösung im Osten - Erhalt im Westen
83
IV.2.1.1. Ostdeutsche Beweggründe
83
IV.2.1.2. Westdeutsche Beweggründe
84
IV.2.2. Zeitnot durch die Befristung
84
IV.3. Welche Konzepte setzten sich warum durch?
85
IV.3.1. Das Ost-West-Verhältnis
86
IV.3.2. Landsmannschaftliche Bindungen
86
IV.4. Parallelen zur westdeutschen Rundfunkpolitik
87
IV.4.1. Geforderte Innovation fand nicht statt
87
IV.4.2. Deutlicher Parteieneinfluss
88
IV.5. Resümee
89
P
ERSONENREGISTER
i
Q
UELLENVERZEICHNIS
iii
1. Literaturverzeichnis
iii
2. Zeitungen und Zeitschriften
v
3. Dokumentenverzeichnis
v
4. Interviewpartner
vi
A
NHANG
viii
Anhang 1: Artikel 36 Einigungsvertrag
viii
Anhang 2: Engholm-Streibl-Papier
ix
Anhang 3: Empfehlungen der SvgMo
x
Anhang 4: Berliner Koalitionsvereinbarung
xi
Anhang 5: 18 Grundpositionen über den NOR
xii
Anhang 6: SPD Aufruf zur Rettung von DT64
xiii
V
ABKÜRZUNGEN
AfP
Archiv für Presserecht
AKK
Anstalt für Kabelkommunikation, Berlin
ARD
Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten
der Bundesrepublik Deutschland
BM Berliner
Morgenpost
BR Bayerischer
Rundfunk
BVerfG Bundesverfassungsgericht
CDU
Christlich Demokratische Union Deutschlands
DDR
Deutsche Demokratische Republik
DFF Deutscher
Fernsehfunk
DLF Deutschlandfunk
DÖV
Die öffentliche Verwaltung
dpa Deutsche
Presseagentur
DS Kultur
Deutschlandsender Kultur (ehemals "Stimme der DDR")
DT 64
Zum Deutschlandtreffen der DDR-Jugend 1964
gegründeter
Jugendsender
DW Deutsche
Welle
epd
Evangelischer Pressedienst Kirche und Rundfunk
EVertr. Einigungsvertrag
FAZ
Frankfurter Allgemeine Zeitung
F.D.P.
Freie demokratische Partei (im Text FDP)
FK Funk-Korrespondenz
FR Frankfurter
Rundschau
GG Grundgesetz
HR Hessischer
Rundfunk
KPPG
Kabelpilotprojekt Gesetz (Berlin)
LVZ Leipziger
Volkszeitung
MABB
Medienanstalt Berlin Brandenburg
MdB
Mitglied des Deutschen Bundestages
MDR Mitteldeutscher
Rundfunk
MW Mittelwelle
ND Neues
Deutschland
NDR Norddeutscher
Rundfunk
NZ Neue
Zeit
VI
ODR
Ostdeutscher Rundfunk (später ORB)
ORB
Ostdeutscher Rundfunk Brandenburg
PDS
Partei des demokratischen Sozialismus (vormals SED)
PVS Politische
Vierteljahresschrift
RB Radio
Bremen
RBr
Rundfunk Brandenburg (später ODR und ORB)
RIAS (TV)
Radio im amerikanischen Sektor (seit 1988 auch TV)
SäZ Sächsische
Zeitung
SED
Sozialistische Einheitspartei Deutschlands
SFB
Sender Freies Berlin
SPD
Sozialdemokratische Partei Deutschlands
SR Saarländischer
Rundfunk
StB
Stenographischer Bericht: Legislaturperiode, Sitzung, Datum
SvgMo Sachverständigengruppe
Medienordnung
SZ Süddeutsche
Zeitung
taz die
tageszeitung
Tsp Der
Tagesspiegel
UKW Ultra
Kurzwelle
WDR Westdeutscher
Rundfunk
Welt Die
Welt
ZDF
Zweites Deutsches Fernsehen
Zeit Die
Zeit
I. EINLEITUNG
Der Umbruch im DDR-Rundfunk begann am 9. Oktober 1989 während der Großdemonstration
im Stadtzentrums Leipzigs. Der Sender Leipzig hatte damals ein Wagnis begangen, indem immer
wieder ein Aufruf des Gewandhausorchesterdirektors Kurt Masur zur Gewaltlosigkeit
ausgestrahlt wurde (Müller 1990: 1). Trotzdem vollzog sich die Wende im Rundfunk der DDR
insgesamt später als in der Politik, nämlich nicht vor, sondern nach dem 9. November. Nachdem
sie jedoch geglückt war, nahmen sich die Funkhäuser in der folgenden Zeit einfach die schon
immer gewünschte Freiheit von der Berliner Zentrale und weiteten ihr Programm aus.
Diese Periode endete mit dem Abschluß des Einigungsvertrages (EVertr.). Dieser machte
zunächst bewußt, daß die DDR bald aufhören würde zu existieren, und mit ihr der Ost-Berliner
Rundfunk. Vielfältige Versuche, Modelle für eine Erhaltung zu finden, scheiterten ausnahmslos.
Einhergehend mit dieser häufig als "Abwicklung" bezeichneten Auflösung der Einrichtung, die
auf den 31. Dezember 1991 befristet wurde, entstand die neue Rundfunklandschaft.
In vielen Diskussionen mit Mitarbeitern Sachsen Radios noch vor Ablauf der Auflösungsfrist im
Spätsommer 1991, war die Trauer über das Ende des gerade erst aufgebauten Systems mit seinen
Freiräumen nicht zu überhören. Viele Redakteure und leitende Angestellte hatten lange Jahre
hindurch beim Sender Leipzig für mehr Autonomie von der Berliner Zentrale, ja mehr
journalistische Freiheit schlechthin gekämpft und schließlich nach der gewonnenen Möglichkeit
mit viel selbstlosem Einsatz den sächsischen Landessender aufgebaut und ihm unter Direktor
Manfred Müller zu hoher Publikumsgunst verholfen.
Noch bevor dieser Umbruch abgeschlossen war und eben auch bevor eine Diskussion über das
künftige Rundfunksystem durch die Regierungen der neuen Länder geführt werden konnte, waren
die Eckpunkte der Transformation des ostdeutschen Rundfunksystems von Bundesregierung und
DDR-Regierung bereits festgelegt worden. Der Grund dafür lag nicht zuletzt in der Entscheidung
der Volkskammer, die deutsche Vereinigung in Form eines Beitritts nach Artikel 23 Grundgesetz
(GG) zu vollziehen.
Die Regelungen des Artikels 36 EVertr.
1
für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk waren trotzdem
sehr umstritten. Häufig wurde kritisiert, der Prozeß des notwendigen Zusammenwachsens der
beiden deutschen Staaten sei - hier wie in vielen anderen Fragen - ausschließlich an den
Interessen der westdeutschen Seite orientiert, die nicht bereit war, ihren institutionellen Rahmen
aufzugeben (Lehmbruch 1990: 463). Dies aber implizierte schon die Vereinigung durch den
1
Artikel 36 EVertr.: siehe Anhang 1.
2
"Beitritt" der DDR zum GG. Wieviel Spielraum für Interpretationen konnte Artikel 36 unter
diesen Umständen noch lassen?
Der EVertr. wurde bekanntlich auf Seiten der DDR durch die Regierung Lothar de Maizières
ausgehandelt und nicht durch die Landesregierungen der neuen Länder. Die Landtagswahlen
fanden dort erst am 14. Oktober, knapp zwei Wochen nach dem Tag der Vereinigung, statt.
Inwiefern also könnte Artikel 36 die Rundfunkordnung der neuen Länder präjudiziert haben?
Der durch die Befristung entstandene Zeitdruck während der Neuordnung des ostdeutschen
Rundfunks - für die gesamte Umbruchphase stand kaum mehr als ein Jahr zur Verfügung -
bedeutete gleichzeitig, daß den Landesregierungen keine Möglichkeit zur Diskussion alternativer
Rundfunkmodelle blieb als jenem öffentlich-rechtlichen, wie es auch im Westen besteht. Obwohl
die Übernahme des dualen Rundfunksystems
2
feststand, kam es wegen vieler
Meinungsverschiedenheiten zu Verzögerungen der Verhandlungen. Was gab es eigentlich noch
zu diskutieren?
Rundfunk ist von großer Bedeutung für die persönliche Darstellung von Politikern und
politischen Inhalten. Aus der westdeutschen Erfahrung ist hinreichend bekannt, daß die Parteien
immer versucht haben, auf die Programmgestaltung und die Besetzung von Führungspositionen
einzuwirken. Das institutionelle Vakuum, welches zunächst die SED und schließlich die
vornehmlich aus Geistlichen bestehende Regierung der DDR hinterlassen hatten, füllten die
Parteien auf Grund ihres organisatorischen Vorsprungs schnell aus, da sie als einzige - das gilt
insbesondere für die "gewendeten" Blockparteien - keine neuen Apparate zu implementieren
brauchten (Lehmbruch 1990: 470; 1993: 27). Haben die Parteien deshalb leichteres Spiel gehabt,
die Diskussionen in Ostdeutschland während der Aufbauphase der neuen Rundfunkanstalten zu
dominieren?
Mit der Diplomarbeit "Transformation und Integration des Rundfunks im Prozeß der deutschen
Einigung - Rundfunk in der DDR nach der Wende: Reform oder Zerschlagung?" von Susanne
Hepperle, in welcher der Frage nachgegangen wurde, warum die ostdeutschen
Rundfunkeinrichtungen aufgelöst wurden, ist der Zeitraum, beginnend mit der Wende in der
DDR von 1989 bis hin zum EVertr., ausführlich dargelegt worden. Die vorliegende Arbeit will,
diese Beschreibung fortsetzend, nun erkunden, wie, warum und von wem die Intentionen des den
Rundfunkübergang regelnden Artikel 36 EVertr. durchgesetzt werden konnten: Warum hat sich
die Rundfunklandschaft in den neuen Ländern so und nicht anders entwickelt?
2
Das duale Rundfunksystem benennt das Nebeneinander von öffentlich-rechtlichen und privaten
Rundfunkporgrammen.
3
I.1. U
NTERSUCHUNGSFRAGEN
Dieser Fragestellung gerecht zu werden bedarf einer Untersuchung der Vorgänge mit Hilfe
folgender weiterführender Fragen:
1. Welche Akteure waren am Prozeß des Aufbaus der neuen Rundfunklandschaft in den
ostdeutschen Ländern beteiligt? Woran orientierte sich ihr Aktionsradius?
2. Welche Konzepte vertraten die Akteure? Ist der Westen glaubwürdig aufgetreten und wurde er
den eigenen normativen Prämissen gerecht?
3. Wer hat sich schließlich auf Grund welcher Faktoren durchsetzen können? In welchem
Verhältnis stehen Argumentation und Ziele zueinander? Welcher Rolle spielten lands-
mannschaftliche Motive? Welche Bedeutung hatte das Ost-West-Verhältnis?
4. Welche Parallelen oder Gegensätze sind dabei im Vergleich zur westdeutschen Situation zu
erkennen und welche Folgen hatte Artikel 36 EVertr.? Ist das Zusammenwachsen als Chance für
Innovation genutzt worden? Hat die Parteipolitik in den neuen Ländern vergleichbaren Einfluß
auf den Rundfunk gewonnen?
3
Anhand der Beantwortung dieser Fragen sollen folgende Hypothesen diskutiert werden:
1. Die Parteien spielten deshalb bei der Neuordnung eine herausragende Rolle, weil sie das von
der SED zurückgelassene institutionelle Vakuum (Lehmbruch 1991: 596) schnell zu besetzen
wußten.
2. Durch die Vielzahl der Aufgaben waren die ostdeutschen Landesregierungen gezwungen, der
Rundfunkpolitik einen eher untergeordneten Stellenwert beizumessen. Dadurch gelang es dem
Bundeskanzler, über die Partei Einfluß auf den Entscheidungsprozeß der mehrheitlich
unionsregierten neuen Länder auszuüben.
3. Das Ende des DDR-Rundfunks bzw. der Einrichtung nach Artikel 36 EVertr. lag im Vorfeld
der deutschen Einheit. Die Volkskammer führte noch unter Ministerpräsident Hans Modrow die
Rundfunkfreiheit ein; später folgte unter Ministerpräsident Lothar de Maizière eine vorauseilende
Anpassung an das westdeutsche System.
4. Durch die ultimative Verpflichtung des Artikels 36 EVertr. zur Auflösung der DDR-
Rundfunkeinrichtungen und zur Gründung von Landesrundfunkanstalten wurden die rund-
funkpolitischen Entscheidungen der neuen Länder nicht präjudiziert.
5. Die Länder lassen sich grundsätzlich ungern eindeutig zugewiesene Kompetenzen streitig
machen. Die politischen Entscheidungen wurden daher desto problematischer, je mehr neben den
Ländern noch andere Akteure eingeschaltet waren.
3
Vgl. bei 2., Frage zwei und 4., Frage drei auch Hoffmann-Riem 1991: 473.
4
6. Die Rundfunkanstalten hatten zu jeder Zeit einen äußerst geringen Einfluß auf die politischen
Entscheidungen. Dies änderte sich nur in Fällen, wo Ministerpräsidenten sich zu Anwälten
solcher Interessen machten.
7. Die Rundfunkpolitik war stark geprägt von Macht- und Standortpolitik.
8. Die Tatsache, daß die Vereinigung Deutschlands auf Grund von Artikel 23 GG erfolgte, den
institutionellen Rahmen der Bundesrepublik also nicht anfocht, ermöglicht die Wahrung
wenigstens eines Teiles der in den letzten 40 Jahren entstandenen politische und gesellschaftliche
Homogenität des westdeutschen Staates (Lehmbruch 1990: 463ff.). Der Vereinigungsprozeß ist
deshalb im Rundfunkbereich einfacher zu verkraften (Seibel 1991: 203), weil die Rückwirkungen
auf die westdeutschen Rundfunkanstalten verschwindend gering sind.
I.2. V
ORGEHENSWEISE
Da über den Aufbau des neuen Rundfunksystems in Ostdeutschland erst wenig Literatur
erschienen ist, konzentriert sich die Diplomarbeit auf die Analyse von Originaldokumenten, der
Fach- und Tagespresse sowie auf Gespräche mit an den Entscheidungsprozessen direkt
Beteiligten. Die wichtigsten Dokumente sind als Anlage beigefügt, werden jedoch im Text
entsprechend zitiert.
Die Transformation des Rundfunksystems der ehemaligen DDR erfolgte in vier Phasen, deren
erste drei bereits in der vorangegangenen Arbeit von Susanne Hepperle behandelt wurden:
1. Die Wende-Phase: Zwischen Oktober 1989 und Juli 1990 vollzog sich die Wende auch in den
Rundfunkeinrichtungen der DDR.
2. Die Autonomie-Phase: Nach dem 1. Juli 1990 wurde das vormals zentralistische System den
Grenzen der wiedererstehenden Länder entsprechend und im Hinblick auf einen künftigen
gesamtdeutschen Staat dezentralisiert. Hier wurde die Grundlage für die Neuordnung des
Rundfunks in den neuen Ländern den Prinzipien des westdeutschen Föderalismus entsprechend
geschaffen.
3. Die Lenkungs-Phase: Nach Vollendung der deutschen Einheit und dem Inkrafttreten des
EVertr. am 3. Oktober 1990 wurden die Sender der früheren DDR zur Einrichtung nach Artikel
36 EVertr. zusammengefaßt (künftig nur noch Einrichtung). und mit der darauffolgenden Wahl
Rudolf Mühlfenzls zum Rundfunkbeauftragten wieder verstärkter staatlicher Lenkung
unterworfen.
4. Die Integrations-Phase: Seit dem 1. Januar 1992 werden die 1991 gegründeten Landes-
rundfunkanstalten aufgebaut.
Um zu erklären, warum die Entwicklung den beobachteten Verlauf genommen hat und in
Konsequenz die eingangs aufgeworfenen Fragen beantworten zu können, geht es zunächst einmal
5
nur um die Erläuterung dessen, was zwischen dem 3. Oktober 1990 und dem Frühjahr 1993
geschehen ist. Wolfgang Seibel beschreibt die sich der Wissenschaft stellende Aufgabe wie folgt:
"Das Anknüpfen an theoretischen Interpretationsmustern oder 'Schulen' erscheint
im Hinblick auf die Erforschung des Prozesses der deutschen Einigung (...) zur
Zeit wenigstens in forschungstaktischer Hinsicht einigermaßen riskant (...)
insofern wird auch die verwaltungswissenschaftliche Forschung in nächster Zeit
das Schwergewicht eher auf hypothesengenerierende als auf hypothesentestende
Verfahren legen müssen." (Seibel 1990: 3)
Die Bedeutung dieser dokumentarischen Forschung muß daher unter den gegebenen Umständen
hoch eingeschätzt werden. Weil der Erklärungswert bloßer Deskription, so Seibel weiter, von
vornherein aber begrenzt sei, muß weitergehende Forschung die Identifikation abhängiger und
unabhängiger Variablen zum Ziel haben, Ursachen und Zusammenhänge aufdecken (Seibel 1990:
4f.). Dies soll die Beantwortung der im Vorfeld gestellten Untersuchungsfragen leisten.
I.3. A
UFBAU DER
A
RBEIT
Eingangs wird die Länderhoheit über den Rundfunk erklärt. Damit einher geht eine Darstellung
des Widerspruchs zwischen dem Gebot der Staatsfreiheit und der Verpflichtung der Parteien, die
via ihrer Mandatsträger die politische Macht innehaben, der BVerfG-Rechtsprechung genügende
Rundfunkgesetze zu erlassen. Beide Aspekte sind bedeutende Bewertungsmaßstäbe für die
Beantwortung der Fragestellung, weil sie Ursache der Art und Weise sind, wie Rundfunkpolitik
vonstatten geht. Danach folgt ein kleiner Überblick über die Autonomie- und die Lenkungsphase,
die wichtige Grundlagen für das Verständnis der Ereignisse nach Vollendung der deutschen
Einheit sind.
Im Hauptteil der Arbeit erfolgt eine genauere Darstellung der Herausbildung neuer, föde-
ralistischer Strukturen. Gegenstand sind also die politischen Entscheidungen, die Verhandlungen
im Vorfeld der Gründungen, nicht die Zustände innerhalb der neuen Anstalten. Insofern genügt es
nicht, nur ein Beispiel darzustellen. Grundlegende Entwicklungsmuster können nur durch eine
Erläuterung aller wichtigen Beispiele erfolgen. Die Zielsetzung einer solchen Darstellung ist die
Falsifizierung der Hypothesen anhand der folgenden Klassifikation der politisch-administrativen
Prozesse:
1. Die Gründung des MDR und die Novellierung des ZDF-Staatsvertrages erfolgten aus-
schließlich durch Verhandlungen zwischen Ländern.
2. Sowohl Landesregierungen als auch die betroffenen Rundfunkanstalten berieten gemeinsam in
den schließlich gescheiterten Verhandlungen über die Gründung der NORA, einschließlich der
komplizierten Kooperationsverhandlungen von SFB und ORB und der Einigung der Länder über
6
die Vergrößerung des NDR. Auch der Sonderfall DT64 wird in diesem Rahmen erläutert, weil
der Erhalt des Jugendradios keine alleinige Entscheidung der Politik war.
3. Die Verhandlungen über die Bildung des nationalen Hörfunks und die Fusion der DW mit
RIAS TV führten die Länder, westdeutsche Rundfunkanstalten und die Bundesregierung.
Die genannten Beispiele werden in dieser Reihenfolge behandelt. Jedes Kapitel endet mit einem
Teilresümee, welches die wichtigsten Punkte noch einmal zusammenfaßt, um die abschließende
Zusammenfassung und Bewertung unter Berücksichtigung der Eingangsfragen übersichtlicher zu
gestalten.
Ohne namentliche Erwähnung der Entscheidungsträger im Text würde die folgende Darstellung
noch unübersichtlicher als sie ohnehin schon ist. Zur Orientierung befindet sich darum am Ende
der Arbeit ein Personenregister, in welchem die mehrfach genannten Amtsinhaber in
alphabetischer Reihenfolge, einschließlich ihrer Funktionen während des behandelten Zeitraumes,
aufgeführt sind.
Aus Gründen der Homogenität der behandelten Materie wird auf eine Darstellung der
Privatisierungen von RIAS 2, der Defa und des Berliner Rundfunks verzichtet, ebenso auf den
Bereich der Zulassung neuer Privatanbieter und damit der Einführung des dualen
Rundfunksystems. Eine Erläuterung des parteipolitischen Einflusses in den ostdeutschen
Rundfunkanstalten muß genauso unterbleiben. Sie würde den Rahmen der Arbeit sprengen und
könnte Gegenstand einer eigenständigen Untersuchung sein.
Dazu zählt nur eingeschränkt die Frage der Verfassungskonformität der Staatsverträge und
Rundfunkgesetze in den neuen Ländern. Auch hier ist zwar eine detaillierte Erklärung unter der
Fragestellung nicht subsumierbar, da es sich um ein rundfunkrechtliches also juristisches Problem
handelt. Daß diese Frage jedoch Gegenstand der Diskussion war, wird kurz aufgezeigt,
schließlich ist dies das herausragendste Ergebnissen der hier darzustellenden Entscheidungen.
I.4. R
AHMENBEDINGUNGEN DER
R
UNDFUNKPOLITIK
I.4.1. LÄNDERHOHEIT
Vor dem ersten Rundfunkurteil des BVerfG war die Länderzuständigkeit über den Rundfunk
strittig, weil Art. 73 Nr. 7 dem Bunde zumindest die Regelungskompetenz für das
Fernmeldewesen zuweist, dem viele Juristen auch den Rundfunk zuordneten. Das BVerfG stellte
1961 jedoch fest, daß Rundfunk auch ein kulturelles Phänomen sei. Nach herrschender Meinung
besitzen die Länder deshalb auf Grund ihrer Kulturhoheit nach Artikel 30 und 70 GG über die
allgemeine Zuständigkeitsvermutung die Kompetenz für die Organisation des Rundfunks
7
(Herrmann 1975: 279). "Es besteht kein Zweifel daran, daß der Rundfunk als kulturelles
Phänomen Länderangelegenheit ist." (Ellwein 1988:149f.).
I.4.2. RUNDFUNKFREIHEIT
I.4.2.1. ANSPRUCH DER MEINUNGSFREIHEIT
Artikel 5 GG schreibt die individuelle Meinungs- und Informationsfreiheit fest. Da Rundfunk
nach Auffassung des BVerfG Voraussetzung für öffentliche Meinungsbildung ist, bedarf es zur
Gewährleistung der Grundrechte aus Artikel 5 GG eines Rundfunks frei von staatlicher Macht, in
dem alle "gesellschaftlichen Kräfte zu Wort kommen und die Freiheit der Berichterstattung
unangetastet bleibt" (BVerfGE 12, 205). Das ist die sogenannte innenpluralistische Variante der
Rundfunkfreiheit, das heißt Integration der Meinungsvielfalt in einer Runfunkeinrichtung, wie sie
in Form von öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten im Idealfall umgesetzt wird.
I.4.2.2. UMSETZUNG IN DER RUNDFUNKGESETZGEBUNG
Der Staat soll nun als Träger politischer Macht die Staatsunabhängigkeit dieser als
"Machtinstrument allerersten Ranges" geltenden Institution Rundfunk sichern (Prodoehl 1989:
280). Es ist also die fiktive Konstruktion eines Staates, welcher darum besorgt ist, auf einen
wesentlichen Faktor seiner eigenen Funktionsfähigkeit keinen Einfluß auszuüben. Diese
Hoffnung beruht auf dem Mythos, der Staat könne eine von Partikularinteressen und
Gruppenauseinandersetzungen enthobene überparteiliche und gesellschaftsintegrierende Funktion
wahrnehmen. Nur durch diese Prämisse kann der scheinbare Gegensatz gelöst werden, nach dem
der Rundfunk einerseits eine staatliche Aufgabe ist, gleichzeitg aber dessen Kontrolle enthoben
sein soll.
Dieser Widerspruch liegt jedoch noch tiefer: Wenn nämlich der Rundfunk vor staatlichem
Einfluß geschützt werden muß, impliziert diese Annahme zugleich, daß bei einer staatlichen
Kontrolle eine parteiliche Instrumentalisierung droht. Die Konstruktion des BVerfG beruht also
auf einer in sich unlogischen Auffassung vom Staat: Die Freiheit von staatlicher
Interessenabhängigkeit soll durch eben diesen geschützt werden. Als Gestalter einer
Rundfunkordnung bringt das Gericht dem Staat Vertrauen entgegen, welches es ihm als
Veranstalter von Programmen verweigert. "Der Staat erscheint als parteilich und überparteilich,
einseitig und neutral in einer Person"
(Prodoehl 1989: 281f.).
Dieser der Rechtsprechung des
BVerfG implizite Widerspruch findet sich in der Beurteilung der Rolle der Parteien wieder.
8
Rundfunkräte sollen Sorge dafür tragen, daß die Vielfalt der vorhandenen Meinungen im
Rundfunk zur Geltung kommt und das Programm dem staatlichen Zugriff vorenthalten bleibt. Die
Tätigkeit politischer Parteien ist ansonsten jedoch notwendig mit bestimmten Interessen und der
Beeinflussung der öffentlichen Meinung verknüpft. Sie sind im politischen System der
Bundesrepublik nicht nur wichtige Träger politischer Macht, sondern deshalb auch Hauptakteure
der Politikformulierung. Die Aufgaben von Parteien und Rundfunkräten unterscheiden sich also
ganz grundsätzlich voneinander. Dennoch sollen diese Parteien als staatliche Funktionsträger die
gesetzlichen Grundlagen für einen freien Rundfunk in Form einer Aufgabenzuweisung an die
Rundfunkräte schaffen. Sie sollen also gerade wenn es um ein so wichtiges Medium wie den
Rundfunk geht, von ihren sonstigen Funktionsinteressen absehen (Prodoehl 1989: 282).
9
II. DIE RUNDFUNKPOLITIK DER DDR
II.1. DDR-R
UNDFUNK ALS DRITTE
A
NSTALT
Nach der Volkskammerwahl am 18. März 1990 wurden die Weichen in Richtung deutscher
Einheit schnell gestellt. Zwar versuchte der damalige Generalintendant des Deutschen
Fernsehfunks (DFF),
4
Hans Bentzien, die Etablierung des Senders als dritte Fernsehanstalt im
zukünftigen Rundfunksystem des vereinten Deutschlands durchzusetzen. Doch dagegen stellten
sich alle maßgeblichen politischen Kräfte sowie die westdeutschen Rundfunkanstalten. Nach der
Abberufung Bentziens und der Einsetzung Michael Albrechts im Juni wurde diese Strategie
deshalb nicht fortgesetzt (Hepperle 1991: 50ff.).
Zum 1. Juli 1990 war der Weg zur Deutschen Einheit durch die Wirtschafts- und Währungsunion
endgültig festgelegt. Zu diesem Zeitpunkt herrschte Einigkeit darüber, daß die von den neuen
Ländern zu bildenden Landesrundfunkanstalten Mitglieder der ARD werden. So forderte der
stellvertretende Intendant des Rundfunks der DDR,
5
Wernfried Maltusch, die Auflösung des
zentralen Rundfunks, die Gründung zweier Anstalten und den Beitritt Mecklenburg-
Vorpommerns zum NDR einschließlich der gemeinschaftlichen ARD-Integration (Rundfunk der
DDR 1990: 69ff.).
Nur der WDR entwickelte ein ähnliches Konzept zur Neuordnung der Rundfunkstruktur in den
neuen Ländern, das die Gründung eines Ostdeutschen Rundfunks vorsah, der zwar nicht identisch
mit dem DFF gewesen wäre, dies aber wohl nur de jure und nicht de facto. Gegen dieses
"Konzentrationsmodell" sprachen deshalb die gleichen Argumente wie gegen eine ARD-
Aufnahme des DFF.
6
Solche Überlegungen widersprachen der unbedingten Zerschlagung des
DDR Rundfunks und der Föderalisierung. Die Gründung zweier Anstalten hätte dagegen diese
Nachteile nicht, und trotzdem wären alle Häuser finanzierbar (Facius 1990: 34).
Kurz nach seinem Amtsantritt fusionierte der Rundfunkbeauftragte die beiden Fernsehprogramme
des DFF zur "DFF-Länderkette" und stellte damit eine Frequenzkette frei, über die ab Dezember
die ARD verbreitet wurde. Das ZDF erhielt etwa zur selben Zeit eine nahezu flächendeckende,
bisher ungenutzte Frequenzkette (epd 15, 27.02.1991). Beides geschah im ausdrücklichen
Einverständnis mit den ostdeutschen Ministerpräsidenten.
4
Nach der Wende war das Fernsehen der DDR wieder in DFF umbenannt worden.
5
Mit dem Begriff Rundfunk war in der DDR fälschlicherweise immer nur der Hörfunk gemeint. In der
Fachterminologie ist Rundfunk der Oberbegriff für Hörfunk und Fernsehen.
6
Facius sah einen Nachteil darin, daß die Anstalt die größte in der ARD geworden wäre und damit den Anteil
der Westsender am Gemeinschaftsprogramm der ARD verringert hätte. Das überzeugt nicht, schließlich sind
kleinere Sender in der Summe ebenso stark im ARD-Programm vertreten.
10
II.2. R
EGIONALISIERUNG DES
DDR-R
UNDFUNKS
Dieser Entwicklung folgend wandelte Michael Albrecht den DFF formal in eine öffentlich-
rechtliche Anstalt um, die dem Gebot der Staatsferne Rechnung trug und die im Westen üblichen
Aufsichtgremien erhielt. Gleichzeitg wurden in jedem der den DFF und den Rundfunk der DDR
tragenden Länder Regionalsender, die sogenannten Landessender, errichtet, die im Frühjahr von
den Direktoren der Regionalsender in Zusammenarbeit mit Maltusch vorbereitet worden waren.
Die Landessender erhielten zunächst die Frequenzen des vormaligen Hörfunk-Kulturporgrammes
DDR 2, das seinerseits mit dem Deutschlandsender
7
zu DS Kultur fusioniert wurde. Der Berliner
Rundfunk und DT64 blieben erhalten (Hepperle 1991: 55ff.). Die Einrichtung der
Landesfunkhausdirektionen sei zwar eine Präjudizierung von Entscheidungen, die eigentlich den
neuen Ländern zustünden, doch sie entsprächen den Wünschen der Bevölkerung, rechtfertigte
sich die Intendanz (Maltusch 1990: 78).
Das Ziel der Umgestaltung des DFF und des Rundfunks der DDR blieb in den Augen anderer
Beteiligter die Bildung einer Mehrländeranstalt durch einen Staatsvertrag der Länder der
ehemaligen DDR und die mögliche Aufnahme in die ARD (Schulzendorf 1990: 86). Der
Strategie der Intendanz folgend, vertraten die meisten Rundfunkschaffenden jedoch die Idee, die
Landessender zu Keimzellen mehrerer Anstalten zu machen.
"Mit der Neukonstituierung der Länder ist eine rechtliche Ordnung der
Rundfunklandschaft zu einer aktuellen Tagesaufgabe der Politik geworden. Der
Einigungsvertrag bietet Rundfunk und Fernsehen der ehemaligen DDR als ein
Erbgut für den Aufbau öffentlich-rechtlicher Anstalten an." (Müller 1990: 1)
II.3. K
OOPERATIONSMODELLE ZWISCHEN
O
ST UND
W
EST
Derweil knüpften die Landessender schnell Kontakte zu westdeutschen Anstalten, die ihre Partner
im Osten finanziell unterstützten und viele Gemeinschaftssendungen veranstalteten. Während der
WDR vor allem mit Antenne Brandenburg kooperierte, unterhielt der HR Kontakte zu dem
thüringischen Landessender und der BR mit Sachsen Radio.
8
Schon in dieser Phase versuchte der
NDR, in Mecklenburg-Vorpommern Fuß zu fassen, indem er dem Landessender ein
Mantelprogramm anbot.
7
Das bereits in den 20er Jahren gegründete Programm hatte zwischenzeitlich jahrzehntelang "Stimme der DDR"
geheißen.
8
In diesem Falle kam es zur Berufung des technischen Direktors des BR, Frank Müller-Römer, zum
Rundfunkbeauftragten der sächsischen Staatskanzlei. In dieser Funktion erarbeitete er zwei Gesetzentwürfe für
eine eigene sächsische Landesrundfunkanstalt.
11
In allen Fällen, wo die Länder gemeinsame Grenzen haben, verbanden die westdeutschen
Anstalten mit ihren Aktivitäten auch die Möglichkeit eines künftigen Zusammenschlusses,
während umgekehrt die Länder des Ostens in der Regel hofften, durch ein Höchstmaß an
Zusammenarbeit eine eigene Anstalt finanzieren zu können. Lediglich der SFB verweigerte sich
einer möglichen Kooperation mit dem Berliner Rundfunk mit der Argumentation, man werde erst
nach einem Staatsvertrag mit einem brandenburgischen Sender fusionieren, der seinereits vorher
den Berliner Rundfunk integriert haben könne. Intendant Günther von Lojewski stellte sich
selbstbewußt auf den Standpunkt, daß es nach dem 3. Oktober 1990 nur noch eine Berliner
Anstalt geben werde, und das sei der SFB. Damit verweigerte er sich der Auffassung des damals
noch im Amt befindlichen rot-grünen Senats unter Walter Momper, der gemeinsame Aktivitäten
mit Ost-Berliner Sendern forderte (Hepperle 1991: 64ff.).
II.4. E
INIGUNGSVERTRAG STATT
R
UNDFUNKÜBERLEITUNGSGESETZ
Im Juni 1990 legte das Medienministerium der DDR unter Gottfried Müller (CDU) einen ersten
Gesetzentwurf für den Rundfunk vor (Kresse 1992: 19). Ein Anlaß war die bis dahin
unzureichende Festschreibung der Rundfunkfreiheit, deren einzige Grundlage verschiedene
Volkskammerbeschlüsse aus der Zeit der Wende waren. Ein weiterer Antrieb war der Wunsch
nach schnellstmöglicher Zulassung privater Anbieter (Hepperle 1991: 76). Der Entwurf
beinhaltete auch die Einführung föderaler Strukturen, da längst klar war, daß ein DDR-eigenes
Rundfunkgesetz höchstens noch den Übergang würde regeln können. Da der Ministerrat in
diesem Gesetz jedoch als oberste Aufsichtsbehörde vorgesehen war, wurde es als zu staatsnah
kritisiert, weshalb sich die SPD dazu veranlaßt sah, am 5. Juli einen Gegenentwurf vorzulegen, in
welchem die Rundfunkeinrichtungen als Ostdeutscher Hör- und Fernsehfunk (OHFF) bis zur
Gründung neuer Anstalten die Rundfunkversorgung sicherstellen sollten. Durch diese Umstände
verzögerte sich die Verabschiedung bis nach der Sommerpause (Kresse 1992: 20).
Mit der Geschwindigkeit der inzwischen näherrücktenden deutschen Einheit konnte das
Medienministerium nicht mithalten werden. Da bis zum Zeitpunkt der Ausarbeitung noch immer
kein Gesetz des DDR-Parlamentes hierfür vorlag, beschloß das Bundesinneministerium, die
Rundfunküberleitung im EVertr. zu regeln. Darüber erzielten die Delegationen beider deutscher
Staaten im August Einigkeit. Die Chefs der westdeutschen Staatskanzleien entwarfen schließlich
den Artikel 36 (Kresse 1992: 21).
9
Der Volkskammer, die den Reformbemühungen eine Chance
geben wollte, wurde die Regelungskompetenz damit entzogen und der Exekutive beider deutscher
Staaten übertragen (Hepperle 1991: 77ff.).
9
Der erste Entwurf sah noch eine Auflösung der DDR-Rundfunkeinrichtungen ohne Befristung vor.
12
Es gab zunächst Bedenken im Hinblick auf die Länderkompetenz, die neue Rundfunkstruktur
genau festzuschreiben. Das Medienministerium der DDR wollte viel erhalten, der Bund das
"Propagandasystem des SED-Regimes" zerschlagen. Das Ziel der Bundesregierung war deshalb
die Verhinderung alter SED-Seilschaften im Rundfunk. Die Ordnung der Zukunft sollte
"entsprechend (...) westdeutschen Gepflogenheiten" staatsunabhängig sein, entweder indem die
neuen Länder die Rundfunkeinrichtungen durch einen gemeinsamen Staatsvertrag weiterzuführen
oder durch Neugründungen zu ersetzen hätten (Schäuble 1991: 198f.). Dennoch beklagte die
PDS, daß mit dieser Überleitung frühzeitig Tatsachen geschaffen würden (Rundfunk der DDR
1990: 74).
Die Volkskammer nahm das Rundfunküberleitungsgesetz schließlich wenige Tage vor dem 3.
Oktober mit überwältigender Mehrheit an, es gab allerdings im Text kaum noch Divergenzen
zum entsprechenden Artikel 36 EVertr. (Kresse 1992: 22).
13
III. DIE RUNDFUNKPOLITISCHE NEUORDNUNG
III.1. D
ER NEUE
ZDF-S
TAATSVERTRAG
III.1.1. DIE AUSDEHNUNG DES ZDF AUF DIE NEUEN LÄNDER
Sofort nach ihrer Wahl wandte sich ZDF-Intendant Dieter Stolte mit persönlichen Schreiben an
die Ministerpräsidenten der ostdeutschen Länder, um ihnen den Beitritt zum ZDF-Staatsvertrag
nahezulegen (Interview Krone); dafür sollte nach Vorstellung der Intendanz der Fernsehrat um je
einen Vertreter der fünf Länder und vier weitere Gruppenvertreter aus Kunst und Wissenschaft
als Ausgleich für das stärker werdende Gewicht der Politik aufgestockt werden (epd 80,
10.10.1990). Stolte wollte so verhindern, daß eine grundsätzliche Neuregelung zu einer
"Verschlimmbesserung" führt. Mit ihren Plänen einer "kleinen Lösung" unter Einschluß einiger
kleiner Anpassungen im Programmauftrag (Interview Krone) stieß die Leitung des ZDF
allerdings nicht nur bei den Verbänden, die bisher über kein direktes Entsendungsrecht verfügten,
sondern auch in der Politik auf wenig Gegenliebe: So sprach sich schon im Oktober 1990 der
SPD-Medienpolitiker Peter Glotz für eine Novellierung des ZDF-Staatsvertrages mit dem Ziel
der Zurückdrängung des politischen Einflusses aus. 40 der 66 Fernsehratsmitglieder wurden bis
dato von den Landesregierungen bestimmt. Die Ministerpräsidenten wollten ebenso Änderungen,
wenn überhaupt, dann gleich umfassend durchführen, zumal durch die deutsche Einheit sämtliche
rundfunkpolitischen Staatsverträge revisionsbedürftig geworden waren. Lediglich die bayerische
Staatskanzlei wandte sich entschieden gegen Vorhaben, die Beteiligung der neuen Länder zu
nutzen, um angebliche Süd- oder Rechtslastigkeiten auszugleichen (epd 81, 13.10.1990) und
unterstützte damit die ZDF-Intendanz.
Im selben Monat stellten die von der Ministerpräsidentenkonferenz beauftragten Amtsinhaber
Bayerns und Schleswig-Holsteins, Max Streibl und Björn Engholm, ihr Konsenspapier
10
vor,
welches die Erweiterung des ZDF-Sendegebietes um die neuen Länder beinhaltete (FK 42,
19.10.1990). Die Chefs der Staatskanzleien wurden mit der Prüfung und Vorbereitung für
folgende Regelung beauftragt:
"1. Befristete Übergangsregelungen für den Beitritt der neuen Bundesländer zum
ZDF-Staatsvertrag; Neufassung des ZDF-Staatsvertrages spätestens bis zum 31.
Dezember 1992." (Engholm-Streibl-Papier, FK 42, 19.10.1990)
10
Sogenanntes
"Engholm-Streibl-Papier": siehe Anhang 2.
14
Das Engholm-Streibl-Papier schien unter den Amtskollegen in bezug auf diesen Punkt
mehrheitsfähig zu sein. (FK 50, 13.12.1990). Das ZDF wurde wie dargestellt im Einverständnis
mit den Ministerpräsidenten der neuen Länder im Dezember auf bisher ungenutzten Frequenzen
ausgestrahlt (epd 15, 27.02.1991).
III.1.2. QUERELEN UM DIE GREMIENBESETZUNG
Daraufhin begannen die langwierigen ZDF-Staatsvertragsverhandlungen, welche zunächst mit
einem Ministerpräsidentenbeschluß endeten, der den Streit um die Besetzung der ZDF-Gremien
jedoch nicht beendete. Da nämlich trotz einer Mehrheit SPD-regierter Länder der CDU/CSU-
Freundeskreis des Fernsehrates nach wie vor dominierte, wollte die SPD wenigstens die
gesellschaftlichen Gruppen stärker repräsentiert sehen (epd 50, 29.06.1991). Die SPD machte
aber keinen Hehl daraus, die Verhältnisse in den Anstalten jenen in den Ländern anpassen zu
wollen. Im Grunde gehe es, so der niedersächsische Regierungssprecher, um das Knacken der
konservativen Mehrheit (BM 11.07.1991). Karl-Heinz Klär, Chef der rheinland-pfälzischen
Staatskanzlei, erklärte, die SPD hätte die konservative Mehrheit im ZDF-Fernsehrat sogar
toleriert, wenn wenigstens im Verwaltungsrat entsprechende Konzessionen gemacht worden
wären. Otto Wiesheu
11
verteidigte jedoch den Status Quo und erklärte in Stellvertretung Streibls
12
grundsätzliches Mißfallen an den parteitaktischen Überlegungen der SPD (FR 12.07.1991) und
damit eine ablehnende Haltung Bayerns. Bei diesen Auseinandersetzungen war das ZDF selbst
eher Zuschauer denn handlungsbefugt (Interview Krone).
Der Grund für diesen Boykott einer Übereinkunft lag in der Gefahr für Bayern, bei einer
Vergrößerung des Verwaltungsrates auf 13 Mitglieder und einer gleichzeitig veränderten
Zusammensetzung, keinen Vertreter mehr entsenden zu können. Die CSU hatte ferner die Sorge,
daß Otto Graf Lambsdorff als Vertreter des Bundes im Verwaltungsrat künftig den Ausschlag
geben könnte, wenn die Regierungschefs sich auf eine Parität wenigstens in diesem Gremium
einigten, wie von der SPD als Kompromiß angeboten (FR 05.08.1991).
13
Mit dieser
Verweigerung fiel Bayern sogar hinter die Vereinbarungen auf Fachebene zurück. Die Ausrede,
es ginge nur um die Aufnahme der neuen Länder, ist insofern "oberfaul" (epd 54, 13.07.1991).
Die Länder waren nun gezwungen, die Verhandlungen über den ZDF-Staatsvertrag im Paket mit
den restlichen Rundfunkstaatsverträgen auf den 31. August zu vertagen (BM 31.07.1991). Dann
wurde jedoch ein neuer Kompromiß für die ZDF-Verhandlungen vorgelegt (epd 68, 31.08.1991).
Dabei standen zwei Modelle für die Neuordnung des Verwaltungsrates zur Diskussion. Eines sah
11
Seit Juni 1991 ist Wiesheu bayerischer Vertreter im ZDF-Fernsehrat.
12
Wegen eines Besuchs aus China erschien Streibl nicht persönlich.
13
In diesem Gremium saß schon in den siebziger Jahren Hans-Dietrich Genscher für den Bund, der damals ein
Verhältnis von 5:4 für die sozialliberale Koalition ermöglichte.
15
die Wahl des Bundesvertreters auf Vorschlag der Bundesregierung durch den Fernsehrat vor, das
zweite gewährte ihr das Recht, über das Mandat selbst zu bestimmen. Ministerpräsident Rudolf
Scharping rühmte sich später, Rheinland-Pfalz habe den parteipolitischen Einfluß im neuen ZDF-
Fernsehrat zurückgedrängt (SWF-Journal 01.12.1991), obwohl man sich auf das direkte
Entsendungsrecht für den Bund geeinigt hatte (§21 b ZDF-Staatsvertrag).
III.1.3. RESÜMEE
Das ZDF hatte Erfolg mit dem Wunsch nach Ausdehnung auf die neuen Länder, und noch bevor
dies durch einen Staatsvertrag der 16 Regierungen besiegelt werden konnte, wurde es gleich der
ARD in Ostdeutschland ausgestrahlt. Und dies, obwohl Mühlfenzls rechtlicher Auftrag, nämlich
die Auflösung des DDR-Rundfunks, die Entscheidung zur Schaltung der ARD auf die DFF 1-
Frequenzen eigentlich nicht erlaubte. Das gilt ebenso für die unzulässigerweise als
Betriebsversuch bezeichnete Aufschaltung des ZDF. Beide Verstöße wurden durch die
nachträgliche Zustimmung der Ministerpräsidenten nicht geheilt.
Wahrscheinlich war diese Entscheidung aber wegen der finanziellen Lage des DFF und der
vermuteten zukünftigen Bedeutung der ARD weise, "vielleicht gar die einzig richtige"
(Hoffmann-Riem 1991: 480). Es darf nicht unterschätzt werden, daß die Ministerpräsidenten
Prioritäten setzen mußten. Das bestätigte der Amtsinhaber Brandenburgs, Manfred Stolpe, nach
einer Konferenz mit seinen Amtskollegen am 20. Dezember 1990: Wirtschaftliche und soziale
Probleme hätten Vorrang vor medienpolitischen Fragen gehabt (Kopetz 1991: 100). Zu
rechtfertigen war lediglich die Frage, warum trotz steigender Gebühren plötzlich weniger
Programme - die dafür aber im Übermaß - vorhanden waren.
Die befürchteten Schwierigkeiten im Zuge einer Neufassung des Staatsvertrages, wie etwa ein
verstärkter Einfluß der Politik, trat entgegen den Erwartungen der ZDF-Intendanz nicht ein. Trotz
heftiger Auseinandersetzung durch den Anspruch auf Einfluß in den Gremien gab es keine
grundlegenden Probleme, obwohl nicht einmal ein Zeitdruck durch bevorstehende Auflösung,
wie beim DFF, oder den dringenden Wunsch nach schnellstmöglicher Ausstrahlung bestand. Das
ZDF sendete in den neuen Ländern bereits.
16
III.2. D
IE
G
RÜNDUNG DES
MDR
III.2.1. DIE ENTSCHEIDUNG FÜR EINE DREI-LÄNDER-ANSTALT
Nachdem die SPD die Landtagswahl in Hessen am 20. Januar 1991 gewonnen hatte und mit den
Grünen eine Koalitionsregierung bildete, beendeten die Thüringer postwendend die
Zusammenarbeit mit dem HR und wandten sich den ostdeutschen Nachbarn zu (Welt
28.01.1991). Bereits im Januar fand ein Treffen aller der CDU angehörenden Ministerpräsidenten
der neuen Länder im Kanzleramt statt, an dem neben Helmut Kohl auch Rudolf Mühlfenzl und
der medienpolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Bernd Neumann, teilnahmen.
In dieser Runde wurde die Neuauflage des Mitteldeutschen Rundfunks
14
vereinbart (FR
01.02.1991). Im Vorfeld hatten die Regierungschefs noch einmal ein gemeinsames drittes
Fernsehprogramm aller neuen Länder, das sogenannte O3-Konzept, abgelehnt. Man wolle jeden
Gedanken an einen Erhalt der geschlossenen DDR-Identität verhindern (epd 8, 02.02.1991). Daß
es bei dieser Entscheidung einen deutlichen Einfluß des Bundeskanzlers gegeben haben könnte,
bestreiten heute nicht einmal leitende Mitarbeiter des MDR (Interview Burmester). Die
Medienkommission der SPD unter dem Vorsitz von Björn Engholm kritisierte die Beratung der
Medienpolitik im Kanzleramt; einen Rückfall hinter die Grundsätze des BVerfG bei der
Gesetzgebung in den neuen Ländern werde man nicht tolerieren und im Falle einer
Verabschiedung von verfassungswidrigen Rundfunkgesetzen vor einer Klage nicht
zurückschrecken (FK 6, 06.02.1991).
Nach dem Willen der CDU-Fraktionen der drei beteiligten Länder sollte die Organisation der
geplanten Anstalt in Anlehnung an andere ARD-Anstalten eingerichtet werden. Im Widerspruch
dazu steht die Meldung, der sächsische Ministerpräsident Kurt Biedenkopf habe vorgeschlagen,
bei dieser Gelegenheit die ARD-übliche Intendanz durch ein Direktorenkollegium, ähnlich wie
bei RB, zu ersetzen (FR 08.02.1991). Der Vorsitz könne zwischen den Direktoren der drei
Landesfunkhäuser rotieren (FR 12.02.1991). Daß von diesem Vorschlag in der Presse später nie
wieder die Rede war, kann vermutlich auf den Anpassungsdruck an die ARD-Strukturen
zurückgeführt werden (Interview Burmester).
Die Ministerpräsidenten vereinbarten weiter, daß nach Unterzeichnung des MDR-Staatsvertrages
zum 1. Juli ein Gründungsintendant gewählt und diesem ein Beirat zur Seite gestellt werde, die
14
Die 1924 gegründete "Mitteldeutsche Rundfunk AG, MIRAG" war von den Nationalsozialisten wieder
eingestellt worden (Müller 1991:3). Der Name des Senders blieb wegen der Rücksichtnahme auf die östlichen
Nachbarn Deutschlands umstritten: Der Mitteldeutsche Rundfunk möge hoffentlich nur ein Arbeitstitel sein:
"Östlich liegt nichts mehr!" (epd 15, 27.02.1991). Wegen des Rückgriffes auf die historische MIRAG wird es
vermutlich trotzdem bei "MDR" bleiben (SZ 14.02.1991).
17
den organisatorischen Aufbau der Anstalt vornehmen sollen, damit die Programmausstrahlung
pünktlich zum 1. Januar 1992 beginnen könne. Personal der Landessender solle prinzipiell
weiterbeschäftigt werden, werde aber auf seine Vergangenheit überprüft (Interview Burmester).
III.2.2. ÜBERNAHME VON PERSONAL DER EINRICHTUNG
Der Vorsitzende der sächsischen CDU-Landtagsfraktion, Goliasch, sprach sich später dafür, den
MDR mit völlig neuen Strukturen - möglichst wenigen personellen und organisatorischen
Übernahmen von den Landessendern im "Crash-Kurs" zu etablieren. Die Stellen sollten
bundesweit ausgeschrieben werden, da die Politik besonderen Wert auf Bewerbungen aus den
Altländern lege (dpa 13.02.1991). Weiter führte er aus, es gehe nicht an, daß eine Redaktion zu
90% aus PDS-Leuten bestehe (LVZ 14.02.1991). Die Direktoren der sächsischen und
thüringischen Landessender, Manfred Müller und Hilmar Süß sowie der thüringische
Landtagspräsident Gottfried Müller
15
empörten sich über ein derartiges Vorgehen. Manfred
Müller bezeichnete den Gedanken gar als unverschämt, man müsse sich dem Erbe stellen und
berücksichtigen, daß einige der belasteten Mitarbeiter sich nach der Wende bewährt hätten (dpa
13.02.1991).
III.2.3. RATIFIZIERUNG DES STAATSVERTRAGES
III.2.3.1. BEDENKEN DER THÜRINGISCHEN FDP
Die schwersten Bedenken gegen die Mehrländeranstalt kamen aus Thüringen, wo man die Gefahr
einer Dominanz Sachsen Radios fürchtete (FR 12.02.1991). Über die Ratifizierung des
Staatsvertrages kam es deshalb zum Koalitionsstreit; der FDP-Fraktionsvorsitzende Andreas
Kniepert verlangte Nachbesserungen bei der Möglichkeit zur Auseinanderschaltung für
Regionalprogramme: "Der MDR darf nicht der Sender Leipzig werden, eingedenk schlechter
Erfahrungen, und er darf auch kein großsächsischer Rundfunk werden." (StB Thüringen,
Legislaturperiode 1, Sitzung 21, am 07.06.1991: 1074) Die FDP habe den Entwurf leider erst sehr
spät zur Kenntnis nehmen können, jetzt sei ein negatives Votum bei der Ratifizierung nicht
auszuschließen. Ministerpräsident Joseph Duchac wies die Vorwürfe als haltlos zurück, sie
entsprängen Profilierungsversuchen (epd 40, 25.05.1991).
Der MDR-Staatsvertrag wurde schließlich am 30. Mai in Erfurt unterzeichnet. Die Thüringer
Liberalen stimmten zu, nachdem vier Notationen aufgenommen, jedoch nicht schriftlich im Text
15
Das CDU-Mitglied war vormalig DDR-Medienminister im Kabinett Lothar de Maizières.
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Originalausgabe
- Erscheinungsjahr
- 1993
- ISBN (eBook)
- 9783832431792
- ISBN (Paperback)
- 9783838631790
- Dateigröße
- 9 MB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- Universität Konstanz – Politik- und Verwaltungswissenschaft
- Note
- 2,0
- Schlagworte
- einigungsvertrag rundfunkanstalten rundfunkpolitik öffentlich-rechtlicher rundfunk deutschen einigung
- Produktsicherheit
- Diplom.de