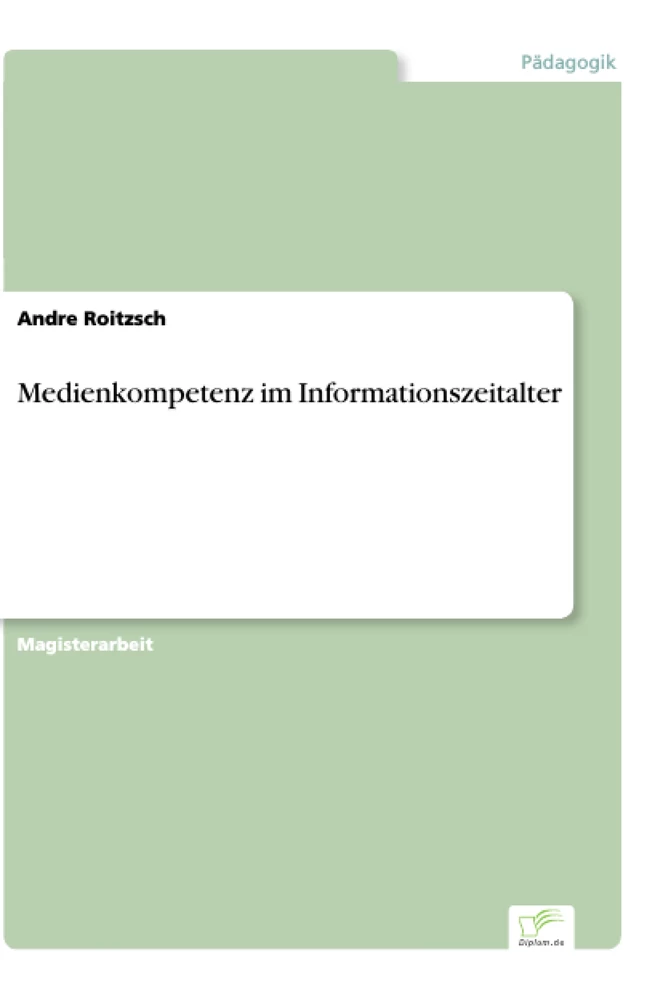Medienkompetenz im Informationszeitalter
©2000
Magisterarbeit
123 Seiten
Zusammenfassung
Inhaltsangabe:Zusammenfassung:
Die beschleunigten medientechnischen Entwicklungen der vergangenen Jahre haben unsere Kommunikationsmöglichkeiten und damit auch unser Zusammenleben radikal verändert. Vor allem vor dem Hintergrund der wirtschaftlichen und lebensweltlichen Veränderungen, die sich durch diese Entwicklung bedingt eingestellt haben und in Zukunft noch weiter verschärfen werden, besteht durchaus der Bedarf, sich mit Fragen der - zunächst mal - adäquaten Nutzung von Medien zu beschäftigen. Diese Erkenntnis hat sich verbreitet und schließlich zu der gegenwärtigen Konjunktur des Medienkompetenzbegriffs geführt.
Als problematisch erweist sich in diesem Zusammenhang allerdings die Tatsache, dass die Diskussion um Medienkompetenz häufig in theoretische Grundsatzfragen ausufert und damit auf einem für die pädagogische Handlungspraxis unbrauchbaren Niveau stecken bleibt.
Diese Arbeit beschäftigt sich ebenfalls mit dem Thema Medienkompetenz und verknüpft Aussagen dazu mit den Gegebenheiten des Informationszeitalters. Die zu belegende These der Arbeit ist somit nicht gerade revolutionär:
Vor dem Hintergrund des beschleunigten Strukturwandels von der Industrie- zur Informationsgesellschaft stellt die Kompetenz im Umgang mit modernen medientechnischen Errungenschaften (sprich Medienkompetenz) eine Schlüsselqualifikation dar, die es auf verschiedenen Ebenen zu fördern gilt.
Der Unterschied zu vielen anderen Arbeiten mit demselben oder ähnlichem Thema besteht in dem ausdrücklich angestrebten Bezug zur pädagogischen Handlungspraxis: Der hier entwickelte Medienkompetenzbegriff ist (auch) theoretisch fundiert, vor allem aber praktisch relevant. Zudem werden Möglichkeiten für die praktische Anwendbarkeit exemplarisch angesprochen.
Hierzu nähert sich die Arbeit dem Thema Medienkompetenz auf drei unterschiedlichen Ebenen:
Auf der normativen Ebene werden in Teil I zunächst theoretische Grundlagen erarbeitet. Die verwandten Begrifflichkeiten werden geklärt, der Untersuchungsgegenstand Medienkompetenz erhält so ein normativ-ideologisches Fundament.
Anschließend wird in Teil II auf der strategischen Ebene ein Status Quo auf der Grundlage der zuvor getroffenen Aussagen ermittelt.
Auf diese Weise erhält der Medienkompetenzbegriff die Konturen, die schließlich notwendig sind, damit abschließend in Teil III auf der operativen Ebene Folgerungen für die Handlungspraxis herausgestellt werden […]
Die beschleunigten medientechnischen Entwicklungen der vergangenen Jahre haben unsere Kommunikationsmöglichkeiten und damit auch unser Zusammenleben radikal verändert. Vor allem vor dem Hintergrund der wirtschaftlichen und lebensweltlichen Veränderungen, die sich durch diese Entwicklung bedingt eingestellt haben und in Zukunft noch weiter verschärfen werden, besteht durchaus der Bedarf, sich mit Fragen der - zunächst mal - adäquaten Nutzung von Medien zu beschäftigen. Diese Erkenntnis hat sich verbreitet und schließlich zu der gegenwärtigen Konjunktur des Medienkompetenzbegriffs geführt.
Als problematisch erweist sich in diesem Zusammenhang allerdings die Tatsache, dass die Diskussion um Medienkompetenz häufig in theoretische Grundsatzfragen ausufert und damit auf einem für die pädagogische Handlungspraxis unbrauchbaren Niveau stecken bleibt.
Diese Arbeit beschäftigt sich ebenfalls mit dem Thema Medienkompetenz und verknüpft Aussagen dazu mit den Gegebenheiten des Informationszeitalters. Die zu belegende These der Arbeit ist somit nicht gerade revolutionär:
Vor dem Hintergrund des beschleunigten Strukturwandels von der Industrie- zur Informationsgesellschaft stellt die Kompetenz im Umgang mit modernen medientechnischen Errungenschaften (sprich Medienkompetenz) eine Schlüsselqualifikation dar, die es auf verschiedenen Ebenen zu fördern gilt.
Der Unterschied zu vielen anderen Arbeiten mit demselben oder ähnlichem Thema besteht in dem ausdrücklich angestrebten Bezug zur pädagogischen Handlungspraxis: Der hier entwickelte Medienkompetenzbegriff ist (auch) theoretisch fundiert, vor allem aber praktisch relevant. Zudem werden Möglichkeiten für die praktische Anwendbarkeit exemplarisch angesprochen.
Hierzu nähert sich die Arbeit dem Thema Medienkompetenz auf drei unterschiedlichen Ebenen:
Auf der normativen Ebene werden in Teil I zunächst theoretische Grundlagen erarbeitet. Die verwandten Begrifflichkeiten werden geklärt, der Untersuchungsgegenstand Medienkompetenz erhält so ein normativ-ideologisches Fundament.
Anschließend wird in Teil II auf der strategischen Ebene ein Status Quo auf der Grundlage der zuvor getroffenen Aussagen ermittelt.
Auf diese Weise erhält der Medienkompetenzbegriff die Konturen, die schließlich notwendig sind, damit abschließend in Teil III auf der operativen Ebene Folgerungen für die Handlungspraxis herausgestellt werden […]
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
ID 3134
Roitzsch, Andre: Medienkompetenz im Informationszeitalter / Andre Roitzsch - Hamburg:
Diplomarbeiten Agentur, 2001
Zugl.: Essen, Universität - Gesamthochschule, Magister, 2000
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte, insbesondere die
der Übersetzung, des Nachdrucks, des Vortrags, der Entnahme von Abbildungen und Tabellen,
der Funksendung, der Mikroverfilmung oder der Vervielfältigung auf anderen Wegen und der
Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen, bleiben, auch bei nur auszugsweiser Verwertung,
vorbehalten. Eine Vervielfältigung dieses Werkes oder von Teilen dieses Werkes ist auch im
Einzelfall nur in den Grenzen der gesetzlichen Bestimmungen des Urheberrechtsgesetzes der
Bundesrepublik Deutschland in der jeweils geltenden Fassung zulässig. Sie ist grundsätzlich
vergütungspflichtig. Zuwiderhandlungen unterliegen den Strafbestimmungen des
Urheberrechtes.
Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in diesem
Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme, daß solche
Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei zu betrachten
wären und daher von jedermann benutzt werden dürften.
Die Informationen in diesem Werk wurden mit Sorgfalt erarbeitet. Dennoch können Fehler nicht
vollständig ausgeschlossen werden, und die Diplomarbeiten Agentur, die Autoren oder
Übersetzer übernehmen keine juristische Verantwortung oder irgendeine Haftung für evtl.
verbliebene fehlerhafte Angaben und deren Folgen.
Dipl. Kfm. Dipl. Hdl. Björn Bedey, Dipl. Wi.-Ing. Martin Haschke & Guido Meyer GbR
Diplomarbeiten Agentur, http://www.diplom.de, Hamburg 2001
Printed in Germany
Inhaltsverzeichnis Seite
2
INHALTSVERZEICHNIS
EINLEITUNG ________________________________________________________ 4
TEIL I THEORETISCHE GRUNDLAGEN_______________________________ 8
1.
Zum Begriff der Medien ________________________________________________8
1.1. Geschichte der Massenmedien _______________________________________________ 14
1.2. Technische Charakteristika der ,,Neuen Medien"_________________________________ 19
2.
Zum Begriff der Kompetenz____________________________________________23
2.1. Die formale Struktur von Kompetenz__________________________________________ 24
2.2. Sprachliche
Kompetenz ____________________________________________________ 26
2.2.1. Kompetenz und Performanz bei Noam Chomsky ____________________________ 26
2.2.2. Entwicklungspsychologischer Ansatz nach Jean Piaget _______________________ 28
2.2.3. Gerold Ungeheuer zum Prinzip der sprachlichen Kreativität ___________________ 29
2.3. Kommunikative
Kompetenz _________________________________________________ 32
2.3.1. Kommunikative Kompetenz bei Dell Hymes _______________________________ 33
2.3.2. Kommunikative Kompetenz bei Jürgen Habermas ___________________________ 35
2.3.3. Kommunikative Kompetenz bei Pierre Bourdieu ____________________________ 37
2.3.4. Die Verwendung von Schemata und Scripts bei Niklas Luhmann _______________ 38
3.
Theorien zur Medienkompetenz ________________________________________41
3.1. Medienkompetenz bei Dieter Baacke __________________________________________ 42
3.2. Medienkompetenz bei Ralf Vollbrecht_________________________________________ 45
3.3. Medienkompetenz bei Lothar Mikos __________________________________________ 47
3.4. Medienkompetenz als Summe verschiedener Komponenten ________________________ 48
TEIL II STATUS QUO DER MEDIENKOMPETENZ _____________________ 53
4.
Zur Operationalisierbarkeit von Medienkompetenz ________________________53
4.1. Medienkompetenz als Medienmündigkeit ______________________________________ 55
4.2. Medienkompetenz als medienspezifische Nutzungsfähigkeit________________________ 58
4.3. Formulierung eines Medienkompetenzbegriffs __________________________________ 60
5.
Das Informationszeitalter: Warum Medienkompetenz heute so wichtig ist _____65
5.1. Massenmedien als (Mit-) Konstrukteure von Wirklichkeit__________________________ 67
5.2. Medienkompetenz als lebensweltlich verankerte Kulturtechnik______________________ 71
5.3. Neue Medien in der Arbeitswelt______________________________________________ 76
5.4. Die Notwendigkeit der Förderung von Medienkompetenz__________________________ 79
5.4.1. Zur ungleichen Verteilung von Bildungskapital _____________________________ 81
Inhaltsverzeichnis Seite
3
TEIL III FOLGERUNGEN FÜR DIE HANDLUNGSPRAXIS ______________ 83
6.
Die Förderung von Medienkompetenz als gesellschaftliche Aufgabe___________83
6.1. Aufgaben der Wissenschaft _________________________________________________ 86
6.2. Aufgaben der Politik_______________________________________________________ 88
6.3. Aufgaben der Wirtschaft____________________________________________________ 90
7.
Das Modell Public Private Partnership ___________________________________93
7.1. Das Europäische Zentrum für Medienkompetenz_________________________________ 96
7.2. Beispiel: Netd@ys NRW - Schulen ans Netz ___________________________________ 100
FAZIT_____________________________________________________________ 105
LITERATURVERZEICHNIS__________________________________________ 109
TABELLENVERZEICHNIS
Tabelle 1: Schrittweise Abstraktion von konkreten Äußerungen _______________________________ 37
Tabelle 2: Medienkompetenz bei Baacke, Vollbrecht und Mikos ______________________________ 51
Tabelle 3: Medienspezifische Nutzungsfähigkeit vs. Medienmündigkeit _________________________ 61
Tabelle 4: Medienkompetenz in Relation zu Medium und Alter des Nutzers ______________________ 63
Tabelle 5: Werbekompetenzniveaus_____________________________________________________ 64
Tabelle 6: Gesellschafter des ecmc _____________________________________________________ 98
Tabelle 7: Das ecmc im Schnittfeld von gesellschaftlichen Aufgaben und Medienkompetenzbegriff ___ 99
Tabelle 8: Förderung von Medienkompetenz durch die Netd@ys NRW ________________________ 104
Tabelle 9 : Dichotomische Struktur dieser Arbeit _________________________________________ 107
ABBILDUNGSVERZEICHNIS
Abbildung 1: Einflussfaktoren und Voraussetzungen für Medienkompetenz______________________ 59
Abbildung 2: Vier-,,Sektoren"-Modell der Wirtschaft ______________________________________ 66
Abbildung 3: Evolution der Informationsvermittlung _______________________________________ 75
Abbildung 4: Struktur-Modell von PPP__________________________________________________ 95
Einleitung
Seite 4
EINLEITUNG
,,Medienkompetenz im Informationszeitalter". Der Titel dieser Arbeit ist so konkret und
aufschlussreich, wie die gesamte aktuelle Diskussion um das Modewort ,,Medienkom-
petenz". Vor allem in bildungspolitischen Schriften
1
und medienpädagogischen Überle-
gungen
2
verzichtet kaum eine Stellungnahme darauf, die Bedeutsamkeit von Kompetenz
im Umgang mit Medien mit den Bedingungen des Informationszeitalters zu verknüpfen;
praktisch brauchbare Ergebnisse stehen allerdings nur in den seltensten Fällen am Ende
der teilweise sehr unterschiedlichen Ausführungen. Die Ironie, mit der Theißen sich
dem Thema nähert, soll verdeutlichen, auf welch dünnes Eis wir uns im Folgenden be-
geben werden:
,,In Wahrheit ist der Begriff eine treffende Metapher aus der Gentechnologie. Dort bezeich-
net ,Kompetenz` nämlich die Fähigkeit von Zellen, von außen angebotenes Erbmaterial
aufnehmen zu können. Da das von ganz vielen Zellen nur sehr wenigen gelingt, verleiht
man diesen mit dem Erbmaterial eine Resistenz gegen bestimmte Gifte. Man kann dann alle
diejenigen Zellen, die kein fremdes Erbmaterial aufgenommen haben, durch eine Giftbe-
handlung abtöten, so daß nur solche überleben, die das fremde Erbmaterial akzeptiert ha-
ben. Im übertragenen Sinne bedeutet Medienkompetenz demnach die Fähigkeit, die Ange-
bote der Medienwelt in sich aufnehmen und damit im widrigen Alltag besser bestehen zu
können. Wenn Ihnen also die Musik des ,Musikantenstadels` derart das Herz erwärmt, daß
Sie damit einen naßkalten Arbeitstag in Ihrer zugigen Imbißbude um die Ecke wohltempe-
riert überstehen, oder wenn Ihnen hohe Dosen von ,Herzblatt` und ,Traumhochzeit` locker
über jeglichen Mangel an eigenen zwischenmenschlichen Beziehungen hinweghelfen, ja
dann verfügen Sie wirklich über Medienkompetenz. Wagen Sie nun einen Blick in die Zu-
kunft und denken an all die vor uns liegenden Probleme: von der steigenden Arbeitslosig-
keit bis hin zur globalen Umweltzerstörung. Ahnen Sie, warum Medienkompetenz immer
wichtiger wird?" (Theißen 1997).
Nun aber zu den Fakten: Die beschleunigten medientechnischen Entwicklungen der
vergangenen Jahre haben unsere Kommunikationsmöglichkeiten und damit auch unser
Zusammenleben radikal verändert. Vor allem vor dem Hintergrund der wirtschaftlichen
und lebensweltlichen Veränderungen, die sich durch diese Entwicklung bedingt einge-
stellt haben und in Zukunft noch weiter verschärfen werden, besteht durchaus der Be-
darf, sich mit Fragen der zunächst mal adäquaten Nutzung von Medien zu beschäf-
tigen. Diese Erkenntnis hat sich verbreitet und schließlich zu der gegenwärtigen Kon-
junktur des Medienkompetenzbegriffs geführt.
3
1
Vgl. hierzu z.B. Mosdorf (1998), BMBF/BMWi (1999), Enquete-Kommission ,Zukunft der Medien
in Wirtschaft und Gesellschaft; Deutschlands Weg in die Informationsgesellschaft` Deutscher Bundes-
tag (1997).
2
Vgl. hierzu z.B. Rein (1996), Erlinger (1997), Baacke (1999), Vollbrecht (1999), Mikos (1999).
3
Vgl. Hillebrand/Lange (1996), S. 24 ff; Rein (1996), S. 11.
Einleitung
Seite 5
Als problematisch erweist sich in diesem Zusammenhang allerdings die Tatsache, dass
die Diskussion um Medienkompetenz häufig in theoretische Grundsatzfragen ausufert
und damit auf einem für die pädagogische Handlungspraxis unbrauchbaren Niveau ste-
cken bleibt.
4
Auch die vorliegende Arbeit beschäftigt sich einmal mehr mit dem Thema Medienkom-
petenz und verknüpft Aussagen dazu mit den Gegebenheiten des Informationszeitalters.
Die zu belegende These der Arbeit ist somit nicht gerade revolutionär:
Vor dem Hintergrund des beschleunigten Strukturwandels von der Industrie- zur Infor-
mationsgesellschaft stellt die Kompetenz im Umgang mit modernen medientechnischen
Errungenschaften (sprich Medienkompetenz) eine Schlüsselqualifikation dar, die es auf
verschiedenen Ebenen zu fördern gilt.
Doch der Unterschied zu vielen anderen Arbeiten mit demselben oder ähnlichem Thema
besteht in dem ausdrücklich angestrebten Bezug zur pädagogischen Handlungspraxis:
Der in dieser Arbeit zu entwickelnde Medienkompetenzbegriff soll (auch) theoretisch
fundiert, vor allem aber praktisch relevant sein. Zudem sollen Möglichkeiten für die
praktische Anwendbarkeit exemplarisch angesprochen werden.
Ein kühnes Vorhaben. Denn der Titel der Arbeit umfasst gleich drei ausgesprochen ge-
haltvolle Begriffe: Medien - Kompetenz - Informationszeitalter.
Viele Facetten wären zu jedem dieser Begriffe erwähnenswert. Allein der Untersu-
chungsgegenstand ,,Informationszeitalter" könnte gewiss mit seinen wirtschaftlichen,
politischen, technischen und individuellen Implikationen eine Magisterarbeit füllen.
Doch unsere Marschroute steht bereits fest: Die verwandten Begrifflichkeiten können
nur soweit eingeführt und untersucht werden, wie es für das Ziel der Arbeit, nämlich die
Formulierung von Vorschlägen für die Handlungspraxis zur notwendigen Förderung
von Medienkompetenz, unbedingt notwendig ist; gewisse theoretische Vereinfachungen
werden daher zugunsten der Handlungspraxis in Kauf genommen.
Einige grundlegende Einschränkungen sollen schon an dieser Stelle festgehalten wer-
den:
Der in dieser Arbeit angewandte Medienkompetenzbegriff ist die Qualifikation eines
Publikums. In Fortführung medienpädagogischer Tradition wird hier ein subjektbezo-
gener Medienkompetenzbegriff vorgestellt und untersucht. Zur Verdeutlichung: Es gibt
4
Vgl. Neuß (2000), S. 2 ff.
Einleitung
Seite 6
Ansätze, welche die Medienkompetenz von Institutionen, Ländern, Netzwerken, Ma-
schinen oder gar der Medien selbst untersuchen.
5
Diesen Theorien wird hier nicht nach-
gegangen. Denn der ohnehin bereits sehr komplexe Medienkompetenzbegriff würde
gewiss unter dem Druck der verschiedenen möglichen Ansätze in eine Vielzahl von
Differenzierungen zerfasern, die eine Magisterarbeit nicht hinreichend untersuchen
kann.
Die Diskussion um Medienkompetenz ist ein Phänomen, das mittlerweile global Gehör
findet. In den technisierten westlichen Gesellschaften ist allgemein die Problematik der
wachsenden Anforderungen an den Mediennutzer bekannt. In den einzelnen Staaten
reagiert man darauf allerdings teilweise mit unterschiedlichen Konzepten. Die in dieser
Arbeit vorgestellten Aussagen und Ansätze beziehen sich auf das Forschungsfeld
Deutschland.
Um trotz der in Kauf zu nehmenden theoretischen Einschränkungen die Substanz ermit-
teln zu können, die in den Begrifflichkeiten steckt, nähert sich die Arbeit dem Thema
Medienkompetenz auf drei unterschiedlichen Ebenen:
Auf der normativen Ebene werden in Teil I zunächst theoretische Grundlagen erarbei-
tet. Die verwandten Begrifflichkeiten werden geklärt, der Untersuchungsgegenstand
Medienkompetenz erhält so ein normativ-ideologisches Fundament. In Kapitel 1 wird
der Medienbegriff eingeführt, Kapitel 2 beschäftigt sich mit verschiedenen Ansätzen
zum Thema Kompetenz, und in Kapitel 3 werden schließlich unterschiedliche theoreti-
sche Konzepte von Medienkompetenz vorgestellt all dies zunächst kritiklos.
Anschließend wird in Teil II auf der strategischen Ebene ein Status Quo auf der Grund-
lage der zuvor getroffenen Aussagen ermittelt. In Kapitel 4 erfolgt zunächst eine Kritik
des eingeführten Medienkompetenzbegriffs, der dabei um einige Aspekte erweitert
wird. Kapitel 5 beschäftigt sich anschließend mit den Gegebenheiten des Informations-
zeitalters. Der zuvor entwickelte Medienkompetenzbegriff wird hier mit seinem gesell-
schaftlichen Kontext vernetzt.
Auf diese Weise erhält der Medienkompetenzbegriff die Konturen, die schließlich not-
wendig sind, damit abschließend in Teil III auf der operativen Ebene Folgerungen für
die Handlungspraxis herausgestellt werden können. Hier wird in Kapitel 6 die Notwen-
digkeit einer gesamtgesellschaftlichen Förderung von Medienkompetenz thematisiert,
5
Vgl. Gapski (2000). Gapski versucht die verschiedenen Diskurse der Medienkompetenz durch ein
systemtheoretisch konstruiertes Rahmenschema in einem dreidimensional gedachten Modell zu erfas-
sen.
Einleitung
Seite 7
besondere Bereiche werden dabei exemplarisch herausgegriffen. Anschließend wird in
Kapitel 7 das Modell Public Private Partnership als mögliches Instrument zur Förderung
von Medienkompetenz vorgestellt. Auch hier werden ebenfalls exemplarisch das
Europäische Zentrum für Medienkompetenz und das Projekt Netd@ys NRW als eine
Alternative vorgestellt, das zuvor formulierte Konzept von Medienkompetenz konkret
zu fördern.
Wenngleich die Arbeit in verschiedenen Abschnitten die elementaren Begrifflichkeiten
differenziert voneinander behandelt, so verschwimmen dennoch die Grenzen der ange-
sprochenen Bereiche. Überlegungen zu den Gegebenheiten des Informationszeitalters
beispielsweise ziehen sich als roter Faden durch den gesamten Text, werden allerdings
erst in Kapitel 5 gebündelt dargestellt. Wo es zum Kontextverständnis notwendig er-
scheint, werden Aussagen dazu vorweggenommen. Andererseits fallen auch Überlegun-
gen, die beispielsweise in Kapitel 1 schon möglich wären, zugunsten eines später zu
behandelnden Kapitels weg. Die Bewertung, wann welches Thema wo wie behandelt
wird, folgt letztlich dem Anspruch der optimalen Übersichtlichkeit und differiert daher
von Fall zu Fall.
Teil I Theoretische Grundlagen
Seite 8
TEIL I THEORETISCHE GRUNDLAGEN
1. Zum Begriff der Medien
Gebraucht man in einem wissenschaftlichen Kontext einen so vielseitig verwendbaren
Terminus wie ,,Medien", so sollte im Vorfeld die Begrifflichkeit geklärt werden, auf die
im Laufe der Untersuchung Bezug genommen werden soll, denn sowohl im Alltagsver-
ständnis als auch in der Wissenschaft hat der Terminus ,,Medien" oder ,,Medium" unter-
schiedliche Bedeutungen:
,,Medien: Mrz. v. Medium: (lat. ,das in der Mitte Befindliche`) (Mrz. Medien, Media),
1) bildungssprachlich: vermittelndes Element, insbes. (in der Mrz.) Mittel zur Weitergabe
oder Verbreitung von Information durch Sprache, Gestik, Mimik, Schrift, Bild, Musik.
2) Physik, Chemie: Träger physikal. oder chem. Vorgänge (z. B. Luft als Träger von
Schallwellen); Stoff, in dem sich diese Vorgänge abspielen.
3) Parapsychologie: die der außersinnl. Wahrnehmung für fähig gehaltene Person" (Meyers
Lexikon Online 2000, Internetquelle
6
).
In dieser Arbeit geht es zunächst um den ersten der drei hier vorgestellten Medienbeg-
riffe. Medien, in dem hier gebrauchten Verständnis, stehen somit im Dienst des mensch-
lichen Zusammenlebens und der menschlichen Kommunikation. Wird Kommunikation
als Prozess der Bedeutungsvermittlung verstanden, so impliziert dies, dass Kommunika-
tion und kommunikatives Handeln stets auf eine Vermittlungsinstanz angewiesen ist,
die als Träger der jeweiligen Bedeutungsinhalte fungiert. Träger von Bedeutungsinhal-
ten können Zeichen sein, die akustisch oder optisch vermittelt werden. Eine Vermitt-
lungsinstanz im oben beschriebenen Sinne ist dann ein Medium, Zeichen sind somit
konstitutive Elemente der genannten Informationsvermittler Sprache, Gestik, Mimik
etc.
,,Medien sind daher als Transportmittel zu begreifen, sie transportieren die zu vermittelnden
Bedeutungsinhalte. Es gibt also keine unvermittelte Kommunikation: alle Kommunikation
bedarf des Mittels oder Mediums, durch das hindurch eine Nachricht übertragen wird" (Di-
özesanarbeitsgemeinschaft für Erwachsenenbildung im Bistum Eichstätt e.V., Arbeitskreis
Medienpädagogik 1999, S. 30).
6
Da es sich bei der angegebenen Quelle um eine Internetquelle handelt, die abhängig von der verwen-
deten Software unterschiedliche Seitenzahlen generiert, können hier keine Seitenangaben zugeordnet
werden. Im weiteren Verlauf der Arbeit werden derartige Quellen mit dem Attribut ,Internetquelle`
anstelle der Seitenangabe versehen. Hiervon ausgenommen sind jene Internetquellen, welche als PDF-
Dateien herunterzuladen sind und daher ein einheitliches Format aufweisen.
Teil I Theoretische Grundlagen
Seite 9
Die Grundstruktur eines Kommunikationsmediums setzt sich prinzipiell aus drei Kom-
ponenten zusammen:
7
·
Zeichen (z.B. Wörter, Gesten) als kognitiv-semiotische Komponente
·
Signale (z.B. ausgesprochene Wörter als akustische Signale, geschriebene Wörter
auf Papier als optische Signale, Bewegungen, die als Gesten verstanden werden) als
materiell-physische Komponente
·
Kontakt als notwendige soziale Komponente.
Soviel zu einem oberflächlichen Verständnis des Medienbegriffs.
8
Nun lassen sich Me-
dien in diesem Kontext in weitere Bereiche differenzieren. Faßler (1997) verweist auf
die von Pross (1972) vorgenommene Einteilung in primäre, sekundäre und tertiäre Me-
dien:
9
·
Primäre Medien sind menschliche Elementarkontakte, also solche Medien, bei de-
nen kein Gerät zwischen Sender und Empfänger geschaltet ist (z.B. Sprache, Mimik,
Gestik).
·
Sekundäre Medien sind solche Medien, die lediglich auf Seiten des Senders den
Einsatz von Hilfsmitteln für die Produktion von Mitteilungen erfordern (z.B. Schil-
der, Bücher, Flaggsignale).
·
Tertiäre Medien sind schließlich jene Kommunikationsmittel, bei denen sowohl auf
Seiten des Senders als auch auf Seiten des Empfängers technische Hilfsmittel zur
Vermittlung eingesetzt werden (z.B. Telefon, Rundfunk, Computer).
Um den Medienbegriff nun so zu formulieren, wie er im Verlauf dieser Arbeit ge-
braucht werden kann, ist es allerdings notwendig, zunächst noch einen Blick auf wichti-
7
Vgl. Diözesanarbeitsgemeinschaft für Erwachsenenbildung im Bistum Eichstätt e.V., Arbeitskreis
Medienpädagogik (1999), S. 32.
8
Sozialwissenschaftliche Ansätze, z.B. der systemtheoretische Ansatz von Luhmann (1987) weiten die
gesellschaftliche Bedeutung des Medienbegriffs noch weiter aus. Luhmann spricht von symbolisch
generalisierten Kommunikationsmedien wie Geld oder Recht, welche die strukturelle Kopplung von
sozialen Systemen und damit erst Sozialität ermöglichen. Dieser speziell soziologische Medienbegriff
ist allerdings nicht Gegenstand dieser Arbeit und wird daher auch nicht weiter untersucht oder gar
hergeleitet.
9
Zur Vertiefung lies Pross (1972). Auch die Diözesanarbeitsgemeinschaft für Erwachsenenbildung im
Bistum Eichstätt e.V., Arbeitskreis Medienpädagogik (1999) weist auf diese Unterscheidung hin. Inte-
ressanterweise spricht Faßler (1997) in diesem Zusammenhang von der Existenz der quartären Me-
dien. Hierunter versteht er die computerbasierten und verstärkten Medienbereiche netztechnischer
und elektronisch-räumlicher Konsumtion, Information und Kommunikation. Im weiteren Verlauf der
Arbeit (Kapitel 1.2) werden diese Medien als sogenannte ,,Neue Medien" eingeführt.
Teil I Theoretische Grundlagen
Seite 10
ge Wesenszüge von Kommunikationsprozessen zu richten. Lasswell zufolge besteht das
Gerüst von Kommunikationsabläufen aus vier entscheidenden Säulen:
10
·
dem Sender, also jemandem, der etwas mitteilen will
·
der Mitteilung selbst
·
einem Medium
·
dem Empfänger, an den die Botschaft gerichtet ist.
Die Aufteilung verweist deutlich auf die Doppelseitigkeit von Kommunikation: Nur
wenn Sender und Empfänger kommunizieren wollen, kann Kommunikation gelingen.
Diese Überlegungen führen zu einer grundlegenden Unterscheidung von Kommunikati-
onsprozessen. Bei der gegenseitigen Kommunikation kann der Empfänger auf die Mit-
teilung des Senders reagieren, wird damit selbst zum Sender und beeinflusst so die fol-
genden Mitteilungen des Senders (z.B. face-to-face-communication). Bei der einseitigen
Kommunikation, beispielsweise bei einem Vortrag, hat der Empfänger diese Möglich-
keit prinzipiell nicht.
11
Darüber hinaus kann unterschieden werden zwischen Kommunikationsprozessen, bei
denen Mitteilungen an einen, mehrere oder prinzipiell unendlich viele Empfänger ge-
richtet sind. Während ein spezieller Empfänger oder auch eine begrenzte Gruppe ver-
schiedener Empfänger noch über primäre Medien erreicht werden kann, bedarf die In-
formationsvermittlung an eine größere oder gar unendlich große Gruppe von Empfän-
gern zumindest sekundärer, meistens aber tertiärer Medien. Besonders interessant ist in
diesem Zusammenhang die Informationsvermittlung an eine unbegrenzt große Gruppe
von Empfängern. Diese Art der Kommunikation wird gemeinhin als Massenkommuni-
kation bezeichnet.
12
,,Unter Massenkommunikation ist jener Prozeß zu verstehen, bei dem Aussagen öffentlich,
d.h. ohne begrenzte oder personell definierte Empfängerschaft, indirekt d.h. bei räumlicher
oder zeitlicher oder räumlichzeitlicher Distanz zwischen Kommunikationspartnern einsei-
tig, d.h. ohne Rollenwechsel zwischen Aussagendem und Aufnehmendem durch technische
Verbreitungsmittel (Massenmedien) an ein disperses Publikum vermittelt werden" (Diöze-
sanarbeitsgemeinschaft für Erwachsenenbildung im Bistum Eichstätt e.V., Arbeitskreis
Medienpädagogik 1999, S. 31).
10
Vgl. Lasswell (1948), S. 37 ff.
11
Gewiss haben auch in dem gewählten Beispiel Empfänger nonverbale Möglichkeiten, den Sender in
seinen Ausführungen zu beeinflussen, doch diese Einflussnahme ist sehr begrenzt und prinzipiell nicht
intendiert. Insofern kann ein Vortrag durchaus als Beispiel für einseitige Kommunikation dienen.
Treffendere Beispiele (z.B. Rundfunk) stehen an dieser Stelle nicht zur Verfügung, da der Begriff der
Massenkommunikationsmittel noch nicht eingeführt wurde.
12
Ein weiterer interessanter Aspekt der Massenkommunikation ist das Phänomen, dass die Anzahl der
Empfänger auch die Form der Darstellung von Informationen beeinflusst. Lies hierzu Faßler (1997),
Faßler/Halbach (1998), Faulstich (1991).
Teil I Theoretische Grundlagen
Seite 11
Diese Perspektive zielt bereits deutlich auf eine Massenkommunikation ab, die vor-
nehmlich über tertiäre Medien erfolgt. Gewiss spielen tertiäre Medien bei der Massen-
kommunikation eine bedeutende Rolle. Dennoch soll an dieser Stelle nicht unerwähnt
bleiben, dass auch sekundäre Medien wie beispielsweise das Buch oder die Zeitung
Massenkommunikationsmedien oder - wie wir sie ab jetzt nennen wollen - Massenme-
dien sind. Unser allgemeiner Medienbegriff erfährt hier also eine Spezialisierung auf all
jene Medien, die als Träger von Massenkommunikationsprozessen eingesetzt werden
können die Massenmedien.
,,Massenmedien oder Massenkommunikationsmittel sind all jene Medien, über die durch
Techniken der Verbreitung und Vervielfältigung mittels Schrift, Bild und/oder Ton optisch
bzw. akustische Aussagen an eine unbestimmte Vielzahl von Menschen vermittelt werden
kann" (Diözesanarbeitsgemeinschaft für Erwachsenenbildung im Bistum Eichstätt e.V.,
Arbeitskreis Medienpädagogik 1999, S. 31).
Die Massenkommunikation ist, wie wir gesehen haben, prinzipiell der einseitigen
Kommunikation zuzurechnen, da die Empfänger keinen unmittelbaren Einfluss auf die
vermittelten Inhalte haben. Dennoch sprechen Medienforscher mittlerweile von einem
komplexen Wechselwirkungsverhältnis zwischen Massenmedien und Rezipienten.
13
Der rückwirkende Einfluss der Rezipienten bezieht sich allerdings nicht auf die techni-
schen Mittel und Möglichkeiten der Übertragungsfunktion von Massenmedien, da diese
freilich von naturwissenschaftlich Machbarem abhängig ist. Vielmehr wird in derartigen
Äußerungen auf die von den Medien vermittelten Inhalte, also die Mitteilungen der
Sender und die Sender selbst, Bezug genommen. Wird von einer Wechselwirkung zwi-
schen Massenmedien und Rezipienten gesprochen, so bezieht sich der Einfluss der Re-
zipienten eigentlich auf die Sender (Rundfunkanstalten, Nachrichtenredaktionen, Wer-
bestrategen), welche die Massenkommunikationsmedien benutzen, um bestimmte Inhal-
te zu vermitteln. Die Massenmedien, die nach der bislang gültigen Definition lediglich
von Sendern gemeinte Bedeutungen übermitteln, werden, wohl wegen der Anonymität
der wirklichen Sender, häufig selbst als Sender verstanden und geraten in diesem Ver-
ständnis selbst zu Produzenten von Bedeutungen. Die Gestalter der Inhalte von Mas-
senmedien werden häufig mit den Massenmedien gleichgesetzt, es wird vom ursprüng-
lichen Sender abstrahiert. Mit einem derartigen Verständnis der Medien wird das lass-
wellsche Gerüst im Prinzip auf zwei Bestandteile verkürzt: der Sender, die Aussage und
das Übertagungsmedium werden unter dem Sammelbegriff ,,die Medien" zusammenge-
13
Vgl. Diözesanarbeitsgemeinschaft für Erwachsenenbildung im Bistum Eichstätt e.V., Arbeitskreis
Medienpädagogik 1999, S. 31. Zur Vertiefung lies Schulz (1992).
Teil I Theoretische Grundlagen
Seite 12
fasst. Dies ist vor allem immer dann der Fall, wenn beispielsweise von der ,,Macht der
(Massen-) Medien" die Rede ist. Diese Entwicklung liegt vor allem in der enormen
Komplexität der durch Medien vermittelten Inhalte und Bedeutungen begründet.
,,Der Verbund von technischem Sender und Empfänger wird zu einem eigenwertigen
Darstellungs- und Erklärungszusammenhang, wird Medium. Je häufiger Vermittlung durch
diese gerätetechnische Medialität genutzt wird, und je selbstverständlicher ihr Gebrauch als
Realitätsdarstellung, -erklärung und -erzeugung ,kultiviert` wird, umso schwächer wird die
Bedeutung der angesichtigen Kommunikation" (Faßler 1997, S. 117).
Die aktuellen Entwicklungen, die dazu geführt haben, dass Medienkompetenz in der
Medienpädagogik zu einem wichtigen Thema wurde, liegen soviel darf wegen der
Augenscheinlichkeit dieser Entwicklungen ohne weiteres vorweggenommen werden
vor allem in dem Aufkommen der Massenkommunikation begründet, die wiederum
durch das Aufkommen neuer technischer Errungenschaften zusätzliche Möglichkeiten
erfährt. Hinzu kommt, dass die durch Massenmedien übermittelten Inhalte, wie wir
noch sehen werden, so komplex sind, dass es besonderer Fähigkeiten der Rezipienten
bedarf, den Sender der Information und seine mögliche Intention zu erkennen und somit
den Wahrheitsgehalt der Informationen angemessen zu bewerten.
Betrachten wir also nochmals die bislang vorgenommenen Überlegungen bezüglich
Medien und Medienkommunikation, so ergeben sich für die angestrebte Untersuchung
des Medienkompetenzbegriffs gleich drei zu berücksichtigende Parameter eines ver-
wendbaren Medienbegriffs, die zudem miteinander verwoben sind:
·
Sowohl sekundäre als auch tertiäre Medien kommen als Massenmedien in Frage
·
Sowohl Massenkommunikation als auch interpersonale Kommunikation erfolgt über
tertiäre Medien
·
Massenmedien, ursprünglich ,,nur" Übermittler von Nachrichten, werden häufig mit
den eigentlichen Sendern von Mitteilungen gleichgesetzt, da diese unerkannt im
Hintergrund bleiben. Somit werden Massenmedien zugleich zu Konstrukteuren und
Trägern von Inhalten.
Die beschriebenen Mediendimensionen schaffen die Grundlage für einen Medienbeg-
riff, der einen fundamentalen Hintergrund für Überlegungen zu einem Medienkompe-
tenzbegriff bildet. Dieser Medienbegriff soll hier kurz skizziert werden:
Teil I Theoretische Grundlagen
Seite 13
·
Medien sind Massenkommunikationsmittel (hierzu zählt beispielsweise auch die
Zeitung als sekundäres Massenkommunikationsmedium).
·
Medien sind technische Geräte, die eine Verständigung zwischen Sender und Emp-
fänger ermöglichen (hierzu zählt beispielsweise auch das Telefon, wenngleich es
kein Massenkommunikationsmittel ist).
·
Medien sind Konstrukteure und Träger von Inhalten (auch Erzeuger von Medienin-
halten werden als Medien bezeichnet, da häufig die eigentlichen Sender hinter den
Medien nicht mehr erkennbar sind).
Nachdem nun ein Medienbegriff herausgearbeitet wurde, der für die Diskussion eines
Medienkompetenzbegriffs brauchbar ist, scheint es sinnvoll, einzelne Aspekte dieses
Medienbegriffs nochmals kurz zu untersuchen; denn jede der drei genannten Dimensio-
nen des Medienbegriffs hat eine eigene Geschichte, die mit Hinblick auf die Konjunktur
des Medienkompetenzbegriffs durchaus interessant ist.
Der nun folgende kurze Abriss über die Geschichte und Entwicklung der modernen
Massenmedien (Kapitel 1.1) soll verdeutlichen, aus welchem Grunde Kompetenz im
Umgang mit Medien in der jüngeren Vergangenheit mit wachsendem Interesse unter-
sucht wurde und gewiss auch, warum es dringend notwendig scheint, dass Forschungen
in diesem Feld sehr rasch zu spürbaren Fortschritten in der allgemeinen Förderung von
Medienkompetenz führen.
Anschließend werden kurz die wesentlichen technischen Charakteristika der sogenann-
ten ,,Neuen Medien" beschrieben (Kapitel 1.2). Denn vor allem der technische Fort-
schritt, der bislang in den dort beschrieben Entwicklungen gipfelt, gilt als (Mit-) Auslö-
ser der jüngsten Medienkompetenzdiskussion.
Das Verständnis von Massenmedien als Konstrukteure und Träger von Inhalten ist
komplexer, hat weitreichende Folgen für den Medienkompetenzbegriff und wird daher
nicht an dieser Stelle nur kurz angesprochen, sondern in Kapitel 5.1 (Massenmedien als
(Mit-) Konstrukteure von Wirklichkeit) vertieft und in den Kontext der Rahmenbedin-
gungen des Informationszeitalters eingebettet.
Teil I Theoretische Grundlagen
Seite 14
1.1.
Geschichte der Massenmedien
Die Geschichte der Massenmedien beginnt gewiss zu jenem Zeitpunkt, an dem die erste
entscheidende Erfindung zur Vervielfältigung von Gedankengut gemacht wurde: mit
Entdeckung des Buchdrucks durch Johannes Gutenberg Mitte des 15. Jahrhunderts. Die
einschneidenden Neuerungen, welche diese Erfindung zur Folge hatte, lassen sich fol-
gendermaßen beschreiben:
,,Was einst nur von wenigen Individuen gelesen worden war, konnte jetzt von einem gan-
zen Volk gelesen werden und fast gleichzeitig auf alle Menschen wirken, welche dieselbe
Sprache verstanden" (Condorcet 1976; zit. n. Winter/Eckert 1990, S. 26).
Die anfangs noch wenigen Druckerpressen vermehrten sich so rasch, dass bereits um
1500 in mehr als 250 Orten Druckerpressen standen und über 20 Millionen Bücher-
Einzelexemplare gedruckt waren.
14
Gegen Ende des 16. Jahrhunderts entstanden die
ersten öffentlichen, periodischen Zeitungen. Diese beschäftigten sich jedoch hauptsäch-
lich mit Alltagsfragen und entsprachen in ihrem Stil noch nicht den heutigen Zeitun-
gen
15
.
Dennoch wurden die Vorteile, welche die Technik des Druckens bot, sehr bald für poli-
tische und gesellschaftliche Zwecke genutzt. So stellten beispielsweise die Schriften
von Martin Luther zwischen 1500 und 1550 allein ein Drittel der deutschsprachigen
Bücher dar. Diese Tendenz verstärkte sich zunehmend. Zeitweise hatten Bücher vor-
nehmlich den Zweck, aktuelle Meinungen und Überzeugungen zu verbreiten.
Großer Antreiber der Politisierung durch Bücher war insbesondere das aufstrebende
Stadtbürgertum, das zu diesem Zeitpunkt die meisten Lesekundigen hervorbrachte. Es
galt als schick, sich in kleinen Lesegruppen zu treffen und dann nach dem gemeinsamen
Lesen über die neuesten Veröffentlichungen zu diskutieren. Aber auch bei den Bauern
und Handwerkern, die größtenteils noch nicht des Lesens mächtig waren, konnte sich
erstmals politische Meinung verbreiten. Die Verteilung von Flugschriften, die dann von
einigen Lesekundigen (z.B. Drucker waren lesekundige Handwerker) unter dem Volk
vorgelesen wurden, trug zur Bildung von politischem Bewusstsein unter der einfachen
Bevölkerung bei. Diese Weitervermittlung könnte als ein erstes two-step-flow-Modell
von Kommunikation betrachtet werden.
16
14
Vgl. Winter/Eckert (1990), S. 26.
15
Diese entwickelten sich erst im Amerika des 19. Jahrhunderts.
16
Vgl. Winter/Eckert (1990), S. 32.
Teil I Theoretische Grundlagen
Seite 15
Die technischen Erfindungen, die zur Fotografie führten, verstärkten die bereits durch
den Buchdruck eingeleitete visuelle Kultur. Die Technik mit fotografischen Negativen
wurde 1835 von William H. Fox Talbot entwickelt. Bereits 1880 erschien das erste Foto
in einer Zeitung. Aber erst nachdem 1888 der erste handliche und preiswerte Fotoappa-
rat auf den Markt kam, wurde die Amateurfotografie möglich. Die neuen Bilder wurden
damit der breiten Allgemeinheit zugänglich.
,,Der Bildbesitz und die Bildrezeption, die noch am Anfang des 19. Jahrhunderts ein Privi-
leg des Adels und der großbürgerlichen Schichten war, wurden demokratisiert. Damit wur-
de das Gefühl für die Bedeutung des Selbst gesteigert" (Winter/Eckert 1990, S. 49).
Das Besondere an den Fotos war, dass sie die fotografierten Gegenstände so realistisch
wie nie zuvor abbilden konnten und dass der Betrachter der Bilder Orte sehen konnte,
die er noch nie zuvor aufgesucht hatte. Der Horizont des Einzelnen wurde somit durch
die Fotos erweitert. Dadurch, dass jede Fotografie - vor allem von Personen - einen spe-
ziellen Augenblick darstellte und damit neben räumlichen auch zeitliche Grenzen über-
winden konnte, entstand zudem eine veränderte Einstellung zur Vergangenheit.
17
War es erst einmal möglich, Gegenstände und Personen naturgetreu abzubilden, lag der
Gedanke nicht fern, eine Vielzahl von aufeinanderfolgenden Bildern so schnell hinter-
einander zu zeigen, dass sie auch Bewegung natürlich abbilden konnten. Bereits seit
Mitte des 19. Jahrhunderts arbeitete man daran, die Fotos zu dynamisieren. 1895 war es
dann soweit: die Brüder Lumiere führten in Paris die ersten Filme vor. Anfangs wurden
sie noch in Cafés aufgeführt. Doch schon bald war der Andrang der Zuschauer so groß,
dass Veranstaltungsräume extra für die Vorführung solcher Filme errichtet wurden. Das
Kino war geboren.
In der Anfangsphase wurde der Film noch genutzt, um alltägliche Vorgänge so realis-
tisch wie möglich darzustellen. Doch es dauerte nicht lange, da entdeckte man die Mög-
lichkeit des Films, erfundene Geschichten zu erzählen. Damit wurde das Kino zu einer
ernsthaften Konkurrenz für das Theater.
Der realistische Charakter von Bildern wurde damit weiterhin gesteigert. Der Film hatte
dem Foto gegenüber den Vorteil, dass er nicht mehr nur einfach einen Augenblick, son-
dern eine längere Zeitspanne fixieren konnte und dass er daher nicht mehr, wie das Fo-
to, nur ein Verweis auf die Vergangenheit war, sondern ,,existenzielle Gegenwärtigkeit"
(Winter/Eckert 1990, S. 73) erzeugen konnte.
17
Vgl. Winter/Eckert (1990), S. 43.
Teil I Theoretische Grundlagen
Seite 16
Der nächste große Schritt in der Entwicklung der Massenmedien war die Konservierung
und der Transport des Tons. Durch die mit dem Telefon beginnende Isolierung des Tons
wurde die bislang durch Druck, Schrift und Fotografie hauptsächlich visuell geprägte
Wahrnehmung in eine neue Dimension geführt.
Die erste öffentliche Fernsprechvermittlung entstand 1878. Das Telefonnetz wuchs von
diesem Zeitpunkt an so rasch, dass es noch vor der Jahrhundertwende zum 20. Jahrhun-
dert zur Übertragung von Predigten und Musikkonzerten genutzt wurde und daher in
dieser Phase durchaus als Massenmedium im zuvor beschriebenen Sinne verstanden
werden kann. Die wichtigste Veränderung, welche das Telefon mit sich brachte, war
eine neue Einstellung zur Entfernung. Menschen konnten zugleich an zwei verschiede-
nen Orten etwas bewirken. Die mühelose Überbrückung großer Entfernungen ohne
Zeitverlust führte zu Beziehungen, die von gemeinsamen Interessen getragen wurden.
Winter und Eckert sprechen in diesem Zusammenhang auch von zunehmend funktiona-
len Differenzierungen (nach Interessen) gegenüber den vorher üblichen segmentären
Differenzierungen (nach Nachbarschaften).
18
Nur kurze Zeit später, nämlich 1901, gelang es dem Italiener Guglielmo Marconi erst-
mals Morsezeichen drahtlos über den Atlantik zu senden. Diese Erfindung leitete die
Entstehung des Radios ein. Rundfunkanstalten strahlten bald regelmäßig Sendungen
aus, die dann von jedem, der ein Empfangsgerät besaß, mitverfolgt werden konnten. In
der Folgezeit entdeckte man die vielen neuen Möglichkeiten (Informationsvermittlung,
Werbung, Unterhaltung), die dieses Medium bot.
Neben den schon durch das Telefon eingeleiteten Neuerungen bezüglich der veränder-
ten Wahrnehmung von Raum und Zeit, hatte das Radio weitere gewaltige Veränderun-
gen zur Folge: prinzipiell konnte jeder - ob Kind oder Analphabet - die Informationen
aus dem Radio rezipieren. Jedermann konnte sich somit über die Geschehnisse aus aller
Welt informieren, über die das Radio berichtete. Eine weitere Besonderheit des Radios
war seine Kompatibilität mit anderen Tätigkeiten. Das Radio konnte im Hintergrund
mitlaufen, während man sich einer völlig anderen Tätigkeit widmete.
Die Verbreitung des Radios und das Erfassen seiner Möglichkeiten von Seiten der Pro-
duzenten und Rezipienten sollte die Gesellschaft jedoch nur bereit machen für das Fern-
sehen.
Die Entstehung des Fernsehens ist eine nahezu zwangsläufige Folge des Erfolges von
Radio und Kino. Nachdem sich bewegte Bilder herstellen ließen und dazu bekannt war,
18
Vgl. Winter/Eckert (1990), S. 59.
Teil I Theoretische Grundlagen
Seite 17
wie sich Radiowellen aussenden und empfangen lassen, konnte es nur noch eine Frage
der Zeit sein, bis es möglich war, auch die Filmbilder in fast jeden Haushalt einziehen
zu lassen.
1935 wurde in Berlin das erste regelmäßige deutsche Fernsehprogramm ausgestrahlt.
Durch das komplexe Bild, welches das Fernsehen von der Welt zu vermitteln vermoch-
te, entstand der Eindruck, dass es die Fähigkeit hätte, dem Zuschauer einen realen Ein-
druck von der Wirklichkeit zu vermitteln. Später gelangte man jedoch zu dem Schluss,
dass nicht die Wirklichkeit abgebildet wird, sondern dass sich die Fernsehwirklichkeit
mit wachsendem Fortschritt immer mehr der menschlichen Wahrnehmung annähert,
dass sie jedoch niemals alle ihre Facetten erfassen kann.
19
Die Verbreitung des Fernsehens leitete erneut eine völlig neue Phase im Bereich der
Mediennutzung ein. Die durch den Buchdruck und die Fotografie eingeleitete und durch
das Radio ein wenig ins Stocken gekommene visuelle Kultur konnte sich endgültig
etablieren. Darüber hinaus hat das Fernsehen eine ungemein wichtige Funktion als Fil-
ter von Informationen.
,,Seine primäre Eigenschaft besteht darin, die Komplexität sozialer Erfahrungen zu reduzie-
ren, indem es die Welt überschaubar und ,einsehbar` präsentiert" (Winter/Eckert 1990, S.
92).
Die Gesellschaft der Gegenwart hat mittlerweile eine Differenziertheit erreicht, die in
ihrer Totalität für den Einzelnen nicht mehr überschaubar zu sein scheint.
Etwa Mitte des 20. Jahrhunderts entstand dann ein neues Medium, dessen Evolution bis
in die Gegenwart hineinreicht und dessen zukünftige Entwicklung nicht absehbar ist:
der Computer.
Als eigentliches Geburtsjahr des Computers, wie wir ihn heute kennen, gilt gemeinhin
das Jahr 1971, als der erste Mikroprozessor entwickelt wurde, ein Computer, der mit
einem Minichip als ,,Gehirn" arbeitete. 1975 kam der erste Mikrocomputer, der auch
von Nichttechnikern genutzt werden konnte, auf den Markt. Zu Beginn seiner Entwick-
lung wurde der Computer noch ausschließlich zur Rationalisierung von Arbeitsvorgän-
gen eingesetzt. Doch durch kontinuierliche Verbesserungen wurden Computer stets
kleiner, preiswerter und benutzerfreundlicher. Vor allem wegen ihrer vielseitigen Ver-
wendbarkeit sind sie daher auch für den privaten Haushalt relevant geworden. Beson-
19
Die mögliche Wirkung von Massenmedien als Wirklichkeitsverzerrer und das damit einhergehende
Entstehen medialer Scheinwirklichkeiten wird in Kapitel 5.1. nochmals aufgegriffen.
Teil I Theoretische Grundlagen
Seite 18
ders Computerspiele machten die Computer als Unterhaltungsmedium für den privaten
Gebrauch interessant. Die Spiele zeigen dem Spieler eine künstliche Umgebung, in der
er eine (ebenfalls künstliche) Figur mit Hilfe von Steuerbefehlen per Computer bewe-
gen kann. Die Computerumgebung reagiert somit - in begrenztem Maße - auf die Akti-
vitäten des Spielers. Damit hatten die elektronischen Medien ein neues Stadium er-
reicht: sie waren interaktiv. Die Trends, wie beispielsweise die Bildung von Schein-
wirklichkeiten oder die Überbrückung von Raum und Zeit, die durch das Fernsehen
ihren bisherigen Gipfelpunkt erlebt hatten, wurden vom Computer aufgegriffen und
sensationell weiterentwickelt.
20
Ein weiterer Meilenstein in der Entwicklung der modernen Computer- und Kommuni-
kationstechnologie ist die Entstehung des Internet. Computer können über einen Tele-
fonanschluss miteinander in Verbindung treten und Informationen austauschen. War der
Computerbenutzer in seiner Interaktion anfangs noch auf den Umfang und die Möglich-
keiten des Programms angewiesen, in dem er sich bewegte, wurde mit der Vernetzung
von Rechnern auch dieser Rahmen gesprengt.
Die beschriebene Entwicklung hat gewiss dazu geführt, dass Medien gegenwärtig so
demokratisch sind, wie nie zuvor. Wer beispielsweise Zugang zum Internet hat, kann
dort zahllose Informationen abrufen und zugleich seine Einstellungen und Ansichten
vor der ganzen Welt ausbreiten; und dies schneller und ausführlicher denn je interak-
tiv. Dennoch werden trotz kontinuierlich steigender Nutzerzahlen zunehmend auch jene
Menschen vom weltweiten Datenverkehr ausgeschlossen, denen entweder nicht die
notwendige technische Ausrüstung zur Verfügung steht (aus welchen Gründen auch
immer) oder aber, die schlichtweg nicht die notwendigen Kenntnisse, Fertigkeiten und
Erfahrungen sprich: nicht die notwendige Kompetenz mitbringen, um dieses ,,Neue
Medium" effektiv zu nutzen. Auch vor diesem Hintergrund muss die Entwicklung eines
Medienkompetenzbegriffs und eine daran anknüpfende Förderung von Medienkompe-
tenz gesehen werden.
20
Vgl. Winter/Eckert (1990), S. 114.
Teil I Theoretische Grundlagen
Seite 19
1.2.
Technische Charakteristika der ,,Neuen Medien"
Nachdem der Focus der Medienentwicklung bislang vornehmlich auf den Veränderun-
gen gesellschaftlicher Strukturen durch die Massenmedien ruhte, soll im nun folgenden
Kapitel das Augenmerk speziell auf die jüngste technische Entwicklung der Medien
gerichtet werden. Denn die verstärkte Aufmerksamkeit, welche der Medienforschung
seit einiger Zeit geschenkt wird, hängt unzweifelhaft mit dem Aufkommen der soge-
nannten ,,Neuen Medien" zusammen.
21
Gerade die Korrelation dieser medientechni-
schen Entwicklungen und ihre Diffusion in gesellschaftliche Zusammenhänge haben die
Konjunktur des Medienkompetenzbegriffs vorangetrieben.
Vornehmlich in der Wirtschaft hat in diesem Zusammenhang auch der Begriff der In-
formations- und Kommunikationstechniken (IuK-Techniken) Einzug gehalten. Zahlrei-
che Autoren beziehen sich in ihren Aussagen über die Veränderungen des Arbeitsallta-
ges auf den zunehmenden Einsatz von IuK-Techniken.
22
Daher soll an dieser Stelle kurz
geklärt werden, was in dieser Arbeit darunter zu verstehen ist:
Bezogen auf die zuvor getroffenen Aussagen über Medien, können als Informations-
techniken all jene tertiären Medien bezeichnet werden, die der einseitigen Informations-
vermittlung dienen (z.B. Rundfunk, Internet)
23
, Kommunikationstechniken dagegen
sollen jene Medien genannt werden, die einen direkten Austausch zwischen Sender und
Empfänger ermöglichen (z.B. Telefon, E-Mail). Sowohl Informations- als auch Kom-
munikationstechniken wurden bereits vor dem Aufkommen der Neuen Medien in ver-
schiedenen Wirtschaftszweigen eingesetzt, doch erst seit die im Folgenden beschriebe-
nen technischen Neuerungen zusätzliche Anwendungsmöglichkeiten geschaffen haben,
lassen sich wieder umfassende Auswirkungen auf alle Bereiche der Wirtschaft feststel-
len.
Welche technischen Faktoren charakterisieren nun die Neuen Medien? Wo liegt der
Unterschied zu den Klassischen Medien die jahrelang untersucht wurden, ohne dass der
Begriff Medienkompetenz eine besondere Bedeutung erlangt hätte?
21
Vgl. Rein (1996), S. 11.
22
Vgl. Reichenwald/Möslein (1997); Stransfeld/Seetzen (1993); BMBF/BMWi (1999).
23
Die angesprochene Einseitigkeit bezieht sich freilich nur auf einen kurzfristigen zeitlichen Rahmen.
Längerfristig ist natürlich auch hier eine Reaktionsmöglichkeit auf Seiten der Empfänger gegeben.
Teil I Theoretische Grundlagen
Seite 20
Zunächst einmal lässt sich festhalten, dass die Vielfalt der technischen Lösungen und
Entwicklungslinien im Bereich der Massenmedien in den vergangenen zehn Jahren
enorm zugenommen hat. Die daraus resultierende Unüberschaubarkeit der Medientech-
nik wird zudem verstärkt durch die mit dieser Entwicklung einhergehende Konvergenz
der verschiedenen Medienformen. Dieser Entwicklungsprozess wird von Fidler gar als
,,Mediamorphosis" bezeichnet.
24
Insofern wäre es strategisch unklug, technische Me-
dien, so wie sie sich zurzeit darstellen, isoliert voneinander zu betrachten. Innerhalb
eines dynamischen und gesellschaftlich eingebetteten Systems koexistieren die Neuen
Medien neben den älteren Medienformen, aus denen sie zuvor evolviert sind. Ältere
Medienformen werden interessanterweise durch neuere Medien ebenfalls beeinflusst,
selten aber nur vollständig verdrängt.
25
Aber nochmals zurück zu der bereits angesprochenen Konvergenz der ursprünglich ver-
schiedenen Medienformen. Im technischen Sinne ist darunter die Integration von bis-
lang getrennten Mediendiensten auf einer technischen Plattform zu verstehen.
26
Schon
in den 1980er Jahren war der Trend einer solchen Konvergenz der Medienformen er-
kennbar. Zu diesem Zeitpunkt gingen Experten allerdings noch von einem Universal-
netz auf der Basis eines integrierten Breitbandnetzes aus. In den 1990er Jahren zeichne-
te sich dann zunehmend eine Verknüpfung heterogener Netzwerkstrukturen zu Netzen
von Netzen ab, so dass bei der gegenwärtigen Entwicklung eher vom Prinzip eines
Baukastens als von einer wirklichen Verschmelzung der Medientechniken gesprochen
werden kann.
27
Die Konsequenz daraus ist dennoch das zunehmende Verschwimmen
der Grenzen zwischen Rundfunk, Telekommunikation und Computer. Diese Entwick-
lung hat in den vergangenen zehn Jahren bereits erkennbar begonnen und dürfte sich in
Zukunft noch weiter fortsetzen.
28
Andererseits ist die Tendenz einer zunehmenden Aus-
differenzierung von Medien bezüglich ihrer Anzahl und Anwendungsformen erkennbar.
Diese Entwicklung dürfte daher zu einer wachsenden Bedeutung von Standardisierung
und daraus resultierender Kompatibilität einzelner technischer Anwendungen führen.
24
Vgl. Fidler (1997).
25
Vgl. Riepl (1992), S. 146; Latzer (1997), S. 147.
26
Vgl. Latzer (1997), S. 76. Latzer weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass die Konvergenz
nicht auf einen technischen Verschmelzungsprozess beschränkt werden kann, sondern auch auf den
Bereich der Industrien und Anwendungsfelder ausgedehnt werden muss.
27
Vgl. Gapski (2000), S. 30.
28
Gewiss ist es prinzipiell äußerst problematisch, für dieses von zahllosen Parametern generierte Feld
zielgenaue Prognosen zu erstellen. Historische Beispiele für nicht eingetroffene Voraussagen belegen
dies deutlich. Das bisherige Verschwimmen der Grenzen einzelner Medientechniken ist jedoch so au-
genscheinlich, dass es nicht besonders kühn erscheint, das Anhalten dieser Tendenz auch für die Zu-
kunft zu unterstellen.
Teil I Theoretische Grundlagen
Seite 21
,,Medien differenzieren sich hinsichtlich Anzahl und Anwendungsformen immer weiter
aus: [...] Daher werden aus technischer und medienpolitischer Perspektive Aspekte der
Standardisierung, der Interkonnektivität und der Interoperabilität von technischen Teilsys-
temen an Bedeutung gewinnen" (Gapski 2000, S.31).
Die technischen Voraussetzungen, welche die angesprochene Konvergenz der Medien
letztlich prägen, werden von Gapski in folgenden Kategorien beschrieben:
29
Digitalität
Erst die Umstellung von analoger auf digitale Codierung von Daten ermöglicht techni-
sche Konvergenz. Auf diese Weise werden Inhalte praktisch ,,verflüssigt" und können
anschließend in beliebige Formen ,,umgegossen" werden. Digitale Daten sind Bedin-
gung für multimediale (also unterschiedliche Medienformen zeitgleich nutzende) Prä-
sentationen und ermöglichen unbegrenzte Vervielfältigungsmöglichkeiten ohne Quali-
tätsverlust.
Virtualität
Virtualität meint die digitaltechnisch realisierte Simulation und Umsetzung beliebiger
algorithmisierbarer Prozesse. Dabei wird eine konstruierte Simulationswelt an einen
realen Handlungsraum mit jeweils unterschiedlichen Handlungsfolgen gekoppelt. Das
Ausmaß der Kopplung bleibt dabei allerdings unterschiedlich. Es reicht beispielsweise
von einer einfachen Rechensimulation (bei der nur Zahlen und Formeln simuliert wer-
den) bis hin zur Virtual Reality Anwendung, bei welcher der Nutzer eine simulierte
komplette Welt beobachten kann, die nur aus Daten besteht und nur per Computer zu-
gänglich ist.
Darüber hinaus hat die Virtualität eine besondere Bedeutung im Bereich der Telekom-
munikationstechnik gewonnen: Durch die Möglichkeit der Datenkomprimierung kann
die Übertragungskapazität für digitale Bild- oder Bewegtbild-Daten bei begrenzter phy-
sikalischer Bandbreite erheblich gesteigert werden.
Multimedialität
Multimedialität meint die zeitgleiche Präsentation und damit verbundene Zusammen-
führung verschiedener Medienformen (z.B. Text, Ton, Bild, Bewegtbild). Für diese
Form der Konvergenz bildet die Digitalisierung ebenfalls eine Grundvoraussetzung.
Charakteristisch für multimediale Anwendungen ist die Kombination von mindestens
29
Vgl. Gapski (2000), S. 31-35.
Teil I Theoretische Grundlagen
Seite 22
einem kontinuierlichen Medium wie beispielsweise Bild oder Film und einem diskreten
Medium wie beispielsweise Text. Häufig wird Interaktivität als ein weiteres Kriterium
der Multimedialität angeführt. Wegen seiner weitreichenden Bedeutung wird dieser
Aspekt hier allerdings einzeln aufgeführt.
Interaktivität
Wie bereits angesprochen bezeichnet Interaktivität die Einflussnahme der Medienrezi-
pienten auf Form und/oder Inhalt der Medien. Freilich wird dabei der Umfang des Ein-
flusses nach wie vor weitgehend von den Medien selbst bestimmt. So reichen die Mög-
lichkeiten der Interaktivität von einfachen Rückkanälen (ja/nein-Antworten) am Tele-
fon, über interaktives Fernsehen, bei dem die Zuschauer beispielsweise Einfluss auf den
weiteren Programmverlauf haben, bis hin zu den bereits angesprochenen Virtual Reality
Anwendungen, durch welche beispielsweise die Körperbewegungen einer Person in den
virtuellen Wahrnehmungsraum rückgekoppelt werden. Insofern werden auf dieser Ebe-
ne Virtualität, Multimedialität und Interaktivität zusammengeführt.
Konnektivität
Dieser Aspekt meint die Möglichkeit des Zusammenschaltens von nachrichtentechni-
schen Sendern und Empfängern zu einem Netzwerk. Hierbei gibt es Unterschiede hin-
sichtlich der Netzwerktypologien (z.B. hierarchisch oder netzwerkartig), der Übertra-
gungskapazitäten (schmal- bis breitbandig), der Übertragungscodierungen (analog oder
digital und verschiedene Protokollarten) und der Übertragungswege (Kabel, Funk oder
Satellit). Das bereits angesprochene Internet kann als Netzwerk von Netzwerken in die-
sem Zusammenhang als eine beispielhafte Technikform angesehen werden und stellt
somit einen Idealtypus der Konnektivität dar. Das Internet integriert globale Reichweite,
Multimedialität und Interaktivität.
Globalität
Mit Globalität ist im Prinzip nichts anderes als die technische Reichweite der Konnekti-
vität gemeint. Durch die Integration der bereits beschriebenen technischen Charakteris-
tika der Neuen Medien hat die globale Vernetzung von Informations- und Kommunika-
tionsmedien ein beachtliches Ausmaß erreicht. Dieser Globalisierungsprozess wird me-
dienwirtschaftlich allerdings nur von einigen wenigen ,,Global Players" vorangetrieben
und in sofern durch sprachliche und kulturelle Eigenheiten begrenzt. Die Ambivalenzen
dieser Entwicklung werden bei Robertson durch den Begriff ,,Glokalität" zum Ausdruck
Teil I Theoretische Grundlagen
Seite 23
gebracht.
30
Damit wird das Augenmerk auf die komplexen, uneinheitlichen und wech-
selseitigen Durchdringungen von lokalen Inhalten in globalen Mediensystemen gerich-
tet. So stehen beispielsweise einem Broker an der Hongkonger Börse per Internet In-
formationen über einen Taubenzüchterverein aus Wanne-Eickel zur Verfügung.
Die aktuelle Konjunktur des Medienkompetenzbegriffs ist unmittelbar mit der hier be-
schriebenen technischen Entwicklung verknüpft.
31
Zwar werden im Fortgang der Arbeit
verschiedene Argumente für die wachsende Bedeutung von Medienkompetenz ange-
führt (Kapitel 5.1/5.2), doch das Gewicht dieser Argumente rekurriert letztlich auf die
soeben beschriebenen gravierenden technischen Neuerungen.
2.
Zum Begriff der Kompetenz
Der Terminus ,,Kompetenz" stammt vom lateinischen ,,competentia" (von competere)
ab und meint wörtlich übersetzt ,,Zusammentreffen". Nur in dieser Bedeutung wird
,,competentia" im klassischen Latein gebraucht.
32
Etwa seit dem 13. Jahrhundert findet der Terminus ,,Kompetenz" (z.B. im römischen
und kanonischen Recht im Sinne von zukommen, zustehen) Verwendung, um Ansprü-
che, später auch damit verbundene Zuständigkeiten zu beschreiben. Die Eigenschaft
,,kompetent" meint hier befugt oder zuständig. Diese Bedeutung wird in der öffentlichen
Verwaltung auch heute noch verwandt. Zuständigkeitsstreitigkeiten in der Verwaltung
dürften dazu beigetragen haben, dass sich der heute gebräuchliche Begriff von Kompe-
tenz als individuelles Vermögen entwickeln konnte.
Auch in der Biologie beschreibt der Begriff der Kompetenz ein bestimmtes Vermögen.
In diesem Kontext bezeichnet er die zeitlich begrenzte Bereitschaft embryonaler Zellen,
auf einen bestimmten Entwicklungsreiz zu reagieren. So gelten beispielsweise in der
Gentechnik solche Zellen als kompetent, die eine zugefügte DNS-Sequenz verarbeiten
können und sich anschließend dementsprechend entwickeln.
33
30
Vgl. Robertson (1998).
31
Vgl. Rein (1996), S. 11.
32
Hier werden weitgehend die Angaben zum Begriff der Kompetenz aus dem Historischen Wörterbuch
der Philosophie von Ritter/Gründer (1976) übernommen.
33
Vgl. Vollbrecht (1999), S. 14.
Teil I Theoretische Grundlagen
Seite 24
Seit 1959 bezeichnet Kompetenz in der Motivationspsychologie ,,die Ergebnisse der
Entwicklung grundlegender Fähigkeiten" (Heckhausen 1976, S. 922). Diese Fähigkeiten
sind nicht nur angeboren, aber auch nicht nur das Produkt von Reifungsprozessen.
Kompetenzen werden in diesem Zusammenhang zwar als Ergebnisse einer Entwicklung
verstanden, diese werden jedoch vom Individuum selbst besorgt. In diesem Kontext
spricht die Psychologie von einem Wirksamkeitsmotiv, welches auf wirkungsvolle In-
teraktionen mit der Umwelt drängt und so die Entwicklung von Kompetenz fördert.
Insofern entwickelt das Individuum seine Kompetenz weniger im Dienste einer Bedürf-
nisbefriedigung, sondern vielmehr um der Fähigkeiten und der Interaktion mit der Um-
welt selbst willen.
34
Im Folgenden wird zur Entwicklung des Medienkompetenzbegriffs zunächst auf den
von Chomsky in die Linguistik eingeführten Kompetenzbegriff Bezug genommen.
Auch Chomsky versteht Kompetenz als individuelles (Sprach-) Vermögen und damit
als mentale Disposition.
35
Da dieses Verständnis nicht folgenlos für den theoretischen
Diskurs des anschließend (Kapitel 2.2- 3.3) zu behandelnden Kompetenzbegriffs
geblieben ist, wird zunächst die formale Struktur des in dieser Arbeit durch Chomsky
eingeführten Kompetenzbegriffs thematisiert.
2.1.
Die formale Struktur von Kompetenz
Der Linguist Chomsky verleiht dem Kompetenzbegriff, wie wir noch sehen werden,
ausdrücklich eine Bedeutung, die auf das humboldtsche Verständnis der zugrunde lie-
genden Kompetenz als ein System generativer (erzeugender) Prozesse zurückgeht. Da-
mit wird Kompetenz zu einer angeborenen, mentalen Vorrichtung und bezeichnet die
Fähigkeit von idealisierten Akteuren in einem (in diesem Falle sprachlichen) Hand-
lungskontext. Somit versteht sie sich als die wirkliche Kenntnis eines Gegenstandes
(hier Sprache), über welche die Akteure intuitiv verfügen.
36
Die Struktur von Kompe-
tenz ist so beschaffen, dass sie regelgeleitete Kreativität ermöglicht. Kompetenzen sind
34
Vgl. Heckhausen (1976), S. 922. Eine Kompetenz im Sinne einer Fähigkeit zur Bedürfnisbefriedigung
unterstellt die Anthropologie. Mikos weist darauf hin: ,,Im anthropologischen Sinn werden unter
Kompetenz die Fähigkeit zur Befriedigung von Bedürfnissen und daraus resultierende Fertigkeiten
verstanden." (Mikos 1999, S. 20). Zur Vertiefung lies Lepenies (1971).
35
Vgl. Baacke (1999), S. 8.
36
Vgl. Behse (1976), S. 923/924.
Teil I Theoretische Grundlagen
Seite 25
in dieser Bedeutung als spezifische mentale Dispositionen zu verstehen. Das Verständ-
nis von Kompetenz als idealtypisches Gebilde, welches in der Anwendung nie vollstän-
dig abgebildet wird, führt dazu, dass sich Individuen nur sehr schwer als kompetent
oder nicht kompetent einordnen lassen. Diese Problematik überträgt sich auch auf die
Operationalisierbarkeit verschiedener Kompetenzen und wird zudem verstärkt durch die
mehrfach vorgetragene Kritik an Chomsky, dass sich Kompetenz eben nicht nur als
statisch fixe, angeborene Größe begreifen lässt, sondern einem kontinuierlichen Wandel
unterzogen ist.
37
Die Problematik der mangelnden Greifbarkeit von Kompetenz hat auch Baacke in sei-
nen frühen Überlegungen zur kommunikativen Kompetenz erkannt. Mit Blick auf die
Tatsache, dass Kompetenz als mentale Vorrichtung einerseits a priori vorhanden sein
soll, sich andererseits niemals vollständig manifestiert, in stetigem Wandel befindet und
daher inhaltlich kaum fassbar ist, schlägt Baacke vor, kommunikative Handlungskom-
petenz in Anlehnung an Watzlawick als Axiom der Kommunikation im Sinne eines
pragmatischen Kalküls zu verstehen. Diese Überlegungen hält Baacke für notwendig,
um den Kompetenzbegriff überhaupt auf einer pragmatischen Ebene untersuchen zu
können. Kommunikative Kompetenz als Axiom versteht er folgendermaßen:
,,Kommunikationsaxiome sind nicht logisch, sondern faktisch wahr [...], beruhend auf Er-
gebnissen empirischer oder phänomenologischer Forschung und deren Verallgemeinerung
in theoretischer Reflexion; oder sie haben einen gewissen Evidenzcharakter, bestätigen all-
gemeine Erfahrung (in Fällen, da empirische Nachweise nicht oder nur unzureichend vor-
handen sind); oder sie resultieren aus der Nötigung, bestimmte Sachverhalte zu erklären
(diese gilt für das vorangestellte ,Grundaxiom`). Sie sind nicht im strengen Sinne beweis-
bar, sondern stellen die erfahrene (zum Teil wissenschaftlich untersuchte) Beschaffenheit
von Kommunikation dar" (Baacke, 1973, S. 98).
Da Baacke die fehlende Greif- und Nachweisbarkeit von Kompetenz richtig erkennt,
hält er es für zwingend notwendig, sie als Axiom zu unterstellen, denn ,,die Annahme
einer Kompetenz [hat] soviel Erklärungscharakter [...], daß theoretische Evidenz allein
sie nahelegt" (Baacke 1973, S. 101).
An diese Überlegungen zur formalen Struktur des Kompetenzbegriffs sollen also nun
die weiterführenden Gedanken zur Herleitung eines adäquaten Medienkompetenzbeg-
riffs angeknüpft werden.
37
Lies hierzu z.B. Habermas (1971), S. 101.
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Originalausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2000
- ISBN (eBook)
- 9783832431341
- ISBN (Paperback)
- 9783838631349
- Dateigröße
- 1.4 MB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- Universität Duisburg-Essen – Kommunikationswissenschaft
- Note
- 2,0
- Schlagworte
- informationsgesellschaft medienkompetenz medienpädagogik kommunikative kompetenz sprachkompetenz
- Produktsicherheit
- Diplom.de