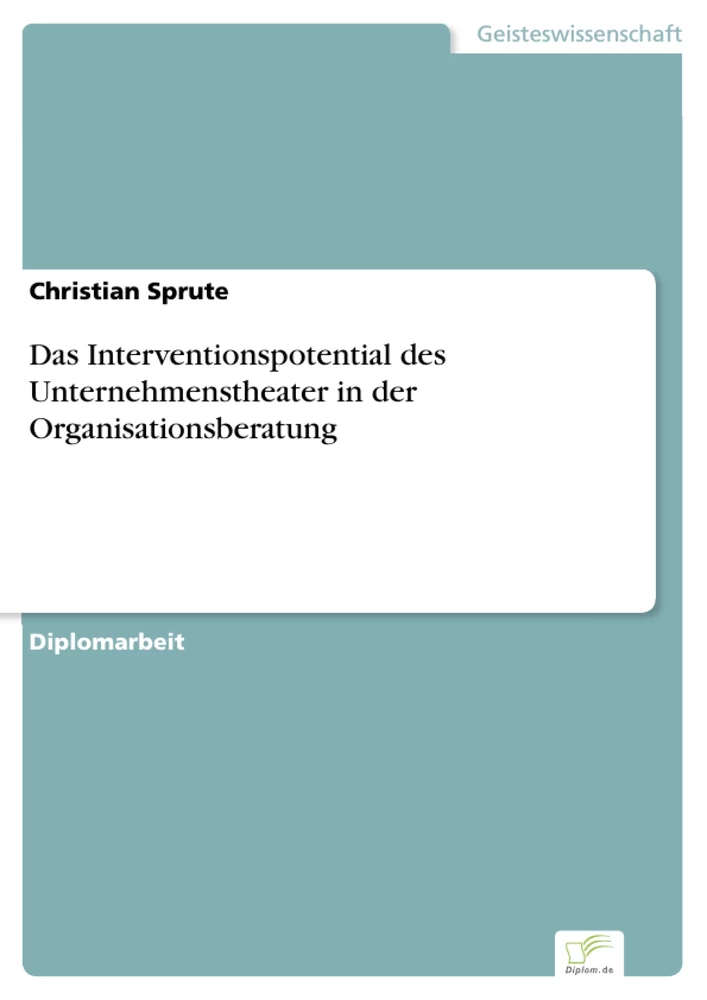Das Interventionspotential des Unternehmenstheater in der Organisationsberatung
©2000
Diplomarbeit
345 Seiten
Zusammenfassung
Inhaltsangabe:Einleitung:
Seit einigen Jahren gibt es eine ungewöhnliche Liason zwischen der Wirtschaft und der Kunst, die sich in dem Begriff Unternehmenstheater manifestiert. Mit dem Terminus Unternehmenstheater bezeichne ich den Einsatz aller Theaterformen in Organisationen, bei denen es zu einer Aufführung kommt. Das Unternehmenstheater umfaßt den Theatereinsatz in Wirtschaftsunternehmen, aber auch in Verbänden wie z.B. dem Arbeitgeberverband zur (gezielten) Unternehmenskommunikation nach innen. Organisationsmitglieder schauen sich das Theater auf Betriebsfesten, Betriebsversammlungen, Jahrestagungen, Fortbildungen, Konferenzen oder speziellen Tagesveranstaltungen (z.B. zur Unternehmenskultur) an. Die Theaterveranstaltung gehört zur Arbeitszeit und ist für die Organisationsmitglieder eine Pflichtveranstaltung. Mit den Theateraufführungen sollen organisationsbezogene Themen wie z.B. bevorstehende Fusionen, Probleme wie die Marktsättigung, Konflikte und Latenzen oder neue Herausforderungen wie z.B. die Deregulierung des Strommarktes der Organisationsumwelt für alle zuschauenden Organisationsmitglieder sichtbar dargestellt werden. Ziel ist es, die Organisationsmitglieder auf die Thematik einzustimmen, damit Veränderungsprozesse in Organsiationen besser umgesetzt werden können. Fast alle in Deutschland operierenden internationalen Unternehmen und Unternehmensberatungen haben inzwischen das Unternehmenstheater als Instrument zur Einleitung bzw. Unterstützung von Organisationsveränderungen bedient, wenn man sich die Referenzlisten der Anbieter anschaut.
Unternehmenstheaterstücke werden für einen bestimmten Bedarf geschrieben, inszeniert und in der Regel nur einmalig aufgeführt. Meistens stehen professionelle Schauspieler auf der Bühne, die in fiktiven Rollen Unternehmenscharaktere oder abstrakte Figuren wie den Markt, den Return on Investment oder Unternehmenshierarchien darstellen. Manchmal stehen ausgewählte Mitarbeiter selbst auf der Bühne. Neben dieser Art des schauspielerischen Unternehmenstheaters gibt es sozusagen partizipative Formen des Unternehmenstheaters, bei dem Mitarbeiter nach einer bestimmten theaterpädagogischen Methode ein vorher festgelegtes Ziel wie z.B. das Konfliktmanagement oder die Teamarbeit bearbeiten und anschließend für die Betriebsöffentlichkeit szenisch aufführen.
Gang der Untersuchung:
Meine Diplomarbeit ist der Versuch eines Spagats zwischen abstrakter Theorie und konkreter Empirie. Sie hat den […]
Seit einigen Jahren gibt es eine ungewöhnliche Liason zwischen der Wirtschaft und der Kunst, die sich in dem Begriff Unternehmenstheater manifestiert. Mit dem Terminus Unternehmenstheater bezeichne ich den Einsatz aller Theaterformen in Organisationen, bei denen es zu einer Aufführung kommt. Das Unternehmenstheater umfaßt den Theatereinsatz in Wirtschaftsunternehmen, aber auch in Verbänden wie z.B. dem Arbeitgeberverband zur (gezielten) Unternehmenskommunikation nach innen. Organisationsmitglieder schauen sich das Theater auf Betriebsfesten, Betriebsversammlungen, Jahrestagungen, Fortbildungen, Konferenzen oder speziellen Tagesveranstaltungen (z.B. zur Unternehmenskultur) an. Die Theaterveranstaltung gehört zur Arbeitszeit und ist für die Organisationsmitglieder eine Pflichtveranstaltung. Mit den Theateraufführungen sollen organisationsbezogene Themen wie z.B. bevorstehende Fusionen, Probleme wie die Marktsättigung, Konflikte und Latenzen oder neue Herausforderungen wie z.B. die Deregulierung des Strommarktes der Organisationsumwelt für alle zuschauenden Organisationsmitglieder sichtbar dargestellt werden. Ziel ist es, die Organisationsmitglieder auf die Thematik einzustimmen, damit Veränderungsprozesse in Organsiationen besser umgesetzt werden können. Fast alle in Deutschland operierenden internationalen Unternehmen und Unternehmensberatungen haben inzwischen das Unternehmenstheater als Instrument zur Einleitung bzw. Unterstützung von Organisationsveränderungen bedient, wenn man sich die Referenzlisten der Anbieter anschaut.
Unternehmenstheaterstücke werden für einen bestimmten Bedarf geschrieben, inszeniert und in der Regel nur einmalig aufgeführt. Meistens stehen professionelle Schauspieler auf der Bühne, die in fiktiven Rollen Unternehmenscharaktere oder abstrakte Figuren wie den Markt, den Return on Investment oder Unternehmenshierarchien darstellen. Manchmal stehen ausgewählte Mitarbeiter selbst auf der Bühne. Neben dieser Art des schauspielerischen Unternehmenstheaters gibt es sozusagen partizipative Formen des Unternehmenstheaters, bei dem Mitarbeiter nach einer bestimmten theaterpädagogischen Methode ein vorher festgelegtes Ziel wie z.B. das Konfliktmanagement oder die Teamarbeit bearbeiten und anschließend für die Betriebsöffentlichkeit szenisch aufführen.
Gang der Untersuchung:
Meine Diplomarbeit ist der Versuch eines Spagats zwischen abstrakter Theorie und konkreter Empirie. Sie hat den […]
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
ID 2687
Sprute, Christian: Das Interventionspotential des Unternehmenstheater in der
Organisationsberatung / Christian Sprute - Hamburg: Diplomica GmbH, 2000
Zugl.: Oldenburg, Universität, Diplom, 2000
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte,
insbesondere die der Übersetzung, des Nachdrucks, des Vortrags, der Entnahme von
Abbildungen und Tabellen, der Funksendung, der Mikroverfilmung oder der
Vervielfältigung auf anderen Wegen und der Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen,
bleiben, auch bei nur auszugsweiser Verwertung, vorbehalten. Eine Vervielfältigung
dieses Werkes oder von Teilen dieses Werkes ist auch im Einzelfall nur in den Grenzen
der gesetzlichen Bestimmungen des Urheberrechtsgesetzes der Bundesrepublik
Deutschland in der jeweils geltenden Fassung zulässig. Sie ist grundsätzlich
vergütungspflichtig. Zuwiderhandlungen unterliegen den Strafbestimmungen des
Urheberrechtes.
Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in
diesem Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme,
dass solche Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei
zu betrachten wären und daher von jedermann benutzt werden dürften.
Die Informationen in diesem Werk wurden mit Sorgfalt erarbeitet. Dennoch können
Fehler nicht vollständig ausgeschlossen werden, und die Diplomarbeiten Agentur, die
Autoren oder Übersetzer übernehmen keine juristische Verantwortung oder irgendeine
Haftung für evtl. verbliebene fehlerhafte Angaben und deren Folgen.
Diplomica GmbH
http://www.diplom.de, Hamburg 2000
Printed in Germany
Wenn alle Subventionen gestrichen werden,
werden sich Leute finden, die bedarfs-
orientiertesTheater spielen.
(George Tabori)
Kunst ist schön, macht
aber viel Arbeit.
(Karl Valentin)
Man muß ein sehr hartnäckiger Mensch sein,
um in unserer Kultur Künstler
zu bleiben.
(Keith Johnstone)
Inhalt
Einleitung
6
1. Kapitel:
Theater als Intervention
13
1.1
Was ist Theater?
13
1.1
Was sind Interventionen?
17
1.2
Theater zur Überbrückung von Kommunikations-
sperren in Beratungsprozessen
22
1.4
Systemische Interventionsformen in der
Organisationsberatung und Möglichkeiten des
Theatereinsatzes
25
2. Die Bedeutung von Emotionen in Organisationen
36
2.1
Emotionale Kompetenz und Lernen bei Individuen
37
2.2
Emotion und Teamarbeit
41
2.3
Emotionaler Widerstand in Organisationen
44
Exkurs: Ergebnisse der Emotionssoziologie
47
2.4
Kommunikationen in sozialen Systemen
51
2.5
Fazit zu Emotionen in Organisationen
54
3. Unternehmenstheater zur Einleitung von Veränderungs-
und Lernprozessen
57
4. Die Modelle der `Katharsis'
62
4.1
Aristotelische Observationskatharsis
63
4.2
Jakob Levy Morenos therapeutische Aktions-
und Integrationskatharsis
68
4.2.1
Die Bedeutung von Morenos Psychodrama für
Lernprozesse auf der Interaktionsebene
73
4.2.2
Die Bedeutung von Morenos Psychodrama für
Lernprozesse auf der Organisationsebene
76
4.3
Augusto Boals `Theater der Unterdrückten'
78
4.3.1
Boals Konzept der dynamisierenden `Katharsis' 85
4.3.2
Die Bedeutung des Theaters der Unterdrückten
für Organisationslernen
90
4.3.3
Die Praxis des `Theater der Unterdrückten'
im Unternehmenstheater
93
5. Unternehmenstheater als `Beobachtung zweiter Ordnung'
96
5.1
Unternehmenstheater mit Schauspielern als
Beobachtungsprodukt zweiter Ordnung
99
5.2
Partizipatives Unternehmenstheater als reflexive
Selbstbeobachtung
107
6. Typen des bedarfsorientierten Unternehmenstheaters
113
6.1
Bedarfsorientierter Theatereinsatz in Unternehmen
113
6.2
Formen des Unternehmenstheaters in Frankreich
116
6.3
Die sechs Grundtypen des Unternehmenstheaters in
Deutschland
118
6.3.1
Unternehmenstheater mit professionellen
Schauspielern
118
6.3.2
Repertoire-Theater
125
6.3.3
Mitarbeiter- und Managertheater
126
6.3.4
Business-Kabarett
130
6.3.5 Improvisiertes
Unternehmenstheater
132
6.3.6
Mitspiel- und Werkstatt-Theater
133
7. Unternehmenstheater als Interventionsmittel - ein
abschließender Blick
137
7.1
Unternehmenstheater im Change-Management
aus Sicht der Empirie
137
7.2
Unternehmenstheater in der Organisationsberatung
aus systemtheoretischer Sicht
143
Literatur
151
Abbildungsverzeichnis
Abb. 1: Der Interventionsbaum
28
Abb. 2: Das Eisbergmodell
56
Einleitung
6
Einleitung
Seit einigen Jahren gibt es eine ungewöhnliche Liason zwischen der Wirt-
schaft und der Kunst, die sich in dem Begriff `Unternehmenstheater' mani-
festiert. Mit dem Terminus `Unternehmenstheater' bezeichne ich den Ein-
satz aller Theaterformen in Organisationen, bei denen es zu einer Auffüh-
rung kommt. Der Begriff ist identisch mit dem `Bedarfsorientierten Thea-
tereinsatz für Unternehmen' wie ihn Schreyögg und Dabitz/Wehner (1999)
gebildet haben (vgl. Kap. 6.1). Der Einfachheit halber verwende ich aller-
dings den Terminus `Unternehmenstheater' als Oberbegriff und richte mich
damit weitestgehend nach einer französischen Definition des `Unterneh-
menstheaters' (théâtre d' entreprise) von Hume
1
(1992: 54):
Das Unternehmenstheater ist die Inszenierung von Organisationen und ih-
ren Umwelten mit theatralischen Mitteln in einem ästhetischen Raum, der
Zuschauer und Schauspieler voneinander trennt. Der Aufführungsraum
und der Produktionsraum sind (im Unternehmen - C.S.) voneinander ge-
trennt In der Aufführung werden die Institution, die Organisation, ihre
Praktiken, Riten, Normen, Codes, Kommunikationsmuster oder Probleme
auf der Basis eines Textskriptes oder einer Improvisation inszeniert. Die
Schauspieler sind Organisationsmitglieder dieses Unternehmens, oder pro-
fessionelle Schauspieler, die sich vollständig mit der Unternehmenskultur
vertraut gemacht haben. Bei den Zuschauern handelt es sich um die ganze
Belegschaft oder einen Teil davon.
(Hume 1992: 54, eigene Übersetzung)
Das `Unternehmenstheater' umfasst demnach den Theatereinsatz in Wirt-
schaftsunternehmen, aber auch in Verbänden wie z.B. dem Arbeitgeberver-
band zur (gezielten) Unternehmenskommunikation nach innen. Organisati-
onsmitglieder schauen sich das Theater auf Betriebsfesten, Betriebsver-
sammlungen, Jahrestagungen, Fortbildungen, Konferenzen oder speziellen
Tagesveranstaltungen (z.B. zur Unternehmenskultur) an. Die Theaterveran-
staltung gehört zur Arbeitszeit und ist für die Organisationsmitglieder eine
1
,,Le théâtre d' entreprise met en scène l'entreprise en utilisant des practiques théâtrales dans un
espace esthétique séparant le public des comediéns. Cet espace scénique est délimité dans un lieu
de production de l'entreprise. La représentation théâtrale met en scène l'institution, l'entreprise,
leurs practiques, leurs rites, leurs coutumes, leurs codes, leur language, ou leurs problèmes à tra-
vers un texte écrit et joué, ou improvisé par des comédiens (salariés de cette institution, de cette
Einleitung
7
Pflichtveranstaltung. Mit den Theateraufführungen sollen organisationsbe-
zogene Themen wie z.B. bevorstehende Fusionen, Probleme wie die Markt-
sättigung, Konflikte und Latenzen oder neue Herausforderungen wie z.B.
die Deregulierung des Strommarktes der Organisationsumwelt für alle zu-
schauenden Organisationsmitglieder sichtbar dargestellt werden. Ziel ist es,
die Organisationsmitglieder auf die Thematik einzustimmen, damit Verän-
derungsprozesse in Organsiationen besser umgesetzt werden können. Fast
alle in Deutschland operierenden internationalen Unternehmen und Unter-
nehmensberatungen
2
haben inzwischen das `Unternehmenstheater' als In-
strument zur Einleitung bzw. Unterstützung von Organisationsveränderun-
gen bedient, wenn man sich die Referenzlisten der Anbieter anschaut.
Unternehmenstheaterstücke werden für einen bestimmten Bedarf ge-
schrieben, inszeniert und in der Regel nur einmalig aufgeführt. Meistens
stehen professionelle Schauspieler auf der Bühne, die in fiktiven Rollen
Unternehmenscharaktere oder abstrakte Figuren wie den Markt, den `Return
on Investment' oder Unternehmenshierarchien darstellen. Manchmal stehen
ausgewählte Mitarbeiter selbst auf der Bühne. Neben dieser Art des schau-
spielerischen `Unternehmenstheaters' gibt es sozusagen partizipative For-
men des `Unternehmenstheaters', bei dem Mitarbeiter nach einer bestimm-
ten theaterpädagogischen Methode ein vorher festgelegtes Ziel wie z.B. das
Konfliktmanagement oder die Teamarbeit bearbeiten und anschließend für
die Betriebsöffentlichkeit szenisch aufführen.
Meine Diplomarbeit ist der Versuch eines ,,Spagats" zwischen abstrakter
Theorie und konkreter Empirie. Sie hat den Anspruch, sowohl das Interven-
tionspotential bzw. die Wirkungsweisen des Unternehmenstheaters theore-
tisch zu begründen, als auch einen empirischen und geordneten Überblick
entreprise ou professionels du spectacle imprégnés de la culture de l'entreprise), mis en scène à
l'attention de tout partie du personnel de cette entreprise ou de cette institution" (Hume 1992: 54).
2
Internationale Unternehmensberatungen wie z.B. Arthur Andersen haben eigene Abteilungen für
Unternehmenstheater gegründet.
Einleitung
8
über alle Anbieter und Produkte des `Unternehmenstheaters' im deutsch-
sprachigen Raum zu geben
3
.
Ein Schwerpunkt meiner Diplomarbeit bezieht sich auf die Frage,
welche Bedeutung das `Unternehmenstheater' als Interventionsmittel in Or-
ganisationsberatungsprozessen hat. In Kapitel 1 untersuche ich deshalb,
· welche Definition von Theater zugrunde gelegt werden muß, wenn
Theater als Interventionsmaßnahme fungieren soll.
· was der Begriff Intervention systemtheoretisch bedeutet und ob Interven-
tionen in psychische und soziale Systeme überhaupt möglich sind.
· welche Interventionsformen der Systemischen Organisationsberatung den
Einsatz von Theatermethoden praktizieren.
Dem `Unternehmenstheater' als künstlerisch-ästhetischem Interventions-
instrument wird von Natur aus insbesondere ein Einwirken auf die Emotio-
nen von Organisationsmitgliedern zugeschrieben (Schreyögg 1999c: 23f). In
Kapitel 2 beschäftige ich mich deshalb mit der Bedeutung von Emotionen in
Organisationen auf den drei Ebenen Individuum, Gruppe und Organisation,
um zu prüfen, ob Gefühle nur personenbezogen sind, oder ob emotionale
Wertegefüge auch sozialen Systemen wie Organisationen zugeschrieben
werden können. Eine zentrale Frage ist dabei, ob die Handlungs- und Ent-
scheidungsmuster von Personen und Organisationen vorrangig gefühlsdo-
miniert sind oder eher vermeintlich ,,vernünftigen" Kriterien unterliegen.
Man denke nur an Unternehmenskulturen, die mit kollektiven Schuld- und
Schamgefühlen die organisatorische Kontrolle regeln oder an Begriffe wie
`Mitarbeiteridentifikation' und `Corporate Identity', die eine emotionale
Basis haben. Das `Unternehmenstheater', könnte dann nicht nur in die psy-
3
Ziel dieser Auflistung von Unternehmenstheateranbietern und ihrer Produkte ist es, die einzelnen
Presse- und Internetinformationen zum Unternehmenstheater zu ordnen und sie als Übersicht für
potentielle Kunden in das World Wide Web zu stellen. Um Kunden und anderen Interessierten ei-
ne Zusammenstellung bisher erschienener Veröffentlichungen zum Thema `Unternehmenstheater'
zu geben, habe ich als ersten Schritt recherchierte und mir vorliegende Medien zum Unterneh-
menstheater (etwa 70 Presseartikel, 2 Videos und geplante Veröffentlichungen) auf meiner Home-
page indexiert, die unter http://www.uni-
oldenburg.de/~5548280/presseartikel.html
aufgerufen werden kann (vgl. auch
die Medienliste in Anhang F).
Einleitung
9
chischen Systeme der Mitglieder, sondern auch in das kollektive Gefühlsle-
ben der Organisation intervenieren. Theoretische Modelle zur emotionalen
Wirkungsweise liefert sowohl die Gruppendynamik nach Kurt Lewin, die
ich in Kapitel 3 anhand seines Modells des `Unfreezing-Moving-Refreezing'
vorstelle, als auch die Theaterwissenschaft mit verschiedenen Katharsiskon-
zepten, die ich in Kapitel 4 anhand der Zuschauerkatharsis der aristoteli-
schen Tragödie, Morenos Aktionskatharsis und Boals dynamisierenden Ka-
tharsis darstelle
4
.
Inwieweit das `Unternehmenstheater' nicht nur präventiv auf bevor-
stehende Veränderungsprozesse einzustimmen vermag, sondern auch refle-
xiv als ,,Reparaturwerkstatt" für ,,emotionale Wunden" im sozialen Gefüge
der Organisationsmitglieder fungieren kann, wird von mir im Anschluß un-
tersucht.
In Kapitel 5 beschäftige ich mich aus systemtheoretischer Perspekti-
ve mit dem kognitiven Interventionspotential des `Unternehmenstheaters',
indem z.B. das Bühnengeschehen Informationen geben kann, die für die
psychischen Systeme als Mitglieder, und das soziale System als Organisati-
on, neu sind und somit irritierend wirken. `Unternehmenstheater' verstanden
als `Beobachtungsprodukt zweiter Ordnung' könnte zuschauenden Systemen
somit einen zusätzlichen Erkenntnisgewinn über sich selbst und ihre Um-
welt bringen.
Das `Unternehmenstheater' kommt ursprünglich aus Frankreich und ist dort
weiter verbreitet als in Deutschland. Dort werden jährlich schätzungsweise
etwa 2000 Theateraufträge auf Nachfrage für Organisationen realisiert
5
. An-
ders als in Deutschland liegt dort ein Schwerpunkt des `Unternehmensthea-
ters' bei partizipativen Theaterformen, insbesondere dem Forumtheater von
Augusto Boal, was unter anderem auf dessen Wirken in Frankreich zurück-
4
Das brechtsche Theater- und (kognitive) Katharsiskonzept wären in diesem Zusammenhang ebenso
zu behandeln. Ich habe mich im Kapitel 4 aber nicht weiter mit Brechts Konzept beschäftigt (außer
in Fußnoten wo es mir wichtig erschien) und verweise hiermit auf die Bedeutung seiner Arbeit für
das Unternehmenstheater.
5
Vgl. die Süddeutsche Zeitung Nr. 25 vom 31.01./01.02.1998, S. V1/1 und die Berliner Morgenpost
vom 04.05.1999.
Einleitung
10
geht
6
. Partizipative Theaterformen als auch maßgeschneiderte Unterneh-
menstheaterstücke sind in Frankreich wesentlich günstiger als in Deutsch-
land, was daran liegt, daß die deutsche `Branche' für `Unternehmenstheater'
noch recht neu ist und der Markt die Preise noch nicht regulieren konnte.
Die Preise für maßgeschneiderte Unternehmens-theaterstücke betragen in
Frankreich mit 5000 DM bis 45.000 DM etwa ein Viertel der Anbieterpreise
in Deutschland, die erst bei 15.000 DM anfangen und bis 200.000 DM ge-
hen
7
.
In Deutschland gibt es derzeit etwa 36 Anbieter (vgl. die Adressenli-
ste im Anhang G) von denen ich im ersten Anhangsteil (A) 21 Anbieter
8
ausführlich mit ihren Beratungskonzepten und Theaterprodukten beschrie-
ben habe
9
. Jährlich werden hier etwa 200-300 Theaterstücke für Unterneh-
men inszeniert; bei einem geschätztem Umsatz von 10 Mio. DM in 1997 (in
2005 etwa 30 Mio.)
10
. Populär wurde das `Unternehmenstheater' insbeson-
dere durch das Marketing des Marktführers Visual Consulting, die seit der
Gründung 1991 über 300 Theaterstücke in Unternehmen inszeniert hat.
Auch durch das Festival für Unternehmenstheater `Business goes Theatre',
das von Jürgen Bergmann, dem Gründer und Geschäftsführer von Transico
bereits drei Mal (1997, 1998 und 1999) vorbereitet und durchgeführt wurde,
gewann das `Unternehmenstheater' an Popularität. Sowohl die Presse, als
auch die Wissenschaft
11
nehmen seit 1997 das Phänomen `Unterneh-
6
Augusto Boal ist der Begründer des Theater des Unterdrückten, einer Sammlung verschiedener
theatraler Interventionstechniken. Er lebte von 1978 bis 1986 in Frankreich, wo er auch ein Zen-
trum der Theater der Unterdrückten (CTO) gründete (vgl. Kap. 4.3).
7
Aragou-Dournon 1999: 164.
8
Als Aufnahmekriterium in die Anbieterliste habe ich mindestens einen erfolgreich durchgeführten
Kundenkontakt als Minimum definiert. Das Interview mit `Untied Artists' aus Wuppertal ist aus
technischen Gründen nicht transkripiert. Nach dem nicht aufgezeichneten Interview hatte ich ein
Erinnerungsprotokoll geschrieben, das ich anschließend mit Martin Plass von Untied Artists in-
haltlich überarbeitet habe, und das der Beschreibung der Untied Artists zugrundeliegt.
9
Die Beschreibungen basieren auf Darstellungen bei Dabitz/Wehner, Presseartikeln und Interviews:
Die Unternehmensberatung Peter Peters & Freunde, PUT, Spielplan, Dein-Theater, das Kabarett
der Wirtschaft, die Beratungsgruppe 3P, Gosia Schnelle und Untied Artists habe ich in halbstruktu-
rierten Interviews zu ihren Theaterkonzepten und ihren -produkten befragt. Die Interviews sind im
Anhang C abgedruckt. Drei weitere Anbieter (ID Fabrik, The Company Stage und Scharlatan
Theater) habe ich aus zeitlichen Abgabeterminen nicht mehr interviewen können, aufgrund der
Selbstbeschreibungen und Presseartikel aber trotzdem mit in die Darstellung aufgenommen.
10
Vgl. Dabitz/Wehner 1999: 142.
11
Vgl. Schreyögg/Dabitz 1999.
Einleitung
11
menstheater' verstärkt wahr. Die auf den Webseiten angegebenen Leistun-
gen der Anbieter reichen von maßgeschneiderten Theaterstücken, Mitarbei-
tertheater, Stegreifkabarett, prozeßorientierte Improvisation, Sketchen und
Produktpräsentationen bis hin zu Präsentations- und Rhetorikseminaren
mittels Rollenspiele
.
Den Oberbegriff `Unternehmenstheater' gliedere ich in
Kapitel 6 auf in sechs Formen des Unternehmenstheaters
12
. Die Typologisie-
rung richtet sich weitestgehend nach der von Georg Schreyögg (1999: 16-
18). Allerdings habe ich die Kategorien `Repertoiretheater' und `Business-
kabarett' hinzugefügt. Zum `Businesskabarett' gibt es mittlerweile drei An-
bieter
13
, die ausschließlich `Unternehmenstheater' in der Kabarettform an-
bieten, sodaß sich eine neue Klassifikation rechtfertigen läßt. Ob man mitt-
lerweile von einer `Branche' des `Unternehmenstheater' sprechen kann, ist
fraglich, da nur drei Anbieter ausschließlich Unternehmenstheaterprodukte
anbieten
14
und wird im Anschluß erörtert. Die bisherigen Fragestellungen
zur emotionalen und kognitiven Wirkungsweise des Unternehmenstheaters
versuche ich dort zusammenzuführen, indem ich mich unter Berücksichti-
gung der vorangegangenen Kapitel sowie der verschiedenen Unterneh-
menstheaterformen mit deren Interventionspotential abschließend beschäfti-
ge.
* * *
12
Das `pantomimische Unternehmenstheater', das von dem Berliner Schauspieler Michael Vogel
(`Theater mit Masken') angeboten wird, ist ausführlich bei Dabitz/Wehner 1999: 135ff beschrie-
ben. Ich habe es hier nicht aufgeführt, da es m.E. nicht zum `Unternehmenstheater' zählt. Die
Maskenspiele sind keine geschlossenen inhaltlichen Unternehmenstheaterstücke, und können auch
nicht dem problemorientierten Mitarbeitertheater zugerechnet werden. Auch wenn das Maskenspiel
des `Theaters mit Masken' künstlerisch sehr eindrucksvoll und anspruchsvoll umgesetzt wird und
Lewins Konzept vom emotionalen Auftauen mehr als andere Unternehmenstheaterprodukte um-
setzt (vgl. Passow 1997: 54), handelt es sich dabei nur um Kurzauftritte mit Masken (z.B. in den
Pausen), um Eintrittskarten abzureißen, Vorhänge auf- und zuziehen, oder um die Programm-
punkte einer Veranstaltung ästhetisch zu verbinden im Sinne einer Moderation.
13
Zur Kategorie Businesskabarett gehören Emil Herzog, Chaos & Partner, das Kaberett der Wirt-
schaft sowie das Galli-Theater, das als ein eigenständiges Produkt auch Businesskabarett anbietet
(vgl. Anhang A 5).
14
Alleinige Anbieter von `Unternehmenstheater' sind die Visual Consulting, Transico und The Com-
pany Stage (vgl. Anhang A 2).
Einleitung
12
Besonders wichtig ist mir ein Interview in englischer Sprache mit dem be-
kannten Theaterlehrer Keith Johnstone in Kanada, bei dem ich für ein Jahr
in Calgary am Jugendtheater mitgewirkt habe. Das Interview kam zustande,
als ich Keith während einer Workshopserie in Norddeutschland im Februar
2000 als freier Übersetzer begleitete. Allgemeine theoretische Fragestellun-
gen wie ,,Was ist Theater?" und ,,Was bedeutet Katharsis für das Theater?"
als auch spezielle Fragen zu dem von ihm begründeten Improvisationsthea-
ter bilden den Schwerpunkt des Interviews. Teile des Interviews habe ich in
die Diplomarbeit mit eingebaut. Es soll jedoch für sich stehen und lohnt sich
meines Erachtens zu lesen, da Keith einer der letzten lebenden großen
Theatermacher des 20. Jh. ist.
Oldenburg, 07. August 2000
Christian Sprute
Kapitel 1: Theater als Intervention
13
1. Theater als Intervention
1.1 Was ist Theater?
Was Theater ist läßt sich kaum definieren. Das Wort Theater kommt vom
griechischen `theatron' und bedeutet `Raum zum Schauen'. Als technischer
Begriff bezeichnete `theatron' im alten Griechenland den Zuschauerteil des
antiken Theaters. Später wurde der gesamte Theaterbau als `theatron' be-
zeichnet
1
. Auch in unserem Jahrhundert bezieht sich der Begriff `Theater'
meistens auf die Institution bzw. das Schauspielhaus
2
, wenn man einmal von
Redensarten wie `mach nicht so ein Theater' absieht, die eigentlich `Theater
spielen' meinen. Als technischer Begriff unterscheidet `theatron' zwischen
Schauendem und Angeschautem und läßt Sinn und Zweck des Schauens
offen. Kommen Zuschauer und Künstler aus Gründen der Unterhaltung, der
Erkenntnis wegen oder der Kunst und Kunstkritik an sich zusammen?
Theater als Institution verstanden ist, für eine Untersuchung zur Wirkungs-
weise von inszeniertem Unternehmenstheater (mit professionellen Schau-
spielern) und als partizipatives Unternehmenstheater aus zwei Gründen ein
zu statischer Begriff. Zum einen findet Unternehmenstheater nicht in Schau-
spielhäusern, sondern in Unternehmen statt, die eine bestimmte Erwartung
(z.B. Unterhaltung, Information, Initiierung eines Veränderungsprozesses)
an die Theaterinszenierung haben. Zum anderen bleiben wichtige theatrale
Zeichen und Mittel (Schauspieler, soziale Beziehungen, Konflikte und Dra-
maturgie) unberücksichtigt, die für das Theater maßgeblich bestimmend
sind. Theater als Interventionsbegriff im Sinne von `Theater inszenieren'
und `Theater spielen' ist im oben beschriebenen Theaterbegriff nicht ent-
halten.
Eine umfassende und in Deutschland geläufige Formel für Theater,
die auch der Marktführer für Unternehmenstheater (Bernhard Strobel) als
Allgemeindefinition verwendet (vgl. Strobel 1999: 242), lautet:
1
Vgl. Brauneck/Schneilin 1992: 950-952 und 1011-1020.
2
,,Ein Theater ist ein Unternehmen, das Abendunterhaltung verkauft" (Bertold Brecht, ca.
1926/1927).
Kapitel 1: Theater als Intervention
14
S spielt R für Z: mindestens ein Spieler spielt vor einem oder mehreren
Zuschauern eine Rolle - und zwar in ein und derselben Zeit/Ort - Einheit
(Brauneck/Schneilin 1992: 1015)
3
.
Diese allgemeine Definition umfaßt sowohl bewußt inszenierte Alltagssze-
nen
4
, wie z.B. die Übernahme einer Rolle in einem Bewerbungsgespräch als
auch Straßentheater, Puppentheater
5
und Staatstheateraufführungen, also die
Darstellung fiktiver Figuren durch Schauspieler. Sie schließt fast alle Thea-
terformen
6
mit ein: Theater als ritueller Kult, Armes Theater (Grotowski),
Theater als Therapie (Petzold), Theater als Instrument der Gesellschaftskri-
tik (Boal, Brecht), Theater als Bildungsanspruch (Moreno, Stanislawski und
Strasberg), heiliges Theater (Brook), Improvisationstheater (Johnstone) und
BusinesstheaterTM (Strobel)
7
. Leicht lassen sich darunter auch alle im An-
hang A vorgestellten Produkte des Unternehmenstheaters zusammenfassen
(vgl. Strobel 1999: 242).
Diese Theater-Definition (S spielt R für Z) ist problematisch, weil sie
den Charakter bzw. die Rolle der Darsteller in den Vordergrund stellt und
die soziale Beziehung der Rollencharaktere
8
zueinander unberücksichtigt
läßt (vgl. Interview mit Keith Johnstone). Auch für das Theater in Organisa-
tionen ist eine auf die Rolle reduzierte Definition von Theater unzureichend,
da das Unternehmenstheater Veränderungen bei Organisationsmitgliedern
und im sozialen System bewirken soll (vgl. Schreyögg 1999c: 26). Theater
in Unternehmen soll in der einen oder anderen Weise notwendige organisa-
torische Veränderungsprozesse vorbereiten bzw. thematisieren (z.B. indem
3
Diese Definition beruht auf Erika-Fischer-Lichtes Minimaldefinition in ihrem Standardwerk `Se-
miotik des Theaters' (1994: 6 u. 25).
4
Damit fallen auch Erkenntnisse aus der Soziologie und Psychologie über Rollenverhalten und (so-
zialer und persönlicher) Identität unter diesem Oberbegriff Theater (vgl. z.B. Goffman 1959).
5
Puppen- und Maskentheater sind von der Definition nicht ausgeschlossen, da ein Puppenspieler
durch Bewegungen und Stimme Rollen mit Hilfe von Puppen spielt.
6
An zwei Theaterformen, dem Lehrstück von Brecht, das nicht für die Zuschauer, sondern für die
Agierenden gespielt wird und am `Unsichtbaren Theater' von Augusto Boal, wo die Zuschauer Zu-
schauer sind, ohne es zu wissen, wird deutlich, daß Theater auch ohne die bewußte Unterscheidung
in Spieler und Zuschauer zustande kommen kann.
7
Vgl. Brauneck/Schneilin 1986 (Theaterlexikon).
8
Rollencharaktere im Unternehmenstheater sind sowohl Personen als auch Allegorien wie z.B. der
Markt, die Konkurrenz, Oben und Unten für die Hierarchieebenen, die von entsprechend kostü-
mierten Personen gespielt werden.
Kapitel 1: Theater als Intervention
15
die Theaterinszenierung zeigt, warum Organisationen gerade nicht bereit
sind, sich zu verändern, selbst wenn sich die Organisationsumwelt drastisch
verändert hat). Eine Theaterdefinition, die eine soziale Beziehung - zwi-
schen Personen, Gruppen, Organisationen - umfaßt, die einen Unterschied
zwischen einem vorherigen und einem zukünftigen (erstrebten) Zustand in
der sozialen Beziehung macht, ist für das Unternehmenstheater notwendig.
Bislang fehlt eine solche allgemeingültige Definition von Theater.
Die im Englischen übliche Theaterdefinition `Theatre is conflict'
füllt diese Beziehungslücke nur einseitig. Eine dramaturgische Grundformel
für fast alle Theater- und Filmskripte wird bei dieser Definition außer acht
gelassen. Geschichten in Film und Theater beginnen in der Regel nicht mit
einem Konflikt, sondern mit einer `harmonischen' Plattform. Jedem Kon-
flikt muß eine stabile Handlung als `Plattform' vorausgehen, damit für den
Zuschauer ein relevanter Unterschied als dramatischer Konflikt - ein Kippen
der sozialen Beziehungen
9
- erkennbar wird (vgl. z.B. die anfängliche Ruhe
in `Die Vögel' von Hitchcock). Eine Theaterdefinition, die sich auf `(Büh-
nen-) Konflikt' beschränkt, kann nicht `(Bühnen-)Harmonie' erklären. Die
Wirkungsweise von Theater wird ausschließlich emotional begründet so-
wohl bei den Spielern als auch dem Publikum. Aber nicht aus jedem beob-
achteten Konflikt im Unternehmenstheater oder miterlebten Konflikt im
Mitarbeitertheater folgt eine Veränderung. Auch schließt man mit einer sol-
chen Konfliktdefinition kognitive Veränderungsprozesse bei Spielern und
beim Publikum aus.
Als minimale Formel für Theater scheint mir daher die von Keith Johnstone
geeignet:
,,Theatre is one person changed by another" (Keith Johnstone vgl.
Interview im Anhang E: 148). Johnstones Definition könnte in systemtheo-
9
Eine Kippe (engl: tilt) ist eine Veränderung der Statusbeziehung. Status hat jede Person, und ist
nicht mit dem sozialen Status oder dem sozialen Rang zu verwechseln. Status ist allgegenwärtig
z.B. in der Stimme, der Körperhaltung und dem Blickkontakt. Personen können sich nicht status-
neutral verhalten. In jeder Interaktion und mit jeder Körperbewegung werden Statussymbole aus-
gesendet, unabhängig von dem sozialen Rang, den eine Person innehat (vgl. Johnstone 1993: 51ff).
So kann ein König einen persönlichen tiefen Status haben, obwohl seine soziale Rangstellung sehr
hoch ist. Johnstone hat zahlreiche Übungen und gruppendynamische Interaktionsspiele entwickelt,
um Statusbeziehungen sichtbar machen und zu trainieren (vgl. Johnstone 1995: 354-380).
Kapitel 1: Theater als Intervention
16
retischem Vokabular frei übersetzt lauten: ,,Theater ist, wenn Ego sich durch
Alter verändern läßt."
Eine solche Theaterdefinition entspricht dem Ziel und Zweck von Theater
als Interventionsform in Organisationen und bezieht sich auf alle Unterneh-
menstheaterformen.
Als Interventionsmittel verstanden muß im Unternehmenstheater de-
finiert werden, wer `Ego' und `Alter' sind. Mit Rücksicht darauf, daß Thea-
ter das Verhalten bzw. die Erwartungsstrukturen von Organisationsmitglie-
dern oder sogar das Entscheidungsverhalten von Organisationen beeinflußen
soll, kann man `Ego' und `Alter' beim Unternehmenstheater und beim Mit-
arbeitertheater
10
unterschiedlich definieren. Beim Mitarbeitertheater, wo die
Organisationsmitglieder selbst im Spiel integriert sind, beziehen sich `Ego'
und `Alter' auf den Protagonisten und den Antagonisten. Beim Unterneh-
menstheater transportiert das Bühnengeschehen fortlaufende Informationen
für eine Summe von Beobachtern bzw. Organisationsmitgliedern in den
Zuschauerraum, der ein eigenes soziales System bildet. Aus dieser Perspek-
tive ist `Ego' dann das Beratungs- bzw. Kunstsystem und `Alter' ist das Kli-
entensystem bzw. die Summe aller zuschauenden Organisationsmitglieder
einer Firma. Das Bühnengeschehen transportiert die im künstlichen Theater-
raum (nach-) konstruierte Systemwelt und Systemumwelt in einer bestimm-
ten ästhetischen Form zu den Beobachtern. Durch Theater soll Veränderung
stattfinden, indem die Organisationsmitglieder und das (Kommunikations-)
System `Firma' ungewohnte Zuschreibungen, Latenzen und wiedergespie-
gelte Selbstzuschreibungen - also ein Abbild von sich und seiner Umwelt -
auf der Bühne beobachten.
Die Veränderung bzw. das Lernen durch Theater erfährt ein System
sowohl kognitiv als auch emotional
11
. Die emotionale Komponente spielt
beim partizipativen Unternehmenstheater, wenn die Organisationsmitglieder
10
Mitarbeitertheater ist eine Form des partizipativen Unternehmenstheater, bei der Organisations-
mitglieder selbst mitspielen (vgl. Kap. 6.3).
11
Theaterwissenschaftler versuchen diese emotionale Komponente mit dem Kunstwort `Katharsis' zu
erklären (vgl. Kap. 4). Königswieser u.a. weisen z.B. daraufhin, daß Theatermethoden in der Orga-
nisationsberatung ein höheres Interventionspotential als ausgefeilte Analysen und rational-
abstrakte Darstellungen haben (vgl. Königswieser 1999: 319).
Kapitel 1: Theater als Intervention
17
selbst auf der Bühne stehen und durch Rollenhandeln Handlungsalternativen
erproben, eine noch wichtigere Rolle als beim Schauspieltheater.
Adressat der Intervention ist beim partizipativen Unterneh-
menstheater (z.B. Mitarbeitertheater) der Protagonist, beim Unterneh-
menstheater das Publikum. Das Klientensystem `Ego' entscheidet dabei
selbst, ob und inwieweit es sich von `Alter' verändern läßt. Neue Informa-
tionen, oder emotionales Mitgefühl können `Ego' dazu bewegen sich in Zu-
kunft anders zu verhalten. Die spezielle Kunstform im Theater bietet dar-
überhinaus einen Vorteil, da sie Informationen ästhetisch verpackt und Mo-
ral im Sinne von `gut' und `schlecht' unberücksichtigt läßt. Psychische Sy-
steme nehmen Informationen leichter auf. Sie müssen sie nicht mit morali-
schen Kategorien bewerten, sondern lassen sie ästhetisch auf sich einwirken.
1.2 Was sind Interventionen?
Das lateinische Wort `intervenire' bedeutet: sich einmischen, eingreifen,
sich einschalten. Interventionen finden innerhalb und zwischen sozialen
Systemen
12
statt. Wenn sich in der Politik Staaten in die Belange anderer
Staaten einmischen oder wenn die Politik in andere soziale Systeme ein-
greift, wie z.B. in die Wirtschaft, um den Wettbewerb zu regulieren, oder in
das Recht zwischen Kläger und Beklagtem als dritte Partei eingreift, dann
spricht man von Intervention. Beim Unternehmenstheater greift das System
Kunst in das System Wirtschaft ein.
12
Entsprechend der Systemtheorie von Luhmann sind `Soziale Systeme' autopoetische Systeme, die
in einem rekursiven Prozeß fortlaufend Kommunikation an Kommunikation anschließen. D.h. die
Kommunikation eines sozialen Systems bezieht sich immer nur auf sich selbst. Das bedeutet nicht,
daß immer gebetsmühlenartig die gleichen Inhalte kommuniziert werden. Vielmehr existiert außer-
halb der Kommunikation nichts, was nicht in ihr selbst integrierbar ist. Der Grund liegt in der ope-
rativen Schließung: soziale Systeme sind struktur- und nicht umweltdeterminiert. Die System-
struktur bestimmt, welche Einflüsse Umweltereignisse auf das System haben, nicht das Ereignis
selbst. Zur Struktur gehören nicht nur die substantiellen, sondern auch die symbolischen ,,Wirk-
lichkeiten" wie Regeln, Normen, Vorschriften, Erfahrungen, das Machtgefüge, Denkvorstellungen,
das Beziehungsnetz von Antipathie und Sympathie usw. (Probst 1987: 36). Diese Vorstellung geht
weit über die Definition von Struktur in der Organisationslehre hinaus. Zum Prozessieren von
Kommunikationen sind soziale Systeme damit auf Menschen angewiesen. Sie können nicht aus ei-
gener Kraft, ohne entsprechende organische, neuronale und psychische Umwelten (und damit
Menschen) existieren (vgl. Kneer/Nassehi 1993: 68). Diese Annahme soll aber nicht dazu verlei-
ten, Organisationen als die Summe von Mitarbeitern, oder Gebäuden zu definieren, sie bleiben Sy-
steme, die Kommunikationen prozessieren. Menschen gehören zur Umwelt von Organisationen.
Kapitel 1: Theater als Intervention
18
Allgemein könnte man `Intervention' als eine auf Kausalitäten beru-
hende, gezielte Operation in der Gegenwart verstehen, die einen Unterschied
zwischen der beobachteten Gegenwart und der vorgestellten zukünftigen
Gegenwart macht (vgl. Fuchs 1999: 11). D.h. Intervention hat zum einen
etwas mit subjektabhängiger Wahrnehmung (Berater) und zum anderen et-
was mit erwünschter, subjektiver Veränderungshaltung im Klientensystem
zu tun. Beratersystem und Klientensystem sind zwei unterschiedliche so-
ziale Systeme, die operativ geschlossen sind. Die Systemstruktur bestimmt,
welche Umweltreize ein System wahrnimmt und in seine Operationen ein-
fließen läßt. Externe Ereignisse sind für soziale Systeme erstmal nur `Per-
turbationen
13
' in einer überkomplexen Umwelt - und die Systemstrukturen
bestimmen, ob sie zu relevanten Informationen werden (Resonanzfähigkeit
für Umwelteinflüsse). Systemtheoretisch stellt sich damit vor die Frage:
`Wie berate ich, wie interveniere ich?' die schwierigere Frage: `Wie sind
Intervention und Beratung überhaupt möglich?'
Insbesondere Luhmann hat auf Kommunikationssperren in der Un-
ternehmensberatung hingewiesen, die sich daraus ergeben, daß das Berater-
system und das Klientensystem zwei unabhängige soziale Systeme sind, die
ganz unterschiedlich ihre Umwelt beobachten und wahrnehmen (vgl. Luh-
mann 1989). Während das Klientensystem die Organisation intern beob-
achtet und Umweltereignisse entsprechend der Organisationsziele und Or-
ganisationsgeschichte wahrnimmt, erschließen sich deren Prozesse und
Strukturen einer zu beratenden Organisation nur extern, aus einer Beobach-
tungsperspektive zweiter Ordnung (vgl. Kap. 5). Durch Vertrag entsteht ein
zeitlich befristetes (eigenständiges) Beratungssystem in dem die Sinnzu-
schreibungen beider Systeme miteinander kommuniziert werden. Die erfolg-
reiche Kommunikation im Beratungssystem ist für Luhmann allerdings sehr
unwahrscheinlich. Schließlich starten beide Parteien ihre Kommunikation in
gegenseitiger Undurchsichtigkeit. Erst allmählich wird die Unbestimmtheit
der Lage durch versuchsweises Handeln abgebaut. Systemtheoretisch be-
13
Perturbation meint Störung, Abweichung. Der Begriff wird von Maturana und Varela (1987: 27)
benutzt und ist identisch mit Luhmanns Irritationsbegriff.
Kapitel 1: Theater als Intervention
19
zeichnet Luhmann diese Unbestimmtheit der Lage mit dem Begriff der
`doppelten Kontingenz'
14
. Die Grundfrage lautet: Wie können die Interakti-
onspartner (Ego und Alter) dazu gebracht werden, die Selektionen von
Kommunikationsmöglichkeiten ihres jeweiligen Gegenübers anzunehmen,
wenn ihr Verhalten durch komplexe selbstreferentielle
15
Operationen be-
stimmt wird, die für den jeweils Anderen undurchsichtig und undurchschau-
bar bleiben? Kommunikative Prozesse
16
sind nach Luhmann in dreifacher
Hinsicht höchst unwahrscheinlich. Es bleibt erstens ungewiß, ob die Mit-
teilung ihren Adressaten erreicht, d.h. dessen Wahrnehmungsschwelle über-
schreitet; zweitens kann man nicht ohne weiteres voraussetzen, daß die mit-
geteilte Information auch verstanden wird und drittens ist fraglich, ob der
`Empfänger' der Mitteilung aufgrund dieser Information zu einem be-
stimmten Verhalten motiviert werden kann (vgl. Luhmann 1991: 26). Jede
Aktion auf der einen Seite macht das Anschlußhandeln auf der anderen Seite
allerdings erwartbarer, was Luhmann `Autokatalyse' (Luhmann 1993: 166)
nennt. Das Beratungssystem ist der Ort, an dem die Verstehensprozesse
17
eingeleitet, die Hypothesenbildung vorangetrieben und die Interventions-
möglichkeiten ausgetestet werden (vgl. Luhmann 1989).
Die Unbestimmtheit der Lage muß in die Beratungssituation also eingebaut
werden. Nach Willke sind Interventionen deshalb ,,zielgerichtete Kommuni-
kationen (d.h., eine bestimmte Wirkung beim Kommunikationspartner zieht
der Berater in das Kalkül der Kommunikation mit ein) zwischen psychi-
14
`Doppelte Kontingenz' (dt. Zufälligkeit) meint, daß die Kommunikation einmal bei Ego und ein
zweites Mal bei Alter stattfindet. Was kommuniziert wird und wie es kommuniziert wird hängt von
Ego und Alter ab. Beide können aber die Perspektive des anderen in ihre Kommunikation mit ein-
schließen. Schulz von Thun hat mit seinem Vier-Ohren- und Vier-Münder Modell diese Unsicher-
heit und Risiken der Kommunikation versucht plastisch darzustellen (vgl. Schulz von Thun 1998).
15
,,Ein System kann man als selbstreferentiell bezeichnen, wenn es die Elemente, aus denen es be-
steht, als Funktionseinheiten selbst konstituiert und in allen Beziehungen zwischen diesen Ele-
menten eine Verweisung auf diese Selbstkonstitution mitlaufen läßt, auf diese Weise die Selbst-
konstitution also laufend reproduziert." (Luhmann 1993: 59). Auf eine verständliche Präzisierung
systemtheoretischer Begriffe muß in dieser Diplomarbeit an vielen Stellen verzichtet werden. Sie
findet sich bei Baraldi u.a. (1998).
16
Kommunikation ist nach Luhmann die Synthese aus den drei Selektionsmöglichkeiten Informa-
tion, Mitteilung und Verstehen (vgl. Kneer/Nassehi 1997: 81ff und Luhmann 1988: 10-18).
17
Luhmann spricht setzt Verstehen auch mit Sinnzuschreibungen gleich. Im Englischen wird der
Zusammenhang von Verstehen und Sinn besonders gut in der Redewendung `does this make sen-
se?' deutlich.
Kapitel 1: Theater als Intervention
20
schen und/oder sozialen Systemen, in der die Autonomie des intervenierten
Systems respektiert wird" (Willke 1987: 357, in Königswieser 1999: 17).
Die Autonomie des Systems weist darauf hin, daß ,,Interventionen nicht
Eingriffe von Beratern (...) sondern Anregungen zur Selbststeuerung" (Ex-
ner u.a. 1987: 268) sind. Trotz der von Willke proklamierten Zielorientie-
rung in einem Beratungsprozeß sollten sich systemtheoretisch aufgeklärte
Interventionsstrategen daher der unsicheren Ausgangslage des Versuchs der
wirkungsvollen Beeinflussung eines autonomen psychischen/sozialen Sy-
stems bewußt sein (vgl. Königswieser 1999: 17).
Organisationen als soziale Systeme erfahren Interventionen meistens durch
externe Mitglieder von Beratungsunternehmen, die zuvor eine entsprechen-
de (beobachterabhängige) Diagnose gemacht haben. Beim Unterneh-
menstheater wird die Diagnose in der Regel von Unternehmensberatungen
durchgeführt, die selbst Theater anbieten oder mit einem Theateranbieter
zusammenarbeiten. In der Diagnose einer Organisation wurden wichtige
Unterschiede heraus gearbeitet, die mittels Interventionen in Form von
Handlungen Unterschiede bewirken sollen. D.h. die beobachteten Unter-
schiede in Organisationen sollen nach einer Intervention nicht nur alleine
vom Berater, sondern auch für die Organisationsmitglieder bzw. das Klien-
tensystem beobachtbar sein. Die Frage lautet: Wie kann ein Berater durch
gezielte Inputs seine Kunden an seinem Wissen teilhaben lassen? Es zeich-
net sich bereits ab, daß Berater für eine erfolgreiche Intervention nicht nur
Fachexpertise sondern ebenso ein gehöriges Maß an sozialer bzw. kommu-
nikativer Kompetenz
18
benötigen. Unternehmenstheater bietet einem Berater
die Möglichkeit das Wissen und die Beraterinformation in einem Skript zu
verdichten, und es anschließend künstlerisch umzusetzen.
18
Aus systemtheoretischer Perspektive ist soziale Kompetenz eine `kommunikative Kompetenz'.
Kommunikation ist nach Luhmann die Einheit der Selektionen von Information, Mitteilung und
Verstehen und ist deshalb höchst unwahrscheinlich, da man nicht davon ausgehen kann, ob die
mitgeteilte Information die Wahrnehmungsschwelle überschreitet und vom ,,Empfänger" auch ver-
standen wird (vgl. Luhmann 1991: 26). Kommunikative Kompetenz bezeichnet die Fähigkeit, aus
der Flut möglicher Informationen und Mitteilungsformen jene auszuwählen, die `Verstehen' auf
der Grundlage systemspezifischer Erwartungsstrukturen möglich machen. Verstehen meint nicht
einen Konsens zwischen Berater und Klient. Beide behalten ihre autonomen Sichtweisen und ler-
nen im Beratungssystem, ohne ihre Identität aufzugeben.
Kapitel 1: Theater als Intervention
21
Systemtheoretisch sind Interventionen nur durch `Irritationen
19
' möglich.
Intervention ist demnach der ,,(prekäre) Versuch, Kunden so zu irritieren,
daß sie auf ihre blinden Flecke aufmerksam werden und an ihren bisherigen
Selbst- und Fremdbeschreibungen zu zweifeln beginnen." (Krafft/Ulrich
1998: 3). Unternehmenstheater versucht solche Irritationen im Klientensy-
stem auszulösen.
Beratung und Intervention ist aber auch sehr sensibel zu handhaben.
Nach Titscher soll jede Intervention nämlich anschlußfähig sein. Die Irrita-
tion muß maßvoll und angemessen sein. Eine Interventionsmaßnahme darf
die Klienten deshalb weder über- noch unterfordern. Wird zuwenig irritiert,
arbeitet das System selbst bei anhaltendem Problem weiter, als wäre nichts
geschehen. Bei zuviel Irritation (indem z.B. funktional notwendige Latenzen
offengelegt werden) verliert das System seine Orientierung und Handlungs-
fähigkeit (vgl. Titscher 1997: 29ff). Die Kunst der Berater liegt darin, solche
Informationen zu produzieren und Formen der Mitteilung zu wählen, die ein
verträgliches Maß an Irritation erzeugen. Unternehmenstheater birgt die Ge-
fahr, aufgrund ihrer Form vom Klienten abgelehnt zu werden. Rational mag
der Kunde das damit begründen, das er Mitspieltheater als `Kinderkram'
bezeichnet oder Zuschautheater als `elitär' und `weltfremd von Betriebspro-
blemen' empfindet. Es könnten dahinter auch konkrete Ängste vor externen
Sanktionen verborgen sein. Kann ein Leiter der Abt. Unternehmenskommu-
nikation eine kostenintensive Theaterinszenierung gegenüber dem Vorstand
verantworten? Was passiert, wenn das Theaterstück ein `Flop' wird (z.B.
weil es eine schlechte Inszenierung ist)? Fühlen sich Vorgesetzte durch die
betrieblichen Inhalte der Theaterinszenierung angegriffen und welche Fol-
gen hat das für den verantwortlichen Organisator einer Theatermaßnahme?
19
,,Unter Irritation soll verstanden sein, daß ein autopoetisches System auf dem eigenen Bildschirm
Störungen, Ambiguitäten, Enttäuschungen, Deviancen, Inkonsistenzen wahrnimmt in Formen, mit
denen es weiterarbeiten kann." (Luhmann 1991: 174). ,,Irritation ist danach ein Systemzustand, der
zur Fortsetzung der autopoetischen Operationen des Systems anregt, dabei aber als bloße Irritation,
zunächst offen läßt, ob dazu Strukturen geändert werden müssen oder nicht; ob also über weitere
Irritationen Lernprozesse eingeleitet werden oder ob sich das System darauf verläßt, daß die Irrita-
tion mit der Zeit von selbst verschwinden werde, weil sie nur ein einmaliges Ereignis war" (Luh-
mann 1997a: 790).
Kapitel 1: Theater als Intervention
22
Die Angst vor Theater-Spielen liegt demgegenüber oftmals in inneren Moti-
ven begründet, wenn man z. B. im Spiel etwas von sich unkontrolliert zeigt,
was in der verbalen Kommunikation verborgen bleiben kann
20
.
1.3 Theater zur Überbrückung von Kommunikationssperren in
Beratungsprozessen
Nachdem die Systemtheorie der Beraterzunft die Schwierigkeit der Einfluß-
nahme in psychische und soziale Systeme aufgezeigt hat, läßt sich fragen, ob
und was das Unternehmenstheater dazu beitragen kann, die Schwierigkeiten
im Beratungsprozeß zu überbrücken. Inwieweit ist durch Theater Personen-
veränderung oder gar Organisationsveränderung möglich? Daß Theater eine
sehr wirksame Interventionsmaßnahme in der Systemischen Organisations-
beratung ist, behaupten zumindestens zwei erfolgreiche Managementberater.
Nach Titscher sind Unternehmenstheaterstücke, die aus einer Diagnosephase
heraus entwickelt wurden, eine sehr starke Intervention in der Unterneh-
mensberatung (vgl. Titscher 1997: 151). Königswieser sieht in analogen
Interventionsformen wie Rollenspielen, kurzen Sketchen, Persiflagen, Live-
Interviews zu brisanten, aktuellen Problemen und kurzen Theaterstücken ein
höheres Interventionspotential gegeben als durch ausgefeilte Analysen und
rational-abstrakte Darstellungen (vgl. Königswieser 1999: 319), da analoge
Interventionsverfahren kognitives Lernen unterstützen, indem auch die
rechte Gehirnhälfte angesprochen wird, die für die Gefühlsverarbeitung und
Affekte zuständig ist (vgl. auch König/Volmer 1999: 102ff).
Die Hoffnungen, die Managementberater wie Titscher und Königs-
wieser in das Unternehmenstheater als Mittel der Organisationsberatung
setzen, gründen auf Schwierigkeiten, die die Kommunikation zwischen zwei
sozialen Systemen mit sich bringt; und zwar sowohl bezogen auf die Kom-
munikationsprozesse in einem Beratungssystem als auch während der In-
formation der Belegschaft über Diagnoseergebnisse aus einem Beratungs-
prozeß. Alle Interventionen müssen nach Königswieser/Exner in der Bera-
20
Dabei sollen gerade diese latenten Konflikte mit Kollegen und auch die inneren Widersprüche im
Mitarbeitertheater freigelegt und aufgelöst werden.
Kapitel 1: Theater als Intervention
23
tung durch dieses `Nadelöhr der kommunikativen Interaktion'. Die Frage ist,
wie durch gemeinsame Kommunikationen im Beratungssystem Verände-
rungen in den Handlungen und Operationen des Klientensystems induziert
werden können
21
. Im Beratungssystem können die Operationen schließlich
nicht direkt durch Interventionen verändert werden. Direkte Veränderung ist
nur im Klientensystem möglich (Stichwort: Selbstorganisation der Systeme).
Das Klientensystem kann nur indirekt mittels verschiedener Intervention-
stechniken wie z.B. positive Konnotationen, zirkuläres Fragen, Analogien
oder Paradoxien
22
angeregt werden, seine bisherigen Selbstbeschreibungen
nicht weiter aufrecht zu erhalten (vgl. Königswieser/Exner 1999: 26ff). Ge-
zielte Intervention ist aus systemtheoretischer Sicht daher höchst unwahr-
scheinlich, da erstens (gelingende) Kommunikation selbst unwahrscheinlich
ist (s.o), und zweitens das Klientensystem nur die Beratungsinformation
akzeptiert, die es zu akzeptieren bereit ist. Was für den Berater wichtig ist,
muß der Klient noch lange nicht akzeptieren und zur Richtschnur seines
eigenen Handelns machen (vgl. Willke 1999: 4).
Das Unternehmenstheater - so die Annahme - kann helfen `das Nadelöhr der
Interaktion' zu vergrößern, indem es Emotionen, Halbbewußtes und Unaus-
prechliches (bzw. Unausgesprochenes) sichtbar und damit kommunizierbar
und veränderungswahrscheinlicher macht. Es wird sozusagen ein eigenes
Handlungssystem, das auch latente Strukturen und unterschwellige Kom-
munikation thematisiert, die dem System anderenfalls (weiterhin) verborgen
bleiben.
Die wichtigste Konsequenz dieser Analyse ist: daß Kommunikation nicht
direkt beobachtet, sondern nur erschlossen werden kann. Um beobachtet
zu werden und um sich selbst beobachten zu können, muß ein Kommuni-
kationssystem deshalb als Handlungssystem ausgeflaggt werden (Luhmann
1993: 226).
21
An dieser Stelle möchte ich darauf hinweisen, daß nach meinem Verständnis die Begriffe Interven-
tion oder Irritation immer auch mögliche Lernprozesse beinhalten.
22
Zur Beschreibung der systemischen Interventionsmethoden siehe Königswieser/Exner 1999, Kö-
nig/Volmer 1999 und Titscher 1997.
Kapitel 1: Theater als Intervention
24
Ein solches Handlungssystem
23
kann z.B. eine Theateraufführung
24
, aber
auch ein Beratungssystem sein, in dem mittels verschiedener Theatertechni-
ken (z.B. Verfremdung) die Kommunikation versinnbildlicht, analysiert und
verändert wird. Organisationsmitglieder stellen mit Theaterverfahren (Psy-
chodrama, Soziodrama, Forumtheater, Szenisches Spiel etc.) im Beratungs-
prozeß selbst Sinnzuschreibungen dar, um sie anschließend unter Anleitung
zu reflektieren und nach Alternativen zu suchen. Innere Widersprüche,
Wünsche, Hoffnungen und konkrete Interaktionsstörungen können so mit-
tels Theater aufgedeckt, versinnbildlicht und kommuniziert werden, was im
rein sprachlich beschränkten Dialog nicht möglich wäre.
Königswieser/Exner weisen daraufhin, daß es ein wichtiges Merkmal
jeder Systemischen Organisationsberatung sein sollte, mit nonverbalen Me-
dien zu arbeiten, Freude an der Reflexion zu haben und mit symbolisch-
analytischen Verfahren zu arbeiten (u.a. Szenen und Geschichten), da her-
kömmliche Kommunikationsformen (Schriftliches, Handbücher, Anweisun-
gen, Vorträge etc.) in der Regel nicht ausreichen und zu kurz greifen (vgl.
Königswieser/Exner 1999: 50). Durch das Ansprechen sowohl von kogniti-
ven als auch emotionalen Komponenten bietet Theater in Beratungsprozes-
sen die Möglichkeit, Personenveränderungen herbeizuführen und die Unter-
nehmenskommunikation wiederherzustellen.
23
Nach Luhmann ist das Letztelement der Handlung die Beobachtung, die eine Seite der Beobacht-
ung unterscheidet und bezeichnet, das Nichtbezeichnete aber als Alternative immer mitkommuni-
ziert (vgl. Luhmann 1999: 91ff). Auf der operativen Ebene können mit bestimmten Theaterverfah-
ren wie Schellers Standbildtechnik oder Boals Statuten - und Forumtheater Beobachtungen und
Sinnstrukturen (Selbstbeschreibungen, Denkgewohnheiten, Gewohnheiten, Erfahrungen, Einsich-
ten) für alle sichtbar gemacht (versinnbildlicht) und durch `Stopverfahren' zeitlich eingefroren
werden, um so verschiedene Beobachtungsperspektiven und Halbbewußtes zu analysieren und
nach Handlungsalternativen zu suchen.
24
Klient und Berater konzipieren aufgrund von Gesprächen den Rahmen eines Theaterstückes, das
inszeniert wird und anschließend die szenische Diagnose der Organisation widerspiegelt (vgl. die
Vorgehensweise vom Erstkontakt bis zur fertigen Inszenierung unter Kap. 6.3.1).
Kapitel 1: Theater als Intervention
25
1.4 Systemische Interventionsformen in der Organisations-
beratung und Möglichkeiten des Theatereinsatzes
Das Ziel einer jeden Intervention durch externe Berater ist die zusätzliche
Informationsgewinnung des Klientensystems über sich selbst
25
. Diese In-
formationen können belastend oder entlastend wirken. Entlastend wirken
alle Interventionen, die ,,das gutheißen oder positiv verstärken, was im Kli-
entensystem vom Berater direkt beobachtet wird, oder die unterstützend
wirken und Orientierung geben" (Titscher 1997: 139). Belastend wirken
dagegen Maßnahmen, die bisherige Gewohnheiten in Frage stellen, irritieren
und nachgefragte Orientierung verweigern. Je nach Prozeßentwicklung und
Beratungsziel (Verschärfung oder Regulierung des Konfliktes/Drucks auf
das Klientensystem), erfolgt anhand dieser Unterscheidung die erste Aus-
wahl der einzusetzenden Theatermethode.
1.
Das Psychodrama und das Pädagogisches Rollenspiel arbeiten in erster
Linie auf eine Konfliktregulierung hin, und haben eine entsprechende
Entlastungsfunktion für das Interaktionssystem und die beteiligten Perso-
nen (vgl. Kap. 4.2).
2.
Das Forumtheater von Boal arbeitet in der Regel mit einer Konfliktver-
schärfung, was einer Belastung des Klientensystems entspricht
26
(vgl.
Kap. 4.3).
3.
Das Szenische Spiel nach Ingo Scheller ist eine Mischform aus Psycho-
drama, Forumtheater und Brechtschen Theater. Die Reflexionsphase im
Szenischen Spiel soll für den Protagonisten allerdings entlastend wirken.
4.
Beim Improvisationstheater wird auf der Bühne ein Konflikt bewußt ver-
schärft, um durch Überzeichnung Staunen und Lachen beim Publikum
hervorzurufen. Wenn Organisationsmitglieder Improvisationstheater
spielen, kann die Überzeichnung des Konfliktes und die Verzerrung der
Personen einen heilenden Effekt haben, da die Spieler aufgestaute Ener-
25
,,Sobald der Berater beginnt zu beobachten, wie das Unternehmen beobachtet [...] kann er den
Problemen dieses Systems einen Sinn geben, über den das System selbst nicht verfügen kann"
(Luhmann 1989: 215).
26
Allerdings folgt auf die Konfliktverschärfung eine Konfliktauflösung. Beim Improvisationstheater
geschieht dies im Sinne des Stegreifspiels nach Moreno indem fremde Rollen ausprobiert werden
(vgl. Kap. 4.2) Beim Forumtheater wird solange nach Alternativen gesucht, bis für alle Beteiligten
eine annehmbare Lage der Situation entstanden ist (vgl. Kap. 4.3).
Kapitel 1: Theater als Intervention
26
gien und Emotionen im Spiel abreagieren, wenn sie über eingefahrene
Rollen- und Handlungsmuster hinaus im Sinne Morenos agieren
27
. Keith
Johnstone, der erfahrene Improvisationstheaterlehrer äußert sich aller-
dings (wissenschaftlich) bescheiden hinsichtlich des therapeutischen Po-
tentials von Improvisationen. Er sieht es folgendermaßen:
Frage: Why do you think some managertrainers use your techniques in
their workshops?
Keith: Just people like them, people enjoy it, people think Improvisation
makes them better. I do not see, how they prove it, but ...
Frage: Do you think, there is a therapeutical potential in your Improvisati-
on?
Keith: Yes!
Frage: Which kind of?
Keith: Oh - I don't know, that there is a therapeutic potential. You said do
I think there is. I think there probably is.
Frage: What do you suppose?
Keith: Well - it is good, if people laugh. But, I mean it is claimed, that,
when people laugh a lot, it is good for them. I do not have the evidence. I
have read books of them with no evidence. There are so many of different
forms of improvised theatre. And I think theatre and improvisation can
have a bad effect on people.
(vgl. das Interview mit Keith Johnstone im Anhang E: 154).
Systemische Interventionsformen (vgl. Abb.1) in der Organisationsberatung
sind nach Königswieser zirkuläre Fragen, paradoxe Interventionen und ana-
loge Interventionen (vgl. Königswieser 1999: 35ff). Besonders bei zirkulä-
ren Fragetechniken und analogen Interventionen eignen sich Theatermetho-
den zur Darstellung von Interaktionssystemen und Organisationsstrukturen,
um öffentliche und latente Kommunikationen und Beziehungsmuster sicht-
bar zu machen. Königswieser und Exner setzen in beiden Bereichen Thea-
terverfahren ein.
27
Diese eingefahrenen Muster beinhalten alle `du sollst nicht', `du darfst nicht', `du kannst nicht', die
wir von Pädagogen, Lehrer und Erwachsenen in unserer Sozialisation übernommen haben. Nach
Johnstone kann man sich diese erworbenen Einschränkungen durch Theaterspiele abtrainieren. Er
hat z.B. einige Theaterspiele entwickelt, indem er Ver- und Gebote aufschreibt und in ihr Gegenteil
verwandelt (vgl. 1995: 58).
Kapitel 1: Theater als Intervention
27
Zirkuläre Fragen
28
(z.B. `welches Bild würde die Verkaufsabtei-
lung von der Organisation zeichnen?') im engeren Sinn beziehen sich auf
Beziehungen (vgl. Königswieser 1998: 36). Es gehören dazu Fragen nach
Rangfolgen wie `wer ist am meisten von dem Problem betroffen?', nach
vorher/nachher- Unterscheidungen (`was hat sich seit der Fusion verän-
dert?'), nach Alternativen (`angenommen der Chef wird noch abweisender -
was passiert dann?'), nach Sichtweisen von Gruppen (`wie sieht der Verkauf
die Firma?') und nach dem Erfolg der Beratung (vgl. Königswieser 1999:
37). Einige theatrale Techniken (z.B. die Einfühlungs- und Reflexionspha-
sen im Szenischen Spiel) basieren auch auf der Anwendung von offenen und
auch zirkulären Fragen
29
.
28
Das `zirkuläre Fragen' ist eine Entwicklung der Mailänder Gruppe um Mara Selvini Palazzoli in
der systemischen Familientherapie. Bei dieser speziellen Fragetechnik ,,werden die Mitglieder rei-
hum über Unterschiede und Beziehungen zwischen anderen Mitgliedern befragt. Indem jedes Mit-
glied auf der Meta-Ebene Auskunft über die Beziehungen der anderen gibt, entwickelt und ver-
mittelt sich ein Bild der familiären Struktur, das einem zirkulär-kausalen Verständnis entspricht."
(Simon/Stierlin 1993: 391). Durch das `zirkuläre Fragen' bekommt ein Berater schnell einen Über-
blick über das Klientensystem, zum anderen gewinnt das Klientensystem selbst neue Einblicke,
d.h. eine Differenz zu den bisherigen Wissensbeständen (vgl. Groth 1996: 41ff).
29
Der Spielleiter sollte dabei eine Meta-Fragehaltung entwickeln und nach bestimmten Frage-
techniken vorgehen. Metafragestellungen, nach denen sich ein Spielleiter richtet sind z.B. `Welche
Verhaltensmuster gibt es?', `Welche eigenen und wechselseitigen Konflikte gibt es?', `Können die
Zuschauer die Konflikte sehen?' (wenn ja sollte der Spielleiter sie benennen lassen).
Kapitel 1: Theater als Intervention
28
Abb. 1: Der Interventionsbaum
Kapitel 1: Theater als Intervention
29
Bei situationsbezogenen Standbildern im Szenischen Spiel von Scheller z.B.
arbeitet der Spielleiter in der Einfühlungsphase mit der Protagonistin die
Situation (1), die eigene Haltung in dieser Situation (2), und die Positionen
und Projektionen zu den anderen Personen (3) heraus, indem er zirkuläre
und offene Fragen zur Beziehungskonstellation und zur Problematik gezielt
stellt. Nachdem die Protagonistin den Raum, die Zeit, die Personen und das
Ereignis dargestellt hat (1 = Situation), wird sie durch den Spielleiter in ihre
eigene Haltung eingefühlt (2 = eigene Haltung) und tritt anschließend hinter
die beteiligten Personen, um ihre Projektionen und angenommenen Situati-
onsdeutungen über die Anderen auszusprechen (3 = subjektiv angenommene
Projektionen der Anderen). In der Reflexionsphase gibt es eine Fülle von
Varianten (z.B. Stimmenskulptur) für Protagonisten, Antagonisten und Be-
obachter, um abweichende Deutungsmuster zu geben. Auch hierbei werden
zirkuläre Fragen wie z.B. `wer denken Sie, ist von dem Problem am meisten
betroffen' gestellt (zum situationsbezogenen Standbild vgl. Scheller 1998:
61ff).
Als Analoge Interventionen wird in der Systemischen Organisati-
onsberatung der Einsatz von Metaphern, Bildern, Skulpturen, Sketchen,
Pantomimen und Geschichten bezeichnet. Als eine Faustregel der Systemi-
schen Organisationsberatung gilt dabei, bildhaft/künstlerisch zu arbeiten, um
durch das Ansprechen der rechten Gehirnhälfte auch latente und unbewußte
Inhalte zu thematisieren, die sich somit leichter vom Klientensystem auf-
nehmen lassen (vgl. Königswieser 1999: 40ff). Durch das Ansprechen auch
der rechten Gehirnhälfte, lassen sich Themen leichter aufnehmen und be-
handeln:
Grundsätzlich sind die Methoden des Spiels prädestiniert, zwischen-
menschliche Themen unter die Lupe zu nehmen und zu bearbeiten. Also
wenn es um Konfliktmanagement geht, oder wenn es darum geht, einen
Teamfindungsprozess zu beschleunigen, also da wo es um Menschen geht
in irgendeiner Weise, ist es auf jeden Fall nützlich, durch das direkte Agie-
ren oder durch das Abbild (mit stellvertretenden Schauspielern - C.S.). Es
geht ja auch darum, eine Analogie zu stiften.
(Christian Hoffmann; vgl. das Interview im Anhang C 2: 70-71)
Kapitel 1: Theater als Intervention
30
Theater bietet eine Vielzahl von analogen Techniken, die zum Teil von der
Systemischen Organisationsberatung aufgegriffen wurden (z.B. die Sy-
stemskulptur und das Szenen-Feedback). Das Standbildverfahren von
Scheller und die Statuenarbeit von Boal bilden zwei Verfahren, die in der
Organisationsberatung eingesetzt werden. Beide Verfahren verdichten kom-
plexe Informationen über soziale Systeme präzise und bieten sich hervorra-
gend zur systemischen Analyse oder zum Reframing
30
an, da eine Vielzahl
von Deutungsmustern im Spielprozeß herausgearbeitet werden (vgl. Scheller
1998: 59ff; Boal 1989: 53ff, 71ff, 241ff).
Nach Titscher zielen alle Interventionen auf folgende Bereiche (Titscher
1997: 141ff):
· Interaktion
· Attribution
· Regeln
· Rahmenbedingungen
Für alle vier Zielrichtungen bieten sich dabei Theaterverfahren an.
Titscher geht davon aus, daß sich die Wirkung einer Beratung auf veränderte
Verhaltensweisen der Mitglieder einer Klientenorganisation niederschlagen
muß (vgl. Titscher 1997: 142).
Partizipative Theaterformen (Psychodrama, Szenisches Spiel etc.)
versuchen die Verkehrsformen (interne und externe gegenüber Kunden, Lie-
feranten) der Interaktion zu beeinflußen. Das geläufigste Beispiel in der
Praxisanwendung von Theatermethoden zur Schulung von Interaktion sind
30
`Reframing' meint in der Logischen Typenlehre, daß über eine Klasse nicht in der Sprache der
Elemente gesprochen werden darf (vgl. Watzlawick 1992: 32-47), d.h., daß die innere Sicht des
Klienten in einen anderen Kontext gestellt werden soll. Nach Watzlawick ist dies eine Verände-
rung/Lösung zweiter Ordnung. Ziel ist es, die Ereignisse und Deutungen der ersten Ordnungsebene
zu entdramatisieren (vgl. Watzlawick 1974: 99-115). Systemische Organisationsberater benutzen
zum `Reframing' oftmals sog. positive Konnotationen (vgl. Groth 1996: 43). Wie aus Kartoffeln
Erdäpfel werden können, kann aus einem dominanten Chef auch ein verantwortungsvoller Chef
werden, oder ein permanenter Kaffeeautomatentrinker wird zum wichtigen Informationsträger, oh-
ne den die reibungslose Zusammenarbeit zwischen den Abteilungen nicht laufen würde.
Kapitel 1: Theater als Intervention
31
Konfliktschlichtungen (vgl. Brenner 1996), Teamentwicklungen (vgl. die
Beschreibung der 3-P-Beratungsgruppe im Anhang A 4: 36-38) und Ver-
kaufstrainings (vgl. die Beschreibung der Mobilé GmbH im Anhang A 2: 9-
11).
Interventionen in Attributionen bedeuten Veränderungen in den Zu-
schreibungen von Ursachen für beobachtete Verhaltensweisen und Ereignis-
se. Ziel der Intervention ist es, die Zuschreibungen (Attribute) umzudeuten
bzw. umzuetikettieren (Reframing). Bei Sitzungsterminen, die immer dann
einberaumt werden, wenn eine bestimmte Person abwesend ist (z.B. durch
Außentermine, 4 Tage Woche etc.) kann diese Person den Eindruck gewin-
nen, daß Besprechungen ohne sie stattfinden sollen. Attributionen bleiben
meist auf die individuelle Ebene beschränkt, können aber auch organisati-
onstypisch sein, wenn z.B. (strukturelle) Probleme in der Organisation indi-
vidualisiert werden (z.B. Sündenbockfunktion
31
). Fallbeispiele für die psy-
chodramatische Arbeit an Attributionen von Organisationsmitgliedern liefert
Brenner u.a. (1996).
Eine ineffiziente Regel könnte z.B. sein, daß Tagesordnungen zu
Anfang der Sitzung festgelegt werden und Besprechungsnotizen von jedem
selbst anzufertigen sind. Ein Berater müßte auf veränderte Kommunikati-
onsregeln hinarbeiten. Eine veränderte Regel könnte ein Rotationsprinzip
der Protokolle sein, die nach zwei Tagen per Email allen Beteiligten zuge-
schickt werden und zusätzlich eine Tagesordnung der nächsten Besprechung
enthalten. In einem Standbild zum Konferenzverhalten könnten diese orga-
nisatorischen Schwachpunkte schnell sichtbar werden.
Unter Rahmenbedingungen fallen für das Unternehmen schwer
veränderbare Umweltfaktoren (Kunden, Zulieferer, Rechtsprechung), die in
die Organisationen hineinwirken können, wie z.B. beim Marketing, mit dem
Unternehmen beabsichtigen, das Kaufverhalten der Kunden zu beeinflußen.
Ziel kann es sein, neue Interaktionsformen anzuregen, wie z.B. beim Auf-
treten des Außendienstes (vgl. Titscher 1997: 143). Unternehmenstheater
31
Eine Sündenbockfunktion meint nichts anderes, als daß Probleme in der Organisationsstruktur
individualisiert und Personen zugeschrieben werden. Ziel ist es (unbewußt) die Strukturprobleme
aufrechtzuerhalten.
Kapitel 1: Theater als Intervention
32
wird in der Praxis besonders zu solchen entsprechenden Schulungen (z.B.
von der Mobilé GmbH - Anhang A 2: 9-11) eingesetzt, um den Kontakt der
Organisation mit der Umwelt - das Auftreten des Außendienstes gegenüber
Kunden - (positiv) zu verändern.
Nach Titscher ist das Versinnbildlichen von Situationen (1997: 148) eine
grundlegende Interventionsform. Nach dem Motto ,,ein Bild sagt mehr als
tausend Worte" bietet diese Interventionsform drei Vorteile: momentane
Lagen können emotional eindrucksvoller dargestellt werden, Diskussionen
werden belebt, und es eröffnen sich dadurch neue Interpretationsspielräume.
Nach Titscher zählen zu den Versinnbildlichungen insbesondere Theater-
stücke und Szenen. Als Vorteil wertet er, daß sie häufig (auch komplexe)
Probleme wesentlich schärfer akzentuiert darstellen können (vgl. Titscher
1997: 148ff).
Systemische Organisationsberatung und Theaterarbeit
In der Organisationsberatung wird Theater als Medium und Methode beson-
ders in der Systemischen Organisationsberatung eingesetzt. Dies verwundert
zunächst, hat die Systemtheorie doch den `Sündenfall' begangen, indem sie
den Menschen aus Kommunikationen und sozialen Systemen ausgeschlos-
sen hat. Allerdings bietet sich eine systemisch orientierte Theaterpädagogik
zur Untersuchung von Interaktionen und Systemstrukturen an. Die Sy-
stemtheorie macht schließlich mit den von der Rollentheorie (z.B. Goffman
1994 u. 1996) beschriebenen Interaktionsritualen, zeremoniellen Regeln und
formalen Kommunikationsmythen ernst, indem sie die Selbstbeschreibun-
gen und das nach außen getragene Image von Menschen, die `Charakter-
masken', und Rollenträger ausgliedert und sich konsequent der Untersu-
chung von Erwartungshaltungen und Erwartungsenthaltungen (von Rollen-
trägern, Organisationsmitgliedern, Berufspositionen, Organisationen,
Rechtssystemen etc.) verschreibt. Ein systemisches Verständnis von Organi-
sationsstrukturen schließt demnach auch die symbolischen `Wirklichkeiten',
Kapitel 1: Theater als Intervention
33
wie Regeln, Normen, Vorschriften, Erfahrungen, das Machtgefüge, Denk-
vorstellungen, das Beziehungsnetz von Antipathie und Sympathie usw. mit
ein (Probst 1987: 36). Theater bietet verschiedene Verfahren, mit denen sol-
che Latenzen und Erwartungsstrukturen aufgedeckt und analysiert werden
können (z.B. Standbildverfahren).
Die Systemtheorie setzt sich u.a. mit der Frage auseinander, aus wel-
chen Elementen Rollen jeglicher Art bestehen. Willke beschreibt Rollen als
ein ,,Bündel von aufeinander bezogenen Erwartungen, als System von Re-
geln, welche ein bestimmtes >>Spiel<< und innerhalb dieses Spiels be-
stimmte arbeitsteilige Aufgabenbündel konfigurieren" (Willke 1999: 151).
Erwartungen
32
bilden demnach die Struktur von psychischen und sozialen
Systemen. Sie informieren (als Blick, als Geste, als Erfahrungswissen über
eine Person, als Wort, als Berufsposition, als Stellenanzeige, als Unterneh-
mensleitbild etc.) über sich selbst und fordern zugleich den Adressaten auf,
den Erwartungen zu entsprechen. Es kommt nicht so sehr auf die Rollenträ-
ger (Menschen) an, sondern auf die Frage ,,an welchen Punkten sie mit wel-
chen Gründen in welcher Weise mit den bestehenden, d.h. vom System vor-
gegebenen Erwartungen umgegangen sind." (Willke 1999: 151). Die sy-
stemische Perspektive zwingt dazu, genau zu unterscheiden, welchen Anteil
Personen an der Konstruktion von Wirklichkeiten haben und welchen Anteil
Regelsysteme, etablierte Routinen und anonymisierte Kommunikations-
strukturen haben
33
. Der Umgang mit Erwartungshaltungen manifestiert sich
in Entscheidungen, die Luhmann als Handlungen definiert, die ,,auf eine an
sie gerichtete Erwartung reagieren" (Luhmann 1984: 594 in Willke 1999:
151).
32
`Erwartungen' sind ausgewählte Sinnverweisungen und Haltungen an denen sich ein System orien-
tiert und die zeigen, wie eine Situation beschaffen ist und was in Aussicht steht. ,,Z.B. weiß man
aufgrund von Erfahrungen was man von jemandem anders oder einer Institution (Schule, Prüfung)
zu erwarten hat" (vgl. Baraldi 1998: u.a. 45ff).
33
`Personen' sind von sozialen Systemen zu trennen. Man denke nur an die Kontinuität der Schul-
ausbildung. Nicht die Personen, sondern das Netzwerk aus Kommunikationen (Regeln, Vorschrif-
ten etc.) bestimmt die Wirklichkeit der sozialen Systeme. Senge umschreibt diese Einsicht mit den
Worten: ,,When placed in the same system, people, however different, tend to produce the same
results" (Senge 1990: 42).
Kapitel 1: Theater als Intervention
34
Die systemische Organisationsberatung und partizipative Unterneh-
menstheaterformen verfolgen, zumindestens in dieser Hinsicht, die gleichen
Ziele: Zum einen die Analyse von Verhaltensregeln von Personen und so-
zialen Systemen, und zum anderen die Analyse und Veränderung der Inter-
aktion und der subjektiven Deutungen einzelner Personen (vgl. Kö-
nig/Volmer 1999: 44ff). Eine Variante der systemischen Organisationsbe-
ratung, die Rollenberatung (Sievers/Weigand 1986; Eck 1990) von Indivi-
duen und Organisationen, hat eine ähnliche theoretische Grundlage und
Zielsetzung wie das Szenische Spiel von Scheller. Szenische Spieltechniken
nach Scheller könnten m.E. die Rollenberatung sinnvoll ergänzen. Mit
Rückgriff auf die soziologische Rollentheorie wird in der Rollenberatung
(wie beim Szenischen Spiel) die Rolle des Protagonisten analysiert, um un-
terschiedliche Rollenerwartungen auszugleichen und Veränderungswünsche
und Widerstände in Bezug auf die Rolle zu bearbeiten (vgl. König/Volmer
1999: 44ff)
34
.
Die Systemische Organisationsberatung und das Theater haben also einige
Schnittstellen in Zielrichtung, Interventionsarchitektur und Beratungspraxis.
Sie nutzt bereits den Theatereinsatz, da sie aus systemischer Perspektive den
Zusammenhang von Emotion und Ratio ernst nimmt. Bei analogen Inter-
ventionsformen und bei Großgruppenveranstaltungen setzen systemische
Berater deshalb Theater als Medium oder als Methode ein (vgl. Königswie-
ser 1999: 47ff). In der Praxis praktizieren mittlerweile etwa ein Dutzend von
Organisationsberatungen Theater in der Beratungsarbeit und haben sich ei-
nige Produkte als eingetragenes Warenzeichen schützen lassen (vgl. Anhang
A). Andersen Consulting hat als erstes großes Beratungsunternehmen seit
drei Jahren eine eigene Abteilung `Unternehmenstheater' und sponsort seit
1998 das Festival `Business goes Theatre'. Mit Schreyöggs Buch `Unter-
nehmenstheater' ist eine erste deutsche Publikation im Herbst 1999 erschie-
nen. Im Herbst 2000 folgen die Publikationen `Das Feuer in Großgruppen'
34
Wissenschaftlich wird neuerdings versucht Theaterpädagogik und Systemtheorie miteinander zu
verbinden. Chris Farmer hat z.B. das Psychodrama mit der systemischen Familientherapie inte-
griert (vgl. Farmer 1998). Ähnlich wäre eine Integration von Psychodrama (und auch anderer
Theaterformen) mit der Systemischen Organisationsberatung denkbar.
Kapitel 1: Theater als Intervention
35
von Roswita Königswieser (Beratergruppe Neuwaldegg) sowie der Sachro-
man `Unternehmenstheater.de' von dem Rhetoriktrainer Peter Flume und
dem Theaterpädagogen Christian Hoffmann, bei dem es um eine fiktive
Firma geht in der es `an allen Enden und Ecken knarrt' und nacheinander
alle relevanten Anbieter von `Unternehmenstheater' auf den Plan treten und
ihre Konzepte anbieten
35
.
35
Vgl. die Homepage von SpielPlan (http://www.spielplan.de) zu genaueren Informationen
zum Sachroman.
http://www.wiwiss.fu-berlin.de/w3/w3schrey/
Manfor.htm am 20
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Originalausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2000
- ISBN (eBook)
- 9783832426873
- ISBN (Paperback)
- 9783838626871
- Dateigröße
- 4.2 MB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- Carl von Ossietzky Universität Oldenburg – Wirtschafts- und Sozialwissenschaften, Institut für Soziologie und Sozialforschung
- Note
- 1,0
- Schlagworte
- interview keith jonhstone intervention unternehmenstheater organisationsberatung katharis anbieter
- Produktsicherheit
- Diplom.de