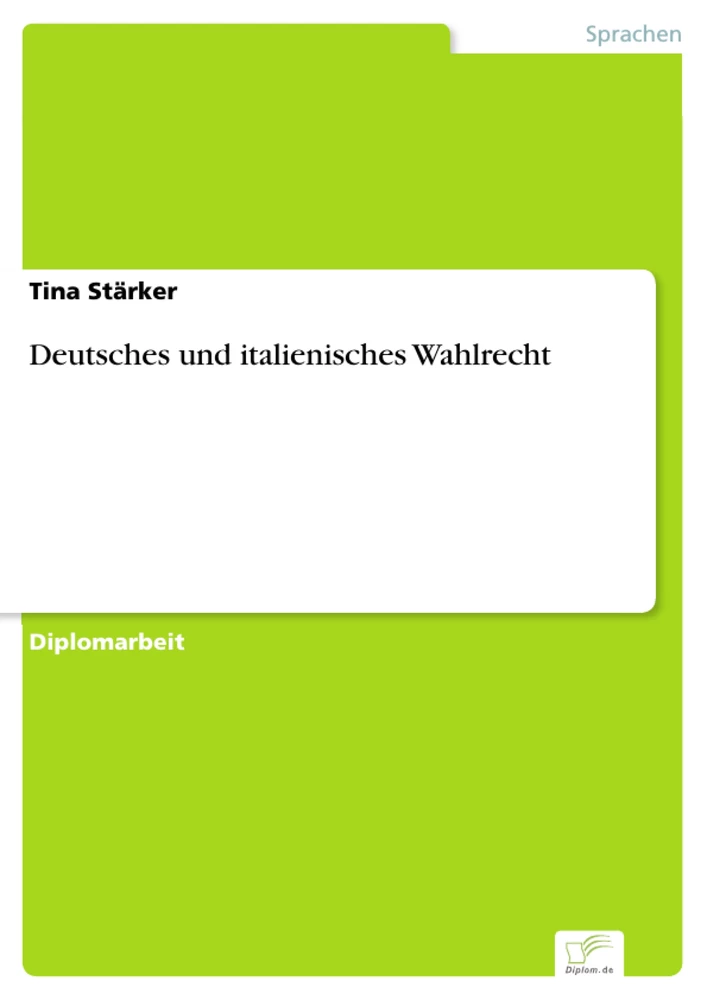Zusammenfassung
Inhaltsangabe:Einleitung:
Betrachtet man die italienische Politik seit Kriegsende, fallen insbesondere die zahlreichen Regierungswechsel ins Auge. In Deutschland hingegen sind die Regierungen stabil. Bei einem Vergleich der beiden Länder drängt sich die Frage auf, wie es möglich ist, dass in zwei Staaten, die beide die parlamentarische Republik als Staatsform gewählt haben, so unterschiedliche politische Verhältnisse herrschen können.
Die politische Stabilität ist offensichtlich nicht nur von der Staatsform eines Landes abhängig, denn auch in anderen Demokratien, so z.B. in Großbritannien und den USA sind Regierungswechsel erheblich seltener als in Italien. Bei näherem Hinsehen wird deutlich, dass neben dem Parteiensystem besonders das Wahlsystem Einfluss auf die politische Stabilität eines Landes hat. Das Wahlsystem reguliert die Zahl der im Parlament vertretenen Parteien und erleichtert oder erschwert somit die Mehrheitsbildung im Parlament.
In der vorliegenden Diplomarbeit werden die Wahlsysteme Deutschlands und Italiens näher untersucht, um ihre Bedeutung für die unterschiedliche politische Situation in den beiden Ländern darzustellen.
Für einen Vergleich der beiden Wahlsystems ist eine ausführliche Darstellung der Bedeutung und Funktion von Wahlen allgemein notwendig, ebenso eine kurze Erläuterung der Rolle der Parteien. Die Darstellung der Techniken der Grundwahlsysteme ist erforderlich, um die Auswirkungen der verschiedenen Wahlsysteme verstehen zu können.
Der geschichtliche Überblick vermittelt einen Eindruck von der Entstehung des heutigen Wahlrechts in Deutschland und Italien. Es wird deutlich, dass die Entwicklung des Wahlrechts immer eng mit politischen und gesellschaftlichen Veränderungen in einem Land einhergeht. Das Kapitel über das geltende Wahlrecht zeigt die Ergebnisse der dargelegten Entwicklung in den beiden Ländern und, um das Bild abzurunden, werden anschließend die zur Diskussion stehenden und die beschlossenen Änderungen erläutert.
Das Glossar greift wichtige italienische Wahltermini auf, die nicht ohne nähere Erläuterung übersetzt werden können oder für die es keine Entsprechung im Deutschen gibt. Der Schwerpunkt liegt hierbei auf Begriffen, unter denen der deutsche Wähler etwas anderes versteht als der italienische Wähler.
Inhaltsverzeichnis:Inhaltsverzeichnis:
1.Einleitung6
2.Wahlen - Allgemein
2.1Grundsätzliches7 - 12
Begriff der […]
Betrachtet man die italienische Politik seit Kriegsende, fallen insbesondere die zahlreichen Regierungswechsel ins Auge. In Deutschland hingegen sind die Regierungen stabil. Bei einem Vergleich der beiden Länder drängt sich die Frage auf, wie es möglich ist, dass in zwei Staaten, die beide die parlamentarische Republik als Staatsform gewählt haben, so unterschiedliche politische Verhältnisse herrschen können.
Die politische Stabilität ist offensichtlich nicht nur von der Staatsform eines Landes abhängig, denn auch in anderen Demokratien, so z.B. in Großbritannien und den USA sind Regierungswechsel erheblich seltener als in Italien. Bei näherem Hinsehen wird deutlich, dass neben dem Parteiensystem besonders das Wahlsystem Einfluss auf die politische Stabilität eines Landes hat. Das Wahlsystem reguliert die Zahl der im Parlament vertretenen Parteien und erleichtert oder erschwert somit die Mehrheitsbildung im Parlament.
In der vorliegenden Diplomarbeit werden die Wahlsysteme Deutschlands und Italiens näher untersucht, um ihre Bedeutung für die unterschiedliche politische Situation in den beiden Ländern darzustellen.
Für einen Vergleich der beiden Wahlsystems ist eine ausführliche Darstellung der Bedeutung und Funktion von Wahlen allgemein notwendig, ebenso eine kurze Erläuterung der Rolle der Parteien. Die Darstellung der Techniken der Grundwahlsysteme ist erforderlich, um die Auswirkungen der verschiedenen Wahlsysteme verstehen zu können.
Der geschichtliche Überblick vermittelt einen Eindruck von der Entstehung des heutigen Wahlrechts in Deutschland und Italien. Es wird deutlich, dass die Entwicklung des Wahlrechts immer eng mit politischen und gesellschaftlichen Veränderungen in einem Land einhergeht. Das Kapitel über das geltende Wahlrecht zeigt die Ergebnisse der dargelegten Entwicklung in den beiden Ländern und, um das Bild abzurunden, werden anschließend die zur Diskussion stehenden und die beschlossenen Änderungen erläutert.
Das Glossar greift wichtige italienische Wahltermini auf, die nicht ohne nähere Erläuterung übersetzt werden können oder für die es keine Entsprechung im Deutschen gibt. Der Schwerpunkt liegt hierbei auf Begriffen, unter denen der deutsche Wähler etwas anderes versteht als der italienische Wähler.
Inhaltsverzeichnis:Inhaltsverzeichnis:
1.Einleitung6
2.Wahlen - Allgemein
2.1Grundsätzliches7 - 12
Begriff der […]
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
ID 2471
Stärker, Tina: Deutsches und italienisches Wahlrecht / Tina Stärker -
Hamburg: Diplomarbeiten Agentur, 2000
Zugl.: Mainz, Universität, Diplom, 2000
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte, insbesondere die
der Übersetzung, des Nachdrucks, des Vortrags, der Entnahme von Abbildungen und Tabellen,
der Funksendung, der Mikroverfilmung oder der Vervielfältigung auf anderen Wegen und der
Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen, bleiben, auch bei nur auszugsweiser Verwertung,
vorbehalten. Eine Vervielfältigung dieses Werkes oder von Teilen dieses Werkes ist auch im
Einzelfall nur in den Grenzen der gesetzlichen Bestimmungen des Urheberrechtsgesetzes der
Bundesrepublik Deutschland in der jeweils geltenden Fassung zulässig. Sie ist grundsätzlich
vergütungspflichtig. Zuwiderhandlungen unterliegen den Strafbestimmungen des
Urheberrechtes.
Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in diesem
Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme, daß solche
Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei zu betrachten
wären und daher von jedermann benutzt werden dürften.
Die Informationen in diesem Werk wurden mit Sorgfalt erarbeitet. Dennoch können Fehler nicht
vollständig ausgeschlossen werden, und die Diplomarbeiten Agentur, die Autoren oder
Übersetzer übernehmen keine juristische Verantwortung oder irgendeine Haftung für evtl.
verbliebene fehlerhafte Angaben und deren Folgen.
Dipl. Kfm. Dipl. Hdl. Björn Bedey, Dipl. Wi.-Ing. Martin Haschke & Guido Meyer GbR
Diplomarbeiten Agentur, http://www.diplom.de, Hamburg 2000
Printed in Germany
»Das Heil der Demokratien, von welchem Typus und Rang sie immer seien,
hängt von einer geringfügigen technischen Einzelheit ab: vom Wahlrecht.
Alles andere ist sekundär. [...] Ohne diese Stütze einer vertrauenswürdigen
Abstimmung hängen die demokratischen Institutionen in der Luft.«
(Jose Ortega y Gasset, spanischer Philosoph;
aus seinem Buch ,,Aufstand der Massen")
Deutsches und italienisches Wahlrecht
3
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
6
2. Wahlen - Allgemein
2.1 Grundsätzliches
7 - 12
Begriff der Wahl
Wahlrechtsgrundsätze
Allgemein
Gleich
Unmittelbar
Frei
Geheim
2.2 Bedeutung und Funktion von Wahlen
13 - 17
Wahlen in kommunistischen Parteidiktaturen - totalitären Systemen
Wahlen in autoritären Systemen
Wahlen in westlichen Demokratien
2.3 Die Parteien als Träger der Wahl
18 - 19
Rechtliche Normierungen in Deutschland: Grundgesetz und
Parteiengesetz
Funktionen von Parteien
3. Die verschiedenen Wahlsysteme
3.1 Die Grundwahlsysteme und ihre Vor- und Nachteile
20 - 25
Mehrheitswahl
Verhältniswahl
3.2 Techniken und Mechanismen der Wahlsysteme
26 - 33
Der Wahlkreis
Die Formen der Wahlbewerbung
Die Stimmgebung
Die Stimmverwertung
Der Verhältnisausgleich
Sperrklauseln
3.3 Abwandlungen der Grundwahl- und Mischsysteme
34 - 36
Deutsches und italienisches Wahlrecht
4
4. Geschichtlicher Überblick über die Entstehung des
geltenden Wahlrechts in Deutschland und Italien
4.1 Deutschland
37 - 46
Die Entwicklung bis 1848
Das Wahlrecht in den Jahren 1848/1849
Das preußische Dreiklassenwahlrecht
Das Wahlgesetz des Norddeutschen Bundes und des Deutschen
Reiches von 1871
Das Wahlrecht der Weimarer Republik
1933 - 1945 Machtergreifung und Entdemokratisierung
Ab 1945 Neubeginn und geteilte Entwicklung
Wahlen und Wahlrecht in der (alten) Bundesrepublik
Wahlen und Wahlrecht in der Deutschen Demokratischen
Republik
4.2 Italien
47 - 58
Die Wahlen zur Camera dei Deputati
Das Wahlrecht im Königreich Sardinien
Annäherung an das allgemeine Wahlrecht von 1882 bis 1912
Einführung des allgemeinen Wahlrechts 1912
Wahlen im Faschismus
Einführung des Wahlrechts für Frauen
Italien wird Republik
Die Senatswahlen
Der Senat während der Monarchie
Die Senatswahlen von 1948 - 1992
Die Wahlrechtsreform von 1993
5. Das geltende Wahlrecht in Deutschland und Italien -
Besonderheiten, Unterschiede und Gemeinsamkeiten
5.1 Deutschland
59 - 66
Die Entwicklung des Wahlsystems bei den Bundestagswahlen
seit 1949
Das Wahlsystem bei den Bundestagswahlen
Wahlberechtigung
Wahlkreiseinteilung
Deutsches und italienisches Wahlrecht
5
Stimmgebungsverfahren
Stimmenverrechnungsverfahren
Fünf-Prozent-Sperrklausel - Grundmandatsklausel
Überhangmandate
5.2 Italien
67 - 78
Die Senatswahlen nach dem Referendum
Die Zuteilung der 315 Senatsmandate an die Regionen
Unterteilung der Senatsmandate in Proportional- und Mehr-
heitsmandate
Stimmgebung
Stimmenverwertung
Sbarramento implicito und scorporo totale
Die Wahlen zur Abgeordnetenkammer
Gliederung des Wahlgebietes in collegi uninominali und
circoscrizioni
Stimmgebung
Stimmgebung
Scorporo parziale und scorporo pro quota
5.3 Unterschiede und Gemeinsamkeiten
79 - 80
6. Zur Diskussion stehende und beschlossene Änderungen
des Wahlrechts in Deutschland und Italien
6.1 Deutschland
81 - 83
6.2 Italien
84 - 87
7. Glossar
88 - 99
8. Schlussbemerkung
100
Bibliographie
101 - 105
Deutsches und italienisches Wahlrecht
6
1. Einleitung
Betrachtet man die italienische Politik seit Kriegsende, fallen insbesondere die
zahlreichen Regierungswechsel ins Auge. In Deutschland hingegen sind die Re-
gierungen stabil. Bei einem Vergleich der beiden Länder drängt sich die Frage
auf, wie es möglich ist, dass in zwei Staaten, die beide die parlamentarische Re-
publik als Staatsform gewählt haben, so unterschiedliche politische Verhältnisse
herrschen können.
Die politische Stabilität ist offensichtlich nicht nur von der Staatsform eines
Landes abhängig, denn auch in anderen Demokratien, so z.B. in Großbritannien
und den USA sind Regierungswechsel erheblich seltener als in Italien. Bei nähe-
rem Hinsehen wird deutlich, dass neben dem Parteiensystem besonders das Wahl-
system Einfluss auf die politische Stabilität eines Landes hat. Das Wahlsystem
reguliert die Zahl der im Parlament vertretenen Parteien und erleichtert oder er-
schwert somit die Mehrheitsbildung im Parlament.
In der vorliegenden Diplomarbeit werden die Wahlsysteme Deutschlands und
Italiens näher untersucht, um ihre Bedeutung für die unterschiedliche politische
Situation in den beiden Ländern darzustellen.
Für einen Vergleich der beiden Wahlsystems ist eine ausführliche Darstellung
der Bedeutung und Funktion von Wahlen allgemein notwendig, ebenso eine kurze
Erläuterung der Rolle der Parteien. Die Darstellung der Techniken der Grund-
wahlsysteme ist erforderlich, um die Auswirkungen der verschiedenen Wahlsy-
steme verstehen zu können.
Der geschichtliche Überblick vermittelt einen Eindruck von der Entstehung des
heutigen Wahlrechts in Deutschland und Italien. Es wird deutlich, dass die Ent-
wicklung des Wahlrechts immer eng mit politischen und gesellschaftlichen Ver-
änderungen in einem Land einhergeht. Das Kapitel über das geltende Wahlrecht
zeigt die Ergebnisse der dargelegten Entwicklung in den beiden Ländern und, um
das Bild abzurunden, werden anschließend die zur Diskussion stehenden und die
beschlossenen Änderungen erläutert.
Das Glossar greift wichtige italienische Wahltermini auf, die nicht ohne nähere
Erläuterung übersetzt werden können oder für die es keine Entsprechung im Deut-
schen gibt. Der Schwerpunkt liegt hierbei auf Begriffen, unter denen der deutsche
Wähler etwas anderes versteht als der italienische Wähler.
Deutsches und italienisches Wahlrecht
7
2. Wahlen - Allgemein
2.1 Grundsätzliches
Begriff der Wahl
Der Begriff Wahlen geht zurück auf das indogermanische Wort "uel". Es be-
deutet so viel wie wollen. In der Tat ist eine Wahl eine Willensbekundung derer,
die wählen.
1
Die Wahl an sich ist ein Verfahren zur Bildung von Vertretungen, sowie zur
Besetzung von Ämtern und Positionen. Andere Verfahren sind der Losentscheid
und die Bestellung nach Geburtsrecht.
Bei einer Wahl geben die Wahlberechtigten ihre Stimmen ab, die ausgezählt
und verrechnet werden.
Wahlberechtigte sind Personen, denen das Recht zu wählen, zugesprochen
wurde.
Die Wahlentscheidung setzt eine Auswahl voraus, denn wählen bedeutet, zwi-
schen mehreren tatsächlich vorhandenen Möglichkeiten sachlicher oder personel-
ler Art zu entscheiden. Dies bedeutet, dass der Wähler zwischen miteinander kon-
kurrierenden Personen, Parteien oder Sachprogrammen eine Auswahl treffen
können muss.
Wenn wählen gleichzusetzen ist mit auswählen, dann gehört die Wahlfreiheit
des Wählers begrifflich auch zur Wahl, denn Wahlen sind frei oder es sind keine.
Eine Wahl ist somit eine Art Konkurrenzkampf, ein Wettstreit um die Stimmen
der Wähler. Wenn keine Konkurrenz gegeben ist, liegt auch strenggenommen
kein Wahlakt vor, sondern eine Akklamation. Konkurrenz setzt jedoch voraus,
dass alle Konkurrenten die gleichen Chancen haben. Ist dies nicht der Fall, kann
nicht von einer Wahl die Rede sein.
1
http://www.bundesregierung.de
Deutsches und italienisches Wahlrecht
8
Wahlrechtsgrundsätze
Die heute geltenden Wahlrechtsgrundsätze - allgemein, gleich, unmittelbar,
geheim, frei - gehen bis auf die Französische Revolution 1789 zurück, deren Ziele
"égalité, liberté, fraternité"
2
waren. Sie sind das Ergebnis der Entwicklung von
einer frühkonstitutionellen Elite-Demokratie im 19. Jahrhundert zur Massen-
Demokratie des 20. Jahrhunderts. Sie sind die klassischen Grundlagen des Wahl-
rechts und die Legitimitätsbasis eines demokratischen Staates. Selbst in sozialisti-
schen Ländern bolschewistischer Prägung sind diese Wahlrechtsgrundsätze seit
der Berliner Verfassung 1936 verfassungsrechtlich formal anerkannt.
Für die Wahl der Abgeordneten des Deutschen Bundestages sind diese Grund-
sätze in Art. 38 Abs. 1 GG festgelegt. Nach Art. 28 Abs. 1 Satz 2 GG sind sie
auch bei den Wahlen zu den Volksvertretungen in den Ländern, Kreisen und Ge-
meinden zu beachten.
3
Allgemein
Allgemein bedeutet, dass grundsätzlich alle Staatsbürger an der Wahl teilneh-
men können und sollen.
Alle Staatsbürger besitzen das aktive und passive Wahlrecht, d.h. sie sind
wahlberechtigt und wählbar, unabhängig von Geschlecht, Rasse, Sprache, Ein-
kommen oder Besitz, Beruf, Stand oder Klasse, Bildung, Konfession oder politi-
scher Gesinnung.
4
Obwohl die Wahlrechtsgrundsätze prinzipiell unantastbar sind, sind doch Aus-
nahmen möglich. So ist zum Beispiel die Einschränkung des Grundsatzes der All-
gemeinheit durch die Forderung nach der Erfüllung gesetzlich normierter allge-
meiner Voraussetzungen zulässig. Zu diesen gesetzlich normierten, allgemeinen
Voraussetzungen gehört die Bestimmung eines Mindestalters für die Wahlberech-
tigten, das Erfordernis der staatsbürgerlichen Handlungsfähigkeit, d.h. der Wahl-
berechtigte muss im vollen Besitz seiner geistigen Kräfte sein und der sogenann-
ten bürgerlichen Ehrenrechte, ebenso muss eine räumliche Bindung an das
2
Gleichheit, Freiheit, Brüderlichkeit.
3
Reineck, Karl-Michael: Allgemeine Staatslehre und Deutsches Staatsrecht, Herford 1993, S. 54.
4
Gensior, Walter; Krieg, Volker: Wahlrechtsfibel, Rheinbreitbach 1994, S. 13.
Deutsches und italienisches Wahlrecht
9
Wahlgebiet gegeben sein. Der Wahlberechtigte muss also seinen Wohnsitz oder
eine Wohnung im Wahlgebiet haben und sich seit längerem im Wahlgebiet auf-
halten.
Aufgrund dieser Tatsache wird in Deutschland seit ungefähr zwei Jahrzehnten
überlegt, ob zur Allgemeinheit der Wahl auch das Wahlrecht für in Deutschland
lebende Ausländer gehört. Zuvor war die Begrenzung des Wahlrechts auf das
,,Wahlvolk", also auf die Staatsangehörigen des Staates, dessen Volksvertretung
zu wählen war, selbstverständlich. Heutzutage fordern diverse Politiker aus den
verschiedensten Gründen die Einführung des Wahlrechts auch für nicht staatsan-
gehörige Einwohner mit qualifizierter Ansässigkeit. Bei den Kommunalwahlen
besitzen EU-Ausländer deswegen auch schon seit 1994 das Wahlrecht. Zwar wird
auch die Einführung des Wahlrechts für Ausländer bei den staatlichen Wahlen
gefordert, aber eine Verwirklichung dieser Forderung ist noch nicht absehbar.
Aus dieser Diskussion ergibt sich die Frage, ob die Nichtbeteiligung von seit
längerem in Deutschland lebenden Ausländern an den Wahlen einem gewandelten
Begriff der Allgemeinheit der Wahl noch gerecht bleiben kann, angesichts der
erhöhten grenzüberschreitenden Mobilität der Bevölkerung und einer geringeren
Sesshaftigkeit.
5
Gleich
Der Grundsatz der Gleichheit gehört inhaltlich mit dem der Allgemeinheit zu-
sammen. Er besagt, dass die Stimmen der Wähler den gleichen Zählwert haben.
Das Stimmgewicht darf also nicht nach Geschlecht, Rasse, Sprache oder ähnli-
chem differenziert werden.
6
Alle historischen Klassen-, Kurien- oder Plural-Wahlrechte sind mit dem Prin-
zip der Gleichheit unvereinbar. Ihr Prinzip war es, das Stimmgewicht der Wähler
nach ,,Klassen oder Kurien, nach Ständen, Berufen oder Steuerklassen oder durch
Sonderung bestimmter Wählerkategorien, etwa Universitätswähler, oder schließ-
lich durch Hervorhebung bestimmter Personengruppen, wie Grundeigentümer,
Steuerzahler, Familienväter, mit Zusatzstimmen zu differenzieren."
7
5
Gensior, Walter; Krieg, Volker: a.a.O., S. 14-15.
6
Schunk, Paul; Unglaub, Manfred: Bundeswahlrecht (mit Erläuterungen) , `94; Neustadt a.d.W.
1994, S.9.
7
Gensior, Walter; Krieg, Volker: a.a.O., S. 14-15.
Deutsches und italienisches Wahlrecht
10
Ebenso verlangt der Grundsatz der Wahlgleichheit, dass die Stimme jedes
Wählers neben dem gleichen Zählwert auch den gleichen Erfolgswert hat. Das
bedeutet, dass die Stimme jedes Wählers im gleichen Maße zum personellen
Wahlergebnis beitragen muss.
Dieser Grundsatz bedingt auch, dass das Wahlverfahren so geregelt sein muss,
dass die Gleichheit der Rechte all jener, die an der Wahl beteiligt sind, gewahrt
wird.
Der Wahlgleichheitsgrundsatz wird als allgemeines Prinzip der Wahlrechtsge-
staltung verstanden und ist der wichtigste Grundsatz.
Die Gleichheit ist aber keine ,,logisch-mathematische", sondern mehr eine for-
male Gleichheit.
Trotz seiner Wichtigkeit lässt auch dieser Grundsatz Ausnahmen zu. Sie benö-
tigen jedoch eine besondere Rechtfertigung und sind nur aus zwingenden, beson-
ders wichtigen, d.h. ,,verfassungspolitisch-strukturellen Notwendigkeiten oder
schwerwiegenden Bedürfnissen der Wahlrechtsgestaltung zulässig"
8
. Darunter
fallen unabweisbare technische Erfordernisse eines ordnungsgemäßen Wahlver-
fahrens, wahlrechtspolitische oder wahlsystematische Gründe.
Ein Beispiel hierfür sind die Sperrklauseln gegen Splitterparteien. Sie sind ver-
fassungsrechtlich zulässig, wenn sie sich gegen alle kleinen Parteien gleicherma-
ßen richten und das ,unabweisbare Ausmaß` nicht überschreiten. Die in Deutsch-
land geltende 5%-Klausel ist demnach zulässig, weil so im Interesse des
Zustandekommens regierungsfähiger Mehrheiten die Parteienzersplitterung ver-
mieden wird
9
.
Unmittelbar
Dieser Grundsatz besagt, dass die Wähler die Abgeordneten, die in das Parla-
ment einziehen sollen, selbst bestimmen, also keine Mittler oder Wahlmänner für
die Entscheidung benötigt werden. ,,Der Wähler muss das letzte und entscheiden-
de Wort haben."
10
Jede Zwischenschaltung eines fremden Willens bei der Stimm-
abgabe muss also ausgeschlossen sein.
8
Gensior, Walter; Krieg, Volker: a.a.O., S.15.
9
Schunk, Paul; Unglaub, Manfred: a.a.O., S.9.
10
Gensior, Walter; Krieg, Volker: a.a.O., S.16.
Deutsches und italienisches Wahlrecht
11
In einzelnen Ländern gibt es heute noch mittelbare Wahlen. Sie sind allerdings
nur noch formal mittelbar, da der Wähler zumeist eine gezielte Stimme abgeben
kann; sein Wille wird also nicht wesentlich von den Wahlmännern fremdbe-
stimmt. Dies ist bei der Wahl des Präsidenten der Vereinigten Staaten von Ameri-
ka der Fall.
Geheim
Man spricht von einer geheimen Wahl, wenn der Wähler seine Stimme so abge-
ben kann, dass niemand Kenntnis von seiner Wahlentscheidung erhält. Es darf
nicht erkennbar sein, wie sich der Wähler entscheiden will, entscheidet oder ent-
schieden hat. Dieser Grundsatz dient der Sicherung der freien Wahl. Offene
Stimmabgaben wie Wahl durch Zuruf oder Handzeichen, zu Protokoll oder durch
Abgabe unterzeichneter Stimmzettel stehen im Widerspruch zu diesem Grundsatz.
Er gilt für das gesamte Wahlverfahren, d.h. er besagt, dass das Geheimnis der
Wahlentscheidung des Wählers respektiert und vor unmittelbarer Verletzung oder
Gefährdung geschützt werden muss.
Frei
Eine Wahl ist frei, wenn der Wähler seinen wirklichen Willen ohne Zwang und
sonstige Beeinflussung bei der Wahl unverfälscht zum Ausdruck bringen kann.
Zum Wesen einer freien Wahl gehört auch das freie Wahlvorschlagsrecht.
Die Grundsätze der freien und der geheimen Wahl sind unauflöslich miteinan-
der verbunden, deshalb beschränken sich die meisten Verfassungen auf die aus-
drückliche Garantie der geheimen Wahl. Eine Wahl kann also nur als frei be-
zeichnet werden, wenn sie geheim ist.
Der Grundsatz der ,Freiheit der Wahl` beinhaltet jedoch nicht die ,Freiheit von
der Wahl`, d.h. die Freiheit der Wahl fernzubleiben. Er besagt lediglich, dass die
Wahl an sich, also die Entscheidung, frei sein muss und nicht von außen beein-
flusst werden darf. In Deutschland gibt es keine Wahlpflicht, deshalb ist jedem
Wähler freigestellt, von seinem Wahlrecht Gebrauch zu machen oder nicht. Wie
das Wort schon sagt, ist wählen ein Recht und keine Pflicht. Deshalb spricht man
auch von Wahlberechtigten.
Deutsches und italienisches Wahlrecht
12
Die Wahlfreiheit ist von so großer Bedeutung für das Wesen der Wahl, dass
man fast sagen kann, dass keine echte Wahl vorliegt, wenn dieser Grundsatz nicht
respektiert wird.
,,Insofern erscheint die Freiheit der Wahl als ,,Obersatz" aller Wahlrechts-
grundsätze und als besonders normierter Grundsatz nahezu überflüssig und mehr
affirmativ, weil selbstverständlich."
11
Die rechtliche Normierung der Wahlfreiheit
hat demnach eher politisch-programmatischen Charakter und ist eine klare Absa-
ge an die totalitären Scheinwahlsysteme und die totalitäre Scheinwahlpraxis im
20. Jahrhundert.
11
Gensior, Walter; Krieg, Volker: a.a.O., S. 18.
Deutsches und italienisches Wahlrecht
13
2.2 Bedeutung und Funktion von Wahlen
Wahlen in kommunistischen Parteidiktaturen - totalitären Systemen
Das Demokratieverständnis in Ländern des realexistierenden Sozialismus ist
ein anderes als in den westlichen Industrieländern. Die kommunistische Partei
gründet ihre Herrschaft und ihren Führungsanspruch nicht auf Wahlen. Die Wah-
len haben also in diesen politischen Systemen keine Legitimationsfunktion. Die
Legitimation der Machtausübung durch eine Partei basiert auf der historischen
Mission, die ,,nach den Erfordernissen der objektiven Gesetze der gesellschaftli-
chen Entwicklung"
12
z.B. im Marxismus-Leninismus der Arbeiterklasse und ihrer
Partei zufällt.
In diesem Zusammenhang sind Wahlen nur ein Instrument der Herrschaftsaus-
übung. Sie unterliegen der absoluten Kontrolle durch die Partei und die Staatsor-
gane, wodurch sich die Opposition nicht artikulieren kann. Man kann also von
Scheinwahlen sprechen, denn diese Wahlen entbehren sämtlicher Funktionen,
deren Grundlage die Auswahlmöglichkeit und die Wahlfreiheit sind. Nicht-
kompetitive Wahlen, Wahlen ohne Auswahlmöglichkeit, sind ein Charakteristi-
kum der kommunistischen Parteidiktaturen: Sie dienen der
,,- Mobilisierung aller gesellschaftlichen Kräfte;
- Verdeutlichung der Maßstäbe der kommunistischen Politik;
- Festigung der politisch-moralischen Einheit der Bevölkerung;
- Dokumentation der Geschlossenheit von Werkstätigen und Partei in Höchst-
zahlen an Wahlbeteiligung und Zustimmung zu den Einheitslisten."
13
Wahlen in autoritären Systemen
In autoritären Systemen werden Wahlen veranstaltet, um die bestehenden
Machtverhältnisse zu bestätigen. Die politische Macht steht also nicht zur Dispo-
sition.
Während sich die Opposition in totalitären Systemen überhaupt nicht äußern
kann, kann sie es in autoritären Systemen wenigstens teilweise, z.B. können Op-
12
Nohlen, Dieter: Wahlrecht und Parteiensystem, Opladen 1990, S. 22.
13
Ebenda, S. 27.
Deutsches und italienisches Wahlrecht
14
positionsparteien zugelassen sein, oder es besteht die Möglichkeit, sich der Wahl
zu enthalten, um so die Unzufriedenheit zum Ausdruck zu bringen.
In autoritären Systemen ist die Kontrolle über den Wahlprozess nicht absolut.
Selbst wenn die Wahlergebnisse die Vorherrschaft der regimetreuen Partei nicht
in Frage stellen, können sie trotzdem die politische Führung beeinflussen, da diese
häufig sensibel auf Veränderungen in Zustimmung und Ablehnung reagiert.
Dies lässt erkennen, dass Wahlen in autoritären Systemen der Konkurrenz
durch demokratische Ideen, durch freie Wahlen, ausgesetzt sind. Aus diesem
Grund werden die Wahlgesetze auch oft reformiert. Die Reformen sollen der Be-
völkerung den Eindruck vermitteln, ,,man bewege sich auf die Herstellung oder
Wiederherstellung demokratischer Verhältnisse zu"
14
.
Wahlen in autoritären Systemen sind demnach semi-kompetitive Wahlen, die
bedingt Opposition zulassen, also eine Zwischenstufe zwischen den nicht-
kompetitiven Wahlen in totalitären Systemen und kompetitiven Wahlen in westli-
chen Demokratien bilden.
Sie sind der Versuch, die bestehenden Machtverhältnisse zu legitimieren, die
innenpolitische Situation zu entspannen, das außenpolitische Ansehen zu verbes-
sern und die Opposition wenigstens teilweise zu integrieren. ,,Semi-kompetitive
Wahlen dienen folglich der Stabilisierung autoritärer Systeme."
15
Wahlen in westlichen Demokratien
Wahlen bilden die Grundlage des liberalen Demokratieverständnisses, demzu-
folge die politische Führung aus Wahlen hervorzugehen hat. Man kann also sa-
gen, dass es ohne Wahlen im Sinne eines offenen Wettbewerbs politischer Partei-
en keine Demokratie gibt.
Kompetitive Wahlen legitimieren nicht nur die politische Führung, sondern so-
gar das politische System an sich. In liberalen Demokratien sind Wahlen und Ab-
stimmungen die wesentlichen Elemente demokratischer Partizipation. Wahlen
sind zwar nur eine von vielen Formen der politischen Mitbestimmung, aber von
besonderer Bedeutung, da sie für den Großteil der Bevölkerung die einzige Form
der Teilnahme am politischen Prozess sind, denn Formen direkter Demokratie -
14
Nohlen, Dieter: a.a.O., S. 23.
Deutsches und italienisches Wahlrecht
15
Volksbegehren und Volksentscheide (Referenden; Plebiszite) - bestehen nur in
wenigen liberalen Demokratien.
Kompetitive Wahlen im parlamentarischen System, also Wahlen als Wettbe-
werb zwischen den Parteien, können eine Vielzahl von Funktionen haben wie:
,,- Legitimierung des politischen Systems und der Regierung einer Partei oder
Parteienkoalition;
- Übertragung von Vertrauen an Personen und Parteien;
- Rekrutierung der politischen Elite;
- Repräsentation von Meinungen und Interessen der Wahlbevölkerung;
- Verbindung der politischen Institutionen mit den Präferenzen der Wähler-
schaft;
- Mobilisierung der Wählerschaft für gesellschaftliche Werte, politische Ziele
und Programme, parteipolitische Interessen;
- Hebung des politischen Bewusstseins der Bevölkerung durch Verdeutlichung
der politischen Probleme und Alternativen;
- Kanalisierung politischer Konflikte in Verfahren zu ihrer friedlichen Beile-
gung;
- Integration des gesellschaftlichen Pluralismus und Bildung eines politisch
aktionsfähigen Gemeinwillens;
- Herbeiführung eines Konkurrenzkampfes um politische Macht auf der
Grundlage alternativer Sachprogramme;
- Herbeiführung einer Entscheidung über die Regierungsführung in Form der
Bildung parlamentarischer Mehrheiten;
- Einsetzung einer kontrollfähigen Opposition;
- Bereithaltung des Machtwechsels."
16
Der Bundestagswahl werden vor allem die folgenden Funktionen zugeschrie-
ben: Legitimation, Kontrolle, Repräsentation und Integration sowie Konkurrenz
und Auswahl.
15
Nohlen, Dieter: a.a.O. 1990, S. 27.
16
Ebenda, S. 26.
Deutsches und italienisches Wahlrecht
16
Legitimation
Moderne Industriegesellschaften bedürfen zu ihrer Steuerung einer Vielzahl
politischer Entscheidungen, die nicht durch den Bürger direkt getroffen werden
können. Aus diesem Grund legitimiert und autorisiert der Wähler mit dem Wahl-
akt Repräsentanten, die Entscheidungen für ihn zu treffen. Die gewählte Mehrheit
ist mit der Regierungsführung beauftragt und durch die Wahlentscheidung des
wahlberechtigten Staatsvolkes legitimiert und autorisiert, Macht und Herrschaft
auszuüben. Die Minderheit der Gewählten übernimmt die Rolle der Opposition
und ist damit zu ,,kritischer Loyalität"
17
verpflichtet. Ihre Aufgabe ist es, die Re-
gierung zu kontrollieren und ,,sich dem Wähler ... als echte personelle und sachli-
che Alternative zu präsentieren"
18
.
Kontrolle
In der Zeit zwischen den Wahlen ist es die Aufgabe der Opposition und der öf-
fentlichen Meinung, die Regierung zu kontrollieren. Durch die Wahl hat dann das
Volk unmittelbar die Möglichkeit der Machtkontrolle.
,,Wahlen haben also nicht nur die Funktion der legitimierenden Machtzuwei-
sung, sondern auch der Machtkorrektur."
19
Die periodisch wiederkehrenden Wahlen geben dem Wähler die Möglichkeit,
seine einmal getroffene Wahlentscheidung zu bestätigen oder sie zu korrigieren.
Theodor Heuss definierte Demokratie als einen ,,Herrschaftsauftrag auf Zeit"
20
.
Konkurrenz und Auswahl
Bei der Wahl wetteifern verschiedene politische Gruppen um politische Macht
in Form von Ämtern und Mandaten. Die Wahl ist also ein Konkurrenzkampf um
politische Macht, den der Wähler mit seiner Stimme zugunsten einer Seite ent-
scheidet.
21
17
Andersen, Uwe: Deutschland - Wahl'90, Opladen 1990, S. 54.
18
Gensior, Walter; Krieg, Volker: Wahlrechtsfibel, Rheinbreitbach 1994, S. 11.
19
Ebenda, S. 11.
20
Ebenda, S. 11.
21
Ebenda, S. 11.
Deutsches und italienisches Wahlrecht
17
Die Chancen der Auswahlmöglichkeit und die damit verbundene Einflussmög-
lichkeit des Wählers sind abhängig von dem politischen System und dem Wahlsy-
stem. Bei den Wahlen mit Wettbewerbscharakter hat der Wähler wesentlich grö-
ßere Einflussmöglichkeiten als in autoritären oder totalitären Systemen.
Auch das Wahlsystem hat Auswirkungen, denn die Möglichkeit, die vorgeleg-
ten Parteilisten zu verändern, Kandidaten zu streichen und neue zu präsentieren,
vergrößert die Auswahlmöglichkeit des Wählers ebenso, wie über mehr als nur
eine Stimme zu verfügen.
22
Repräsentation und Integration
Die im Volke vorhandenen vielfältigen verstreuten Meinungen und Auffassun-
gen werden in der Auseinandersetzung der miteinander konkurrierenden politi-
schen Gruppen integriert und schließlich in politische Macht umgesetzt. Deswe-
gen hat die Wahl auch eine Repräsentations- und Integrationsfunktion. Diese
Funktionen können aber nur unter bestimmten Voraussetzungen erfüllt werden.
Dazu gehören ein gewisses Maß an politischer Bildung und die Fähigkeit des
Wählers zwischen verschiedenen personellen und sachlichen Angeboten zu unter-
scheiden, ebenso eine Reihe institutioneller Bedingungen, damit ein echter Kon-
kurrenzkampf zwischen den politischen Gruppen möglich ist. Zu diesen institu-
tionellen Bedingungen gehören die Wahlrechtsgrundsätze und das Wahlsystem.
23
22
Andersen, Uwe: a.a.O., S. 55.
23
Gensior, Walter; Krieg, Volker: a.a.O., S. 12.
Deutsches und italienisches Wahlrecht
18
2.3 Die Parteien als Träger der Wahl
Besonders im Hinblick auf Wahlen ist in modernen Massendemokratien die
politische Willensbildung ohne Parteien kaum denkbar. Die Parteien sind die
,,wichtigste organisierte Mittlerinstanz zwischen Bevölkerung und Staat"
24
. Aus
der Menge der politischen Sach- und Personalinteressen treffen sie eine Voraus-
wahl und bündeln sie zu einem Angebot an den Wähler. ,,Die Schlüsselposition,
die die Parteien in unserem politischen System innehaben, kommt in der Bezeich-
nung Parteiendemokratie zum Ausdruck."
25
Rechtliche Normierungen in Deutschland: Grundgesetz und Parteiengesetz
Das Grundgesetz erkennt als erste deutsche Verfassung die wichtige Rolle der
Parteien ausdrücklich an, knüpft sie aber an Bedingungen, um verfassungsrechtli-
che Sicherungen einzubauen. In Art. 21 Abs. 1 GG heißt es deswegen: ,,
1
Die Par-
teien wirken bei der politischen Willensbildung des Volkes mit.
2
Ihre Gründung
ist frei.
3
Ihre innere Ordnung muss demokratischen Grundsätzen entsprechen.
4
Sie
müssen über Herkunft und Verwendung ihrer Mittel sowie über ihr Vermögen
öffentlich Rechenschaft geben."
Die Tatsache, dass die Parteien mit der Mitwirkung an der politischen Willens-
bildung betraut sind, besagt, dass ihnen zwar eine wichtige Aufgabe übertragen
wurde, ihnen jedoch nicht ein Monopolanspruch zugestanden wird. Ebenso wer-
den wegen der Bedeutung der Parteien die Eckwerte innerparteilicher Demokratie
und der Transparenz der Finanzierung ausdrücklich vorgegeben. Art. 21 Abs.2
GG besagt, dass Parteien, deren Ziel es ist, die freiheitlich demokratische
Grundordnung zu beeinträchtigen oder zu beseitigen, verfassungswidrig sind,
worüber das Bundesverfassungsgericht entscheidet. Ein Parteienverbot bedeutet
unter anderem, dass die Abgeordneten dieser Partei ihr Mandat verlieren.
Art. 21 Abs. 3 GG weist daraufhin, dass das Nähere durch das 1967 verab-
schiedete Parteiengesetz geregelt wird.
Hier findet sich auch eine Definition des Parteienbegriffes (§2 Abs. 1 Parteien-
gesetz). Trotz der offenen Formulierung ist im Hinblick auf die Parlamente von
24
Andersen, Uwe: Deutschland - Wahl ´90, Opladen 1990, S. 71.
25
Ebenda, S. 71.
Deutsches und italienisches Wahlrecht
19
Bund und Ländern eine klare Abgrenzung einmal gegenüber Interessenverbänden
und Bürgerinitiativen und zum anderen gegenüber den kommunal begrenzten
Rathausparteien erkennbar.
26
Funktionen von Parteien
In §1 Abs. 2 Parteiengesetz wird die im Grundgesetz vorgegebene zentrale
Aufgabe der Parteien näher erläutert. Dieser Aufgabenkatalog macht das außeror-
dentlich breite Wirkungsfeld der Parteien deutlich.
Eine der wichtigsten innerparteilichen Entscheidungen ist die Aufstellung der
Parlamentskandidaten, die sich um ein Mandat bewerben und gleichzeitig die
,,personelle Visitenkarte der Partei"
27
sind.
Bei der Bundestagswahl entscheidet der Wähler direkt über die Abgeordneten,
seine Repräsentanten, denn mit seiner Erststimme wählt er den Abgeordneten sei-
nes Wahlkreises und mit der Zweitstimme die Liste einer Partei. Aufgrund des
Wahlsystems, der personalisierten Verhältniswahl, entscheidet jedoch die Zweit-
stimme über die parteipolitische Zusammensetzung des Bundestages.
Dem Grundgesetz ist das imperative Mandat, das zulässt, dass dem Abgeord-
neten von bestimmten Stellen Weisungen erteilt werden können, die sein Ab-
stimmungsverhalten beeinflussen sollen, fremd. Die Abgeordneten haben dem-
nach ein freies Mandat. Dies bedeutet nach Art. 38 Abs. 1 Satz 2 GG, dass die
Abgeordneten Vertreter des ganzen Volkes sind, nicht an Aufträge und Weisun-
gen gebunden und nur ihrem Gewissen unterworfen sind.
28
Der im parlamentarischen System im Normalfall bestehende Fraktionszwang,
auch Fraktionsdisziplin genannt, steht dazu aber nicht im Widerspruch.
29
26
Andersen, Uwe: a.a.O., S. 72.
27
Ebenda, S. 72.
28
Reineck, Karl-Michael: Allgemeine Staatslehre und Deutsches Staatsrecht, Herford 1993, S.
275.
29
Andersen, Uwe: a.a.O., S. 55.
Deutsches und italienisches Wahlrecht
20
3. Die verschiedenen Wahlsysteme
Neben den Wahlrechtsgrundsätzen gibt es auch die sogenannten Mandatsver-
teilungsgrundsätze. Die beiden wichtigsten Systeme sind die Mehrheitswahl und
die Verhältniswahl.
30
Sie bilden das Grundprinzip des Verfahrens, nach dem die Wähler ihre Stimme
abgeben und diese in Mandate umgesetzt werden. Das Wahlsystem bestimmt so-
mit die Abläufe des gesamten Wahlprozesses; die Einteilung des Wahlgebietes in
Wahlkreise, die Art der Wahlbewerbung, die Stimmabgabe und die Stimmver-
wertung. Es beeinflusst dadurch die Formierung der politischen Kräfte ebenso wie
die Wahlentscheidung des Wählers und ihre Auswirkung auf die parlamentarische
Mandatsstärke der Parteien.
3.1 Die Grundwahlsysteme und ihre Vor- und Nachteile
Aus der folgenden Darstellung der beiden Grundtypen geht hervor, dass weder
die Mehrheitswahl noch die Verhältniswahl das perfekte Wahlsystem ist. Sie wei-
sen beide Vorteile auf, denen aber nicht unerhebliche Nachteile gegenüberstehen.
Aus diesem Grund finden in einigen Ländern gemischte Wahlsysteme Anwen-
dung, die Elemente beider Verfahren enthalten, um so die Vorteile miteinander zu
verbinden und die Nachteile auszuschließen. Auch der Deutsche Bundestag wird
nach einem solchen gemischten Verfahren gewählt.
31
Mehrheitswahl
Historisch gesehen ist die Mehrheitswahl als Entscheidungsprinzip zu verste-
hen. Es ist etwa seit dem 5. Jahrhundert an die Stelle des Prinzips der Einstim-
migkeit getreten und gilt heute als Gegensatz zur Verhältniswahl.
Die Mehrheitswahl ist eine Personenwahl. Das heißt, der Kandidat, der die
meisten Stimmen auf sich vereinigt, ist gewählt.
Wenn der Staatspräsident zu wählen ist, werden die Stimmen für das ganze
Land ausgezählt. Wenn aber ein Parlament nach dem Grundsatz der Mehrheits-
30
Reineck, Karl-Michael: Allgemeine Staatslehre und Deutsches Staatsrecht; Herford, 1993, S. 54.
31
Ebenda, S. 59/60.
Deutsches und italienisches Wahlrecht
21
wahl gebildet werden soll, wird das Wahlgebiet meist in entsprechend viele
Wahlkreise eingeteilt, wie Abgeordnete vorgesehen sind
32
.
,,Das Wahlgebiet ist die räumliche Grundlage (Gebiet, Territorium) der Kör-
perschaft (Staat, Kreis, Gemeinde), deren Parlament oder Volksvertretung zu
wählen ist."
33
Bei der Mehrheitswahl wird zwischen absoluter und relativer
Mehrheitswahl unterschieden. Bei der absoluten Mehrheit muss ein Kandidat
mehr als 50% der abgegebenen gültigen Stimmen erzielt haben und bei der relati-
ven Mehrheit reicht es, wenn er im Verhältnis zu den anderen Kandidaten die
meisten Stimmen erhalten hat.
Sollte im ersten Wahlgang der absoluten Mehrheitswahl keiner der Kandidaten
die Mehrheit erzielen, kann für den zweiten Wahlgang eine Stichwahl, eine Wahl
zwischen dem Erst- und dem Zweitplatzierten des ersten Wahlgangs, oder die
Beschränkung auf das Erreichen der relativen Mehrheit vorgesehen werden. Die-
ses notwendige, aber komplizierte Prozedere wird oft als Nachteil der Mehrheits-
wahl gewertet.
Sowohl bei der absoluten als auch bei der relativen Mehrheitswahl bleiben die
für die unterlegenen Bewerber abgegebenen Stimmen unberücksichtigt. Große
Minderheiten bleiben dadurch unter Umständen ohne Vertretung. Hat Kandidat A
51% und Kandidat B 49% der Stimmen erhalten, bleibt fast die Hälfte der Wähler
unberücksichtigt. Im Extremfall, wenn Kandidat A 35%, Kandidat B 33% und
Kandidat C 32% der Stimmen erhalten haben, sind im Parlament 35% der Wähler
vertreten, während 65% unbeachtet bleiben.
34
Hier kann schon fast nicht mehr
von einer Mehrheitswahl gesprochen werden. Dies ist einer der Nachteile der
Mehrheitswahl, da das so gewählte Parlament nicht den wirklichen politischen
Meinungsstand der Bevölkerung widerspiegelt.
Ein weiterer Nachteil ist, dass sich auf längere Sicht ein Trend zum Zwei-
Parteien-System bildet und somit eine Einschränkung der Parteienvielfalt stattfin-
det, wie es in den USA und Großbritannien der Fall ist.
Ebenso von Nachteil ist, dass es bestimmten Personen, so zum Beispiel Fach-
leuten aus Wissenschaft und Praxis, deren Mitarbeit im Parlament von Nutzen
wäre, aufgrund ihrer fundierten Kenntnisse nur einer Materie kaum möglich ist,
32
Reineck, Karl-Michael: a.a.O., S. 54/55.
33
Gensior, Walter; Krieg, Volker: Wahlrechtsfibel; Rheinbreitbach 1994, S. 19.
34
Reineck, Karl-Michael: a.a.O., S. 55.
Deutsches und italienisches Wahlrecht
22
einen Wahlkreis zu gewinnen, da durch das Mehrheitswahlsystem Allroundpoliti-
ker begünstigt werden, von denen sich die Wähler besser vertreten glauben.
35
Die Mehrheitswahl ist, zumindest bei relativer Mehrheitswahl, einfach und klar
zu überschauen. Sie stellt eine enge Verbindung zwischen Wählern und Gewähl-
ten her (Personenwahl), sichert somit die Unabhängigkeit der Abgeordneten von
der Partei und erhält die Freiheit des Mandats gegen Interessenpolitik (freies
Mandat). Dies wird von den Gegnern der Mehrheitswahl kritisiert, da so außer-
parlamentarische Einflüsse an Bedeutung gewinnen.
Befürworter der Mehrheitswahl werten den Trend zum Zwei-Parteien-System
als Vorteil, da durch den Ausschluss kleiner Parteien stabile Regierungen gebildet
werden können und klare Fronten zwischen Opposition und Regierung entstehen.
Diese Entwicklung führt somit zu eindeutigen Mehrheitsverhältnissen im Parla-
ment. Langwierige Koalitionsverhandlungen werden vermieden, die Regierungs-
bildung und die Parlamentsarbeit beschleunigt.
36
Eine Zersplitterung der politi-
schen Macht wird durch die Mehrheitswahl verhindert.
37
Dem Argument der klaren Mehrheiten wird entgegengehalten, dass die Un-
gleichheit des Stimmengewichts ungerecht ist und die Wähler der unterlegenen
Kandidaten enttäuscht werden. In ,,sicheren" Wahlkreisen führt dies zu Lethargie.
Verhältniswahl
Die Verhältniswahl kann als geistiges Kind der ,,égalité" (Gleichheit) der Fran-
zösischen Revolution bezeichnet werden. Sie ist in der zweiten Hälfte des 19.
Jahrhunderts entstanden und zu Beginn des 20. Jahrhunderts in die Praxis einge-
führt worden. Das Entscheidungsprinzip der Verhältniswahl ist, bei der Vergabe
der Mandate dem Verhältnis der abgegebenen Stimmen zu folgen. Im Endeffekt
bleibt keine der abgegebenen gültigen Stimmen unberücksichtigt.
38
Dies ent-
spricht eher dem Gebot der Gleichbehandlung aller Staatsbürger als die Mehr-
heitswahl.
Aus diesem Grund wird von der Verhältniswahl gesagt, sie sei ein ,,Spiegelbild
der Wählerschaft, ein getreues Abbild der in der Aktivbürgerschaft vorhandenen
35
Reineck, Karl-Michael: a.a.O., S. 56.
36
Ebenda, S.56.
37
Gensior, Walter; Krieg, Volker: a.a.O., S. 32.
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Originalausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2000
- ISBN (eBook)
- 9783832424718
- ISBN (Paperback)
- 9783838624716
- Dateigröße
- 1.7 MB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- Johannes Gutenberg-Universität Mainz – Angewandte Sprach- und Kulturwissenschaft
- Note
- 1,7
- Schlagworte
- italien deutschland recht wahlen politik
- Produktsicherheit
- Diplom.de