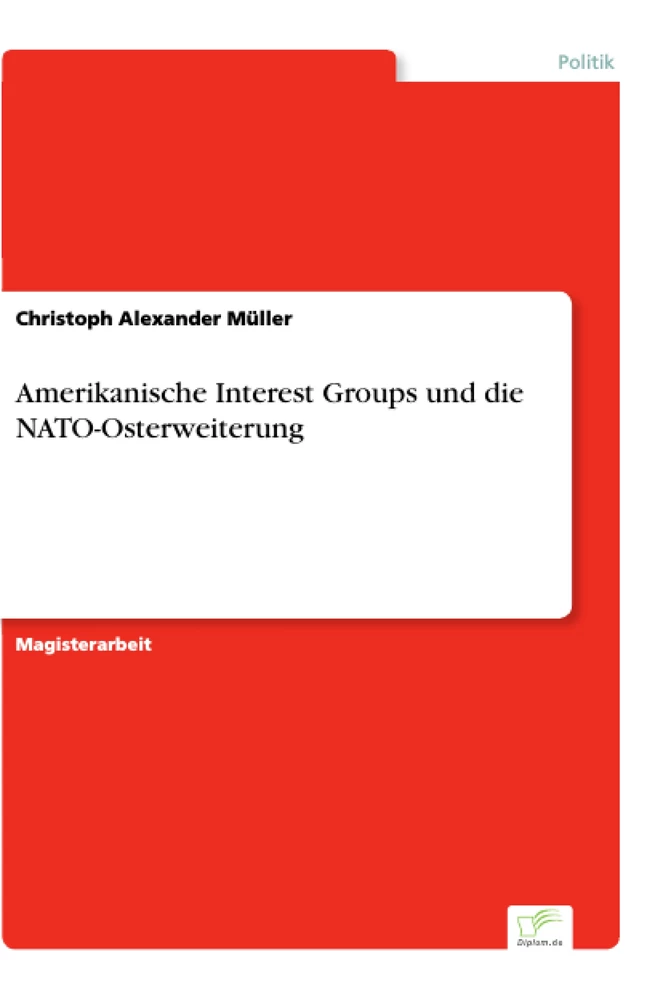Amerikanische Interest Groups und die NATO-Osterweiterung
©1999
Magisterarbeit
166 Seiten
Zusammenfassung
Inhaltsangabe:Einleitung:
Nach dem Epochenwandel zu Beginn dieses Jahrzehnts gehörte die im Juli 1997 von den Staats- und Regierungschefs in Madrid beschlossene Erweiterung der NATO um Polen, Ungarn und der Tschechischen Republik zweifellos zu den wichtigsten Ereignissen in der euroatlantischen Sicherheitspolitik seit dem Ende des Kalten Krieges.
Diese Arbeit untersucht, welche Institutionen, Persönlichkeiten und Lobbies mit welchen Mitteln in den Vereinigten Staaten durch gezielte Interessenvertretung versuchten, politische Entscheidungsträger für die NATO-Osterweiterung zu gewinnen.
Im Mittelpunkt der Arbeit stehen die Bemühungen der ostmitteleuropäisch-ethnischen Lobby und des militärisch-industriellen Komplexes. Beide konnten aus unterschiedlichen Gründen maßgeblich Einfluss auf die amerikanische Erweiterungsdebatte nehmen.
Des weiteren wird der Zusammenhang und das gegenseitige Abhängigkeitsverhältnis zwischen den einzelnen amerikanischen Interessenverbänden, der Exekutive und der Legislative beispielhaft untersucht. Hierbei werden auch sekundäre Interessen, wie die der jüdisch-amerikanischen Lobbies und der Veteranenverbände, geschildert.
Die Arbeit analysiert ein außenpolitisches Feld vor dem Hintergrund amerikanischer nationaler Interessen. Die kennzeichnenden Gegebenheiten des politischen Systems Amerikas lassen dabei folgende Fragen in den Vordergrund treten, die diese Arbeit leiten:
1. Die wirtschaftlichen und ethnischen Einzelinteressen sind im amerikanischen politischen Prozess aus strukturellen Gründen weitaus größer und einflussreicher als in anderen westlichen Demokratien. Was sind die strukturellen Gründe, und wie werden die erfolgreich genutzt?
2. Aufgrund der geringen politischen Eigenheiten der Parteien und der deutlichen Gewaltenteilung im Kongress haben Interessenverbände in den Vereinigten Staaten weitaus größere Chancen als in Westeuropa. Welche Prozesse laufen dabei ab, und wie können sie am besten umschrieben werden?
3. Die NATO-Osterweiterung berührte zum Teil Interessen, die nicht im Vordergrund der außenpolitischen Agenda standen. Um was für Interessen handelte es sich, und wie machten sie sich bemerkbar?
Inhaltsverzeichnis:Inhaltsverzeichnis:
Inhaltsverzeichnis2
Vorwort6
Erstes Kapitel: Das Anliegen der Arbeit7
A.Untersuchungsgegenstand8
1.Abgrenzung8
2.Die Messung von Einfluss8
3.Fragestellungen10
Zweites Kapitel: Übersicht11
A.Die amerikanischen Interest Groups und ihre Arbeits- und […]
Nach dem Epochenwandel zu Beginn dieses Jahrzehnts gehörte die im Juli 1997 von den Staats- und Regierungschefs in Madrid beschlossene Erweiterung der NATO um Polen, Ungarn und der Tschechischen Republik zweifellos zu den wichtigsten Ereignissen in der euroatlantischen Sicherheitspolitik seit dem Ende des Kalten Krieges.
Diese Arbeit untersucht, welche Institutionen, Persönlichkeiten und Lobbies mit welchen Mitteln in den Vereinigten Staaten durch gezielte Interessenvertretung versuchten, politische Entscheidungsträger für die NATO-Osterweiterung zu gewinnen.
Im Mittelpunkt der Arbeit stehen die Bemühungen der ostmitteleuropäisch-ethnischen Lobby und des militärisch-industriellen Komplexes. Beide konnten aus unterschiedlichen Gründen maßgeblich Einfluss auf die amerikanische Erweiterungsdebatte nehmen.
Des weiteren wird der Zusammenhang und das gegenseitige Abhängigkeitsverhältnis zwischen den einzelnen amerikanischen Interessenverbänden, der Exekutive und der Legislative beispielhaft untersucht. Hierbei werden auch sekundäre Interessen, wie die der jüdisch-amerikanischen Lobbies und der Veteranenverbände, geschildert.
Die Arbeit analysiert ein außenpolitisches Feld vor dem Hintergrund amerikanischer nationaler Interessen. Die kennzeichnenden Gegebenheiten des politischen Systems Amerikas lassen dabei folgende Fragen in den Vordergrund treten, die diese Arbeit leiten:
1. Die wirtschaftlichen und ethnischen Einzelinteressen sind im amerikanischen politischen Prozess aus strukturellen Gründen weitaus größer und einflussreicher als in anderen westlichen Demokratien. Was sind die strukturellen Gründe, und wie werden die erfolgreich genutzt?
2. Aufgrund der geringen politischen Eigenheiten der Parteien und der deutlichen Gewaltenteilung im Kongress haben Interessenverbände in den Vereinigten Staaten weitaus größere Chancen als in Westeuropa. Welche Prozesse laufen dabei ab, und wie können sie am besten umschrieben werden?
3. Die NATO-Osterweiterung berührte zum Teil Interessen, die nicht im Vordergrund der außenpolitischen Agenda standen. Um was für Interessen handelte es sich, und wie machten sie sich bemerkbar?
Inhaltsverzeichnis:Inhaltsverzeichnis:
Inhaltsverzeichnis2
Vorwort6
Erstes Kapitel: Das Anliegen der Arbeit7
A.Untersuchungsgegenstand8
1.Abgrenzung8
2.Die Messung von Einfluss8
3.Fragestellungen10
Zweites Kapitel: Übersicht11
A.Die amerikanischen Interest Groups und ihre Arbeits- und […]
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
ID 2368
Müller, Christoph Alexander: Amerikanische Interest Groups und die NATO-Osterweiterung /
Christoph Alexander Müller - Hamburg: Diplomarbeiten Agentur, 2000
Zugl.: München, Universität, Magister, 1999
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte, insbesondere die
der Übersetzung, des Nachdrucks, des Vortrags, der Entnahme von Abbildungen und Tabellen,
der Funksendung, der Mikroverfilmung oder der Vervielfältigung auf anderen Wegen und der
Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen, bleiben, auch bei nur auszugsweiser Verwertung,
vorbehalten. Eine Vervielfältigung dieses Werkes oder von Teilen dieses Werkes ist auch im
Einzelfall nur in den Grenzen der gesetzlichen Bestimmungen des Urheberrechtsgesetzes der
Bundesrepublik Deutschland in der jeweils geltenden Fassung zulässig. Sie ist grundsätzlich
vergütungspflichtig. Zuwiderhandlungen unterliegen den Strafbestimmungen des
Urheberrechtes.
Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in diesem
Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme, daß solche
Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei zu betrachten
wären und daher von jedermann benutzt werden dürften.
Die Informationen in diesem Werk wurden mit Sorgfalt erarbeitet. Dennoch können Fehler nicht
vollständig ausgeschlossen werden, und die Diplomarbeiten Agentur, die Autoren oder
Übersetzer übernehmen keine juristische Verantwortung oder irgendeine Haftung für evtl.
verbliebene fehlerhafte Angaben und deren Folgen.
Dipl. Kfm. Dipl. Hdl. Björn Bedey, Dipl. Wi.-Ing. Martin Haschke & Guido Meyer GbR
Diplomarbeiten Agentur, http://www.diplom.de, Hamburg 2000
Printed in Germany
Inhaltsverzeichnis
INHALTSVERZEICHNIS ... 1
VORWORT ... 4
ERSTES KAPITEL: DAS ANLIEGEN DER ARBEIT... 5
A. Untersuchungsgegenstand... 6
1. Abgrenzung ... 6
2. Die Messung von Einfluß ... 6
3. Fragestellungen... 8
ZWEITES KAPITEL: ÜBERSICHT... 9
A. Die amerikanischen Interest-Groups und ihre Arbeitsbereiche und Organisations-formen... 9
1. Begriffsdefinition und Arten von Interest-Groups ... 9
2. Die Entstehung und Entwicklung des amerikanischen Verbändewesens... 10
3. Das Selbstverständnis ... 13
4. Die Rolle im politischen System der U.S.A... 15
4.1. Die Vielfalt der amerikanischen Gesellschaft und die politische Kultur ... 16
4.2. Die dezentralisierte Natur des politischen Systems ... 16
4.3. Die schwache Parteiführung ... 17
B. Die NATO-Osterweiterung ... 20
1. Gegenstand ... 20
2. Problematik... 21
C. Die Beteiligung amerikanischer Interest Groups an der NATO-Osterweiterung ... 22
Die beteiligten Interest Groups... 22
2. Art und Umfang der Beteiligung ... 23
D. Theoretische Grundlagen der Fallstudien ... 24
1. Die Stellung ethnischer Interest Groups in der politischen Theorie ... 24
2. Die Stellung des militärisch-industriellen Komplexes in der politischen Theorie ... 26
DRITTES KAPITEL: DIE ERSTE FALLSTUDIE: DER POLISH AMERICAN
CONGRESS ... 27
A. Struktur, Einflußformen und Entwicklung ... 27
1. Struktur ... 27
1.1. Darstellung ... 27
1.2. Stärken und Schwächen der Struktur ... 27
1.2.1 Stärken... 27
1.2.2. Schwächen ... 28
2. Einflußformen... 29
3. Entwicklung... 31
3.1. Darstellung ... 31
3.1.1. Von Teheran bis Solidarnocz: Die Wurzeln für die Erweiterungsforderung ... 31
B. Orientierungslosigkeit mit Ende des Kalten Krieges ... 36
1. Darstellung ... 36
2
1.1. Die Suche nach einem neuen Selbtsverständnis... 36
2. Die Bedeutung des Interesses an der NATO-Osterweiterung... 39
C. Einflußnahme auf die NATO-Osterweiterung ... 40
1. Anfangsphase: Einleitung einer Kampagne ... 40
1.1. Darstellung ... 40
1.1.1. Entscheidungsfindung... 40
1.1.2. Startschwierigkeiten... 43
1.1.3. Erster Schwung in der Kampagne... 46
1.1.3.1. Partnerschaft für den Frieden... 46
1.1.3.2.
Die Medien als Einflußinstrument und die Wertung des wissenschaftlichen Beweises für
das Unrecht von Jalta... 48
1.2. Bewertung der Anfangsphase: ... 50
2.
Hochphase: Druck auf die Administration in Hinblick auf Partnerschaft für den Frieden und Clintons
Wiederwahl... 51
2.1. Darstellung ... 51
2.1.1. Interessenkonflikte in der Administration... 52
2.1.2. Wählerabhängigkeit: Gründe für Clinton's Aufmerksamkeit ... 55
Bundesstaaten mit starken ostmitteleuropäischen Minderheiten... 57
2.1.3. Druck auf die Administration ... 58
2.1.3.1. Der Entwurf einer neuen Lobbystrategie ... 60
2.1.3.2. Die Gründung der Central and East European Coalition ... 61
2.1.3.3. Einfluß mit Hilfe technischer Mittel: Ein Beispiel... 63
2.1.3.4. Erstes Treffen der Administration mit der Central and East European Coalition ... 64
2.1.3.5. Der Interessenzwiespalt des Präsidenten ... 65
2.1.3.6.
Die Wertung russischer und amerikanischer Rhetorik durch den Polish American
Congress
68
2.1.3.7. Zweites Treffen der Administration mit der Central and East European Coalition... 69
2.2
Bewertung der Hochphase ... 70
3. Endphase : Konstante Erweiterungsbemühungen ... 72
3.1. Darstellung ... 72
3.1.1. Die anhaltende Rußlandproblematik... 72
3.1.2. Einfluß auf die Republikanische Partei... 73
3.1.3. Bedeutende Lobbybeispiele... 74
3.1.4. Das außenpolitische Desinteresse des U.S. Kongresses ... 76
3.1.5. Kooperation mit anderen Verbänden... 77
3.1.6. Die öffentliche Diskussion... 83
3.2. Bewertung der Endphase ... 86
VIERTES KAPITEL:DIE ZWEITE FALLSTUDIE: DIE RÜSTUNGSLOBBY... 88
A. Struktur und Entwicklung ... 88
1. Struktur ... 88
1.1. Darstellung ... 88
1.1.1. Der militärisch-industrielle Komplex ... 88
1.1.2. Das Phänomen der `Revolving Door'... 91
2. Entwicklung... 92
2.1. Darstellung ... 92
2.1.1. Das Ende des Kalten Krieges: eine veränderte Marktsituation... 92
2.1.2. Die Entwicklung des Erweiterungsinteresses... 97
2.2. Bedeutung für das Interesse an der NATO-Osterweiterung... 98
B. Einflußnahme auf die NATO-Osterweiterung ... 99
1. Die Möglichkeiten des ostmitteleuropäischen Marktes ... 99
1.1. Darstellung ... 99
1.1.1. Die Anforderungen der NATO ... 99
1.1.2. Amerikanische Ambitionen auf dem ostmitteleuropäischen Markt ... 100
2. Kooperationsformen zwischen Staat und Rüstungsindustrie ... 103
2.1. Finanzierungsmöglichkeiten ... 103
3
2.1.1. Darstellung... 103
2.1.1.1. Foreign Military Financing ... 103
2.1.1.1.1. Central East European Defense Loan Fund ... 104
2.1.1.1.2. Defense Export Loan Guarantee Program ... 105
2.1.1.2. Export-Import Bank... 106
2.1.1.3. Excess Defense Articles... 106
2.1.1.4.. Leasing ... 107
2.1.1.5. Offsets ... 108
2.1.2. Bewertung der Finanzierungsmöglichkeiten... 110
2.2. Institutionen und Organisationen... 111
2.2.1. Darstellung... 111
2.2.2. Bewertung des Einflusses ... 113
3. Lobbyaktivitäten der Rüstungsindustrie in den U.S.A... 114
3.1. Darstellung ... 114
3.1.1.
Fallbeispiel: U.S. Committee to Expand NATO... 114
3.1.2.
Wahlkampfunterstützung... 119
3.1.3.
Einfluß auf den U.S. Kongreß ... 121
3.2. Bewertung der Aktivitäten... 122
4. Rüstungs- und Regierungsaktivitäten in Ostmitteleuropa ... 123
4.1. Darstellung ... 123
4.1.1. Flugzeughandel... 125
4.1.2. Air Shows ... 129
4.1.3. Fallbeispiel Rumänien ... 130
4.2. Bewertung der Aktivitäten... 132
5.
Bewertung der Aktivitäten des militärisch-industriellen Komplexes... 133
FÜNFTES KAPITEL: ZUSAMMENFASSUNG UND ERGEBNIS... 137
LITERATUR- UND QUELLENVERZEICHNIS... 141
Buchveröffentlichungen ... 141
Zeitungen/Zeitschriften/Journale... 143
Dokumente ... 148
Interviews... 149
Pressemitteilungen... 149
Senatsanhörungen ... 150
Vorträge ... 150
Internet ... 150
4
Vorwort
Die Aktualität des Themas `Amerikanische Interest-Groups und die NATO-Osterweiterung'
und die damit einhergehende mangelnde Sekundärliteratur verlangten in der Vorgehensweise
der Recherche sowohl einen jeweils acht-wöchigen Forschungsaufenthalt in Brüssel am
NATO-Hauptquartier als auch in Washington D.C.. Die dabei gewonnenen Erkenntnisse, mit
denen sich der bisher unbehandelte Einflußverlauf von Interessenverbänden auf die amerika-
nische Erweiterungsdiskussion rekonstruieren ließ, stammen in erster Linie aus zahlreichen
Interviews mit Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Politik und Medien, gestützt durch Zeitungs-
recherchen der jeweiligen Zeitspannen.
Ohne die hilfreiche Unterstützung vieler Personen wäre dieses umfangreiche Vorhaben nicht
zu bewältigen gewesen. Mein besonderer Dank gilt daher den Mitarbeitern des internationalen
Stabes in Brüssel am NATO-Hauptquartier, die mir nicht nur die Hintergründe zur NATO-
Osterweiterung erläuterten, sondern auch, zusammen mit einzelnen amerikanischen Rü-
stungslobbyisten in Brüssel, zu Kontakten mit zahlreichen Interviewpartnern in Washington
D.C. und New York City verhalfen.
Die Bereitschaft dieser Interviewpartner,
1
ihr persönliches, zum Teil sehr umfassendes Wissen
um und über die innen- als auch außenpolitischen Hintergünde der Erweiterungsdiskussion in
den Vereinigten Staaten mitzuteilen und zur Verfügung zu stellen, war von außerordentlichem
Wert für die Erkenntisse zu diesem Thema. Mein ganz besonderer Dank gilt dabei dem Polish
American Congress, der mir zudem zur Rekonstruktion seiner Aktivitäten einen Großteil sei-
nes Schriftverkehrs mit politischen Mandatsträgern als auch mit seinen Mitgliedern zur Bear-
beitung überließ.
Schließlich möchte ich auch meinen Eltern, Felicitias und Claus-Peter Müller, dafür danken,
mir diesen sowohl erkenntnisreichen als auch spannenden Aufenthalt in Belgien und den
U.S.A. durch ihre Unterstützung ermöglicht zu haben.
Anmerkung: Aufgrund eines Herstellerfehlers im Textverarbeitungsprogramm kann es in Ausnahmefällen vor-
kommen, daß die Angaben zu Fußnoten erst auf der folgenden Seite erscheinen.
1
Einige Interviewpartner werden auf ihren Wunsch hin namentlich nicht genannt. Die Namen liegen dem Verfas-
ser vor.
5
Erstes Kapitel: Das Anliegen der Arbeit
Nach dem Epochenwandel in Europa zu Beginn dieses Jahrzehnts gehört die im Juli 1997 von
den Staats- und Regierungschefs in Madrid beschlossene Erweiterung der NATO um Polen,
Tschechien und Ungarn zweifellos zu den wichtigsten Ereignissen in der euroatlantischen
Sicherheitspolitik seit dem Ende des Kalten Krieges. Nur wenige Jahre nach dem Fall der
Berliner Mauer, der Selbstauflösung des Warschauer Paktes und dem Zusammenbruch der
Sowjetunion öffnete sich die NATO den Kernländern Ostmitteleuropas. Somit wurde die
transatlantische Sicherheitsgemeinschaft erstmals auf Länder des ehemaligen Warschauer
Paktes ausgedehnt, der bislang begrenzte Raum von Sicherheit, Stabilität und Demokratie
über Deutschland nach Osten hin ausgeweitet. Am 12. März 1999 überreichten die Außenmi-
nister Polens, Ungarns und der Tschechischen Republik in Independence (MI), wo knapp 50
Jahre vorher Präsident Truman die Gründung der NATO bekanntgab, während einer feierli-
chen Zeremonie ihre Beitrittsurkunden. Auf dem NATO-Gipfeltreffen am 24. April 1999 in
Washington D.C. wird diese erste Erweiterung des Mitgliederkreises der NATO seit dem
Beitritt Spaniens 1982 feierlich bestätigt werden.
Fällt der Begriff NATO, so wird er in erster Linie mit Soldaten, Panzern oder auch mit den
Fernsehbildern der regelmäßigen Treffen von Staats- und Regierungschefs sowie den Vertei-
digungsministern der Bündnispartner assoziiert. Die Nordatlantische Allianz ist aber weitaus
vielschichtiger. Hinter dieser eher vordergründigen Kulisse verbirgt sich ein äußerst komple-
xer Apparat, der sowohl militärische als auch wirtschaftliche und politische Aspekte beinhal-
tet und miteinander verbindet. Von den 16 Mitgliedsstaaten wird gefordert, diese militäri-
schen, wirtschaftlichen und politischen Entwicklungen gemeinsam zu erfassen und zu beur-
teilen, sie zu bearbeiten und ihnen gegebenenfalls auch geschlossen entgegenzutreten. Der
hierfür benötigte Konsens bedeutet aber nicht nur die Entscheidungsfindung zwischen den
Bündnispartnern auf der außenpolitischen Ebene. Es erfordert auch die innenpolitische Aus-
einandersetzung mit seinen Problemen in den jeweiligen Mitgliedsländern. Wie sieht diese
innenpolitische Auseinandersetzung aus? Wer versucht dabei seinen Einfluß geltend zu ma-
chen? Wie wird dieser Einfluß geltend gemacht? Und wo liegen tiefer gründende Interessen?
6
A. Untersuchungsgegenstand
Die vorliegende Arbeit wird untersuchen, welche Institutionen mit welchen Mitteln in den
Vereinigten Staaten durch gezielte Interessenvertretung versuchen, politische Entscheidungs-
träger für ihre Ziele zu gewinnen. Dabei bietet es sich an, die Arbeitsweise amerikanischer
Interest-Groups am Beispiel der NATO-Osterweiterung darzustellen. Die Thematik ermög-
licht die Analyse eines Feldes der Außenpolitik vor dem Hintergrund nationaler Interessen. Im
Mittelpunkt der Arbeit stehen daher die Bemühungen von Interessenverbänden um die Er-
weiterung der Nordatlantischen Allianz. Dabei soll der Zusammenhang bzw. das gegenseitige
Abhängigkeitsverhältnis zwischen einzelnen amerikanischen Interessenverbänden auf der ei-
nen Seite und Exekutive und Legislative auf der anderen Seite untersucht werden. Ziel der
Arbeit ist es, die unterschiedlichen Kräfte verschiedender Interessen aufzuzeigen, die ihren
Einfluß in der Erweiterungsdebatte geltend gemacht haben.
1. Abgrenzung
Da sich viele, voneinander unabhängige Interessen an der amerikanischen Erweiterungsde-
batte beteiligt haben, ist der Rahmen dieser Untersuchung äußerst komplex. Eine vollständige
Darstellung aller beteiligten Interessenverbände würde daher den Rahmen der Untersuchung
überschreiten. Aus diesem Grund soll der Einfluß amerikanischer Interest-Groups auf die
amerikanische Erweiterungsdiskussion beispielhaft am militärisch-industriellen Komplex und
den Interessen des Polish American Congress, stellvertretend für die in den USA lebenden
ethnischen Minderheiten, dargestellt werden.
Sowohl die Rüstungslobby als auch das Interesse ethnischer Minderheiten wurden als Bei-
spiele gewählt, da sie einerseits maßgeblichen Einfluß auf die Erweiterungsdebatte geltend
machen konnten, andererseits ihr Engagement unterschiedlicher Natur waren. So können so-
wohl die unterschiedlichen Arten der Organisation und Einflußnahme als auch etwaige Ge-
meinsamkeiten deutlich dargestellt werden.
2. Die Messung von Einfluß
Die Messung von Einfluß erweist sich als äußerst schwierig, denn der Erfolg von Interest-
Groups wird gewöhnlich nach Erkenntnisinteresse oder Forschungsansatz unterschiedlich
7
gemessen. Demnach existieren verschiedene Maße für Einfluß, der auch ohne konkrete Ak-
tionen oder Forderungen von Interessenverbänden vorliegen kann.
2
Denn politischer Druck ist
nur eine Form des Einflusses, und Einflußnahme ist wiederum nur eine Form von Aktivität.
An Bedeutung gewinnt daher die Frage, ob zwischen dem Einfluß einzelner Gruppen und den
angenommenen Erfolgen eine Kausalität besteht, oder ob es sich um zufällige Korrelationen
handelt. Dabei ist eine wenig zufriedenstellende Erkenntnis, daß der Einfluß je nach Gruppe,
Zeitpunkt, Politiker, Gegendruck etc. variiert.
3
Eine Messung wird besonders dann erschwert,
wenn die Arbeit der Gruppen eher langfristig angelegt ist oder nur Teilerfolge erzielt werden.
Festgestellt werden kann aber in den meisten Fällen, ob eine bestimmte Gruppe in ihrem Ein-
fluß anderen Gruppen gegenüber eine eher dominierende oder eine eher untergeordnete Rolle
spielt.
Als Hilfsgröße für die Quantifizierung von Erfolg bietet sich eine Untersuchung der Faktoren
an, die zum potentiellen Einfluß einer Gruppe beitragen. Das Ergebnis äußerst sich als Netz-
werk voneinander abhängiger Faktoren. Diese Faktoren spielen eine wichtige Rolle bei der
Einflußnahme unterschiedlicher Gruppen auf den Meinungsbildungsprozeß. Des weiteren
dienen sie Politikern zur generellen Einschätzung der Gruppenmacht. Zu diesen Faktoren ge-
hören z.B. Merkmale der Mitglieder, ihre Ressourcen oder die Unterstützung durch Massen-
medien.
4
Da aber auch Einflußpotential noch nichts über tatsächlichen Einfluß aussagt, kann nur davon
gesprochen werden, wenn die Entscheidungsgremien (z.B. Abgeordnete) die Position der Inte-
rest-Groups oder Lobbyisten anderer vorziehen und dies wiederum das Ergebnis einer Ent-
scheidung mitbewirkt. Dies wird in der vorliegenden Arbeit zu untersuchen sein.
2
BACHRACH, Peter und Morton S. BARATZ, in: BRINKMANN, Heinz-Ulrich: Public Interest Groups im
politischen System der USA. Opladen: Leske Verlag + Budrich GmbH, 1984.
3
KEY, Valdemir O.: Politics, Parties, and Pressure Groups. New York: Thomas Y. Crowell Company, 1969 (5.
Aufl.). S. 138.
4
TRUMAN, David B.: The Governmental Process. New York: Alfred A. Knopf, 1971 (2. Aufl.) S. 506 f.. Vgl.
auch die Pfadanalyse in: DYE, Thomas R.: Policy Analysis: what Governments do, why they do it, and what
difference it makes. Birmingham: University of Alabama, 1978. S. 79-94.
8
3. Fragestellungen
Ziel dieser Arbeit ist die Untersuchung des Einflusses von Interest-Groups auf den politischen
Prozeß der USA. Dabei sollen der Einfluß von Rüstungsinteressen und die Interessen ethni-
scher Minderheiten in den Vereinigten Staaten am Beispiel der NATO-Osterweiterung unter-
sucht werden. Die kennzeichnenden Gegebenheiten des politischen Systems Amerikas lassen
dabei folgende Fragen in den Vordergrund treten:
a)
Die wirtschaftlichen und ethnischen Einzelinteressen sind im amerikanischen
politischen Prozeß aus strukturellen Gründen weitaus größer und einflußreicher
als in anderen westlichen Demokratien. Was sind die strukturellen Gründe, und
wie werden sie erfolgreich genutzt?
b)
Aufgrund der geringen politischen Eigenheiten der Parteien und der deutlichen
Gewaltenteilung im Kongreß haben Interest-Groups in den Vereinigten Staaten
weitaus größere Erfolgschancen als in Westeuropa. Welche Prozesse laufen
dabei ab, und wie können sie am besten umschrieben werden?
c)
Die NATO-Osterweiterung berührte zum Teil Interessen, die nicht im Vorder-
grund der außenpolitische Agenda stehen. Um was für Interessen handelte es
sich, und wie machten sie sich bemerkbar?
Anhand dieser Fragestellung wird zu zeigen sein, daß das Tandem aus ethnischen Lobbies und
Rüstungslobby zusammen mit noch weiteren darzustellenden Interessenverbänden in der
NATO-Osterweiterungsforderung in den Vereinigten Staaten erfolgreich war.
9
Zweites Kapitel: Übersicht
A. Die amerikanischen Interest-Groups und ihre Arbeitsbereiche und Organi-
sations-formen
1. Begriffsdefinition und Arten von Interest-Groups
Bei der Verwendung des Begriffs `Interest-Groups' besteht Klärungsbedarf in der Definition
der Terminologie. Organisationen, die in Aktivitäten zur Beeinflussung des politischen Pro-
zesses verwickelt waren, sind in den letzten Jahren aufs unterschiedlichste benannt worden.
Leider gibt es bisher noch keine zufriedenstellende Typologie amerikanischer Interessenver-
bände, die sowohl alle unterschiedlichen Größen, Strukturen, Ideologien und Arbeitsmethoden
beinhaltet.
5
In einer Untersuchung von Interessenverbänden identifizierten Richard Kimber
und Jeremy J. Richardson
6
über 20 unterschiedliche Bezeichnungen für das selbe Phänomen,
u.a: Political Group, Lobby, Voluntary Association, Pressure Group, Protective Group, De-
fensive Group, Anomic Group, Institutional Group, Associational Group, Non-associational
Group, Formal-role Group, Exclusive Group und Political Group. Einige dieser Begriffe ha-
ben im Laufe der Zeit aufgrund populärer Zeitungsveröffentlichungen im Zusammenhang mit
dem Mißbrauch von Lobbyismus eine negative Nebenbedeutung erhalten. Zu diesen negativ
belasteten Begriffe zählen z.B. Vested Interests, Special Interests und Pressure Groups. Da
sich Politologen nicht auf einen gemeinsamen Begriff einigen konnten, ist besonders in den
Vereinigten Staaten die Literatur über Interest-Groups verwirrend. Deshalb schlagen Kimber
und Richardson bei der drastisch deutlich werdenden Bandbreite von Definitionen folgende
Begriffsbestimmung vor:
,,A pressure group [interest group] may be regarded as any group which articulates demands that
the political authorities in the political system or sub-system should make an authoritative allocati-
on."
7
5
Vgl.: KEY, Valdemir O.: Politics, Parties, and Pressure Groups. New York: Thomas Y. Crowell Company,
1969 (5. Aufl.). Kapitel 1-4.
6
KIMBER, Richard und Jeremy J. RICHARDSON: Pressure Groups. London: Dent Co., 1974. S. 1.
7
Ibid. S. 3.
10
In Anlehnung an diese Definition können sechs unterschiedliche Verbandstypen im heutigen
Amerika identifiziert werden, die ihren Einfluß auf die Politik des Staates geltend machen:
1.
Verbände von Kapital und Arbeit;
2.
Standes- und Berufsverbände;
3.
traditionelle Ein-Punkt-Organisationen;
4.
Public Interest Groups, nämlich Organisationen, die beanspruchen, im öffentli-
chen Interesse das Gemeinwohl zu vertreten;
5.
ideologische Gruppen;
6.
Interessengruppen von politischen Körperschaften des öffentlichen Rechts, die
im amerikanischen als Intergovernmental Lobbying Organization bezeichnet
werden.
8
Einen weiteren wichtigen Schritt in der Definition geht Alan Grant. Für ihn wird zum bedeu-
tenden Merkmal von Interest-Groups, daß sie eigennützig sind und somit die Interessen und
Ziele ihrer Mitglieder schützen, verteidigen und fördern.
9
2. Die Entstehung und Entwicklung des amerikanischen Verbändewesens
Die Entwicklung von Interest-Groups in den Vereinigten Staaten verlief mit unterschiedlicher
Stärke. Unter den ersten Einwanderern des frühen 17. Jahrhunderts befanden sich viele, die
ihrer Religion wegen verfolgt wurden. Sie sammelten sich in Kolonien, geordnet nach ihrer
religiösen Ausrichtung. So entstand unter katholischer Dominanz Maryland, hatten die Purita-
ner die Oberhand in Massachusetts und waren die Quäker die Gründungsväter von Pennsylva-
nia. Folglich wurden diese Kolonien die ersten Interest-Group der neuen Welt: Ihre Regierun-
gen organisierten sich entlang religiöser Richtlinien und schufen moralische und politische
Satzungen. Nachdem die neue Nation entstanden war, spiegelte sich die starke Ausrichtung
der Landwirtschaft in den ersten regionalen Gesellschaften wider. 1785 wurde z.B. `The Phil-
adelphia Society for Promoting Agriculture' gegründet, in der Benjamin Franklin aktives
Mitglied und George Washington Ehrenmitglied waren.
Eine Untersuchung der vergangenen 150 Jahre zeichnete mehrere Epochen starker Gruppen-
bildung auf, unterbrochen durch lange Abschnitte relativer Untätigkeit. David Truman argu-
mentierte daher auch, daß ,,the formation of associations tends to occur in waves."
10
James
8
Übernommen aus: LÖSCHE, Peter, in: ADAMS, Paul Willi und Ernst-Otto CZEMPIEL (Hrsg.): Die Vereinig-
ten Staaten: Interessenorganisationen. Frankfurt/New York: Campus Verlag, 1992 (Band I). S.486.
9
GRANT, Alan: The American Political Process. Brookfield: Dartmouth Publishing Company, 1994 (5. Aufl).
S. 182-183.
10
TRUMAN, S. 59.
11
Q. Wilson identifizierte drei große Epochen der Gruppenbildung in den Vereinigten Staaten
zwischen 1800 und 1945.
11
Die erste Epoche erstreckte sich von 1830 bis 1860, als sich die
ersten nationalen Organisationen in der amerikanischen Geschichte bildeten. The Young
Men's Christian Association, The Grange, The Elks und zahlreiche Abolistionist Groups bil-
deten sich in den drei Jahrzehnten vor dem Bürgerkrieg. Geprägt wurde diese Periode insbe-
sondere durch das 2
nd
Great Awakening, in dem prominente Prediger das Übel der Sklaverei
anprangerten und sich die ersten Anti-Slavery Asscoiations bildeten. Die 1880er brachten
schließlich die zweite Epoche, angeführt von den Kräften der Industrialisierung. Wirtschaftli-
che Verbände wurden gegründet, um sowohl die Arbeitgeber- als auch die Arbeitnehmerseite
zu repräsentieren (AFL, Knights of Labor und zahlreiche andere Industrieverbände). Die dritte
Epoche wurde Anfang des 20. Jahrhunderts eingeleitet und dauerte bis 1920. Während dieser
Zeit wurde eine größere Anzahl an Verbänden gegründet, etwa die Chamber of Commerce,
The National Association of Manufacturers, The American Medical Association, NAACP,
Urban League, American Farm Bureau, Farm Union, American Cancer Society und das Ame-
rican Jewish Committee.
Wilson vermutete als Ursache für die Bildung der großen Anzahl von Organisationen in der
relativ kurzen Zeitspanne zwischen 1900-1920 eine Reihe von sozialen Umständen. So trug
die enorme Entwicklung von Kommunikationssystemen dazu bei, daß sich Verbände landes-
weit organisieren konnten. Mit Beginn dieses Jahrhunderts erleichterten Eisenbahnen, Tele-
phone, Zeitungen und später auch Radios die interne Kommunikation von Interest-Groups.
Drei weitere Faktoren förderten ebenfalls deren Wachsen. Die Regierung begann Unterneh-
mensaktivitäten zu regulieren, infolge dessen sogenannte `Business Groups' gebildet wurden,
die sich gegen solche Interventionen zur Wehr setzten. Des weiteren ergab die zunehmende
Spezialisierung von Arbeitsprozessen einen Anstieg an Wirtschaftsverbänden,
12
und außer-
dem trug die massive Einwanderung zu einer gesteigerten Heterogenität der amerikanischen
Gesellschaft bei. Wilson folgerte, daß diese Kräfte die Bildung von Verbänden erleichterten,
und gab hierfür folgende, generell gehaltene Erklärung:
,,Periods of rapid and intense organizational formation are periods in which the salience of purpo-
sive incentives has sharply increased. Organizations become more numerous, when ideas become
more important. ... Widespread organizing seems always to be accompanied by numerous social
movements."
13
11
WILSON, James Q.: Political Organizations. New York: Basic Books, 1973. S. 198.
12
Vgl. auch: BERRY, Jeffrey M.: The Interest Group Society. Boston/Toronto: Simon Schuster, 1984.
S. 20 ff.
13
WILSON, James Q.: Political Organizations. New York: Basic Books, 1973. S. 59.
12
Jede dieser Perioden war deshalb auch mit sozialen Unruhen verbunden.
Obwohl Wilson in seiner Studie nur drei Epochen aufzeichnete, muß der Anstieg von Interest-
Groups in den 60'er und 70'er Jahren als vierte Epoche dazugezählt werden. Er ist größten-
teils auf den Anstieg von Ursachen-orientierten und wirtschaftlichen Verbänden zurückzufüh-
ren, der die gesteigerte Gesellschafts- und Regierungsaktivität dieser Zeit widerspiegelt. Eine
Studie fand heraus, daß die meisten aktiven Interest-Groups nach dem zweiten Weltkrieg ent-
standen und einen beachtlichen Zuwachs ab den frühen 1960ern erfuhren.
14
Außerdem haben
Interest-Groups ihre Aufmerksamkeit seit dieser Zeit vermehrt auf Washington D.C. gerich-
tet. Ziel ihres Einflusses war `to hunt where the ducks are'. Ende der 1950er Jahre unterzog
sich die politische Beteiligung einer bedeutenden Trendwende. Herkömmliche Aktivitäten wie
Wahlbeteiligung nahmen ab, und die Parteien wurden schwächer. Auf den Regierungsebenen
machte sich vermehrt der Einfluß von Bürgerinteressen bemerkbar. Besonders beeindruckend
war der starke Anwuchs von `Citizens Groups', die sich aufgrund einer gemeinsamen Idee
oder eines gemeinsamen Grundes bildeten. 1980 betrug ihr Anteil immerhin schon 1/5 aller
vertretenen Interessen in Washington D.C..
15
Indem immer mehr Bürger in Protestgruppen,
Bürgerorganisationen oder Special Interest Groups aktiv wurden, schien das amerikanische
`free-rider'-Phänomen keine unüberwindbare Hürde mehr darzustellen. Seit den späten
1970ern stabilisierte sich die Vermehrung dieser Gruppen weitgehend, und die Verbände ver-
treten inzwischen gut etabliert die Interessen von Konsumenten, Umweltschützern und ande-
ren Public-Interest-Oganisationen.
16
Aber nicht nur die Vermehrung solcher mitgliedsbedingten Interessenverbände ist gestiegen,
sondern auch die politische Aktivität anderer Interessen, wie einzelner Unternehmen,
17
Uni-
versitäten, Kirchen, Stiftungen und sog. Think Tanks. Historisch betrachtet, gaben sich solche
Gruppen durch die Interessenvertretung ihrer Handelsvereinigungen oder anderer professio-
neller Verbände zufrieden. Seit Mitte der 1960er haben sich jedoch viele dieser Institutionen
dazu entschlossen, selber in Washington D.C. vertreten zu sein. So hat sich allein zwischen
14
WALKER, Jack L.: ,,The Origins and Maintenance of Interest Groups in America". American Political Sci-
ence Review 77, Vol. 77 (Juni 1983). S. 390-406.
15
Ibid. S. 1.
16
Vgl.: SALISBURY, R. H.: ,,Interest Representation and the Dominance of Institutions". American Political
Science Review, Vol. 78 (March 1984). S. 64-77. Und: RICHARDSON, Jeremy J.: Pressure Groups. New York:
Oxford University Press, 1993. Und: GREENWALD, Carol S.: Group Power. New York: Praeger, 1977.
17
Vgl.: BAUER, Raymond, Sola de POOL und Athony L. DEXTER: American Business and Public Policy.
New York: Prentice Hall, 1964.
13
1961-1982 die Anzahl individueller Unternehmensvertretungen in Washington D.C. verzehn-
facht,
18
wovon maßgeblich Anwälte, Lobbyisten
19
und Public-Relations Unternehmen in Wa-
shington D.C. profitierten.
Von James Madison bis zur Madison Avenue haben Interest-Groups eine wichtige Rolle in
der amerikanischen Politik gespielt. Wenn sie mit ihren speziellen Interessen aber nichts Neu-
es in der amerikanischen Geschichte darstellen, so kann trotzdem die Frage gestellt werden,
ob die Interest-Groups nicht in der jüngeren Vergangenheit einigen fundamentalen Verände-
rungen unterlagen? Dazu ließen sich zählen:
1.
Ein überproportionaler Anstieg von Interest-Groups seit den frühen 1960ern.
2.
die Zentralisierung ihrer Hauptquartiere in Washington D.C und nicht in
New York City oder anderen großen Städten.
3.
bedeutende technische Entwicklungen im Verarbeitungsprozeß von Infor-
mationen, die hochentwickelte, zeitgerechte und spezialisierte Kommunika-
tionsstrategien umsetzen.
4.
der Anstieg sog. Single-Issue Groups.
5.
Veränderungen der Wahlkampffinanzierungsgesetze von 1971 und 1974,
der andauernde Anstieg von Political Actions Committees (PAC's) sowie
die Zunahme von unabhängigen Wahlkampfausgaben einzelner Interessen-
verbände und Personen.
6.
die kontinuierliche Abnahme an Möglichkeiten von Parteien, wichtige
wahlabhängige und politische Entscheidungen unabhängig von äußeren Ein-
flüssen zu treffen.
7.
die zunehmende Anzahl von Public-Interest-Groups wie Common Cause.
8.
die wachsende Zahl von Aktivitäten und der gesteigerte Einfluß von Institu-
tionen wie Universitäten, wirtschaftlichen Unternehmen, Stadt- und Länder-
regierungen und ausländischer Interessen.
20
3. Das Selbstverständnis
Sowohl Politiker als auch Wissenschaftler haben übereinstimmend festgestellt, daß Interest-
Groups ein selbstverständliches Phänomen in Demokratien darstellen. Hierzu schrieb James
Madison in den `Federalist Papers':
18
Vgl.: COLGATE, George (Hrsg.): National Trade and Professional Associations of the United States 1982.
Washington D.C.: Columbia Books, 1984.
19
Zur Arbeitsweise von Lobbyisten vgl.: MILBARTH, Lester: The Washington Lobbyists. Chicago: Rand
McNally, 1963.
20
Vgl.: SCHLOZMAN, Kay L. und John T. TIERNEY: ,,More of the Same: Washington Pressure Group Activity
in a Decade of Change" Journal of Politics, Vol. 45 (Mai 1988). S. 351-377.
14
,,The causes of faction ... are sown in the nature of man ... . By a faction I understand a number of
citizens, whether amounting to a majority or minority of the whole, who are united and actuated by
some common impulse of passion, or of interest, adverse to the rights of other citizens, or to the
permanent and aggregate interests of the community."
21
Die großen Unterschiede in der Meinung von Bürgern eines Landes sind die wesentliche Vor-
aussetzung für die Entwicklung von Interest-Groups. Die amerikanische Kultur sowie die
verfassungsrechtlichen Anforderungen an die Regierung haben dazu beigetragen, daß Interest-
Groups ihre heutige Stärke erreichten. Dies ist sowohl auf die zunächst offene Einwande-
rungspolitik der Vereinigen Staaten zurückzuführen, die den `melting-pott' mit seinen ethni-
schen und religiösen Wurzeln entstehen ließ, als auch auf die scharfen Gegensätze der vorre-
volutionären Zeit, als Landinteressen mit kommerziellen Interessen konkurrierten, Gläubiger-
und Schuldnerklassen entstanden, sich Küstenbewohner von den Hinterländlern unterschieden
und die Gegensätze von Tory- und Whig-Präferenzen aufeinander stießen.
Auch die amerikanische Verfassung trägt ihren Teil zur Stärke von Interest-Groups bei. Die
Grundrechte heutiger Demokratien sind ein angelsächsisches Erbe, in das Landesrecht bereits
von Henry II (1154-1189) eingebracht und seit 1214 fest verwurzelt in der Magna Carta. Vor
diesem Hintergrund finden Interest-Groups die Grundlage ihres Wirkens im ersten Zusatzar-
tikel von 1791 zur amerikanischen Verfassung verankert. Dieser lautet:
,,Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exerci-
se thereof; or abridging the freedom of speech, or of the press; or the right of the people peacea-
bly to assemble, and to petition the Government for a redress of grievances."
22
Das verfassungsrechtlich verankerte Petitionsrecht verleiht amerikanischen Interest-Groups
und ihren Lobbyisten in Washington D.C. und in den einzelnen Bundesstaaten ihre Existenz-
berechtigung. Dabei werden unterschiedliche Techniken
23
angewandt, um von diesem Recht
Gebrauch zu machen. So sprechen Unternehmen für ihre Aktionäre, Gewerkschaften für ihre
Arbeiter und Verbände für ihre Mitglieder. Von diesem Standpunkt aus betrachtet verleiht die
Verfassung auch Interest-Groups das Recht, über ihre Lobbyisten die Interessen ihrer Mitglie-
der gegenüber der Regierung zu vertreten.
21
MADISON, James, Alexander HAMILTON und John JAY: The Federalist Papers. Harmondsworth: Penguin
Books, 1987. S. 123.
22
Ibid. S. 500. Hervorhebung durch Verfasser.
23
Vgl.: Anhang 1: ,,Percentage of Groups Using each Lobby Technique to Exercise Influence". Und: Anhang 2:
,,How Interest Groups Influence Congress".
15
Die amerikanische Neigung, sich zur Verwirklichung eines Ziels in Gruppen zusammenzu-
schließen, ist ein Merkmal amerikanischer Politik geworden. 1963 untersuchten Gabriel Al-
mond und Sidney Verba zur Unterstützung dieser These in einer vergleichenden Studie die
politische Kultur der Vereinigten Staaten und Großbritanniens sowie West-Deutschlands, Ita-
liens und Mexikos. 57% der befragten Amerikaner gaben an, Mitglied eines Verbandes zu
sein. In Großbritannien waren es hingegen nur 47%, in Deutschland 44%, in Italien 29% und
in Mexiko 25%.
24
Spezifizierend gaben 25% der befragten Amerikaner an, Mitglied in einer
Organisation zu sein, die in das politische Geschehen involviert ist. In Italien beantworteten
lediglich 6% diese Frage befürwortend. Des weiteren gab ein Drittel der befragten Amerikaner
an, mehr als einer Organisation anzugehören. Das ist doppelt soviel wie in Großbritannien (an
zweiter Stelle rangierend) und 16 mal soviel wie in Mexiko.
25
Die kulturellen Werte Amerikas
mögen diese Entwicklung wohl erheblich unterstützt haben. Wie der französische Aristokrat
Alexis de Tocqueville bemerkte, fördern Werte wie Individualismus und die Notwendigkeit
persönlicher Leistung die Neigung von Bürgern, sich Gruppen anzuschließen.
26
Außerdem
trägt die große Anzahl an Zugangsmöglichkeiten auf lokaler, staatlicher und nationaler Ebene
dazu bei, daß Amerikaner einen starken Sinn für politische Effizienz entwickelt haben.
27
4. Die Rolle im politischen System der U.S.A.
Die Ausübung von Einfluß ist eines der am schwersten zu verstehenden Phänomene des ame-
rikanischen politischen Prozesses. Kein vergleichbares politisches System unterliegt soviel
äußerem Druck wie das der USA, und schon im frühen 19. Jahrhundert stellte Alexis de
Tocqueville fest:
,,Better use has been made of association and this powerful instrument of action has been applied
to more varied aims in America than anywhere else in the world."
28
Was schon damals für den europäischen Besucher offensichtlich war, hat auch heute nicht
seine Kraft als politischer Einflußfaktor verloren. Eine der entscheidendsten Ursachen hierfür
liegt in der großen Anzahl an Interest-Groups, die das amerikanische politische System prä-
gen. Das politische System liefert im Gegenzug die notwendigen Rahmenbedingungen. Nicht
24
ALMOND, Gabriel und Sidney VERBA: Civic Culture. Boston: Little, Brown, 1963. S. 246.
25
Ibid.: S. 264.
26
Vgl.: Anhang 3: ,,Types of Organizations and Nature of Affiliation".
27
. ALMOND, Gabriel und Sidney VERBA: Civic Culture. Boston: Little, Brown, 1963. Kapitel 8 und 10. Zu
den unterschiedlichen Einflußmöglichkeiten vgl. Anhang 1.
28
TOCQUEVILLE, A. de: Democracy in America. New York: Mentor, 1956. S. 229.
16
ohne Grund werden sie auch oft als das `Dritte Haus' der Legislative beschrieben. Zusammen
mit dem Senat und dem Repräsentantenhaus haben Interest-Groups eine wichtige Bedeutung
auf dem Weg einer Gesetzesvorlage. Schon de Tocqueville schrieb über ihre Beteiligung am
politischen Prozeß:
,,Whenever at the head of some new undertaking you see government in France, or a man of rank
in England, in the United States you will be sure to find an association. ... In no country in the
world has the principle of association been more successfully used, or applied to a greater multitu-
de of objects, than in America. ... Societies are formed to resist evils which are exclusively of a
moral nature, as to diminish the vice of intemperance. In the United States, associations are esta-
blished to promote public saftey, commerce, industry, morality and justice."
29
4.1. Die Vielfalt der amerikanischen Gesellschaft und die politische Kultur
Die amerikanische Gesellschaft ist durch eine reiche soziale Vielfalt geprägt. Die vielen ethni-
schen und nationalen Hintergründe der Bevölkerung, die unterschiedlichen Interessen der Re-
gionen und die Komplexität der Wirtschaft haben dazu beigetragen, daß die Vereinigten
Staaten zum bevorzugten Nährboden miteinander konkurrierender Interessen geworden sind.
Seit de Tocqueville sein Werk `Democracy in America' geschrieben hatte, wurden die USA
von verschiedenen Phasen der Einwanderung, einem unglaublichen Zuwachs an Land und der
Entwicklung von einer einfachen Agrargesellschaft hin zu einer kompliziert strukturierten,
industriellen und technologischen Nation geprägt. Mit einer größeren Arbeitsteilung und wirt-
schaftlichen Spezialisierung sowie dem regulierendem staatlichen Eingriff ist die Anzahl und
Vielfalt von Gruppen gestiegen, die ihre Interessen schützen wollen.
Die amerikanische politische Kultur hat den Anwuchs von Interest-Groups durch das prinzi-
pielle Recht der freien Meinungsäußerung gefördert. Die Garantie der freien Meinungsäuße-
rung und der Versammlungsfreiheit waren und sind für die Entwicklung der Gruppen von
enormer Bedeutung und ihre Anerkennung durch die amerikanische Bevölkerung findet ihren
Ursprung in der Annahme, daß Gruppen das Recht besitzen, sich Gehör zu verschaffen, so
lange sie im Rahmen der Gesetzes und der Verfassung arbeiten. Im Gegenzug findet die An-
sicht, daß diese Gruppen dem öffentlichen Interesse abträglich sind, nur geringen Zuspruch.
4.2. Die dezentralisierte Natur des politischen Systems
Die formelle Anordnung der amerikanischen Regierungsinstitutionen gibt Interest-Groups
zahlreiche Möglichkeiten, Einfluß auf den politischen Prozeß zu nehmen. Interest-Groups
29
TOCQUEVILLE, A. de: Democracy in America. New York: Mentor, 1956. S. 95-96.
17
suchen unausweichlich den Kontakt mit jenen politischen Entscheidungsträgern, die in der
Lage sind, ihre Interessen durchzusetzen. Hier bietet das dezentralisierte politische System der
USA zahlreiche Zugangsmöglichkeiten. Durch die Gewaltenteilung können Legislative, Exe-
kutive und Judikative sowie die vielen unabhängigen, regulierenden Ausschüsse und Kom-
missionen eine wichtige Rolle in bestimmten Teilen der politischen Entscheidungsfindung
spielen. Die föderative Struktur ermöglicht dabei die Annäherung an nationale oder bundes-
staatliche Behörden und lokale Regierungen. So führt die Vielzahl an offiziellen Ämtern auf
unterschiedlichsten Ebenen zu einer unvergleichbaren Größe an Zugangsmöglichkeiten, die
aber nicht alle von gleicher Bedeutung für Interest-Groups sind. Interest-Groups mit Anliegen
in Fragen der Außen- oder Rüstungspolitik wissen, daß die Mehrzahl dieser Entscheidungen
in Washington D.C. getroffen wird, und richten ihre Bemühungen daher an das Department of
Defence, an das State Department oder an diejenigen Abgeordneten, die einen Sitz im rele-
vanten Haus- oder Senatsausschuß besitzen. Interest-Groups mit Interessen bei Ausbildungs-
fragen bewegen sich hingegen eher auf bundesstaatlicher Ebene.
Offener und komplexer wurde der Gesetzgebungsprozeß durch Veränderungen in der Ar-
beitsweise des Kongresses in den 1970ern und 1980ern. Die Veröffentlichung der Protokolle
von Ausschussitzungen sowie Fernsehübertragungen aus den Sitzungen beider Kammern er-
möglichten es Interest-Groups, die Aktivitäten der Abgeordneten genauer zu überprüfen.
Auch die Verlagerung von Verantwortungsbereichen an Unterausschüsse und die Überschnei-
dung von Zuständigkeiten einzelner Ausschüsse insbesondere bei außenpolitischen Fragen
bietet ihnen einen größeren Handlungsspielraum. Diese Veränderungen haben Interest-Groups
zwar einerseits einen größeren Raum für Aktivitäten gegeben, haben aber andererseits die
Einflußnahme erheblich komplizierter und in ihrem Ergebnis weitaus unsicherer gemacht,
womit die Verteilung der Einflußaktivitäten auf eine größere Menge an Personen und Ent-
scheidungsstellen erforderlich wurde.
4.3. Die schwache Parteiführung
Ein Nebeneffekt von Gewaltenteilung und lokalisierter Politik ist, daß der Fraktionszwang
unter amerikanischen Abgeordneten weitaus schwächer ist als in parlamentarischen Regie-
rungssystemen. Abgeordnete können unabhängige Meinungen zu bestimmten politischen Fra-
gen vertreten, ohne daß die Existenz der Exekutive von ihrem Abstimmungsverhalten ab-
hängt. Diese Freiheit bedeutet aber auch, daß sie für Interest-Groups zugänglicher sind, und
18
die Abwesenheit eines wirklichen Fraktionszwanges sowie die schwache Parteiführung lassen
ein Vakuum im politischen Entscheidungsprozeß entstehen, der es Interessenverbänden er-
möglicht, auf diesen Prozeß einzuwirken.
Amerikanische Parteien sind sowohl in ihrer Organisation als auch in ihrer Fraktionsdisziplin
schwach. Die sog. `Primaries' haben der Parteiführung die Möglichkeit genommen, Kandi-
daten für bestimmte Posten zu nominieren, was die erweiterte Partizipation an Wählern be-
deutet. Die finanzielle Abhängigkeit solcher Kandidaten-zentrierten Organisationen und die
geringe Wahlbeteiligung in Primaries bieten gut organisierten Interest-Groups zahlreiche
Möglichkeiten, ihre Präsenz spüren zu lassen. Dabei wird der amerikanische Kongreß von so
vielen Seiten beeinflußt, daß die Entscheidungsfreiheit des Abgeordneten oft in Frage gestellt
zu sein scheint. Nicht selten wird daher davon gesprochen, daß Abgeordnete in Hinblick auf
eine Wiederwahl den Entscheidungen große Aufmerksamkeit widmen, die von einflußreichen
Interest-Groups ihrer Wahlkreise unterstützt werden. Die vielen Ebenen von Gruppenaktivi-
täten, gekoppelt mit den steigenden Zahlen organisierter Interessen, unterscheidet daher die
heutige Politik von Interest-Groups von den Einflußarten früherer Zeiten. Der gegenwärtige
Trend an Einflußnahme von immer besser organisierten und stärkeren Interessenverbänden
scheint die Befürchtungen des Ökonomen Theodore Lowi und des Politikwissenschaftler
Mancur Olson zu bestätigen, interessengebundene Politik würde dazu beitragen, daß sog.
Patt-Situationen in der politischen Entscheidungsfindung entstehen und die politischen Insti-
tutionen an Glaubwürdigkeit einbüßen.
30
Diese Ansicht steht im Gegensatz zu den Auffassun-
gen von James Madison und anderen frühen Gruppen-Theoretikern wie David Truman.
Der Abgeordnete im Fadenkreuz miteinander konkurrierender Interessen wurde aber schon
früher kritisiert. Feindseligkeit schlug Interessenverbänden schon vermehrt im Zeitalter ame-
rikanischer Industrialisierung entgegen. So beklagten damals viele `Progressives' die große
Anzahl an Monopolen in der Industrie und die offensichtliche Verbindung von Interessen mit
korrupten Politikern. Einige Zeit später, im Jahr 1935, schrieb Senator Hugo Black (später
Vorsitzender Richter am Obersten Gerichtshof):
30
Vgl.: LOWI, Theodore J.: The End of Liberalism. New York: Norton, 1979 (2. Auflage). Und: OLSON, Man-
cur: The Rise and Decline of Nations. New Haven: Yale University Press, 1982.
19
,,Contrary to tradition, against the public morals, and hostile to good government, the lobby has re-
ached such a position of power, that it threatens government itself. Its size, its power, its capacity
for evil, its greed, trickery, deception and fraud condemn it to the death it deserves."
31
Ähnliche Vermutungen werden heute wieder geäußert, insbesondere seitdem PACs aufgrund
der Annahme des `Campaign Reform Amendments' im Jahr 1974 einen überdurchschnittli-
chen Anstieg erfahren. PAC-Unterstützungen sind von weniger als $23 Millionen im Jahr
1975-76 auf $430 Millionen im Wahlkampfjahr 1995-96 gestiegen und somit zum beliebten
Ziel der öffentlichen Kritik geworden.
32
Ein typischer Vorwurf stammt aus dem Lager der
Public-Interest Lobby selbst, dem Common Cause:
,,The Special Interest State is a system in which interest groups dominate the making of govern-
ment policy. These interests legitimately concentrate on pursuing their own immediate -usually
economic - agendas, but in so doing they pay little attention to the impact of their agendas on the
nation as a whole."
33
Trotz des beachtlichen öffentlichen Mißtrauens gegenüber der Arbeitsweise von Interest-
Groups, haben Politikwissenschaftler und andere Beobachter diese Gruppen oft in einem an-
deren, weitaus positiveren Licht betrachtet. David Truman sah Interessenverbände eng im
Herzen politischen Geschehens verankert, umgeben von einem großen, komplexen und zu-
nehmend spezialisierten Regierungssystem. Interessenverbände sind nach seiner Meinung in
einer sich ständig verändernden Welt zu einem Element der Kontinuität geworden. Er be-
merkte ,,the multiplicity of co-ordinate or nearly co-ordinate points of access to governmental
decissions"
34
und schließt daraus:
,,The significance of these many points of access and of the complicated texture of relationsships
among them is great. This diversity assures various ways for interest groups to participate in the
formation of policy, and this variety is a flexible, stabilizing element."
35
31
ZEIGLER, Harmon L. und Wayne PEAK: Interest Groups in American Society. Englewood Cliffs: Prentice
Hall, 1972. S. 35.
32
Vgl.: LÖSCHE, Peter, in: ADAMS, Paul Willi und CZEMPIEL, Ernst-Otto (Hrsg.): Die Vereinigten Staaten:
Interessenorganisationen. Frankfurt/New York: Campus Verlag, 1992 (Band I). S:501-502.
33
COMMON CAUSE: The Government Subsidy Squeeze. Washington, D.C.: Common Cause, 1980. S. 11.
34
TRUMAN, David D.: The Governmental Process. New York: Alfred A. Knopf, 1971 (2. Aufl.). S. 519.
35
Ibid.
20
B. Die NATO-Osterweiterung
1. Gegenstand
Am 4. April 1989 feierte die NATO ihr 40-jähriges Bestehen. Das Ereignis fiel damals mit
dem Beginn fundamentaler Veränderungen im Verlauf der Ost-West Beziehungen zusammen,
die einen weitreichenden Transformationsprozeß der Sicherheitspolitik nicht nur in Europa,
sondern auf der ganzen Welt zur Folge haben sollten. Durch die Bereitstellung einer Basis
kollektiver Verteidigung und gemeinsamer Sicherheit sowie der Aufrechterhaltung eines stra-
tegischen Gleichgewichts während des Kalten Krieges, konnte durch die Nordatlantische Alli-
anz die Freiheit und Unabhängigkeit seiner 16 Mitgliedsländer über 40 Jahre hinweg gesichert
werden. In Übereinstimmung mit dem Nordatlantik Vertrag vom 4. April 1949 wird die
NATO in der Zukunft nicht nur diesen Auftrag weiterführen, sondern zusätzlich neue Aufga-
ben übernehmen. Dabei ist die NATO-Osterweiterung ein weiterer Schritt in der Strategie,
Sicherheit und Stabilität im Euro-Atlantischen Raum zu garantieren und im Rahmen der Inte-
grationspolitik auch die Erweiterung der EU und der WEU sowie die Stärkung der OSZE zu
fördern.
Es ist kaum möglich, das Ursprungsdatum der NATO-Erweiterungsdiskussion festzulegen.
36
Eine Reihe von Gründen schloß eine substantielle NATO-Erweiterungsdiskussion unmittelbar
nach der `Zeitwende' zunächst aus. Hier sind zu nennen:
1. Die Charta von Paris (1990);
2. Moskaus Einverständnis und seine Bedingungen zur deutschen Wiedervereini-
gung;
3. Maastricht' und die Einbindung des wiedervereinigten Deutschlands in den eu-
ropäischen Einigungsprozeß.
Von Einzelverlautbarungen abgesehen, setzte die eigentliche Diskussion um die NATO-
Osterweiterung 1993 ein. Die Aussagen einiger prominenter westlicher Politiker und die Ver-
öffentlichungen angesehener Strategieexperten erzeugten im Frühjahr und Sommer 1993 ei-
nen wahrnehmbaren Wandel in der politischen Atmosphäre. Als die Vereinigten Staaten im
Mai 1993 für den Januar des folgenden Jahres einen NATO-Gipfel vorschlugen, stand für
viele Beobachter fest, daß es nur ein `Erweiterungsgipfel' sein konnte. Ein erster Schritt war
36
Vgl.: FOUZIEH, Melanie E. und August PRADETTO: Osteuropa und die Erweiterung der NATO: Identitäts-
suche als Motiv für Sicherheitspolitik. Hamburg, 1997. S. 11.
21
die Verabschiedung des Programms `Partnerschaft für den Frieden', und die Erklärung der
prinzipiellen Bereitschaft zur Aufnahme neuer Mitglieder
Das westliche Bündnis hatte sich seit Anfang 1994 mit zunehmender Eindeutigkeit auf die
Öffnung der NATO nach Osten festgelegt, und im Jahr 1995 beherrschte nach der Erörterung
des `warum und wie' die `NATO-Erweiterungs-Studie' den Schwerpunkt der Diskussion. In
dieser Grundlagenstudie wurden alle wesentlichen Fragen erörtert. Die Kritierien, die von
allen sich bewerbenden Staaten erfüllt werden mußten, nannte der amerikanische Verteidi-
gungsminister William Perry im November 1995 bei seinem Besuch in Estland:
1. demokratische Strukturen;
2. zivile Kontrolle über die Streitkräfte;
3. militärische Ausbildung nach NATO-Normen;
4. Marktwirtschaft;
5. gute Beziehungen zu den Nachbarländern.
Das darauffolgende Jahr stand im Zeichen der sogenannten `individuellen Dialoge' mit inter-
essierten Staaten, und am Ende des Jahres 1996 beschlossen die NATO-Außenminister, auf
einem Gipfel in Madrid 8.-9. Juli 1997, die ersten Kandidaten zu Aufnahmeverhandlungen
einzuladen. Damit wurde das Vorhaben an die einzelnen nationalen Parlamente der 16
NATO-Mitglieder zur Ratifikation weitergereicht. Am 16. und 17. Dezember 1997 unter-
zeichneten die Außenminister der 16 NATO-Staaten mit den Außenministern Polens, Ungarns
und der Tschechischen Republik in Brüssel die Beitrittsprotokolle zur Aufnahme in das
Bündnis, und am 12. März übergaben die Außenminister der drei Beitrittskandidaten die Bei-
trittsurkunden an die NATO in Indepence (MI). Die Ratifizierung der Beitrittsurkunden wird
am 5. April 1999, anläßlich des 50. Jahrestages der Gründung der NATO, in Washington D.C.
erfolgen.
2. Problematik
Obwohl alle 16 Mitglieder der Allianz gleichberechtigt sind, gibt es, wie in jeder anderen in-
ternationalen Institution auch, Länder, deren Stimmen ein weitaus größeres Gewicht tragen als
die anderer. Die Vereinigten Staaten gelten als eine der maßgeblichsten, wenn nicht sogar die
maßgeblichste Säule in der NATO, und oft wird ihre Vorgehensweise als Leitlinie für die Po-
litik kleinerer Staaten genutzt. Aus diesem Grund hatte die Stimme der Vereinigten Staaten in
der Erweiterungsdiskussion der Allianz besondere Bedeutung, die von der eigentlichen Er-
22
weiterungsinitiative bis hin zur Verabschiedung der Ratifizierungsabkommen zur Aufnahme
Polens, Ungarns und Tschechiens in die NATO deutlich wurde. Dabei standen sowohl die
Vorgehensweise der Administration als auch die Abstimmung des U.S. Senats
37
über die Er-
weiterung stets im Mittelpunkt internationaler Politikanalysen.
Es stellt sich somit die Frage nach dem Einfluß amerikanischer Interessenverbände auf Exe-
kutive und Legislative und den daraus resultierenden Auswirkungen auf die amerikanische
Außenpolitik.
C. Die Beteiligung amerikanischer Interest Groups an der NATO-
Osterweiterung
Die beteiligten Interest Groups
Die Zahl der beteiligten Interest Groups an der amerikanischen Erweiterungsdiskussion war
zwar enorm, läßt sich aber einer einfachen Gliederung zuordnen. In der Regel konnte man in
einem ersten Schritt zwischen erweiterungsbefürwortenden und -ablehnenden Verbänden un-
terscheiden. Die Gegner und Befürworter der NATO-Erweiterung in den U.S.A. waren leicht
zu erkennen: Förderer der Idee sprachen von `Enlargement', was nach behutsamer und wohl-
durchdachter Erweiterung klang; Kritiker benutzten dagegen den Begriff `Expansion'. Auf der
Seite der Gegner befanden sich besonders friedensbewegte Gruppen und Think Tanks, wobei
die stärkste Erweiterungskritik von liberalen Think Tanks wie dem Arms Trade Resource
Center , dem Center for Defense Information und der American Federation of Scientists aus-
ging. Unterstützt wurden sie von einzelnen Persönlichkeiten wie Suzan Eisenhower oder dem
konservativen Erweiterungsgegner George F. Kennan. Auf ihre Rolle wird noch im dritten
Kapitel:3.1.6.: `Die öffentliche Diskussion' eingegangen.
Auf der Seite der Befürworter befanden sich in erster Linie die ostmitteleuropäischen Interes-
senverbände, die die Erweiterung der Allianz als Notwendigkeit für die weitere erfolgreiche
Entwicklung ihrer Heimatländer betrachteten. Darauf folgten Wirtschaftsinteressen, wie die
der Rüstungsindustrie und der Versicherungsbranche, welche sich von einer erweiterten Alli-
37
Gute Zusammenfassung zur Haltung des U.S. Senats in: CAMBONE, Stephen: ,,Will the U.S. Senate endorse
23
anz neue Absatzmärkte erhofften. Als drittes folgten auf der befürwortenden Seite Verbände,
angefangen von ethnischen Verbänden wie dem American Jewish Committee, deren Bezug
zur Erweiterung auf dem ersten Blick nicht deutlich war, über Landes- und Lokalregierungen
bishin zu Veteranenverbänden. Zur eigenen Interest-Group entwickelte sich im Laufe der Er-
weiterungsdiskussion auch die Administration. Ihre Bedeutung und Vorgehensweisen werden
im dritten Kapitel 3.1.5.: `Kooperation mit anderen Verbänden' noch eingehender behandelt.
Folgender Tatbestand läßt sich bereits vorab festhalten. Auf Seiten der Erweiterungsbefür-
worter konnte zwischen Verbänden unterschieden werden, die ein direktes politisches Interes-
se (z.B. ethnische Verbände) oder wirtschaftliches Interesse (z.B. Unternehmensverbände) an
einer Vergrößerung der NATO hatten und solchen, die lediglich ein indirektes Interesse (z.B.
Veteranenverbände) hatten. Auf Seiten der Erweiterungsgegner ließ sich die Motivation hin-
gegen in politische und finanzielle Lager teilen, wobei die Übergänge fließend waren. So
hielten einige Verbände eine Erweiterung für politisch bedenklich, andere für finanziell um-
stritten, wobei das politische Lager nicht selten die finanzielle Begründung zur Unterstrei-
chung ihrer Meinung benutzte.
2. Art und Umfang der Beteiligung
Art und Umfang der beteiligten Interessen an der Erweiterungsdiskussion waren äußerst un-
terschiedlich. Am längsten, ab 1991, waren die ethnischen Interessenverbände aktiv, gefolgt
von den Rüstungsinteressen ab 1995. Während sich die ethnischen Verbände darauf konzen-
trierten, ihren Einfluß gegenüber der Administration und den Mitgliedern des Kongresses
geltend zu machen, arbeitete die Rüstungslobby vornehmlich auf dem neuen Markt in Ost-
mitteleuropa, da sie ihre Interessen aufgrund ihres permanent starken Einflusses gegenüber der
Exekutive und Legislative aus Gründen (auf die in den folgenden Kapitel noch näher einge-
gangen wird) nicht sonderlich ausweiten mußte. Die Adminstration entwickelte sich selber ab
1996 zur eigenen Interest-Group, indem sie maßgeblichen Einfluß auf den Senat zu nehmen
versuchte. Die weiteren befürwortenden Interessengruppen, wie Veteranenverbände, traten
mehrheitlich erst in der abschließenden Phase der Erweiterung ab 1997 in die Diskussion ein
und hatten eine unterstützende Wirkung.
NATO's enlargement", in: The NATO Review, (Nov.-Dez. 1997).
24
Die Erweiterungsgegner äußerten erste Kritik mit dem Einsetzen der ernsthaften internationa-
len Diskussion über eine Vergrößerung ab 1994. Dabei handelte es sich in erster Linie um die
sicherheitspolitische Kritik an einer vergrößerten Allianz in Form von Zeitungsbeiträgen und
Podiumsdiskussionen, die von Politologen und Think Tanks ausging. Diese Kritik wurde ab
1996 erweitert durch Vorwürfe gegen die Interessen der Rüstungsindustrie, die maßgeblich
von Friedensinstitutionen kam und ab 1997 größeren Umfang annahm.
D. Theoretische Grundlagen der Fallstudien
1. Die Stellung ethnischer Interest Groups in der politischen Theorie
In den 1980er wurde den politischen Aktivitäten ethnischer Interest Groups in den Vereinig-
ten Staaten besonders in Hinblick auf ihre außenpolitische Tätigkeit große Aufmerksamkeit
gewidmet. Diese vermehrte Aufmerksamkeit resultiert aus einer vorangegangen allgemeinen
Betrachtungweisen von Gruppenverhalten.
Eine erste Betrachtungsweise wurde mit Arthur F. Bentley's Veröffentlichung `The Process of
Government'
38
im Jahre 1908 ins Leben gerufen. Er organisierte systematisch die unter-
schiedlichen Theorien, die sich, aus dem liberalen Pluralismus des späten 19. Jahrhunderts
hervorgehend, mit den Tätigkeiten organisierter Gruppen und anderen weniger formellen
`Partikeln' der Politik beschäftigte. David Trumans `The Governmental Process',
39
erschienen
1951, erweiterte das Forschungsgebiet bedeutend, indem er sich sowohl mit der organisatori-
schen und politischen Dynamik solcher Gruppen beschäftigte als auch den Einfluß auf Regie-
rungsentscheidungen untersuchte und Interessenverbände als `Countervailing Forces' be-
trachtete. Interest-Groups wurden fortan als allgegenwärtiger und akzeptierter Bestandteil des
politischen Lebens verstanden.
Eine zweite Beobachtungsform der politischen Analyse trug ebenfalls zur heutigen Aufmerk-
samkeit auf die außenpolitischen Aktivitäten ethnischer Interest-Groups bei: der Einfluß or-
ganisierter Interessen auf den staatlichen außenpolitischen Entscheidungsprozeß. Elmar Eric
38
Vgl.: BENTLEY, Arthur F.: The Process of Government. Bloomington: Principia Press, 1908.
39
Vgl.: TRUMAN, David D.: The Governmental Process. New York: Alfred A. Knopf, 1971 (2. Aufl.).
25
Schattenschneiders `Politics, Pressure and the Tariff'
40
aus dem Jahr 1937 spricht die typi-
schen Sorgen dieser Zeit über den angeblichen Einfluß wirtschaftlicher Gruppierungen und
Handelsverbände auf die internationale Handelspolitik aus. Stetige Forschungen in den
1960ern weiteten den Begriff `Gruppe' schließlich von Wirtschaftsverbänden auch auf andere
Interessengruppierungen aus, die sich mit außenpolitischen Themen befaßten. Und nicht sel-
ten wurde auch in ihnen der außenpolitische Einfluß (real oder antizipiert) betont.
Hieraus ging eine dritte Beobachtungsweise in der `Gruppen'-Literatur
41
hervor, die sich mit
der vermehrten Annahme von Ethnizität als natürlicher Voraussetzung für Gruppenbildung
und organisierter politischer Einflußnahme beschäftigte. Über mehrere Jahrzehnte hinweg
wurde der Begriff Ethnizität in Verbindung mit dem politischen Leben der Vereinigten Staa-
ten gesetzt,
42
und zahllose Studien analysierten ethnische Gruppierungen auf ihren historisch-
soziologischen Kontext hin, angefangen mit den Gründen für ihre Auswanderung bis hin zur
internen politischen und organisatorischen Dynamik ihrer Verbandsstruktur.
43
Die plötzliche
Aufmerksamkeit um das ethnische Bewußtsein in den 1970ern und 1980ern verstärkte dann
das Interesse von Forschern am politischen Verhalten von Gruppen, die sich aufgrund gleicher
ethnischer Wurzeln gründeten.
44
Die Kombination dieser drei Betrachtungsformen innerhalb
der Gruppentheorie hat somit zu einer Unmenge an Literatur über den Einfluß ethnischer In-
teressenverbände auf die amerikanische Außenpolitik geführt. Diese müssen nach Mohammed
Ahrari vier Bedingungen erfüllen, um außenpolitisch erfolgreich zu arbeiten:
1)
Der Verband muß mit seiner Politik amerikanische strategische Interessen an-
sprechen;
2)
Der Verband muß einerseits in die amerikansche Gesellschaft integriert sein,
andererseits genügend Identifikationspotential zu seinem Heimatland besitzen,
um in seiner außenpolitischen Motivation ernst genommen zu werden;
3)
Vom Verband wird ein hohes Maß an politischer Aktivität gefordert;
40
Vgl.: SCHATTENSCHNEIDER, Elmar E.: Politics, Pressure, and the Tariff. Englewodd Cliffs: Prentice Hall,
1937.
41
Zur Gruppenpolitik vgl. auch: LATHAM, Edward: The Group Basis of Politics, in: EULAU, Heinz, Samuel J.
ELEDERSVELD und Morris JANOWITZ: The political Behaviour. New York: Free Press, 1956. S. 239. Und:
PARENTI, Michael: ,,Power and Pluralism: A View from the Bottom", in: Journal of Politics, Vol. 32 (1970). S.
501 ff.
42
Vgl.: GLAZER, Nathan und Daniel P. MOYNIHAN: Beyond the Melting Pot: The Negroes, Puerto Ricans,
Jews, Italians, and Irish of New York City. Cambridge: MIT Press, 1970 (2. Ausg.).
43
Vgl.: GERSON, Louis L.: The Hyphenate in Recent American Politics and Diplomacy. Lawrence: University
of Kansas Press, 1964. Und: GLAZER und MOYNIHAN. Und: GLAZER, Nathan und Young, Ken (Hrsg.):
Ethnic Pluralism and Public Policy. Toronto: Lexington Books/D.C. Heath and Company, 1983.
44
Übernommen aus: GOLDBERG, David H.: Foreign Policy and Ethnic Interest Groups. New York: Green-
wood Press, 1990.
26
4)
Der Verband muß auf politischer Ebene einheitlich agieren.
45
Bei der Behandlung des ersten Fallbeispiels, dem Polish American Congress, werden diese
Merkmale besonders deutlich und sein außenpolitischer Einfluß nachvollziehbar.
2. Die Stellung des militärisch-industriellen Komplexes in der politischen Theo-
rie
In der Regel werden die Aktivitäten und der Einfluß der Rüstungsindustrie in Zusammenhang
mit dem von C. Wright Mills begründetem Elitemodell gebracht. Dieses nimmt an, daß ver-
schiedene Interessen durch eine dominierende Interest-Group beherrscht und zum Teil über-
stimmt werden. Die enge Kooperation zwischen Staat und Rüstungsindustrie legt die Vermu-
tung nahe, daß Einfluß und Interessen des militärisch-industriellen Komplexes unkontrolliert
und geschützt vor der Außenwelt innerhalb eines `Eisernen Dreiecks'
46
ihren Weg bahnen
können und somit einen Elitecharakter annehmen.
Dieser vorherrschenden Meinung muß aber entgegengestellt werden, daß es sich bei dem mi-
litärisch-industriellen Komplex um eine Interest-Group unter vielen handelt. Seine Existenz,
seine Natur und die daraus resultierenden Konsequenzen sind eher mit dem pluralistischen
Modell als mit der Elitetheorie in Einklang zu bringen. Es wird auch deutlich, daß dieser, ob-
wohl er eine außergewöhnlich große und einflußreiche Interest-Group darstellt, nicht in einem
politischem Vakuum arbeitet. Seine Empfehlungen für Militärausgaben müssen vom Kongreß
befürwortet werden, und die Kosten müssen letztlich auch mehrheitlich von der Öffentlichkeit
toleriert werden. Die Arbeit ordnet daher den militärisch-industriellen Komplex der Grup-
pentheorie zu, weist ihm aber in dessen Rahmen eine besondere Bedeutung zu.
45
AHRARI, Mohammed E.: Ethnic Groups and Foreign Policy. New York: Greenwood Press, 1987. S. 155-
158.
46
Vgl.: Anhang 2 und Viertes Kapitel: A.1.1.2. `Das Phänomen der Revolving Door'.
27
Drittes Kapitel: Die erste Fallstudie: Der Polish American Congress
A. Struktur, Einflußformen und Entwicklung
1. Struktur
1.1. Darstellung
Der Polish American Congress schreibt über sich:
,,The Polish American Congress is a federation, an umbrella organization covering the majority of
Polish American fraternal, veteran, social, cultural, religious and other types of organizations."
47
Dieser Dachverband gliedert sich in 41 sog. `Chapters' und `Units' in 20 Bundesstaaten der
Vereinigten Staaten, denen jeweils lokale polnische Organisationen angehören. In den großen
polnisch-amerikanischen Gemeinden wie Chicago (IL) und Detroit (MI) gibt es hunderte die-
ser Organisationen oder Verbände mit zahlreichen Mitgliedern. Insgesamt wird die Zahl der
Mitgliedern jener Organisationen und Verbände, die dem Polish American Congress unterge-
ordnet sind, wird auf ca. eine Millionen geschätzt.
Die Richtlinien und Vorgehensweisen in der Politik des Polish American Congress werden
durch seinen Council of National Directors festgelegt, und durch das in Chicago ansässige
Hauptquartier in ausgeführt. Zudem unterhält ein Verbindungsbüro in Washington D.C. Kon-
takte zur Administration, dem U.S. Kongreß und wichtigen Bundesbehörden um bei Gesetz-
gebungsprozessen oder anderen wichtigen Entscheidungen die Interessen der Polonia weitest-
gehend umzusetzen.
1.2. Stärken und Schwächen der Struktur
1.2.1 Stärken
Die Struktur des Polish American Congress als Dachverband hat signifikante Vorteile:
1.
Die Polonia tritt nach außen hin geschlossen auf und beweist dadurch die Stär-
ke ihres Wählerpotentials;
48
47
Eigene Veröffentlichung des Polish American Congress: Historical Background. Ohne weiteren Angaben.
28
2.
Die Dachverbandsstruktur ermöglicht es, schneller und gezielter auf akute Er-
eignisse zu reagieren als eine große Anzahl einzelner, zum Teil voneinander
unabhängiger Organisationen und Verbände. Vorab formulierte Vorgehenswei-
sen und Standpunkte ermöglichen es der Verbandsführung beim Eintreten einer
akuten Situation schnell und ohne lange Absprachen auf die neue Situation rea-
gieren;
3.
Ausreichend finanzielle Mittel ermöglichen die Koordination der alltäglichen
Arbeit;
4.
Die Ausrichtung ist die politische Einflußnahme. Es gibt keine weiteren be-
deutenden Funktionen, denen unter Umständen höhere Priorität eingeräumt
werden müßte.
49
Die effiziente Struktur wird durch einen äußeren Umstand ergänzt, der einen bedeutenden
Pfeiler seiner Stärke bildet. Da die amerikanische Polonia keine bedeutende und organisierte
Vertretung durch Abgeordnete im amerikanischen Kongreß besitzt, fallen insbesondere au-
ßenpolitische Initiativen in den Zuständigkeitsbereich des Dachverbandes. Daher versteht sich
der Polish American Congress als das außenpolitische Sprachrohr der Polonia und seine In-
itiative zur NATO-Osterweiterung wird verständlich. Dies erfordert von den politischen Or-
ganen der Vereinigten Staaten, daß sie nicht nur die innenpolitischen Interessen des Polish
American Congress berücksichtigen, sondern auch seinen außenpolitischen Standpunkten
Beachtung schenken. Die Vorgehensweisen der politischen Organe können somit beeinflußt
werden.
1.2.2. Schwächen
Bis in die 1980er Jahre war die mangelhaft organisierte Kongreßvertretung in Bezug auf au-
ßenpolitische Initiativen eine erhebliche Schwäche des Polish American Congress. Auch der
ständige Personalmangel des Verbindungsbüros in Washington D.C. und das Versäumnis,
einen eigenen und effektiven Medienzugang entwickelt zu haben, ließen Mängel auftreten, die
nach Worten Stephen A. Garretts die Public-Relations-Aktivitäten oft zu einer ,,ethnic fire-
brigade"
50
werden ließen. Hinzu kam das Problem, daß das State Department die Ansicht
vertrat, amerikanische Interessen in Polen besser beurteilen zu können als der Polish Ameri-
can Congress, und die beiden etablierten Parteien ließen sich in ihrer Haltung zu Ostmitteleu-
48
Zum Beispiel: ,,Dear Senator: ... The Polish American Congress, an umbrella organization representing 10
million Americans of Polish heritage has for the past six years strongly advocated the enlargement of NATO."
Aus einem Brief: Polish American Congress an Kay B. Hutchinson, Senator(R-TX). 7. Juli 1997.
49
Vgl.: ZNANIECKA-LOPATA, Helena: Polish Americans. New Brunswick: Transaction Publishers, 1994 (2.
Aufl.). S. 128.
50
GARRETT, Stephen A.: From Potsdam to Poland: American PolicytToward Eastern Europe. New York:
Praeger, 1986. S. 97.
29
ropa nur zu Lippenbekenntnissen bewegen. Die Einseitigkeit dieser Schwächen führte aber
nur zu einer teilweisen Einschränkung seiner Effektivität.
Eine Reihe von Umständen und Veränderungen in den späten 1970er und frühen 1980er Jah-
ren marginalisierten diese Schwächen allerdings. Angefangen mit der Wahl Johannes Paul II.
zum Papst und der Entstehung der Solidarnosz-Bewegung, folgte die Gründung des `North
American Center for Polish Affairs' (`Studium') durch Professor Ehrenkreutz an der Univer-
sity of Michigan ,,to assist American and Canadian Polish organizations professionally in
their political activities on behalf of Poland's right of self-determination and independence."
`Studium' stellte amerikanischen Einflußgrößen und Meinungsmachern genaue Informationen
über die polnischen Umstände zur Verfügung und diente auch dem Polish American Congress
als wichtige Quelle für seine Arbeit. Das Konglomerat aus Wissen über und Sympathie für die
polnischen Ereignisse von Seiten der amerikanischen Bevölkerung ließ auch Politiker die Be-
deutung des Polish American Congress wieder erkennen. Piotr S. Wandycz beobachtete, daß
die polnisch-amerikanische Elite trotz der erwähnten Mängel erfolgreich als Vermittler zwi-
schen den Vereinigten Staaten und Polen arbeitete:
,,It is quite evident that the Polonia or its most articulate and active members constitute an im-
portant allthough far not decisive factor in American-Polish relations. Both Washington and War-
saw have on numerous occasions singled out this ethnic group as a special asset, but its potential is
not yet utilized, given the relatively narrow base of power of Polish Americans and the low degree
of political sophistication of the masses with regard to Polish needs and problems."
51
2. Einflußformen
Der Einfluß ethnischer Minderheiten auf die amerikanische Außenpolitik ist so groß, daß Ge-
orge F. Kennan in ihr nichts anderes sah als die ,,konvulsischen Reaktionen der Politiker auf
ein politisches Leben, das durch lautstarke Minoritäten beherrscht wird."
52
Die Übergänge
zwischen solchen ethnischen Minderheiten und ihren Interessenverbänden, den `Foreign Lob-
bies', sind oft fließend, und prinzipiell reicht es schon aus, daß eine Minderheit groß und ent-
schlossen genug ist, um Wahlen beeinflussen zu können. Der langjährige Senator Charles
McC. Mathias sagte zum außenpolitischen Einfluß dieser Gruppen:
,,Ethnic politics, carried as they often have been to excess, have proven harmful to the national in-
terest. ... They have generated both unnecessary animosities and illusions of common interest whe-
51
WANDYCZ, Piotr S.: The United States and Poland. Cambridge: Harvard University Press, 1969. S. 412-413.
52
KENNAN, John. F., zitiert in: CZEMPIEL, Ernst O.: Amerikanische Außenpolitik. Stuttgart: W. Kohlhammer
Verlag GmbH, 1979. S. 40.
30
re little or none exists. There are also baneful domestic effetcs: fueled as they are by passion and
strong feelings about justice and rectitude, debates relating to the interplay of the national interest
with the specific policies favored by organized ethnic groups generate fractious controversy and
bitter recrimination."
53
Mathias' Meinung stellte Melvin Small gegenüber, daß sich neben wirtschaftlichen und politi-
schen Verbänden auch ethnische Interest-Groups durchaus positiv zum außenpolitischen Pro-
zeß eines demokratischen Systems beitragen können. Voraussetzung dafür ist allerdings, daß
die eigenen Interessen dem nationalen Interesse untergeordnet werden.
54
Da dieser Maßstab in
der Praxis allerdings eher unbeachtet bleibt, muß der Nutzen dieses Einflusses kritisch beob-
achtet werden. Automatisch stellt sich im Zusammenhang zur NATO-Osterweiterung die Fra-
ge, ob sich der Polish American Congress an diese Maxime gehalten oder ob er die eigenen
Interessen den nationalen Interessen vorgezogen hat?
Die Partizipation am politischen Leben ist Interessenverbänden in Demokratien durch zwei
unterschiedliche Methoden möglich:
1.
Durch direkten oder indirekten Einfluß auf öffentliche Entscheidungsträger;
2.
Durch die Wahl eigener Mitglieder in politische Ämter.
Direkter Einfluß wird angewandt, wenn Beamte oder Politiker in ihrer Wiederwahl von der
Unterstützung des Interessenverbandes direkt abhängig sind, oder wenn sie sich offiziell für
die Interessen des Verbandes einsetzen. Indirekter Einfluß hingegen wird hingegen dann be-
nutzt, wenn mit Unterstützung anderer Gruppen die Verwirklichung eines Ziels erreicht wer-
den soll.
Obwohl die amerikanische Polonia in ihrer Vorgehensweise mit einer Kombination aus der
ersten und zweiten Methode arbeitete, lag stets ein Schwerpunkt auf dem direkten und indi-
rekten Einfluß, eigene Leute wurden hingegen nur selten in politische Ämter gewählt. Helena
Znaniecka Lopata identifizierte zwei Arten politischer Situationen, in denen direkter oder in-
direkter Einfluß von Seiten der Polonia geltend gemacht wurde. Die eine beschreibt sie als
`akut' (sich auf einen Vorfall oder ein Ereignis beziehend), die andere als `chronisch' (der
kontinuierliche Wunsch zur Veränderung einer Situation).
55
Zugängliche Einflußmöglichkei-
53
Zitiert in: KEGLEY, Charles W. und Eugene R. WITTKOPF: American Foreign Policy: Pattern and Process.
New York: St. Martin, 1987. S. 269.
54
Vgl.: SMALL, Melvin: Democracy Diplomacy: The Impact of Domestic Politics on U.S. Foreign Policy,
1789-1994. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1996. S. xvi-xvii.
55
ZNANIECKA-LOPATA, Helena: Polish Americans. New Brunswick: Transaction Publishers, 1994 (2. Aufl.).
S. 127.
31
ten sind dabei persönliche Kontakte und der Gebrauch von Massenmedien um eine breite,
nationale wie auch internationale öffentliche Meinung oder Stimmung zu erzeugen. Dabei
kam es mitunter vor, daß eine `akute' Situation während einer `chronischen' Situation auftrat,
und die `akute' Situation dazu benutzt wurde, um darauf aufmerksam zu machen, daß sie gar
nicht erst entstanden wäre, wenn die `chronische' Situation vorher beseitigt worden wäre.
Nach dieser Definition kann die NATO-Erweiterungskampagne des Polish American Con-
gress als eine `chronische' Situation beschrieben werden, die selbst aus einer vorangegange-
nen `chronischen' Situation entstanden ist. Über 40 Jahre ist Polen durch die russische Vor-
herrschaft dominiert worden. Mit dem Ende des Kalten Krieges und dem Zusammenbruch der
Sowjetunion erfüllten sich die Forderungen des Polish American Congress nach einem freien
und unabhängigen Polen, und die `chronische' Situation, während der man sich zu politi-
schem Einfluß gezwungen sah, ging zu Ende. Aus ihr heraus entstand die Forderung, das neue
Polen in die Nordatlantische Allianz einzugliedern, ein Ansinnen, das, über sieben Jahre hin-
weg, ebenfalls als `chronisch' zu bezeichnen ist. Und während dieser zweiten `chronischen'
Situation gab es zahlreiche akute Anlässe, um wiederum Einfluß geltend zu machen. Die fol-
genden Kapitel werden hierauf eingehen.
3. Entwicklung
3.1. Darstellung
3.1.1. Von Teheran bis Solidarnocz: Die Wurzeln für die Erweiterungsforderung
Sowohl die Angriffe Deutschlands und Rußlands auf Polen ab September 1939 als auch die
Errichtung eines durch die Sowjetunion kontrollierten kommunistischen Regimes in Polen
nach dem Zweiten Weltkrieg gaben der polnisch-amerikanischen Tagespolitik eine neue Be-
deutung. Abermals wurde das politische Bewußtsein der polnischen Minderheiten in den Ver-
einigten Staaten für das Heimatland geweckt, und die zweite Generation der in Amerika gebo-
renen Polen war aufgefordert, der Heimat zur Seite zu stehen. Dabei galt es festzustellen, ob
die Heimatverbundenheit der polnischen Einwanderergeneration überhaupt überlebt hatte und
an die jüngste Generation polnisch-stämmiger Amerikaner weiter vermittelt worden war.
In der Zeit zwischen den beiden Weltkriegen hatte die Identifikation gebürtiger Polen mit der
Heimat neue Gestalt angenommen. Verdeutlicht wurde diese Haltung, als sich 1934 die ame-
32
rikanische Delegation auf einem Treffen der `World Union from Abroad' weigerte, dieser
neuen Organisation im Ausland lebender Polen beizutreten. Ihre Entscheidung wurde damals
mit den Worten begründet:
,,Polonia in America is neither a Polish Colony nor a national minority, but a component part of the
great American nation, proud, however, of its Polish origin and careful to implant in the hearts of
the younger generation a love for all that is Polish."
56
Dieses Zitat wurde häufig als die `polnisch-amerikanische Unabhängigkeitserklärung' be-
zeichnet, denn sie erfolgte zu einem Zeitpunkt, als Versuche zur `Verstaatlichung' der ameri-
kanischen Polonia fehlschlugen, indem sie von äußeren Kräften wieder enger an die Heimat
gebunden werden sollte. So mobilisierte die Polonia zwar auch während des zweiten Welt-
krieges humanitäre Hilfe für seine polnischen Opfer, wies aber u.a. die Forderung ab, der
`Polish Army-in-Exile'
57
beizutreten.
58
Auch Bemühung der polnischen `Intelligentsia', Ein-
fluß auf die amerikanische Polonia über Zeitschriften wie `The Polish Review' auszuüben,
hatte keinen Erfolg. Generell war die Einsatzbereitschaft der Polonia für das Heimatland
weitaus geringer als während des Ersten Weltkrieges. Beschuldigungen wegen Vaterlandsver-
nachlässigung von Seiten der polnischen Führung führten zu Gegenbeschuldigungen der Po-
lonia und mündeten letztlich in einer Verärgerung der polnischen Gemeinde in den U.S.A..
Die ehemaligen Polen waren bereits ein zu starker Bestandteil der amerikanischen Gesell-
schaft, als daß man sie hätte wieder herauslösen können.
Ein Umdenken erfolgte erst mit Ende des Zweiten Weltkrieges. Die Gefahr einer sowjetischen
Besetzung und der drohende Verlust von Souveränität und östlicher Staatsgebiete der Heimat
veranlaßte die Führung der Polonia dazu, ihren unpolitischen Standpunkt aufzugeben. Die
Unabhängigkeit Polens vor dem Krieg hatte erheblich dazu beigetragen, die Polonia als sol-
che ab 1918 in den Vereinigten Staaten zu rechtfertigen, und die Führung der polnischen
Mittelklasse sah durch die Kriegsfolgen in Europa die Gewinne der politischen Anerkennung
als qualifizierte Minderheit der vorangegangenen zwei Jahrzehnte gefährdet. Das Treffen der
`Großen Drei' (Roosevelt, Churchill und Stalin) im Winter 1943 in Teheran machte deutlich,
daß Polen kein freies Land mehr sein sollte. Mit Rücksicht auf Stalin akzeptierte Churchill
56
SYMONOLEWICZ-SYMMONS, K.: ,,The Polish American Community - Half a Century After `The Polish
Peasant'", in: The Polish Review, Vol. 11 (Sommer 1966).
57
General Sikorski, Chief of Staff der polnischen Armee, floh während der deutschen Invasion nach England, um
sich der Exilregierung anzuschließen. Von dort aus besuchte er die Vereinigten Staaten, um junge Männer polni-
scher Abstammung für die polnische Armee gewinnen zu können. Sein Erfolg war jedoch marginal.
58
ZNANIECKA LOPATA, Helena: The Function of Voluntary Associations in an Ethnic Community: `Polo-
nia'. Chicago: University of Chicago, 1954(Ph.D. diss.). S. 80-102.
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Originalausgabe
- Erscheinungsjahr
- 1999
- ISBN (eBook)
- 9783832423681
- ISBN (Paperback)
- 9783838623689
- Dateigröße
- 2 MB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- Ludwig-Maximilians-Universität München – Amerikanische Kulturgeschichte, Amerikanistik
- Note
- 1,7
- Schlagworte
- lobby rüstungslobby interessenverbände nato-osterweiterung innen- außenpolitik
- Produktsicherheit
- Diplom.de