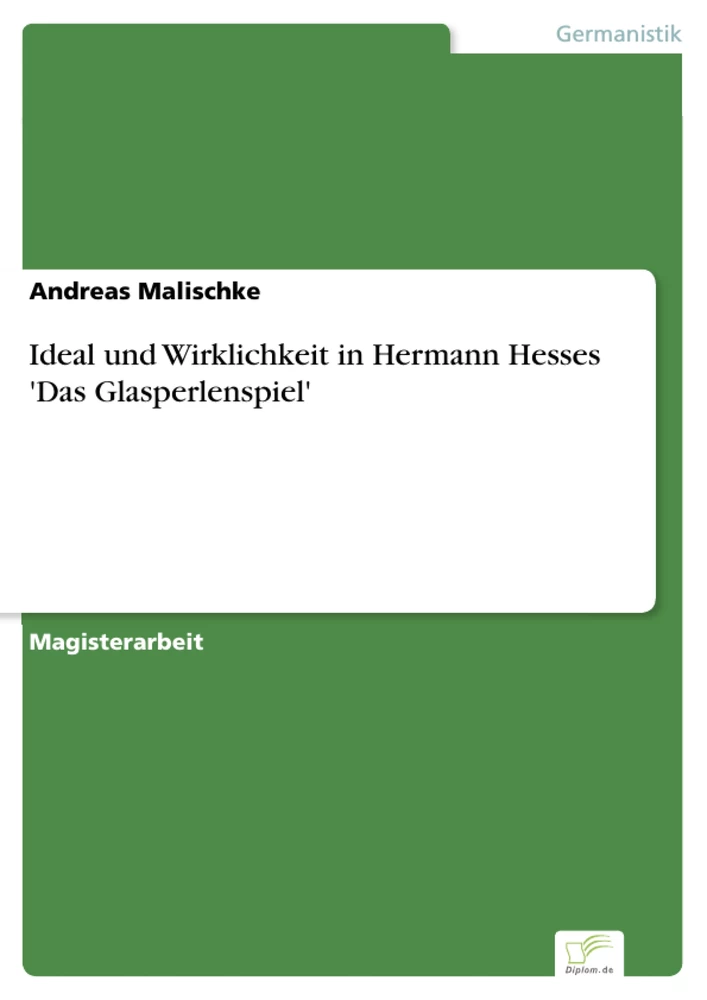Ideal und Wirklichkeit in Hermann Hesses 'Das Glasperlenspiel'
Zusammenfassung
Das zentrale Thema dieser Arbeit ist die Analyse des Weges und des Zieles der Selbstverwirklichung des Menschen. Der Leser soll verstärkt dazu angeregt werden, sich mit seinem Inneren auseinanderzusetzen. Die Kohärenz des Abendlandes und des Fernen Ostens sowie das Bedürfnis, des Europäers nach Selbstversenkung und Ruhe, was er in Ostasien zu finden glaubt, sollen aufgezeigt werden. Dies bedingt Kritik an unserer heutigen schnellebigen und oberflächlichen Zeit. Ziel dieser Arbeit ist es auch, die gemeinsame Basis aller Religionen, Kulturen und Denkformen aufzuzeigen, um die 'Widersinnigkeit des Rassismus zu unterstreichen. Da in der Forschung über das hier zu besprechende Werk Hermann Hesses die Bedeutung Chinas und Indiens für den Schriftsteller vernachlässigt wurde, sollen in dieser Arbeit vor allem auch die ostasiatischen Motive herausgearbeitet werden sollen die Biographie, das Elternhaus sowie die polilischen Ziele das Autors vorgestellt werden, um die persönlichen Motive Hesses, das Werk zu schreiben, zu verstehen. Im Anschluss an eine kurze Untersuchung sollen die drei Bedeutungen des Glasperlenspiels im Leben Knechts, der Hauptperson des Werkes, herausgearbeitet werden. Nach einer genauen Analyse des Stufen der Menschwerdung Knechtsrollen die von ihm geschriebenen Gedichte und Lebensläufe kurz behandelt werden, um die Bedeutsamkeit der Ziele die alle Menschen, unabhängig davon, in welchem Kulturkreis und in welcher Epoche sie geboren wurden, gemeinsam haben, zu unterstreichen. Abschliessend wird Hesses Idee der Weltreligion vorgestellt. Nach Ansicht des Autors besteht zwischen den verschiedenen Denk- und Lebensweisen sowie Religionen eine gemeinsame Basis und Wesensstruktur, die es erlaubt, die Grenzen der einzelnen Glaubensformen zu überwinden und eine menschliche Welt zu schaffen. Inhaltsverzeichnis:Inhaltsverzeichnis:
0.EINLEITUNG
1.DIE PERSÖNLICHKEIT DES AUTORS2
1.1Biographie2
1.2Elternhaus3
1.3Hesses Motive, das Werk zu schreiben4
1.4Politisches Engagement4
1.5Zusammenfassung5
2.FORMALE ASPEKTE DES WERKES
2.1Form und Funktion der drei Bestandteile des Werkes7
2.2Romangattung9
2.3Zusammenfassung10
3.IDEE UND ERSCHEINUNG DES GLASPERLENSPIELS12
3.1Die drei Bedeutungsformen des Glasperlenspiels12
3.1.1Das Glasperlenspiel als Erscheinung der Idee13
3.1.1.1Das Feuilletonistische Zeitalter13
3.1.1.1.1Die vier Versionen des Traktates13
3.1.1.1.2Die Entstehungsgeschichte des […]
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
INHALTSANGABE
EINLEITUNG
1 DIE PERSÖNLICHKEIT DES AUTORS
Biographie
Elternhaus
Hesses Motive, das Werk zu schreiben
Politisches Engagement
Zusammenfassung
2 FORMALE ASPEKTE DES WERKES
Form und Funktion der drei Bestandteile des Werkes
Romangattung
Zusammenfassung
3 IDEE UND ERSCHEINUNG DES GLASPERLENSPIELS
Die drei Bedeutungsformen des Glasperlenspiels
Das Glasperlenspiel als Erscheinung der Idee
Das Feuilletonistische Zeitalter
Die vier Versionen des Traktates
Die Entstehungsgeschichte des Feuilletonistischen Zeitalters
Symptome des Verfalls
Die Gegenbewegung
Der Orden Kastalien
Aufbau und Funktion
Das Glasperlenspiel
Die Entstehungsgeschichte
Aufbau und Funktion
Ideographie
Das dialektische Prinzip
Taoistische Grundlagen
Die Musik
Die Meditation
Zusammenfassung
Das Glasperlenspiel als Idee an sich
Der Morgenlandfahrer
Das Motto
Das Wesen der Idee an sich
Die Idee an sich in der abendländischen und östl. Philosophie
Das I Ging
Hegel und Schopenhauer
Zusammenfassung
Das Glasperlenspiel als Idee an sich im Menschen
Die Verknüpfung der drei Stränge
4 DAS STREBEN NACH DER IDEE AN SICH
Die drei Stufen von Knechts Lebensweg
Berufung
Begegnung mit dem Musikmeister
Der erste und zweite Grad der Berufung
Der Musikmeister als Vorbild
Begegnung mit Plinio als 3. Grad der Berufung
Synthese der Berufung als erster Grad des Erwachens
Erwachen
Studienjahre
Die Begegnung mit dem Älteren Bruder
Aufbau des I Ging
Das Orakelzeichen
Das vierte Zeichen
Das neunte Zeichen
Das sechste Zeichen
Die Begegnung als zweiter Grad des Erwachens
Die Begegnung mit Pater Jakobus
Das 56. Zeichen
Huldigung an Burckhardt
Das Wesen des Pater Jakobus
Erkenntnisse Knechts in der Synthese des Erwachens
Das Wesen Knechts
Berufung und Erwachen als Strukturglieder der Begegnung
Abschied
Die Berufung zum Magister Ludi als 1. Grad des Abschieds
Die erneute Begegnung mit Plinio als 2. Grad des Abschieds
Der Austritt aus dem Orden
Der Tod als Synthese des Abschieds und als Vollendung
Zusammenfassung
Die Gedichte
Analyse der Gedichte
Die Lebensläufe
Funktion der Lebensläufe
Der Regenmacher
Der Beichtvater
Der indische Lebenslauf
Zwei Fragmente eines weiteren Lebenslaufes
Zusammenfassung
5 HESSES IDEE DER URRELIGION
Gleiche Wesensstrukturen der Weltreligionen
Einführende Bemerkungen
Analoge Symbole für die Idee an sich
Die Analogie der drei Stufen der Menschwerdung
Zusammenfassung
Die drei Stufen der Menschwerdung in den Lebensläufen
AUSBLICK
ANMERKUNGEN
PRIMÄR- UND SEKUNDÄRLITERATUR
EINLEITUNG
Das zentrale Thema dieser Schrift ist die Analyse des Weges und des Zieles der Selbstverwirklichung des Menschen. Der Leser soll verstärkt dazu angeregt werden, sich mit seinem Inneren auseinanderzusetzen. Die Kohärenz des Abendlandes und des Fernen Ostens sowie das Bedürfnis des Europäers nach Selbstversenkung und Ruhe, was er in Ostasien zu finden glaubt, sollen aufgezeigt werden. Dies bedingt Kritik an unserer heutigen schnelllebigen und oberflächlichen Zeit. Ziel dieser Arbeit ist es auch, die gemeinsame Basis aller Religionen, Kulturen und Denkformen aufzuzeigen, um die Widersinnigkeit des Rassismus zu unterstreichen. Da in der Forschung über das hier zu besprechende Werk Hermann Hesses die Bedeutung Chinas und Indiens für den Schriftsteller vernachlässigt wurde, sollen in dieser Schrift vor allem auch die ostasiatischen Motive herausgearbeitet werden.
Zunächst sollen die Biographie, das Elternhaus sowie die politischen Ziele des Autors vorgestellt werden, um die persönlichen Motive Hesses, das Werk zu schreiben, zu verstehen. Im Anschluss an eine kurze Untersuchung sollen die drei Bedeutungen des Glasperlenspiels im Leben Knechts, der Hauptperson des Werkes, herausgearbeitet werden. Nach einer genauer Analyse der Stufen der Menschwerdung Knechts sollen die von ihm geschriebenen Gedichte und Lebensläufe kurz behandelt werden, um die Bedeutsamkeit der Ziele, die alle Menschen, unabhängig davon, in welchem Kulturkreis und in welcher Epoche sie geboren wurden, gemeinsam haben, zu unterstreichen. Abschließend wird Hesses Idee der Weltreligion vorgestellt. Nach Ansicht des Autors besteht zwischen den verschiedenen Denk- und Lebensweisen sowie Religionen eine gemeinsame Basis und Wesensstruktur, die es erlaubt, die Grenzen der einzelnen Glaubensformen zu überwinden und eine menschliche Welt zu schaffen.
1 DIE PERSÖNLICHKEIT DES AUTORS
1.1 Biographie
Hesse wurde 1877 in Calw in Württemberg geboren. Sein Vater war russischer Herkunft, seine in Ostindien geborene Mutter Tochter eines Schwaben und einer französischen Schweizerin.
Hesse wohnte während seiner ersten Lebensjahre in Basel und wurde Schweizer Staatsbürger. Später nahm er die württembergische Staatsangehörigkeit an, da er sich in Göppingen auf eine Ausbildung zum evangelischen Theologen vorbereitete. Er brach diese Ausbildung im Kloster Maulbronn ab, da er Dichter und nichts anderes werden wollte. Nach einem Selbstmordversuch im Juni 1892 hielt er sich drei Monate in der Nervenheilanstalt Stetten auf. Er machte nach einem ersten gescheiterten Versuch erneut eine Lehre als Buchhändler in Tübingen und arbeitete in den folgenden Jahren sporadisch in verschiedenen Antiquariaten und Buchhandlungen. 1911 unternahm er mit dem Maler Hans Sturzenegger eine viermonatige Reise nach Südostasien – nach Ceylon, Malaysia, Singapur und Indonesien.[1]
1916 starb sein Vater. Im gleichen Jahr begann bei seiner Frau eine Schizophrenie, die bis zu ihrem Tode andauerte. Der erste seiner drei Söhne wurde schwer krank. Hesse unterzog sich bei einem Schüler von C. G. Jung einer psychotherapeutischen Behandlung. 1919 siedelte er nach Montagnola, welches im Kanton Tessin liegt, über. 1921 machte er eine Psychoanalyse bei C. G. Jung und wurde 1924 wieder Schweizer Staatsbürger. Im gleichen Jahr heiratete er Ruth Wenger, die Tochter der Schriftstellerin Lisa Wenger; die Ehe währte jedoch nur drei Jahre. 1931 heiratete er die Kunsthistorikerin Ninon Dolbin. Während der Hitlerdiktatur wurden zahlreiche Werke Hesses verboten, so u.a. "Steppenwolf", "Narziss und Goldmund" sowie "Unterm Rad", Im Jahre 1946 erhielt Hesse den Nobelpreis. Er starb 1962 in Montagnola.[2]
1.2 Das Elternhaus
Das ganze bewegte Leben Hesses ist prinzipiell dadurch gekennzeichnet, dass er immer wieder mit verschiedenen Kulturen konfrontiert ist und sich mit ihnen auseinandersetzt.
Seine Eltern waren lange Zeit in Indien als Missionare tätig gewesen und haben sich intensiv mit der ostasiatischen Philosophie auseinandergesetzt. Sein Großvater mütterlicherseits war Indologe, sein Großvater väterlicherseits wanderte nach Indien aus. Sein Vetter W. Gundert war Japanologe.
Hesse spürte schon in frühester Kindheit die internationale Atmosphäre des Elternhauses. Das Bewusstsein der Toleranz gegenüber anderen Völkern, Kulturen und Rassen bewahrte er sein ganzes Leben.
In seiner Jugend beschäftigte er sich intensiv mit der indischen Philosophie sowie mit Schopenhauer, später dank der Übersetzungen des Sinologen R. Wilhelm und des Tübinger Professors J. Grill auch mit chinesischer Philosophie, dem Taoismus, dem Konfuzianismus und dem I Ging. Während seiner viermonatigen Reise nach Asien im Jahre 1911 lernte er die chinesische Kultur schätzen, welche er später der indischen vorzog. In "Über mein Verhältnis zum geistigen Indien und China" schreibt er:
…, verlor ich aus meinem Denken doch mehr und mehr die
Resignation und für mich bezeichnete ich diese Wendung
zuweilen als eine Wendung von Indien nach China, d.h. von
einem asketischen Denken Indiens zu dem bürgerlichen
bejahenden Denken Chinas.[3]
Sein Interesse an der den ganzheitlichen Menschen einbeziehenden Philosophie Ostasiens war ein Korrektiv für die Entpersönlichung aller Lebensbereiche in dem zivilisierten und technisierten Westen, in dem das Zweckdenken dominierte. Auch das Werk "Das Glasperlenspiel" enthält zahlreiche ostasiatische Motive, so zum Beispiel den Gedanken der Polarität und der Wandlung.
1.3 Hesses Motive, das Werk zu schreiben
"Das Glasperlenspiel" ist wie alle Werke des Autors ein Bekenntnis seines Lebens, seiner Erfahrungen und Denkweise. Er "habe schon seit Jahren den ästhetischen Ehrgeiz aufgegeben und schreibe keine Dichtung, sondern eben Bekenntnis".[5]
In dem hier zu besprechenden Werk kritisiert Hesse das sogenannte feuilletonistische Zeitalter, in dem Oberflächlichkeit, nationaler Egoismus und Krieg herrschen. Dies ist auch eine Kritik an unserer heutigen Konsumwelt.
Eine Intention des Autors ist die Überwindung nationalistischen Denkens. Seine Forderung nach menschlichem, die Trennung der Rassen überwindendem Denken drückt der Verfechter der Internationalität in seinem Werk dadurch aus, dass er in dem Glasperlenspiel des Ordens in Kastalien abendländische, indische und chinesische Kulturen vereinigt.
Hesse will in diesem Werk die über alle Räume und Zeiten stehende Dimension des ewigen Geistes als Grundlage des menschlichen Lebens verdeutlichen. Gerade auf Grund des menschenverachtenden Faschismus will er "das Reich des Geistes und der Seele als existent und unüberwindlich sichtbar machen".[6]
Der Schriftsteller vermeidet es, das Naziregime konkret anzugreifen, denn das 3. Reich
sei nur eine der zahlreichen Verirrungen des Menschen. Zudem schreibt er verschiedene Fassungen und publiziert nur die vierte, scheinbar unpolitischste, da er Angst vor einem Verbot hat.
1. 4 Politisches Engagement
Hesse stellt zwar als Dichter und Literat den Menschen in den Mittelpunkt und appelliert an den einzelnen, sich selbst von innen heraus zu ändern, aber zahlreiche Schriftstellen belegen, dass er auch politisiert und sich mit der aktuellen politischen Situation der Zeit auseinandergesetzt hat. in "Lektüre für Minuten"[7] sind zahlreiche Äußerungen zu Kommunismus und China, zur Problematik von Krieg und Frieden sowie zur Stellung des Dichters in der Gesellschaft zu finden.
Auf Grund seiner Reiseerfahrungen setzt er sich für die Dritte Welt ein. Er postuliert die Gleichberechtigung aller Völker und das Ende der Ausbeutung durch den Westen.[8]
In den ersten drei Fassungen des Traktates im Werk "Das Glasperlenspiel" politisiert Hesse stark und greift immer wieder das nationalsozialistische Regime an. Er wendet sich sowohl gegen die Gewalt und Manipulation, die während des feuilletonistischen Zeitalters herrschen, als auch gegen das rassistische Gedankengut, das die Wissenschaften beeinflusst hat.[9]
In dem dritten Entwurf des Hauptteils des Werkes aus dem Jahre 1931 sollte das Buch mit einem kämpferischen Gespräch zwischen Hitler und Josef Knecht abschließen. Thema des Gespräches ist das Verhältnis von Geist und Politik. Hitler ist bemüht, die unabhängige Institution des Glasperlenspiels dem Staat unterzuordnen und den Geist in den Dienst der Partei zu stellen. Knecht weigert sich, darauf einzugehen, und akzeptiert den Untergang des Spiels. Dieses abschließende hochpolitische Gespräch zwischen Knecht und Hitler hat Hesse aus Angst vor der Zensur in der publizierten Fassung weggelassen.[10]
1.5 Zusammenfassung
Bereits seit frühester Kindheit wird Hesse mit anderen Kulturkreisen und Denkweisen konfrontiert, da sich viele seiner Verwandten mit ostasiatischer Philosophie auseinandergesetzt haben. Zunächst beschäftigt sich der Autor mit Indien, später vorzugsweise mit China, da er die lebensbejahende, integrative Philosophie des Taoismus und Konfuzianismus der lebensverneinenden, asketischen Lebensweise der Inder vorzieht.
Die Erfahrung der internationalen Atmosphäre im Elternhaus bewirkt, dass sich Hesse für die Überwindung des nationalistischen und rassistischen Denkens einsetzt. Obwohl er vor allem den einzelnen Menschen, sein individuelles Leben und sein Bestreben nach Selbstverwirklichung, in den Vordergrund stellt, politisiert er auch. In seinem Bekenntniswerk "Das Glasperlenspiel" vermeidet es der Schriftsteller, zu stark zu politisieren und das Naziregime direkt anzugreifen, da er befürchtet, dass der Roman publiziert wird.
"Das Glasperlenspiel" ist ein Bekenntnis zu dem über den raumzeitlichen Dimensionen schwebenden immer existenten Geist.
Im folgenden sollen einige formale Aspekte sowie die Romangattung näher erläutert werden.
2 FORMALE ASPEKTE DES WERKES
2.1 Form und Funktion der drei Bestandteile des Werkes
"Das Glasperlenspiel" besteht aus drei Teilen, die sich in Form und Funktion voneinander unterscheiden: aus dem in Prosa geschriebenen Hauptteil, den Gedichten und den ebenfalls in Prosa geschriebenen Lebensläufen.
Ein Chronist erzählt im Hauptteil die Biographie Josef Knechts, wobei er sich auf Handschriften und amtliche Geheimaufzeichnungen Knechts, auf von Schülern und Freunden gemachte Nachschriften der Vorträge des Magister Ludi sowie auf Briefe und legendäre Berichte beruft. Der Bericht wird etwa um 2400 niedergeschrieben. Knecht selbst lebt um 2200.
Es handelt sich bei dem Werk um eine futuristische Utopie, einmal um die politische Brisanz des Werkes während des Nationalsozialismus und feuilletonistischen Zeitalters zu entschärfen, zum andern um mittels der Verlagerung der Forderung nach Selbstverwirklichung in die Zukunft die Überzeitlichkeit der Idee zu verdeutlichen. Hesse äußert sich in einem Brief an Rudolf Pannwitz im Januar 1955 dazu:
Ich musste, der grinsenden Gegenwart zum Trotz, das Reich des Geistes und
der Seele als existent und unüberwindlich sichtbar machen. So wurde meine
Dichtung zur Utopie, das Bild wurde in die Zukunft projiziert, die üble
Gegenwart in eine überstandene Vergangenheit gebannt.[1]
Mit Hilfe der Utopie kann Hesse zudem die gegenwärtige Situation distanzierter beurteilen.
Der Hauptteil wird mit einem Traktat eingeleitet, das dem Leser die Wahrheit, nach der jeder Mensch streben soll, in theoretischer Weise erklärt. Der Leser soll mittels des Erzählten zur Überwindung der Gegensätze des Lebens sowie zum Streben nach Einheit und Synthese geführt werden. Die Legende am Ende der Lebensbeschreibung Knechts gilt als beispielhafte und idealtypische Selbstwerdung des Menschen. Während das Traktat noch wissenschaftlich – theoretischen Charakter hat, zeigt die Legende die konkrete und lebenspraktische Realisierung der allgemeinen Ideen der Einführung.
Das Leben Knechts, des Idealtypos von Mensch, wird vor allem von Begegnungen bestimmt. Wie in Kapitel 4.1 ausführlich aufgezeigt werden soll, müssen diese Ereignisse unter dem Aspekt einer antithetischen Struktur betrachtet werden. Zwei Begegnungen führen immer zu einer Synthese, zu einer neuen Stufe im Leben Knechts.
Im Hauptteil ist ein Wendepunkt sowohl in formaler als auch in inhaltlicher Hinsicht zu konstatieren. Das Erwachen Knechts, d.h. sein Austritt aus dem Kloster, sein Wille, in der Welt lehrend tätig zu sein, seine Erfahrung der wahren Wirklichkeit, die sich nur im Innern des Menschen vollzieht, und seine Erkenntnis, dass erst die verinnerlichte Polarität von Geist und Welt der Weg zur Vollkommenheit ist, sind als der wesentlichste Wendepunkt im Roman zu betrachten.
Die Darstellung der in den Menschen verlagerten Konflikte sowie das Zurücktreten der Außenwelt zugunsten des inneren Geschehens sind wesentliche Elemente von Seelenbiographien, zu denen zahlreiche Werke Hesses große Nähe aufweisen.
In der ersten Hälfte des Hauptteils werden die ersten 25 Jahre von Knechts Leben erzählt, während die zweite Hälfte wesentlich ausführlicher 9 Jahre seines Lebens behandelt. Die Dominanz der Schlussteile, d.h. die Bedeutsamkeit von Knechts Austritts aus dem Orden sowie seiner Selbstvervollkommnung, wird in einer veränderten Raffungsintensität ausgedrückt.
Die von dem Magister Ludi während seiner Studienzeit selbst verfassten Gedichte enthalten wesentliche Ideen, die schon im vorausgehenden Hauptteil bedeutsam waren. Die Gedichte werden in Kapitel 4.3 näher untersucht.
Die Hauptpersonen in den drei Lebensläufen "Der Regenmacher", "Der Beichtvater" und "Indischer Lebenslauf" streben ebenfalls wie Knecht im ersten Lebenslauf nach Vollkommenheit, nach der Synthese von Idee und Erscheinung, was im Kapitel 4.4 näher aufgezeigt werden soll. In den Lebensläufen werden die gleichen Themen, die im ersten Lebenslauf beschrieben wurden, wiederholt bzw. variiert. Hesse will zeigen, dass die Idee an sich von der raumzeitlichen Dimension unabhängig ist.
Sowohl die Gedichte als auch die Lebensläufe haben die Funktion, die in der Lebensbeschreibung des Magister entwickelten zentralen Thesen, Themen und Gedanken zu betonen und zu variieren. [2]
2.2 Romangattung
"Das Glasperlenspiel" ist kein Bildungsroman in dem Sinne wie z.B. Goethes "Wilhelm Meister".
Die innere Entwicklung des Magister Ludi verläuft sprunghaft in Stufen und nicht organisch in Metamorphosen. Zwar wirken die Umwelt und die Menschen auf Knecht ein und lösen in ihm immer wieder Prozesse aus, die dem Hauptträger der Handlung das Ziel der Selbstverwirklichung näher kommen lassen, aber es ist nicht das Ziel des Magisters, sich in eine vorgegebene soziale Gemeinschaft zu integrieren bzw. ein bestimmtes Bildungsziel zu erreichen. Bildung ist eher als Gesamtbildung, als seelische und geistige Selbstvervollkommnung, zu verstehen.[3]
"Das Glasperlenspiel" ist eher als Entwicklungsroman, der den inneren Vorgang der Selbstwerdung aufzeigt, zu betrachten. Knecht ist kein Held wie im Bildungsroman, sondern ein sich selbst entdeckender und sich selbst verwirklichender Mensch; nicht die Welt formt ihn, sondern er sich selbst im Einklang mit seinem Schicksal.
Das Werk ist auch ein Erziehungsroman, denn Knecht als Magister Ludi bildet Repetenten im Orden aus. Wie in Kapitel 4.1.2.4 näher aufgezeigt werden soll, versteht Hesse unter Erziehung eine Verbindung von Führen und Wachsenlassen. Auf der einen Seite soll der Pädagoge den Zögling bewusst und willentlich lenken. Sowohl der Pädagoge als auch der Schüler sollen ihr Leben in den Dienst der Wahrheit stellen, die Grundpolarität aller Gegensätze erkennen sowie die Synthese von Geist und Welt erfahren. Andererseits soll sich der Lernende in der selbstständigen Auseinandersetzung mit sich und seiner Umwelt selbst entdecken und sein eigenes Schicksal erfahren.[4]
2.3 Zusammenfassung
"Das Glasperlenspiel" ist ein Entwicklungs- und Erziehungsroman, jedoch kein Bildungsroman im Sinne Goethes.
Das Traktat des Romans ist eine theoretische Einführung in die Ideenwelt Hesses. Die wichtigsten Motive im Hauptteil dieser Utopie werden in den Gedichten und Lebensläufen wiederholt und variiert, um deren Wirklichkeit zu unterstreichen. Traktat und Hauptteil werden von einem Chronisten, der sich auf zahlreiche Dokumente beruft, erzählt.
Wichtige Elemente sind die sich verändernde Raffungsintensität, die antithetische Begegnungsstruktur sowie die Wendepunktstruktur.
Das Erwachen Knechts, sein Austritt aus dem Kloster und seine Erkenntnisse, dass die Polarität von Geist und Welt in sich verinnerlichen muss, bedeutet ein Wendepunkt in seinem Leben.
Die Synthese von antithetischen Begegnungen führt Knecht zu einer neuen Stufe. Der ganze Hauptteil des Romans ist von dieser antithetischen Begegnungsstruktur gekennzeichnet.
Nachdem der Lebenslauf des Autors sowie die Einflüsse des Elternhauses auf sein späteres Schaffen, sein politisches Engagement, die Motive für das Schreiben des Werkes, die Gattung sowie formale Aspekt des Romans einführend erläutert wurden, soll im folgenden das Glasperlenspiel, d.h. sein Aufbau, Sinn und Zweck, näher untersucht werden. Dabei wird besonders darauf Wert gelegt, dass das Glasperlenspiel dreifach als Erscheinung im Orden, als Idee an sich und als Idee, die als Anlage im Menschen vorhanden ist, unterschieden wird.
3 IDEE UND ERSCHEINUNG DES GLASPERLENSPIELS
3.1 Die drei Bedeutungsformen des Glasperlenspiels
Der Titel des Buches "Das Glasperlenspiel: Versuch einer Lebensbeschreibung des Magister Ludi Josef Knecht samt Knechts hinterlassene Schriften" weist schon darauf hin, dass es sich in dem Werk um mehrere Bedeutungen und Stränge des Glasperlenspiels handelt.
Einmal ist das Glasperlenspiel eine konkrete Erscheinung im Orden Kastalien; es gilt als das Zentrum und das Herz der geistigen Elite in Waldzell; es ist ein formales und psychologisches Spiel. Das Glasperlenspiel ist aber auch als Anlage in jedem Menschen vorhanden. Knecht als vorbildliche Persönlichkeit, als Idealtypos von Mensch, hat diese Idee des Glasperlenspiels stufenweise in sich erfahren. Im antithetischen Zusammenspiel zwischen dem im Orden konkrete Erscheinung gewordenen Glasperlenspiel als Symbol der Idee und der stufenweise erfahrenen und realisierten Idee des Glasperlenspiels in Knecht als Träger der Idee entwickelt Hesse in seinem Werk die Idee des Glasperlenspiels an sich, eine Idee, die als Ursprung allen Seins gilt, die die Basis des Lebens ist, jedoch nicht expliziert definiert wird.
Im folgenden sollen die drei Bedeutungsformen des Glasperlenspiels als konkrete Erscheinung der Idee in Kastalien, als zu realisierende Anlage im Menschen, der der Träger der Idee ist, sowie als Idee an sich näher untersucht werden.
Zunächst möchte ich mich mit der Erscheinung der Idee des Glasperlenspiels in Kastalien auseinandersetzen. Dabei muss die historische Ausgangslage des Werkes, das feuilletonistische Zeitalter, das unserer heutigen Zeit entspricht, untersucht werden, um die Entstehungsgeschichte des Ordens, dessen Aufbau und Funktion untersucht werden sollen, sowie das Zentrum Kastaliens, das Glasperlenspiel, zu verstehen. Eine genaue Analyse der Struktur des Glasperlenspiels sowie des Weges, auf dem die Spieler des Ordens zu seinem Wesen gelangen, soll aufzeigen, dass die konkrete Erscheinung des Spieles ein real gewordener Ausdruck des Idee an sich ist.
3.1.1 Das Glasperlenspiel als Erscheinung der Idee
3.1.1.1 Das feuilletonistische Zeitalter
3..1.1.1.1 Die vier Versionen des Traktates
Hesse beschreibt und kritisiert vor allem im Traktat, in der 1934 entstandenen vierten, dem Leser allgemein bekannten Fassung des Werkes, das so genannte kriegerische oder feuilletonistische Zeitalter, das unser heutigen Zeit entspricht. Im Schreiben des Magister Josef Knecht an die Erziehungsbehörde, in dem der Spielmeister seinen Austritt aus dem Orden begründet, wird ebenfalls Kritik am feuilletonistischen Zeitalter geübt. Zudem sind noch die drei 1932 entstandenen Fassungen der Einleitung, die sich partiell sehr stark von der publizierten vierten Version unterscheiden, zu erwähnen.
Während Hesse in den drei zuerst geschriebenen Fassungen noch stark politisiert und das feuilletonistische Zeitalter mit dem Regime Hitlers gleichsetzt, ist in der vierten Version der konkrete historische Bezug zum Faschismus nicht mehr nachvollziehbar. In den 1932 entstandenen Versionen liegt das feuilletonistische Zeitalter zwischen 1932 und 1945. In der letzten Fassung wird dagegen die Entwicklung dieses Zeitalters vom Beginn der Reformation bis heute aufgezeigt. Ursprünglich hatte Hesse die Absicht, ein Protestsymbol gegen den Faschismus zu setzen Er äußert sich über seine Motivation, das Buch zu schreiben, wie folgt:
Es galt für mich zweierlei: einen geistigen Raum aufzubauen, in dem ich
atmen und leben könnte aller Vergiftung der Welt zum Trotz,
eine Zuflucht und Burg, und zweitens dem Widerstand des Geistes gegen die
barbarischen Mächte zum Ausdruck zu bringen ….[1]
Da jedoch in Deutschland der Nationalsozialismus wütete, ist Hesse besorgt, ob sein politisierendes Werk überhaupt gedruckt werden würde, denn die drei Versionen der Einleitung sind eine genaue Schilderung der damals herrschenden barbarischen Zustände. Hesse schreibt 1933 in seinem Tagebuch:
Da erschrak ich zunächst über die paar Seiten des Vorworts, die von heute
handeln: der geistige Zustand Deutschlands ist darin beinah haargenau
vorausgeschildert. Es liest sich wie eine soeben geschriebene Parodie
auf heute ….[2]
Der Schriftsteller zieht daraus Konsequenzen und schreibt 1934 eine weitere, zum Teil stark veränderte Fassung des Traktates. In der vierten Fassung des Werkes berichtet ein namenloser Biograph aus der Distanz des 24. Jahrhunderts auf Grund von Untersuchungen des Historikers Plinius Ziegenhals[3] über das feuilletonistische Zeitalter, dessen direkter Bezug zum Nationalsozialismus nicht mehr erkennbar ist. Der Autor ist bemüht, eine "Distanz der Knecht – Zeit zum Heute"[4] zu schaffen; er will auf Grund des Mangels an aktuellen politischen Bezügen, den die Einleitung hat, den Gegensatz zwischen der barbarischen Alltagspolitik und der wahren Wirklichkeit, die räumlich und zeitlich übergreifend ist, herausarbeiten.
3.1.1.1.2 Die Entstehungsgeschichte des Feuilletonistischen Zeitalters
In der letzten Version der Einleitung beschreibt Hesse das feuilletonistische Zeitalter als Endphase des untergehenden Abendlandes. Dieses kriegerische Zeitalter ist das Ende einer langen Säkularisierungsbewegung, die während der Reformation begann. Die Menschen wären über Jahrhunderte hinweg bemüht, sich von den Ketten der Herrschaft der Kirche und jeglicher autoritärer Normen zu befreien. Es setzte langsam eine Freiheit des Verstandes ein. Die Folgen dieser Säkularisierung des Geistes sind Haltlosigkeit, Pessimismus und Untergangsstimmung. Die Menschen haben sich eine geistige Freiheit erkämpft, ohne neue normative Bindungen zu finden. Hesse schreibt:
Die Entwicklung des geistigen Lebens in Europa scheint von dem Ausgang
des Mittelalters an zwei große Tendenzen gehabt zu haben: die Befreiung
des Denkens und Glaubens von jeglicher autoritativen Beeinflussung, also
den Kampf des sich souverän und mündig fühlenden Verstandes gegen
die Herrschaft der römischen Kirche und - andererseits – das heimliche,
aber leidenschaftliche Suchen nach einer Legitimierung dieser seiner Freiheit,
nach einer neuen, aus ihm selbst kommenden, ihm adäquaten Autorität.[5]
3.1.1.1.3 Symptome des Verfalls
Symptome dieses Krisenzeitalters sind Selbstaufgabe, Käuflichkeit und Entwürdigung des Geistes. Die Menschen stellen den Geist nicht in den Dienst der Wahrheit, wie es Hesse in seinem Werk postuliert, sondern leben oberflächlich. Sie flüchten in eine Scheinwelt. Oberflächliche Bildung und das massenhafte Konsumieren von der Zerstreuung dienendem Wissen sollen den Menschen manipulieren. Bildung ist eine Droge zur Verdrängung der den Menschen beherrschenden Ängste vor Hunger, Tod und Krieg.[6] Die Menschen hören Vorträge über Dichter, ohne je ihre Werke gelesen zu haben. Man plaudert über tausend Gegenstände und sammelt bruchstückhaft Wissen, ohne je den tieferen Sinn verstanden zu haben. Bildung hat den Charakter einer "rasch und verantwortungslos hergestellten Massenware".[7] "Über jedes Tagesereignis ergoss sich eine Flut von eifrigem Geschreibe."[8] Diese Produktionssucht ist ein Symptom für die Flucht vor den Ängsten, denen die Menschen nicht ins Auge zu schauen wagen. Das Kreuzworträtsel als ein damals sehr beliebtes Spiel ist ein Symptom für den Verfall des Geistes. Der in der Masse lebende Mensch gilt nichts mehr; er hat das Bedürfnis aufzufallen und sich von den anderen abzugrenzen.
Die Dichter sind freie Schriftsteller, die nach Literaturpreisen schielen, die den Menschen nicht mehr den Spiegel vorhalten und sie vor der Verdrängung ihrer Todesängste und deren Kompensation durch die Scheinwelt der Massenware Bildung warnen. Die Ziele der Gelehrten, der Professoren, sind rascher und leichter Gelderwerb, Ruhm und Ehre in der Öffentlichkeit, Ansehen und Lob in den Zeitungen, Luxus im materiellen Leben und Ehen mit den Töchtern der Bankiers und Fabrikanten. Auch sie beteiligen sich an der "Entwertung des Wortes"[9] und dienen in dieser schnelllebigen Zeit "den Interessen des Tages".[10]
Der Geist im feuilletonistischen Zeitalter ist nicht mehr autonom; es gibt keine Freiheit des Denkens mehr; die Wissenschaftler müssen Forschung und Lehre in den Dienst der Herrschenden stellen. Der Geist ist eine Marionette und ein Handlange für den Krieg und die Zerstörung. [11] Wenige gehen in die Opposition und weigern sich, den Geist für Macht- und Kriegszwecke missbrauchen zu lassen. Fast alle scheitern jedoch, sterben im Exil oder werden umgebracht. Die meisten Vertreter des Geistes passen sich dem Druck der Zeit an und "stellen ihre Gaben, Kenntnisse und Methoden den Machthabern zur Verfügung".[12] Sie missbrauchen auf Grund ihrer Passivität und ihrer Ignoranz den Geist, dessen oberstes Gesetz " die Wahrheit, das heißt das Streben nach Wahrheit"[13] ist.
In der zweiten Fassung der Einleitung des Werkes berichtet der Schriftsteller über zwei 1950 erschienene Bücher von zwei Professoren. Eines dieser beiden Werke trägt den Titel "Das grüne Blut"[14], in dem der Hochschulprofessor Schwentchen eine germanische Rassentheorie aufstellt. Hesse schreibt dazu:
Er war es, der die durch Rassenlegenden allen Denkens entwöhnte Jugend durch die neue von ihm erfundene Legende vom "grünen Blut" beschenkte.
Dies grüne Blut, so hieß es, sei die mystische, einem heiligen Stigma gleichzusetzende Auszeichnung weniger, nämlich der aus mindestens 30 Generationen reinen Germanenstammes entsprossenen echten Führernaturen. …. Niemand wagte der Legende öffentlich zu widersprechen, man war an Terror gewohnt ….[15]
Dieses Zitat von Hesse widerlegt das falsche Bild eines romantisierenden, unpolitischen, in aller Abgeschiedenheit lebenden Autors. Michel konstatiert folgerichtig:
Dies ist nicht nur eine unüberhörbare Kritik des Rassismus und aller Blut- und – Boden - Schwärmerei, sondern auch eine erbitterte Persiflage auf das beamtete und lohnabhängig konjunkturhörige deutsche Hochschulsystem.[16]
Dass zu jener Zeit Gewalt, Brutalität und unterdrückender Terror herrscht und dass die Menschen es nicht wagen zu widersprechen, erwähnt Hesse auch an zahlreichen anderen Stellen früherer Fassungen. Man kann zum Beispiel kaum über die Straße gehen, "ohne von Bewaffneten angebrüllt, in den Bauch getreten und häufig auch getötet zu werden".[17]
Wie schon erwähnt, verzichtet Hesse in der endgültigen Fassung auf die politisierenden Stellen aus Angst davor, dass das Werk nicht veröffentlicht wird.
3.1.1.1.4 Die Gegenbewegung
Zu jener Zeit der feuilletonistischen Zeitalters entsteht eine geistige Gegenbewegung, die die Notwendigkeit eine Antifeuilletonismus erkennt.
Auf Grund des kriegerischen Chaos der damaligen Zeit, der geistigen Oberflächlich-keit und des Verdrängens der Ängste entsteht das Bedürfnis nach Geist, der als einziges Ziel die Erkenntnis der Wahrheit hat, sowie das Bedürfnis nach Zucht, Ordnung, Hierarchie, Norm, Vernunft, Gesetz und nach Änderung der Denkmoral. Die geistige Gegenbewegung konstituiert sich in dem Orden Kastalien. Sie hat das Ziel, alle Wissensquellen zu bewahren und der Welt ihr geistiges Fundament zu gewährleisten. Absicht dieser Gegenbewegung ist auch, sich von den Machtin-teressen zu lösen und sich ohne staatliche Manipulation dem Geist widmen zu können.
Hesse selbst nennt den Mönchsorden Kastalien eine "pädagogische Provinz".[18] Der Autor wählt diesen Ausdruck in Anlehnung an Goethes pädagogische Provinz in seinem Werk "Wilhelm Meister". Es soll jedoch nicht Aufgabe sein, die beiden Konzeptionen miteinander zu vergleichen.[19]
Mit seiner Kritik am feuilletonistischen Zeitalter will Hesse nicht nur den Zerfall der Jahrhunderte alten Tradition des Abendlandes aufzeigen, sondern auch Hoffnung auf eine Regeneration des Geistes als Grundlage für die Weiterentwicklung der Kultur wecken, da es Gruppen gibt, "welche entschlossen waren, dem Geist treu zu bleiben und mit allen Kräften einen Kern von guter Tradition, von Zucht, Methode und intellektuellen Wissen über diese Zeit hinwegzuretten".[20]
Im folgenden sollen der Aufbau und die Funktion des Ordens beschrieben werden, um das Wesen Kastaliens zu verdeutlichen.
3.1.1.2 Der Orden Kastalien
3.1.1.2.1 Aufbau und Funktion
Der Orden Kastalien ist nach der im Tempelbezirk Delphi sprudelnden, heiligen Quelle Kastalia, an der sich die Pilger wuschen, die zu Apoll wollten, benannt. Kastalia ist auch ein Symbol für die Fruchtbarkeit und Lebensverjüngung. Vermutlich ist Kastalien in der Schweiz oder im süddeutschen Raum anzusiedeln. Es erinnert an das Kloster Maulbronn, in dem der Autor sein Theologiestudium absolvieren sollte. Er bezeichnet Kastalien als "Zisterzienserkloster".[21]
Kastalien ist eine über das ganze Land verstreute Organisation mit dem Hauptsitz in Waldzell. Der Orden ist in zwölf Abteilungen, die wissenschaftlichen Fachrichtungen entsprechen, gegliedert. Hesse erwähnt nicht alle Fachbereiche, sondern nur Altphilologie, Mathematik, Astronomie, Grammatik und Musik. Jeder Abteilung steht ein Magister vor. Zu Kastalien gehören Eliteschulen, Hochschulen, Archive, Bibliotheken, Seminare, Akademien, Laboratorien, Festhallen, Lehrsäle sowie Gästehäuser. Waldzell ist das Vicus Lusorum, die Stadt der Glasperlenspieler.
Die Führung unterliegt der Ordensleitung mit einem angegliederten politischen Departement, welches den Orden nach außen vertritt. Der Leiter des Glasperlenspiels ist der Magister Ludi, der die Elite der Repetenten auswählt. Seinen Stellvertreter, den er selbst bestimmt, nennt man in Kastalien "Schatten",[22] was sowohl seine Identität mit dem Meister als auch seine Wesenlosigkeit ausdrückt. Die Leiter und obersten Lehrer der Eliteschulen bilden die Erziehungsbehörde, die den Unterricht und die geistigen Organisationen des Ordens leitet.
Der Orden wird von dem Land und der Regierung finanziert. Er bildet in seinen Eliteschulen Repetenten aus, die als Lehrer und Wissenschaftler nach Abschluss der Studien an öffentlichen Schulen und Hochschulen lehren sollen. Es ist ihre Aufgabe, die Welt, in der die geistige Moral verfällt, zu erneuern.
Kastalien hat ein eigenes System von Bildungseinrichtungen. Schüler werden nach Charakter und Begabung in einem dreistufigen Bildungsgang für den Dienst im Orden oder in der Welt vorbereitet. Sie müssen sich von ihren Familien lösen und sich in den Orden integrieren. Hesse schreibt:
Ist doch gerade das Auslöschen des Individuellen, das möglichst vollkommene Einordnen der Einzelperson in die Hierarchie der Erziehungsbehörde und der Wissenschaften eines der obersten Prinzipien unseres geistigen Lebens.[23]
Der dreistufige Bildungsgang ist folgendermaßen aufgebaut: nach der Grundstufe der allgemeinen Ausbildung folgt ein an Begabung und Neigung orientiertes fachwissenschaftliches Studium. Die Schüler werden nach den Kriterien von Leistung und Charakter von den Lehrern persönlich ausgewählt. Es finden keine Prüfungen statt. Anschließend folgt ein freies Studium, nach dessen Abschluss die Repetenten als dem Orden angehörige Lehrer den Staat im Staate verlassen, um in der Welt zu lehren und um ihr das geistige Fundament zu geben. Eine andere Möglichkeit besteht darin, dass sie Unterrichtende an den ordenseigenen Schulen oder wissenschaftliche Einrichtungen werden.
Es werden gelegentlich Gastschüler, so genannte Hospitanten, aufgenommen. Sie sind Schüler, die nur eine begrenzte Zeit im Orden leben sowie lernen und anschließend wieder in die Welt zurückkehren. Die Aufnahme von Hospitanten ist eher eine Konzession des Ordens an die Reichen, die die Institution mitfinanzieren. Da die Bürger des Landes den Orden unterhalten, sind die Ordensmitglieder zwar frei von materiellen Sorgen, aber abhängig von der Welt.
Die Kastalier haben das Recht, ohne nachwirkende Verpflichtungen den Orden zu verlassen. Sie haben sich verpflichtet, auf Ehe, Liebe und materiellen Besitz zu verzichten. Der Orden ist eine reine Männergesellschaft. Zu dem Vorwurf einer Leserin, das Buch sei frauenfeindlich, meint Hesse, dass er als alter Mann die Frauen nicht mehr kenne und sie für ihn zum Geheimnis geworden seien.[24]
In Kastalien wird darauf verzichtet, originelle Produktivität zu zeigen. Alle geistigen Werte und Inhalte von West und Ost werden im Archiv bewahrt und beim Glasperlenspiel, was in Kapitel 3.1.1.3 näher beschrieben und analysiert werden wird, verwendet.
Der Orden hat zwei Ideale: Die interdisziplinäre Verknüpfung von Forschung und Lehre aller Wissenschaften und die Aufhebung der Isolation jeglichen Teilgebietes. Ein weiteres Ziel der Kastalier ist die eigene Vollkommenheit.[25]
Der hierarchische Aufbau Kastaliens entspricht in einigen Zügen dem Mönchsorden des Mittelalters und hat auch Elemente eines am Konfuzianismus orientierten Staatsverbandes.
Schon der Name Kastalien weist auf die Antike hin. Der hierarchische Aufbau der Gemeinschaft, der sich jedes einzelne Mitglied dienend einordnen muss sowie das im Orden zu führende Leben in Besitzlosigkeit, Enthaltsamkeit und Askese erinnern an einen christlichen Mönchsorden. Hesse selbst vergleicht die zwölf Magister, die einzelnen Fachabteilungen vorstehen, mit den zwölf Aposteln.[26]
Die Mitglieder des Ordens dienen jedoch keinem Gott, keiner konkreten Religion. Kastalien ist eine säkularisierte geistige Bewegung. Ihre Religion ist das Glasperlenspiel, dem sie dienen. Es ist "das eigentliche Heiligtum Kastaliens, sein einzigartiges Geheimnis und Symbol".[27]
Der Orden Kastalien ähnelt aber auch der konfuzianischen Schule von Lü, die Konfuzius in seiner Heimat gründete. Es war eine hierarchisch gegliederte Schule, die nicht der Bildung des allgemeinen Volkes, sondern der der Aristokratie diente. Ziel der Ausbildung war die Berufung der Eliteschüler in ein hohes Staatsamt.[28]
Der Konfuzianismus ist ebenso wie der Taoismus des Lao Tse eine begrifflich schwer darstellbare, immaterielle Auffassung des Weltgrundes. Sowohl Konfuzius aus auch Lao Tse betrachteten den Sinn Tao als Grundlage aller Erscheinungen des Lebens. Während Lao Tse das Sich konzentrieren des Menschen auf sein Inneres und das Sich öffnen für den Weltgrund fordert, ist der Konfuzianismus des Politikers Konfuzius eine Staatslehre, eine sozialpolitische Ethik, die das menschliche Zusammenleben eines Verbandes oder zweier Personen regelt. Ein weiteres Prinzip des Konfuzianismus ist die persönliche Tugendlehre.
So kann Kastalien als ein von der persönlichen Tugendlehre, d.h. vom Streben nach Selbstvervollkommnung durchdrungener Beamtenstaat bezeichnet werden. Posten und Rang in der Hierarchie werden nicht nur nach Neigung und Begabung vergeben. Auch der Charakter ist von Bedeutung. Die Ordensmitglieder berufen sich auf folgende Prinzipien:
… auf die Objektivität und Wahrheitsliebe im Studium, und auf die Pflege der meditativen Weisheit und Harmonie.[29]
Die Meditation und die kontemplative Innenschau, d.h. das Sich abkapseln von der Außenwelt und die Konzentration auf die innere Bilderflut, sind ebenfalls ein ostasiatisches Motiv Hesses. Dass die Musik ein Ausdruck der Vervollkommnung ist, ist ein weiteres Motiv Asiens. Meditation und Musik sind wesentliche Bestandteile der konkreten Erscheinung des Glasperlenspiels in Kastalien.[30]
Der ideale Kastalier "weiß nichts vom Streben nach Geld, nach Ruhm, nach Rang, er kennt … keine Abhängigkeit vom Erfolg".[30] Der Verzicht auf Ruhm, Rang und Geld sowie ein Leben in materieller Enthaltsamkeit sind nicht nur Prinzipien des christlichen Mönchsordens, sondern auch ein Element des Taoismus und des konfuzianischen Staatssystems. In einem Werk der Taoisten Liä Dsi und Yang Dschu über die chinesische Philosophie[31] steht über die Lehre von den vier Abhängigkeiten:
Vier Gründe sind es, dass die lebenden Menschen nicht zur Ruhe kommen: der eine ist das lange Leben, der zweite ist der Ruhm, der dritte ist der Rang und Stand, und der vierte ist der Besitz. Um dieser vier Dinge willen fürchten sie die Geister, fürchten sie die Menschen, fürchten sie die Macht und fürchten sie die Strafe. Die das tun, sind Menschen, die nicht zur Besinnung kommen. Man kann sie töten, man kann sie am Leben lassen: ihr Schicksal wird von außen her bestimmt.[33]
Ein auf der konfuzianischen Staatslehre beruhender Verband hat das Ziel, gesellschaftlich wirksam zu sein und ethisches Verantwortungsbewusstsein zu zeigen. Die Kastalier hingegen isolieren sich von der Welt. Für die Ordensmitglieder ist sie "ein Tummelplatz der Triebe und der Moden, der Begehrlichkeit, der Habgier und Machtgier, der Mordlust, der Gewalt, der Zerstörungen und Kriege, der ehrgeizigen Minister, der gekauften Generäle, der zusammengeschossenen Städte".[34] Diese Isolation des Ordens und seine Unfähigkeit, sich zu wandeln, sind ein Zentralthema des Werkes, wie im Kapitel 4.1 ersichtlich wird.
Der Orden Kastalien ist ein bürokratisch durchorganisierter Staat im Staate mit Strukturelementen, die einem konfuzianischen Lebensverband bzw. einem christlichen Mönchsorden des Mittelalters ähneln. Die Kastalier bilden eine säkularisierte geistige Gegenbewegung zum feuilletonistischen Zeitalter, das von Oberflächlichkeit, Todesverdrängung, Ängsten und geistigem Verfall bestimmt ist. Die Ordensmitglieder wollen nicht den Machtinteressen dienen. Mittels Meditation und Studium streben die Kastalier nach Wahrheit. Ihr Geist steht im Dienste der Universalität. Alle Fachgebiete und Wissenschaften sollen interdisziplinär miteinander verflochten werden.
Das Herz und Zentrum des Ordens ist das Glasperlenspiel, dessen Entstehungs-geschichte, Aufbau und Funktion näher untersucht werden sollen.[35] Dabei sollen zahlreiche Bezüge zur ostasiatischen, d.h. indischen und chinesischen Kultur und Philosophie hergestellt werden.
3.1.1.3 Das Glasperlenspiel
3.1.1.3.1 Entstehungsgeschichte
Das Glasperlenspiel ist von Bastian Perrot aus Calw erfunden worden. Perrot ist eine Anspielung auf Heinrich Perrot sen., Hesses Lehrherrn in einer Turmuhrenfabrik in Calw, dem Geburtsort des Schriftstellers.[36] Perrot konstruierte einen Rahmen mit einigen Dutzend Drähten, worauf er Glasperlen verschiedener Größen, Farbe und Form aneinanderreihte. Die Glasperlen entsprachen Notenwerten. Je nach Position der Glasperlen konnten musikalische Themen konstruiert und verändert werden.
Diese Spielidee wurde einige Jahrzehnte später von den Mathematikern übernommen, anschließend auch von beinahe allen Wissenschaften wie der klassischen Philologie, Logik und den bildenden Künsten.
Dem Spiel fehlte jedoch die interdisziplinäre Verquickung. Auf Grund dieses Bedürfnisses nach Synthese erfand der Schweizer Musikgelehrte und Liebhaber der Mathematik Lusor oder Joculator Basiliensis[37] eine Zeichen- und Formelsprache, mit der es möglich war, Mathematik und Musik miteinander zu verbinden. Diese beiden Disziplinen können als Grundlage des Glasperlenspiels betrachtet werden. Dieses Bedürfnis nach Synthese von unterschiedlichen, ja feindlichen Disziplinen und Themen bestand schon im 16., 17, und 18. Jahrhundert, in denen gelehrte Musiker "ihren musikalischen Kompositionen mathematische Spekulationen zugrunde legten".[38]
Später erschien die Schrift eines Pariser Gelehrten mit dem Titel "Chinesischer Mahnruf". Dieser chinesische Philologe forderte eine internationale Zeichensprache, mit es möglich sei, die Grenzen der Fachwissenschaft zu überwinden. Ähnlich wie das Lateinische im Mittelalter oder heute das Englische, forderte der Gelehrte "eine internationale Zeichensprache auszubauen, …, welche allen Gelehrten der Welt verständlich wäre".[39] In der dritten Version des Traktates bezeichnet Hesse den Titel "Erinnerung an China", in der endgültigen Fassung "Chinesischer Mahnruf". Der Autor will mit dem veränderten Titel die Dringlichkeit und Notwendigkeit einer Weltsprache unterstreichen.
Im folgenden soll versucht werden, gemeinsame Bezüge zwischen der Formelschrift des Glasperlenspiels und der chinesischen Ideographie herzustellen.
3.1.1.3.2 Aufbau und Funktion
3.1.1.3.2.1 Ideographie
Hesse war weder Sinologe noch hatte er die chinesische Sprache studiert. Er beschäftigte sich jedoch intensiv mit chinesischer Philosophie, Literatur und Kunst, 40 insbesondere mit dem I Ging, dem Orakelbuch der Wandlungen. Dass der Schriftsteller eine Parallele zwischen dem königlichen Spiel und der chinesischen Sprache sieht, soll in der folgenden Analyse belegt werden.
Die chinesischen Schriftzeichen werden, wie Adrian Hsia in seinem Werk "Hermann Hesse und China" beschreibt,[41] in vier Hauptkategorien unterteilt: man unterscheidet Piktogramme, einfache Bildzeichen, die eine bestimmte Form nachbilden; einfache Ideogramme, die das durch das Zusammensetzen von mehreren einfachen Zeichen entstehen und deren Bedeutung durch die in ihnen enthaltenen einzelnen Symbole gegeben ist; Phonogramme, Lautzeichen, die eine phonetische und eine die Bedeutung gebende Wurzel haben.
Die Hauptbegriffe können sowohl als Substantiv, Adjektiv, Adverb oder Verb verwendet werden und verleihen – so Hsia – der chinesischen Sprache eine große Elastizität. Dies soll an einem Beispiel näher erläutert werden:
Das Symbol Yin, ein Urelement des Tao neben dem Yang, bedeutet, als Nomen verwendet, das Weibliche, das Weib, das Kühle, das Verborgene, das Empfangende usw., als Adjektiv kühl, feucht, schattig, weiblich, leise, intrigenhaft, gefährlich usw. und als Verb schweigen, betrügen, verstecken, empfangen, passiv sein usw.. Über diese Polyvalenz eines Zeichens schreibt Koller:
Zentrale Prägnanz des Begriffes, der seine Wiedergabe in einem einzigen
Schriftzeichen gestattet, bei gleichzeitiger Vielfalt der Bezugsmöglichkeit,
chemisch gesprochen: der freien Valenzen dieses selben Begriffes.[42]
Das Symbol Yin ist auf Grund dieser Elastizität der Bedeutung in allen Gebieten der Wissenschaft und Künste anwendbar. Die Grenzen der verschiedenen Disziplinen können überschritten und aufgegeben werden. Diese Elastizität und Universalität des Chinesischen erlaubt es, einen gemeinsamen Nenner zwischen einzelnen Wissenschaften zu bilden.
So hat das Glasperlenspiel in Kastalien auch seine Regeln und Grammatik, seine "Formeln, Abbreviaturen und Kombinationsmöglichkeiten".[43] Das Spiel drückt alle Wissensgebiete aus; es ist ein geschlossenes System von Ausdrücken und Symbolen für alle Wissenschaften. Das Glasperlenspiel ist "ein Spiel mit sämtlichen Inhalten und Werten unserer Kultur".[44] Diese universale und heilige Sprache vermag es, "alle geistigen und künstlerischen Werte und Begriffe auszudrücken und auf ein gemeinsames Maß zu bringen".[45] Die Geheimsprache des Glasperlenspiels, deren Hauptbestandteil die Mathematik und Musik waren, hat das Ziel, "die Inhalte und Ergebnisse nahezu aller Wissenschaften auszudrücken und zueinander in Beziehung zu setzen".[46] Hesse vergleicht das Spiel mit einem Schachspiel, bei dem alle Figuren und Felder außer der gewöhnlichen noch eine geheime Bedeutung haben.[47]
Wie die chinesische Schreibkunst erlaubt, den Zeichen eine individuelle Färbung zu geben und Bilder und Assoziationen beim Betrachter durch die persönliche Handschrift hervorzurufen, so soll auch der Kastalier die Symbole des Glasperlenspiels durch seine persönliche Phantasie beeinflussen. Der Pariser Gelehrte fordert in seiner Schrift "Chinesischer Mahnruf" eine internationale Geheimsprache, "welche ähnlich der chinesischen Schrift … erlaube, das Komplizierteste eine Ausschaltung der persönlichen Phantasie und Erfinderkraft … graphisch auszudrücken, …".[48]
In der chinesischen Sprache existieren – so Hsia – vier bzw. sechs Regeln, um neue Zeichen zu bilden. Es ist also möglich, dass jeder neue Worte bildet, wobei die Anzahl der Zeichen unendlich ist.
In Kastalien entscheidet die Weltkomission der Magister der pädagogischen Provinzen über die Einbeziehung neuer Inhalte in die Spielsprache. Alles, "was die Menschheit an Erkenntnissen, hohen Gedanken und Kunstwerken in ihren schöpferischen Zeitaltern hervorgebracht"[49] hat, wird in die heilige Sprache aufgenommen. Es werden jedoch keine neuen geistigen Inhalte, Ideen und kulturellen Werte geschaffen. Der isoliert lebende Orden bewahrt den ganzen geistigen Weltinhalt; es ist nicht seine Aufgabe, auf die Welt einzuwirken. Die Tatsache, dass die Ordensmitglieder nur konservieren und sammeln sowie ein kontemplatives Leben führen, drückt sich auch darin aus, dass es strengstens verboten ist, literarisch kreativ zu sein, z. B. Gedichte zu schreiben.
Der Orden versteht das Glasperlenspiel als Antipode zum Zweckrationalismus des feuilletonistischen Zeitalters. Der Geist dient nicht mehr der Zerstreuung; die Spezialisierung der einzelnen Fachbereiche ist überwunden, da bei diesem Spiel alle Wissensgebiete miteinander verknüpft sind.
3.1.1.3.2.2 Das dialektische Prinzip
Die Spieler in Waldzell stellen zwei feindliche Themen, Thesen oder Ideen gleichwertig nebeneinander, führen sie gegeneinander und streben das harmonische Zusammenführen an. Sie wenden das dialektische Prinzip an, wenn sie "aus These und Antithese möglichst rein die Synthese zu entwickeln"[50] versuchen.
Das Ziel dieses formal – intellektuellen Spieles der dialektischen Synthetisierung antithetischer Themen ist die Erkenntnis des Seins an sich. Hesse schreibt:
Ich begriff plötzlich, …, dass jedes Symbol und jede Kombination von Symbolen nicht hierhin und dorthin, nicht zu einzelnen Beispielen, Experimenten und Beweisen führe, sondern ins Zentrum, ins Geheimnis und Innerste der Welt, in das Urwissen.[51]
Die Erscheinungen der Themen und Ideen der einzelnen Disziplinen der Wissenschaften und Künste werden nach dem dialektischen Prinzip synthetisch auf eine Einheit, auf ein Urprinzip, zurückgeführt.
Auch in dem Gedicht "Das Glasperlenspiel", das Knecht trotz Verbot schrieb, wird auf das Äußere, die Erscheinung, die das Urprinzip repräsentiert, verwiesen:
Wir lassen vom Geheimnis uns erheben
Der magischen Formelschrift, in deren Bann
Das Uferlose, Stürmende, das Leben,
Zu klaren Gleichnissen gerann.[52]
Das Urwissen, dieses Geheimnis, die Einheit hinter der Vielfalt, ist nicht als konkrete Person oder als Gott zu sehen. Das Glasperlenspiel ist für die Ordensmitglieder ein säkularisierter Religionsersatz, ein a-personaler Glaube. Der religiöse Charakter des Spieles wird besonders beim Jahresfestspiel, dem ludus anniversarius, deutlich.
Die Aufgabe der Ordensmitglieder ist, wie der Musikmeister, ein Vollendeter und Knechts Vorbild, einmal sagt:
Unsere Bestimmung ist, die Gegensätze richtig
zu erkennen, erstens nämlich als Gegensätze,
dann aber als die Pole einer Einheit.[53]
Das westliche Denken ist darauf fixiert, Gegensätze als kontradiktorisch, widerstrebend, sich ausschließend und bekämpfend zu betrachten, während im ostasiatischen Denken Antithesen Polaritäten, sich notwendig ergänzende und bedingende Teile einer Einheit sind.
Das Spiel ist dem Taoismus sehr nahe, denn es ist ein unmittelbarer Weg
ins Innere des Weltgeheimnisses, wo im Hin und Wider zwischen Ein-
und Ausatmen, zwischen Himmel und Erde, zwischen Yin und Yang sich
ewig das Heilige vollzieht.[54]
Im folgenden sollen die Ideen des Taoismus kurz vorgestellt werden, um den Bezug zum Glasperlenspiel zu verdeutlichen.
3.1.1.3.2.3 Taoistische Grundlagen
Die Grundlagen des Taoismus sind in dem von Wilhelm übersetzten Werk "Tao Te King: Das Buch des Alten vom Sinn und Leben"[55] enthalten.
Lao Tse sagt, dass die Wahrheit, das Sein an sich, unaussprechbar sei. Die absolute Potenz sei die Einheit alles jemals Gedachten und Ausgesprochenen und nur erlebbar. Ähnlich äußert sich der Musikmeister im Roman:
Die Wahrheit wird gelebt, nicht doziert.[56]
Im chinesischen Denken wird das Natur, Mensch und Kosmos umfassende Symbol der Einheit als Tao bezeichnet. Die Erscheinungen der Welt werden als konkrete Gegensätze gesehen, die auf die Urpolarität von Schöpferischem und Empfangendem, vom Licht und Schatten, Positivem und Negativem, dem Männlichen und Weiblichen, von Yin und Yang zurückgeführt werden. Die Ureinheit beschreibt Lao Tse folgendermaßen:
Wenn auf Erden alle das Schöne als schön erkennen,
so ist dadurch schon das Hässliche gesetzt.
Wenn auf Erden alle das Gute als gut erkennen,
so ist dadurch schon das Nichtgute gesetzt.
Denn Sein und Nichtsein erzeugen einander.
Schwer und kurz gestalten einander.
Hoch und Tief verkehren einander.
Stimme und Ton sich vermählen einander.
Vorher und Nachher folgen einander.[57]
Tao kann – nach Wilhelm – mit "Sinn" oder "Weg" übersetzt werden.[58] Der Sinn entspricht dem Ursein, der alles Seiende und alle Erscheinungen, also Te, d.h. das "Leben" erzeugt. Te ist den Gesetzesmäßigkeiten des Tao unterworfen. Der Kreislauf der Natur sowie das Leben der Menschen werden von dieser Polarität bestimmt. Das Tao zeigt sich im dynamischen, sich ständig wandelnden Leben als konstantes Gesetz und bestimmende Kraft. Es ist der Wandel des Gleichen in den Gegensätzen.
Hesse, der das gleiche Weltbild entwickelt, äußert sich in "Geist der Romantik":
Die Vielgestaltigkeit der Welt, das reiche bunte Spiel des Lebens mit seinen
tausend Formen wird zurückgeführt auf das göttliche Eine, das dem Spiel
zugrunde liegt.[59]
Die Rückführung von antithetischen Themen zweier Disziplinen auf das Grundprinzip bei den Glasperlenspielern entspricht also der taoistischen Denkweise. Die Kastalier betreiben das Spiel unter dem pars – pro – toto – Prinzip. Jeder dialektische Ansatz, gleichgültig welcher, führt zum Kern. Der Mikrokosmos des geistigen Spieles soll den Makrokosmos von Tao und Te widerspiegeln.
[...]
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Originalausgabe
- Erscheinungsjahr
- 1989
- ISBN (eBook)
- 9783832418571
- ISBN (Paperback)
- 9783838618579
- DOI
- 10.3239/9783832418571
- Dateigröße
- 6 MB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf – Philosophische Fakultät, Germanistik
- Erscheinungsdatum
- 1999 (November)
- Note
- 2,0
- Schlagworte
- glasperlenspiel dialektisches prinzip komplementäres denken stufen menschwerdung ostasien indien china
- Produktsicherheit
- Diplom.de