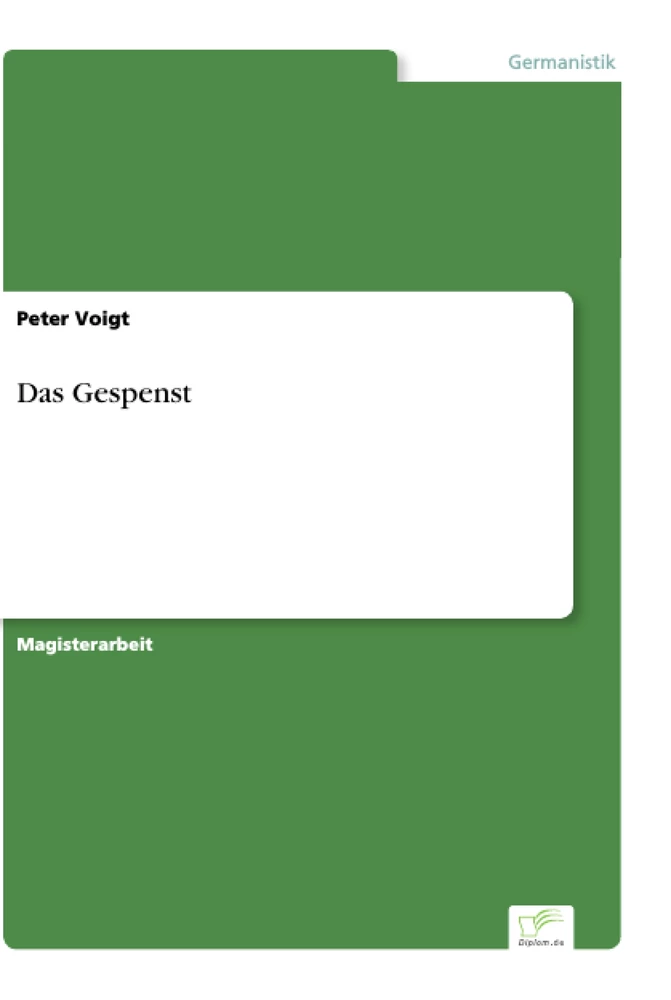Zusammenfassung
Inhaltsangabe:Einleitung:
Ob die Shen und die Kuei, der Chagrin oder der Domovoy, ob die Verre-Geister, der Umi Bozu, der Khu oder der Tash - in den meisten Kulturen und zu fast allen Zeiten waren Gespenster, Erscheinungen und Geisterwesen ebenso fest verankert und besaßen einen ebenso wichtigen wie starken Funktionswert in der Ordnung des Alltags wie die Darstellungen und Interpretationen der Dachreligionen oder der jeweiligen Glaubensgemeinschaften. Ektoplasmatische Körper-Manifestationen, Phantome und Weiße Frauen, Rauchgeister, Höllenhunde, Fetsche und Doppelgänger, all diese übernatürlichen Phänomene, deren Dasein allein durch die moderne Ratio und durch die Naturwissenschaften heutzutage in Frage gestellt werden, sind schon weit über den Sinn und Zweck ihrer Existenz hinausgelangt: nämlich einerseits die Urängste zu personifizieren und damit zu bannen und andererseits die Neugier auf mögliche Zwischenwelten zu wecken und Erklärungsansätze hinsichtlich des Terminus Jenseits darzubieten. Das Unbegreifliche und Schaurige erinnert den Menschen sowohl an seine eigene Sterblichkeit, als auch an die Frage nach dem Danach; diese zwei Konstanten im Leben eines jeden Individuums zwingen es, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen und produzieren ihrerseits ständig neue Schimären, die wiederum weitergetragen und modifiziert werden. Somit hat dieses amorphe Wesen längst, dank unzähliger kreativer Köpfe und eines filigranen Mediennetzes, eine einmalige Eigendynamik entwickelt, die es zu einem Freizeitmoloch sondergleichen mutieren ließ und die dem individuellen Grauen einen gänzlich neuen Stellenwert gegeben hat.
Mittlerweile ist das Gespenst, eingebunden in die Grusel-, Schauer- oder Horrorgeschichte, zu einer Kunstform geworden, die ganz eigenen variablen Gesetzen unterliegt. Damit deute ich nicht nur auf die legendären Campfire-Tales, die klassische Geistergeschichte oder die Geschichten vom Monster im Wandschrank als elterliches Druckmittel, sondern auf den gesamten Komplex der sogenannten Spukgeschichten bzw. der Geschichten mit phantastischen Elementen, der die Freude am Gruseln und die Notwendigkeit des Schreckens dokumentiert und perfektioniert und diese Arbeit noch immer verrichtet. Kaum ein Literaturzweig ist dermaßen dehnbar und themenübergreifend, obwohl er von einigen Fachgeistern nur allzu schnell verpönt und als Schund abgetan wird. Man darf bei solch unüberlegten Äußerungen jedoch nicht vergessen, daß die Horrorliteratur in erster Linie […]
Ob die Shen und die Kuei, der Chagrin oder der Domovoy, ob die Verre-Geister, der Umi Bozu, der Khu oder der Tash - in den meisten Kulturen und zu fast allen Zeiten waren Gespenster, Erscheinungen und Geisterwesen ebenso fest verankert und besaßen einen ebenso wichtigen wie starken Funktionswert in der Ordnung des Alltags wie die Darstellungen und Interpretationen der Dachreligionen oder der jeweiligen Glaubensgemeinschaften. Ektoplasmatische Körper-Manifestationen, Phantome und Weiße Frauen, Rauchgeister, Höllenhunde, Fetsche und Doppelgänger, all diese übernatürlichen Phänomene, deren Dasein allein durch die moderne Ratio und durch die Naturwissenschaften heutzutage in Frage gestellt werden, sind schon weit über den Sinn und Zweck ihrer Existenz hinausgelangt: nämlich einerseits die Urängste zu personifizieren und damit zu bannen und andererseits die Neugier auf mögliche Zwischenwelten zu wecken und Erklärungsansätze hinsichtlich des Terminus Jenseits darzubieten. Das Unbegreifliche und Schaurige erinnert den Menschen sowohl an seine eigene Sterblichkeit, als auch an die Frage nach dem Danach; diese zwei Konstanten im Leben eines jeden Individuums zwingen es, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen und produzieren ihrerseits ständig neue Schimären, die wiederum weitergetragen und modifiziert werden. Somit hat dieses amorphe Wesen längst, dank unzähliger kreativer Köpfe und eines filigranen Mediennetzes, eine einmalige Eigendynamik entwickelt, die es zu einem Freizeitmoloch sondergleichen mutieren ließ und die dem individuellen Grauen einen gänzlich neuen Stellenwert gegeben hat.
Mittlerweile ist das Gespenst, eingebunden in die Grusel-, Schauer- oder Horrorgeschichte, zu einer Kunstform geworden, die ganz eigenen variablen Gesetzen unterliegt. Damit deute ich nicht nur auf die legendären Campfire-Tales, die klassische Geistergeschichte oder die Geschichten vom Monster im Wandschrank als elterliches Druckmittel, sondern auf den gesamten Komplex der sogenannten Spukgeschichten bzw. der Geschichten mit phantastischen Elementen, der die Freude am Gruseln und die Notwendigkeit des Schreckens dokumentiert und perfektioniert und diese Arbeit noch immer verrichtet. Kaum ein Literaturzweig ist dermaßen dehnbar und themenübergreifend, obwohl er von einigen Fachgeistern nur allzu schnell verpönt und als Schund abgetan wird. Man darf bei solch unüberlegten Äußerungen jedoch nicht vergessen, daß die Horrorliteratur in erster Linie […]
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Voigt, Peter: Das Gespenst / Peter Voigt.- Hamburg: Diplomarbeiten Agentur, 1999
Zugl.: Bremen, Univ., Magisterarbeit, 1999
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte, insbeson-
dere die der Übersetzung, des Nachrucks, des Vortrags, der Entnahme von Abbildungen
und Tabellen, der Funksendung, der Mikroverfilmung oder der Vervielfältigung auf ande-
ren Wegen und der Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen, bleiben, auch bei nur
auszugsweiser Verwertung, vorbehalten. Eine Vervielfältigung dieses Werkes oder von
Teilen dieses Werkes ist auch im Einzelfall nur in den Grenzen der gesetzlichen Bestim-
mungen des Urheberrechtsgesetzes der Bundesrepublik Deutschland in der jeweils gel-
tenden Fassung zulässig. Sie ist grundsätzlich vergütungspflichtig. Zuwiderhandlungen
unterliegen den Strafbestimmungen des Urheberrechtes.
Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in die-
sem Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme, daß
solche Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei zu
betrachten wären und daher von jedermann benutzt werden dürften.
Die Informationen in diesem Werk wurden mit Sorgfalt erarbeitet. Dennoch können Feh-
ler nicht vollständig ausgeschlossen werden, und die Diplomarbeiten Agentur, die Auto-
ren oder Übersetzer übernehmen keine juristische Verantwortung oder irgendeine Haf-
tung für evtl. verbliebene fehlerhafte Angaben und deren Folgen.
Dipl. Kfm. Dipl. Hdl. Björn Bedey, Dipl. Wi.-Ing. Martin Haschke & Guido Meyer GbR
Diplomarbeiten Agentur, http://www.diplom.de, Hamburg 1999
Printed in Germany
Universität Bremen
Fachbereich 10
Magisterschrift
Das Gespenst
Gutachter: Prof. Dr. phil. Gert Sautermeister
Korreferent: Prof. Dr. phil. Hans-Albrecht Koch
Erstellt von Peter Voigt
Zeitrahmen: 04.09.1998 bis 04.03.1999
Peter Voigt * Gr. Johannis 142/144
28199 Bremen * 0421/506713 * Matr.Nr. 936250
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung 04
2. Wort- und Begriffsgeschichte 05
3. Das Gespenst im Volksglauben 09
3.1.
Das Geschöpf
10
3.2.
Die Motivation des Übernatürlichen
11
3.3.
Manifestation und Darstellung
12
3.4.
Die Lokalisierung
14
3.5.
Die temporisierte Erscheinung
15
3.6.
Die Wahrnehmung
16
4. Das literarische Gespenst 16
4.1.
Eigensinnig und kummervoll warnend
17
4.2.
Stumm und körperlos
20
4.3.
Verliebt und verstorben
21
4.4.
Im Spukhaus
25
5. Erklärte und erklärbare Phänomene 27
5.1.
Täuschung und Imitation
28
5.2.
Phantasmagorie
30
6. Die Gespenstergeschichte 33
6.1.
Definition und Abgrenzung
34
6.2.
Formstrukturen
39
6.3.
Zu den Beglaubigungsansätzen
42
6.4.
Aufbautechniken der Spannung
44
6.5.
Der Hintergrund der Angst
46
6.6.
Zwischen Mittelalter und Szientismus
48
3
7. Ludwig Tiecks ,,Der blonde Eckbert" 52
7.1.
Irrationalität und Romantik
52
7.2.
Tieck und die Gespenster
54
7.3.
,,Der blonde Eckbert"
65
7.3.1. Zur Entstehungsgeschichte
65
7.3.2. Zur Wirkungsgeschichte
66
7.3.3. Zur Analyse
68
8. Nachwort: Zweifel, Lust ... und was dazwischenliegt 80
Anhang A: Erklärung zur Urheberschaft
84
Anhang B: Normvorschläge
84
Anhang C: Bildquelle
84
Primärliteratur
85
Sekundärliteratur
88
Audioquelle
90
4
Das Gespenst
1. Einleitung
Ob die Shen und die Kuei, der Chagrin oder der Domovoy, ob die Verre-
Geister, der Umi Bozu, der Khu oder der Tash - in den meisten Kulturen und zu
fast allen Zeiten waren Gespenster, Erscheinungen und Geisterwesen ebenso
fest verankert und besaßen einen ebenso wichtigen wie starken Funktionswert
in der Ordnung des Alltags wie die Darstellungen und Interpretationen der
Dachreligionen oder der jeweiligen Glaubensgemeinschaften. Ektoplasmatische
Körper-Manifestationen, Phantome und Weiße Frauen, Rauchgeister,
Höllenhunde, Fetsche und Doppelgänger, all diese übernatürlichen Phäno-
mene, deren Dasein allein durch die moderne Ratio und durch die
Naturwissenschaften heutzutage in Frage gestellt werden, sind schon weit über
den Sinn und Zweck ihrer Existenz hinausgelangt: nämlich einerseits die
Urängste zu personifizieren und damit zu bannen und andererseits die Neugier
auf mögliche Zwischenwelten zu wecken und Erklärungsansätze hinsichtlich
des Terminus Jenseits darzubieten. Das Unbegreifliche und Schaurige erinnert
den Menschen sowohl an seine eigene Sterblichkeit, als auch an die Frage
nach dem Danach; diese zwei Konstanten im Leben eines jeden Individuums
zwingen es, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen und produzieren
ihrerseits ständig neue Schimären, die wiederum weitergetragen und modifiziert
werden. Somit hat dieses amorphe Wesen längst, dank unzähliger kreativer
Köpfe und eines filigranen Mediennetzes, eine einmalige Eigendynamik
entwickelt, die es zu einem Freizeitmoloch sondergleichen mutieren ließ und die
dem individuellen Grauen einen gänzlich neuen Stellenwert gegeben hat.
Mittlerweile ist das Gespenst, eingebunden in die Grusel-, Schauer- oder
Horrorgeschichte, zu einer Kunstform geworden, die ganz eigenen variablen
Gesetzen unterliegt. Damit deute ich nicht nur auf die legendären Campfire-
Tales, die klassische Geistergeschichte oder die Geschichten vom Monster im
Wandschrank als elterliches Druckmittel, sondern auf den gesamten Komplex
5
der sogenannten Spukgeschichten bzw. der Geschichten mit phantastischen
Elementen, der die Freude am Gruseln und die Notwendigkeit des Schreckens
dokumentiert und perfektioniert und diese Arbeit noch immer verrichtet. Kaum
ein Literaturzweig ist dermaßen dehnbar und themenübergreifend, obwohl er
von einigen Fachgeistern nur allzu schnell verpönt und als Schund abgetan
wird. Man darf bei solch unüberlegten Äußerungen jedoch nicht vergessen, daß
die Horrorliteratur in erster Linie unterhalten soll. Was jeder Einzelne
letztendlich für sich und sein Weltgefüge aus einer solchen Erzählung
übernimmt, wird jedoch zwangsläufig über den Unterhaltungswert hinausgehen
und den reinen Konsumrahmen sprengen, da die meist sehr geschickte
Inszenesetzung der Angst und der angsterzeugenden Mechanismen
automatisch Parallelen zum eigenen Innersten zieht.
Was ich nun in der folgenden Arbeit über das Gespenst aufzuzeigen versuche,
stellt lediglich einen kleinen Ausschnitt des gesamten Terrains dar: Von
Definitions- und Erklärungsansätzen, dem Gespenst im Volksglauben und
einem kurzen Geleitwort zum literarischen Gespenst werde ich überleiten zur
Gespenstergeschichte und deren Poetik mit konkretem Fallbeispiel, so daß
trotz der Komplexität des Themas ein guter Überblick über die gespenstischen
Hintergründe verbleibt.
2. Wort- und Begriffsgeschichte
Auch wenn manch Anmaßender die Etymologie als ,, das erste Refugium der
Ignoranten" (Wilpert, 1994, S.1) bezeichnet, so wage ich doch nicht, die
Importanz eines adäquaten Anfangs zu unterschätzen, der auf ebensolche
Werkzeuge auf keinen Fall verzichten kann. Aus diesem Grunde werde auch
ich mit diesen notwendigen Erklärungsansätzen beginnen.
Die meisten Konversationslexika haben zum Begriff Gespenst leider nicht viel
zu bieten. So läßt z.B. das ,, dtv Lexikon" (1990, Bd. 6, S.330) bloß verlauten,
daß der blanke Wortursprung im Althochdeutschen (,, gispanst Verlockung" ) zu
finden sei und daß jene Spukgestalten ,, im Volksglauben [...] als Totengeister,
Tiere oder formlose Wesen meist bei Nacht" erscheinen. Selbst Hainings
,,Großes Gespenster-Lexikon" (1994) hat nichts anderes über die Etymologie
6
und die Begriffsgeschichte zu berichten.
1
Dagegen bietet Wilperts Werk, das
sich ausführlich mit dem Thema Gespenst befaßt, natürlich einen wesentlich
detaillierteren Überblick. Trotz seiner erwähnten Kritik beginnt auch er mit
wortgeschichtlichen Erläuterungen, indem er aufzeigt, daß die Volksetymologie
Gespenst von ,, spinnen" herleitet und mit ,, Gespinst" und ,, Hirngespinst" (Wilpert,
1994, S.1) zusammenbringt; der unmittelbare Bezug (Bezeichnender und
Bezeichneter) von Spinner und Gespenst zu Schöpfer und Geschöpf ist jedoch
wortgeschichtlich nicht gegeben. Das Bezeichnete (Gespenst) im heutigen
Gebrauch nun ist, wenn man die Äquivalente aus den ältesten Kulturen mit in
Betracht zieht, wesentlich älter als das Wort Gespenst, welches wiederum älter
als seine heutige Bedeutung ist.
Über die Etymologie siedelt Wilpert (1994, S.1) fortführend das Gespenst
ebenfalls im Althochdeutschen an (,, spanan anreizen, überreden, verlocken" )
2
und verweist zusätzlich noch auf das Fortleben dieser Bedeutungen in den
Adjektiven ,, abspenstig" und ,, widerspenstig"
3
. Als Substantive zum Verb spanan
existieren neben dem angegebenen gispanst im Althochdeutschen noch die
Worte gispensti und spanst und im Mittelhochdeutschen die Worte spenst,
gespanst und gespenst (Verlockung, Verführung, Sinnenreiz).
Im Zuge eines eklatanten Begriffswandels bekommt der Gegenstand Gespenst
dann einen abstrakteren und das Wort selbst einen konkreteren Status. Das
Kuriose zudem ist, daß das Wort in meist religiösen Texten gänzlich neue
Eigenschaften erhält, da es in solchem Kontext mit Teufel und Dämon
assoziiert wird, so daß die Bezeichnungen Blendwerk, Täuschung und Trug als
synonyme Bedeutungskomponenten mittlerweile fester Bestandteil der
sogenannten Beichtformeln sind (vgl. Wilpert, 1994, S.2).
4
So festigt sich das
Wort im sechzehnten Jahrhundert in der konkreteren Bedeutung von
Geistererscheinung, bloßes Scheinbild, Trugbild (teuflischer, dämonischer oder
zauberischer Herkunft)
5
, die sich bis in die Literatur der Klassik hält. Parallel
dazu entwickelt sich -seit dem Mittelhochdeutschen vom vierzehnten
Jahrhundert an- die Bedeutung von ,, schattenhafte, unscharfe Geister-
1
Man muß selbstverständlich die schon unterschiedlichen Intentionen der diversen Lexika bei
Definitionsvergleichen berücksichtigen.
2
vgl. ,, Handwörterbuch zur deutschen Volkskunde" (1930/31, Bd. III, S.766).
3
vgl. ,, Duden" (1989, Bd. 7, S.237).
4
Damit ist die Absage an den Teufel und sein Gespenst gemeint.
7
erscheinung" (Wilpert, 1994, S.2). Diese beschränkt sich zunächst auf die
bösen Geister und den Teufel und weitet sich -seit dem sechzehnten
Jahrhundert- auf pauschale Erscheinungen, deren Ursprung nicht nachprüfbar
ist, aus. Dabei wird eine teuflische Herkunft nicht unbedingt ausgeschlossen.
Im neunzehnten Jahrhundert erreicht das Begriffsfeld Gespenst später eine
vorläufige Endmarke, weil der Umgang mit der gewandelten Bedeutungsbasis
von anthropomorphe (menschenähnliche) Geistererscheinung und umgehender
Geist sich bis in unsere Tage einer gewissen Ausschließlichkeit bedient. Sobald
es aber um die Abgrenzungen der Artverwandten (Spuk, Geist)
6
geht, offerieren
die einschlägigen Enzyklopädien dem Akribischen ungenaue Definitionen, die
die unterschiedlichen Bezeichnungen, welche keineswegs synonym gebraucht
werden sollten, immer wieder mit Geistererscheinung, Erscheinung
Verstorbener, Totengeistern, Spuk und Spukgestalt
7
in Verbindung bringen, des
öfteren sogar mit Nachtmahr (Inkubus, Alp oder Alb) in seiner Funktion als
Angsttraum (Alpdruck, Alptraum) verursachendes Wesen, dessen Bezug zu
den wirklichen Artverwandten nun wirklich nicht nachzuvollziehen ist, da er
gänzlich anderen Kriterien und Hintergründen seine Existenz zu verdanken hat
(vgl. Frayling, 1996, S.6f.). Auf diese Weise wird natürlich die Ausschließlichkeit
in der Benutzung neutralisiert. Diese Abgrenzungen sind außerdem nicht nur
sprachlich, sondern auch begrifflich unscharf.
8
Fest steht, daß das Wort Spuk ursprünglich nur niederdeutsch (mnd. spok,
spuk) und niederländisch (niederl. spook) bezeugt, dessen konkrete Herkunft
aber ungeklärt ist. Es wird sinnentsprechend zum Wort Gespenst benutzt, was
auch die einander entsprechenden Ableitungen verdeutlichen: spuken als
Synonym für (herum)geistern bzw. als Geist umgehen, Spökenkieker als
Synonym für Geisterseher usw. (vgl. ,, Duden, 1989, Bd. 7, S.697). Erst im
siebzehnten Jahrhundert wird das Wort ins Hochdeutsche übernommen, das
unter Einflußnahme norddeutscher Schriftsteller einen oft mundartlichen
Charakter erhält. Durch diese Übernahme unterliegt es einer gewissen
5
vgl. ,, Duden" (1989, Bd. 7, S.237), vgl. Wilpert (1994, S.2).
6
vgl. van Loon (1998, S.71).
7
Geist: vgl. ,, dtv Lexikon" (1990, Bd. 6, S.247f.), vgl. ,, Duden" (1989, Bd. 7, S.226), vgl. Haining
(1994, S.89); Spuk: vgl. ,, dtv Lexikon" (Bd. 17, S.188), vgl. ,, Duden" (1989, Bd. 7, S.697), vgl.
Haining (1994, S.240); vgl. Schürk (1970, S.218ff.).
8
Dieses Problem findet Äquivalenzen im fremdsprachigen Gebiet: ,, ghost" , ,, spirit" , ,, spectre" ,
,,fantôme" (Wilpert, 1994, S.3).
8
Verschiebung hinsichtlich seiner Verwendung, durch die es den direkten Bezug
zum Gespenst verliert und nunmehr eher in die Kategorie ,, Poltergeist (Geist,
der Geräusche verursacht oder Dinge bewegt)"
9
einzuordnen ist (vgl. Wilpert,
1994, S.4; vgl. van Loon, 1998, S.90). Dieses geschieht im Verlauf der
Übertragung des unheimlichen Treibens des erweiterten Spuks von der Person
auf das Phänomen selbst, d.h., Aktion und Gestalt bilden eine Art Korrelat mit
neuen Pflichten und neuen Regeln: Der Spuk ist meistens entweder an
bestimmte Orte (Spukhäuser) oder als ,,Wegespuk" (Chambers, 1977, S.120)
an die Präsenz bestimmter Personen gebunden. Sein Dasein, das sich in
sinnlich wahrnehmbaren Phänomenen (z.B. Jammer-, Tritt- oder Schlag-
geräuschen) bemerkbar macht, ergibt sich aus der unabänderlichen Wieder-
holung eines verbrecherischen Aktes (Zwangsreue), und nur die Aufdeckung
der diesseitigen Greueltat kann seine Erlösung initiieren.
Die Unterscheidung zwischen den Begriffen Gespenst und Geist ist neben der
vollzogenen Trennung von Gespenst und Spuk komplexer. Wenn man in den
unterschiedlichen Lexika unter Geist nachschlägt, bekommt man zunächst
ausschließlich religiöse oder philosophische Inhalte präsentiert (vgl. ,, dtv
Lexikon" , 1990, Bd. 6, S.247), die nichts mit dem zu untersuchenden Geist zu
tun haben. Erst unter dem Schlagwort Geister wird man fündig. Dort wird der
Geist, um den es auch hier gehen soll, als ,, selbständiges numinoses Wesen,,
(,, dtv Lexikon" , 1990, Bd. 6, S.247f.) beschrieben, das in vielen religiösen
Glaubensgemeinschaften beheimatet ist. Er wird zwar meistens als körperloser
Schemen dargestellt, doch besitzt er Intelligenz und Willen sowie übernatürliche
Kräfte. In der Kommunikation mit den Menschen erscheint er in verschiedenen
Gestalten: als deformierter Mensch, Tier oder als amorphes Wesen. Für die
Tätigkeit der Geister sind Ausdrücke wie geisten, gespensten, regieren,
umgehen, wafeln, wanken oder weizen
10
gebräuchlich. Die Klassifizierung des
Geisterwesens ist durch den christlich beeinflußten Volksglauben geprägt, der
es auf eine Ebene zwischen den Menschen und den Engeln (bzw. der
antagonistischen Kraft) platziert (vgl. Wilpert, 1994, S.4f.), und es zugleich in
böse und gute Geister unterteilt (vgl. ,, Handwörterbuch zur deutschen
9
Chambers (1977, S.121); Der in Rußland verbreitete Domovoy ist ebenfalls dieser Kategorie
zuzuordnen. (vgl. Haining 1994, S.56).
10
vgl. ,, Handwörterbuch zur deutschen Volkskunde" (1930/31, Bd. III, S.473).
9
Volkskunde" , 1930/31, Bd. III, S.474). Zudem bilden sich zwei weitere Gruppen
heraus, die sich literarisch als ,, übersinnliche und psychopathologische
Erscheinungen wie Halluzinationen, Sich-selbst-Sehen, [..] imaginierte Doppel-
gänger und das Zweite Gesicht" in der Gespenstergeschichte einerseits und als
,,Stoffe, Figuren und Motive [...] wie [..] Hexen, Zauberer, Heinzelmännchen [...],
Lamien, Werwölfe und [..] Vampire aus dem Stamm Draculas und schließlich
die künstlichen Menschen, Homunculi, Frankensteins und Automaten" (Wilpert,
1994, S.5) im Schauerroman andererseits ihre Existenz behaupten.
Wie sich gezeigt hat, ist allein nach den sprachlichen Begriffen eine scharfe
Definition des Gespenstes ebensowenig möglich wie die konkrete Trennung der
genannten Begrifflichkeiten, da sich die definitorischen Übegriffe einfach als zu
schwerwiegend erweisen; und da ein solch komplexes Gerüst wie das Wort
bzw. der Begriff Gespenst aufgrund der lückenhaften Überlieferungen und der
daraus resultierenden Vagheit überhaupt niemals fertiggestellt werden kann,
wird es auf ewig zwischen den schon existierenden Fakten und den
zwangsläufigen Abwandlungen, die die Entwicklungen der verschiedenen
Kultur- und Glaubensgemeinschaften mit sich bringen, gefangen sein.
3. Das Gespenst im Volksglauben
Der Forschungsgegenstand Gespenst findet nun in erster Linie seinen
Ursprung als Motiv in den volksläufig verbreiteten Vorstellungen aus der
Folklore. Die Literatur fungiert bestenfalls als Vermittlungsinstanz, indem sie die
Gespenster, natürlich modifiziert und mit neuen Prädikaten belegt, als Leihgabe
des Volksglaubens über die Gespenstergeschichte publiziert. Hinsichtlich der
Definition von Gespenstern gelangt die Volkskunde jedoch nicht über die
Ergebnisse der Begriffsgeschichte hinaus,
11
die, wie schon teilweise angeführt,
das Gespenst als ,, schreckenerregende, anthropomorph zumindest gedachte
Erscheinung" (Wilpert, 1994, S.8) darstellt und es aufgrund seiner körperhaft
vorgestellten Menschengestalt als Totengeist, Wiedergänger oder Revenant
(Gespenst, Geist, der aus einer anderen Welt wiederkehrt) versteht. Die
11
Auch sie hat mit Abgrenzungsproblemen zu kämpfen: Dem Versuch, ,, Geister" zum
Oberbegriff für ,, Naturgeister" und ,, Totengeister" (Gespenster) zu machen, steht der Versuch,>
10
Volkskunde verdeutlicht aber, daß die Vorstellungen dieses Phänomens aus
den verschiedensten religiös-mythologischen Systemen stammen, in denen
sich heidnische, christliche, spiritistische und okkulte Hintergründe
verknüpfen.
12
3.1. Das Geschöpf
Im Gespensterglauben nun manifestiert sich die Seele eines Verstorbenen,
aufgrund der unterschiedlichsten Umstände reanimiert, zum gespenstischen
Abbild des verschiedenen Leibes (vgl. Wilpert, 1994, S.13). Auf die Erde
zurückgekehrt verbreiten sie dann im Angesicht ihrer Bezugspersonen
(Verwandte, Nahestehende) den vielumschriebenen Schrecken, der sich
allerdings meistens in Grenzen hält, weil ihre Herkunft -ihre ehemalige
Menschlichkeit- ja natürlichen Ursprungs ist und nur ihr Wiedergängertum über
die Über- bzw. Unnatürlichkeit das Grauen schürt. Diese heidnische Vorstellung
ruheloser Toter hält sich lange Zeit aus dem Grunde im Volksglauben des
Christentums, weil sie eng mit der in der Öffentlichkeit verbreiteten,
extravaganten christlichen Glaubensbasis verbunden ist. Denn auch im
Geisterglauben bildet der Tod eine Passage in eine andere Daseinsform, die
ausschließlich zu jenem Zeitpunkt beidseitig begehbar ist. Auch der Bezug zu
den Engeln wird durch die ruhelosen Seelen, welche wie die Seraphim und die
Cherubim vom Himmel auf die Erde zurückkehren (vgl. Brittnacher, 1994, S.27),
immer wieder verdeutlicht:
Mochte ihr Erscheinen auch beängstigend sein, so war es dennoch
statthaft; denn ein Geist war letztlich nichts anderes als der zum Gespenst
verkommene Engel der Bibel, [...], der sich in die Leichentücher des
Lazarus hüllte und göttliche Kunde brachte. (Brittnacher, 1994, S.28)
Ein weiterer Bezug zum Christentum wird in diesem Zusammenhang durch den
Umstand geschaffen, daß die Gespenster wie ihre biblischen Geschwister
13
Zeugen und Verkünder von Botschaften einer Übermacht darstellen; die Anord-
>den Begriff ,, Spuk" als Domizil für ,, Gespenster als sichtbare Wiedergänger" und ,, unsichtbare,
nichtmenschliche Kräfte" (Wilpert, 1994, S.10) zu schaffen, gegenüber.
12
Man kann davon ausgehen, daß in jedem religiösen bzw. religiös behafteten System Platz für
Gespenster und geisterhafte Erscheinungen ist.
13
vgl. ,, Handwörterbuch zur deutschen Volkskunde" (1930/31, Bd. III, S.767).
11
nungen und Botschaften der Gespenster an ihre Bezugspersonen unterstützen
diese in Entscheidungsfragen, beschützen sie und mahnen zur Reue oder
,,erinnern an begangene Vergehen" (Chambers, 1977, S.117). Weitere
Aufgaben für das Gespenst stellen sich in der Bewachung von Schätzen, im
(Umher)spuken
14
an verlassenen Orten und im Betreiben drastischen Unfugs
als Erinnerungsinstanz dar (vgl. Brittnacher, 1994, S.27).
Andere theologische bzw. religionsbeeinflußte Definitionsansätze sprechen von
der Verdichtung des potentiell gefährlichen und ruhelosen Willens Toter in
halbkörperlicher Form (vgl. Wilpert, 1994, S.10). Für das religiöse Denken
bedeuten die Gespenster, also Verstorbene, die im Jenseits ob Hades oder
Fegefeuer- keine Ruhe finden,
15
jene Seelen, die entweder aus einem
übermenschlichen Lebenswillen heraus gar nicht wissen, daß sie tot sind oder
vor einem supranaturalen Gericht nachträglich Rechenschaft über noch zu
Lebzeiten vollzogene Handlungen ablegen müssen. Auf jeden Fall begründen
sie ihre Existenz entweder durch Eigenverschulden (Problemlösung) oder durch
das Verschulden der Hinterbliebenen (Rachesinnen).
3.2. Die Motivation des Übernatürlichen
Als nächstes wären jene Gründe aufzuführen, die ein Gespenst überhaupt erst
zum Spuken veranlassen. Der Volksglauben läßt dazu folgende Punkte
verlauten (gegliedert nach Wilpert, 1994, S.11ff.):
a) Das Fundament bildet wohl die eigentliche Todesursache, die sich meist auf
Ungewöhnliches und auf Unglücksfälle bezieht (z.B. Tod durch einen Unfall, ein
Unglück, eine Krankheit oder durch Mord
16
).
b) Alsdann ist die Bestattungsart zu nennen, die, unsachgemäß (Fehler beim
Bestattungsritus) oder gar nicht (unaufgefundene oder mißachtete Leichname)
durchgeführt, ebenfalls zur Wiederkehr bewegen kann.
14
Folgend werde ich die Begriffe (umher)geistern bzw. (umher)spuken synonym für die
Tätigkeiten des Gespenstes verwenden, da wie erwähnt- eine klare Abgrenzung nicht möglich
ist und eigentlich keine Mißverständnisse aufkommen können.
15
vgl. ,, Handwörterbuch zur deutschen Volkskunde" (1930/31, Bd. III, S.767).
16
vgl. Haining (1994, S.245).
12
c) Auch die Schuld der Hinterbliebenen (dann: Bezugspersonen) kann die
Seele zurückbefehlen, falls z.B. die Bekundung des letzten Willens mißachtet
wird, eine ungerechte Nachlaßverteilung stattfindet oder gebrochene Ver-
sprechen im Vordergrund stehen.
d) Eine Schuld kann gewiß auch beim Verschiedenen selbst liegen (vgl. van
Loon, 1998, S.81f.), die sich meist vor dem Hintergrund unaufgedeckter
Verbrechen begründet. In solchem Falle symbolisiert das Spuken die
Vollstreckung der Gerechtigkeit: Das Gespenst kann erst zum Zeitpunkt der
Pflichterfüllung bzw. der Wiedergutmachung erlöst werden.
e) Die charakterliche Beschaffenheit des Toten ist ebenfalls als
Erklärungsmöglichkeit für seine jenseitige Existenz zulässig: Ausgeprägte
Eigenschaften eines Menschen (Bösartigkeit, Lebensgier, Willensstärke,
Gewalttätigkeit) werden hier durch den Tod und den Begräbnisritus nicht
gebrochen und erhalten die Verbindung zu den Lebenden aufrecht.
f) Eine weitere verbreitete Theorie in diesem Kontext bezieht sich auf das
Sinnen nach Rache hinsichtlich des erfahrenen Unrechts (Mord, Wortbruch,
Verleumdung).
17
Das Gespenst muß sich also aufgrund eines unabgeschlossenen Lebens oder
einer nicht erbrachten Pflichtausübung zum spuken berufen fühlen. Es nimmt
einen beträchtlichen Anteil seines menschlichen Vor-Daseins mit auf die andere
Seite. Dieser Anteil prägt und definiert die Art des Gespenstes, den Umfang des
Schreckens und die Weise der Erlösung. Die Beschaffenheit der
gespenstischen Existenz wird so -oft schon lange vor dem eigentlichen
Wiedergang- auf einer irdischen Matrix festgelegt.
3.3. Manifestation und Darstellung
Nach dieser recht konkreten Auflistung stellt sich die Frage nach der
eigentlichen Erscheinungsform des Gespenstes: Da es dem Menschen seit
jeher schwer fällt, sich die durch den Volksglauben definierte Immaterialität
eines Gespenstes gegenständlich vorzustellen, bestehen logischerweise
genauso viele Darstellungsvarianten, wie es die fast unbegrenzte menschliche
17
vgl. van Loon (1998, S.82).
13
Phantasie billigt (vgl. Wilpert, 1994, S.13ff.). Es wäre ja schließlich auch
literarisch eine Katastrophe, eine Erscheinung mit dem Prädikat Nicht-
Vorhanden-Sein bildlich umsetzen zu wollen, weil in diesem Falle jegliches
angsterzeugende Mittel fehlen und sich der Leser aufgrund der abwesenden
Wirkung denkbar langweilen würde. So gebiert das Menschenhirn nach und
nach Manifestationsvarianten, die sich in den Kategorien ,, hörbare, sichtbare
oder taktile Manifestationen [...], die als Auditionen, Visionen bzw. Sensibilitäten
wahrgenommen werden" (Wilpert, 1994, S.14), ausdrücken.
Akustische Phänomene: Sobald das Sehvermögen reduziert bzw. außer Kraft
gesetzt wird (in besonderem Hinblick auf die Dunkelheit zur Nacht), verstärkt
sich laut der Psychologie die auditive Wahrnehmungsfähigkeit. Dieser Umstand
bietet eine hervorragende Basis für die Versuche des Gespenstes, sich
akustisch bemerkbar zu machen.
18
Diese Versuche stellen sich durch
Klopfgeräusche, Poltern
19
, Schritte, Kettengeklirr und das klassische Heulen
dar. Verständliche Artikulationen treten allerdings ohne das Visuelle nur selten
auf, weil des Gespenst in der Regel etwas sprachträge ist.
Visuelle Phänomene: In diesem Falle zeigt das Gespenst eine wahre
Bandbreite von Manifestationen (vgl. van Loon, 1998, S.72ff.), die sich von der
amorphen Lichterscheinung, über gestaltlose Nebelwolken, schemenhafte und
durchsichtige Darstellungen bis hin zur anthropomorphen bzw. vollkörperlichen
Erscheinung, die durchaus die Fähigkeit zur Konturveränderung besitzt und oft
auch unter Zuhilfenahme der Akustik agiert, erstreckt. Diese Vollkörper-
Manifestationen haben die Eigenschaft, kein Spiegelbild und keinen
Schattenwurf zu besitzen.
20
Nun kann es auch passieren, daß sich die
letztgenannte Erscheinungsweise partiell auf bestimmte Körperteile beschränkt
wie z.B. die legendäre Geisterhand
21
, die sich im Volksglauben in der Form
einer Geisterohrfeige als Bekräftigung einer Warnung dem Irdischen
18
Der Spiritismus geht davon aus, daß es dem Wiedergänger arge Probleme bereitet, sich dem
Menschen überhaupt erst bemerkbar zu machen, so daß er diese kräfteschonende
Erscheinungsform wählt (vgl. Wilpert, 1994, S.14).
19
Hier offenbart sich wieder einmal das Scheitern der Differenzierungsversuche (zu enger
Bezug zur Begrifflichkeit Poltergeist bzw. Spuk).
20
Das literarische Gespenst setzt sich über diese Einschränkungen manchmal hinweg. Im
Spiritismus erscheint diese Darstellungsvariante als ,, Astralleib" (Wilpert, 1994, S.15).
21
Als literarische Beispiele: vgl. Quiller-Couchs ,, Das Händepaar" , in ,, Die unheimlichsten
Gespenstergeschichten" (1978, S. 40ff.); vgl. Le Fanus ,,Die Gespensterhand" , in ,, Geister-
geschichten" (1996, S.37ff.).
14
vergegenwärtigt. Was das Voll-Visuelle betrifft, so muß das Gespenst einen
Kompromiß zwischen der wiedererkennbaren Menschengestalt und der angst-
erzeugenden, durch die Grabesverhältnisse verunstalteten Erscheinung finden.
Hinsichtlich der Kleidung eines Gespenstes kann man behaupten, daß es
entweder keinen Wert auf Schick und Eleganz legt oder daß sein Fundus
einfach recht beschränkt ist (Wildes ,, Gespenst von Canterville"
22
entspricht
wohl nur literarischem Wunschdenken, da die gespenstische Wirklichkeit etwas
anders aussieht). Sie müssen sich also entscheiden, ob sie das zu ihren
Lebzeiten Übliche am Leibe tragen oder ob sie im klassischen Totenhemd
erscheinen. Die erste Möglichkeit ist natürlich einfacher für den Bespukten
nachzuvollziehen und der Erlösung des Gespenstes dienlicher, da sie Hinweise
auf die Todesart geben kann (wassertriefende, erdbefleckte oder blut-
verschmierte Kleidung).
Taktile Phänomene: Diese beziehen sich ganz einfach auf Minimalmanifesta-
tionen wie z.B. auf die Wahrnehmung plötzlicher Kälte, eines eisigen Luftzugs
oder eines unerklärlichen Windstoßes in einem abgeschlossenen Raum.
Abschließend zu diesem Teilkapitel muß noch erwähnt werden, daß alle Be-
völkerungsgruppen und beiderlei Geschlechter im Wiedergängertum vertreten
sind, daß sich das Durchschnittsalter eines Gespenstes logischerweise über
dem der Lebenden befindet, daß sie außerhalb des Raum-Zeit-Gefüges ihren
Fokus finden und daß ihre Daseinserwartung nicht zu bestimmen ist. Zudem ist
die Psyche eines Gespenstes aufgrund seines Ursprungs eine der mensch-
lichen Psyche ähnliche.
3.4. Die Lokalisierung
Dem Volksglauben nach sind Gespenster an gewisse Örtlichkeiten gebunden,
die sich über die menschliche Phantasie meistens als überaus romantische
bzw. schaurige Stätten darstellen (Friedhöfe, alte Landhäuser, Burgen und
Schlösser, Klöster und Kirchen, Glockentürme und verlassene Ruinen).
23
Tatsächlich wird das Gespenst auf rein folkloristischer Ebene fast aus-
22
Wilde (1980, S.188ff.). Hier wird auch der Ursprung des Gespenstes ,, Hui Buh" (Alexander-
Burgh, 1978; Halver, 1979) deutlich, das sich eindeutig auf das Canterville-Gespenst bezieht
und die eigentliche Wiege meines Interesses für diesen Themenkomplex darstellt.
15
schließlich an Orten angesiedelt, zu denen es zu Lebzeiten oder durch den
Umstand des Todes einen Bezug hatte
24
(Schlachtfelder und Exekutionsplätze,
Brücken und Seeufer, Mordstätten und Tatorte). Zur Identifikation und zur
Erlösung des Gespenstes stellen diese feststehenden Örtlichkeiten natürlich
notwendige Hinweise.
3.5. Die temporisierte Erscheinung
Von Mitternacht bis ein Uhr dieser Zeitrahmen ist wohl klassisch für das
Agieren des Gespenstes. Außer bei zwingenden Gründen favorisiert es diese
Spanne, um seinen primären Pflichten nachzukommen. In manchen Kultur-
bzw. Landschaftskreisen ist allerdings auch die Stunde vor Mitternacht als
zeitliches Spukdomizil verbreitet, und in Südeuropa dient der Mittag, die
sogenannte Pansstunde
25
als Geisterstunde. Das Gespenst existiert zwar
außerhalb der Zeit, ist aber augenscheinlich doch innerhalb dieser Zeitlosigkeit
an gewisse temporelle Regeln gebunden, die bei Nichtbeachtung streng
geahndet werden können. In manchen Geschichten und Erzählungen wird die
Waltenszeit einer Erscheinung vom Abendrot bis zum ersten Hahnenschrei
(ähnlich wie beim Vampir) ausgedehnt, da die ja recht kurze Zeitspanne
herzlich wenig Aktionsraum läßt. In diesem Falle werden gerne die zwölf langen
Winternächte präferiert, auch der düsteren, unwirtlichen Atmosphäre wegen.
Neben der relativ festgelegten Uhrzeit muß noch auf die Periodik hingewiesen
werden (vgl. Wilpert, 1994, S.20), die Angaben -durch die oft gleichen Intervalle
(bestimmter Wochen-, Monats- oder Jahrestag, bestimmte Kirchenfeiertage)-
über den Spukhintergrund gibt (Todes- oder Verbrechenstag).
Der Umstand schließlich, der die Existenzdauer des Gespenstes begründet,
wird durch den Zeitpunkt der Erlösung festgelegt. Durch diese Erlösung wird
der unheimliche Bann, der es an die irdische Welt fesselt und damit auch die
Zeit aufgehoben.
23
vgl. Wilpert (1994, S.18).
24
vgl. van Loon (1998, S.83f.).
25
Aus der griechischen Religion stammt die Vorstellung, daß Pan (aus Arkadien stammender
Hirtengott), dargestellt mit halbtierischem Kopf und Bockshörnern, in der sommerlichen
Mittagshitze bei den Menschen den sprichwörtlichen ,, panischen Schrecken" verbreitet (auch oft
vervielfältigt und als Mittagsdämonen umschrieben). (dtv Lexikon, 1990, Bd.13, S.310).
16
3.6. Die Wahrnehmung
Sowohl der Mensch als auch das Gespenst selbst unterliegen gewissen
Einschränkungen bezüglich der Wahrnehmung des irdischen bzw. jenseitigen
Gegenübers und seiner Umwelt. Dem Spiritismus zufolge nimmt nur ein kleiner
Anteil der Gespenster sein Umfeld und Veränderungen in der Umgebung
überhaupt wahr, d.h., daß starre Spukabläufe durch diese örtlichen
Veränderungen (zugemauerte Türen, umgebaute Treppenfluchten) nicht
unbedingt beeinflußt werden müssen. Dies bedeutet nicht, daß die
Erscheinungen nicht wissen, wo sie sich befinden, nur sind sie dermaßen in
ihrem Auftrag gefangen, daß die Umgebung einen sekundären Platz einnimmt.
Umgekehrt ist nicht jeder Mensch dazu befähigt, Gespenster wahrzunehmen,
weil der Instinkt in großen Bereichen bekanntlich durch das Kopfdenken
unterbunden wird; anders bei Tieren, die anscheinend eher eine Verbindung zur
Jenseitswelt aufgrund ihrer noch unverfälschten Instinkte schaffen können (lit.
Ums. vgl. Skipp / Spector, 1982, S.48). Eine Interaktion zwischen Mensch und
Gespenst kommt nun lediglich auf dem Fundament der dem Gespenst
auferlegten Problemlösung zustande, welche die Notwendigkeit der Kontakt-
aufnahme mit dem Menschen zwangsläufig beinhaltet.
26
Damit sind die für das Verstehen um das Wirken eines Gespenstes wichtigsten
Wesenszüge und Hintergründe aus dem Volksglauben preisgegeben, so daß
ich nun allmählich auf das Gespenst in der Gespenstergeschichte und auf ihre
Mechanismen und ihre Poetik überleiten möchte.
4. Das literarische Gespenst
Es ist zu betonen, daß, will man sich mit dem Gespenst in der Gespenster-
geschichte adäquat auseinandersetzen, die Ergebnisse aus dem Volksglauben
und aus der Wort- und Begriffsgeschichte, die sich über Jahrhunderte
herausgeprägt haben, eine obligatorische Analysebasis bilden, da sich diese
Literaturgattung natürlich in erster Linie auf diese Hintergründe beruft und
26
Gerade im literarischen Bereich wird auf eine Einhaltung der im Volksglauben geschaffenen
Jenseitsgesetze und der pseudologischen Mechanismen und Wechselwirkungen zugunsten
des Spannungsaufbaus einer Geschichte nicht unbedingt viel Wert gelegt.
17
gewisse Modifikationen
27
ohne dieses Vorwissen vielleicht nicht ganz ver-
ständlich erscheinen bzw. gar nicht entdeckt würden. Der grundsätzliche
Unterschied zwischen dem folkloristisch definierten und dem literarischen
Gespenst bleibt aber von den Bereicherungen der literarischen Gespenster-
geschichte am Volksglauben weitestgehend unberührt. Das eine wird über die
Überlieferung geglaubt, das andere muß aber als Kunstprodukt erst noch
glaubhaft gemacht werden (vgl. Wilpert, 1994, S.22).
4.1. Eigensinnig und kummervoll warnend
Vom Erscheinungs- und Charakterbild her präsentieren sich die Gespenster
aus der Literatur nicht mehr ausschließlich als kettenrasselnde Ungetüme in
blutbefleckten oder erdverschmierten Laken und Gewändern, von denen noch
der Volksglaube erzählt, sondern auf eine neuartige Weise schemenhaft,
unkörperlich, zeitweise botschaftslos und stumm. Bedeutungsvoll ist in diesem
Zusammenhang E.T.A. Hoffmanns Werk ,, Die Serapionsbrüder" (1995), erstellt
im Zeitrahmen von 1819 bis 1821, welches die typischen Elemente der
Gespenstergeschichte verinnerlicht und den erwähnten Erscheinungs- bzw.
Wesenswandel des Gespenstes ausdrucksstark vermittelt. Hoffmann, der zu
seiner Zeit weit über Deutschlands Grenzen hinaus namhafte Schriftsteller wie
Gogol, Baudelaire oder Poe beeinflußt, thematisiert des öfteren die
,,Nachtseiten" des Zivilisationsprozesses und stellt das ,, Unheimliche, das
Dämonische, den Wahnsinn und das Verbrechen in den Mittelpunkt"
28
seiner
Schriften.
29
Was die Vorstellung von Gespenstern als Abgesandte einer höheren Macht
anbelangt, so verweist sie die Gespensterliteratur in den Bereich von ,, Ammen-
märchen" und ,, gefährlichen Wunschphantasien" (Brittnacher, 1994, S.75). Dies
27
Die literarische Phantasie kennt keine Grenzen, und die Kombination mit Ironie,
Gesellschaftskritik und diversen fremdartigen Phantasiemotiven bleibt nicht aus.
28
,, Deutsche Literaturgeschichte" (1992, S.194).
29
Durch seinen Roman ,, Die Elixiere des Teufels" (1994) von 1815 verdeutlicht Hoffmann, wie
fließend die Übergänge zur Schauerromantik sind, die sich in ihrem Interesse für die dunklen
Seiten der menschlichen Existenz, für das Abgründige und Geheimnisvolle von der Aufklärung
vehement unterscheidet. Zu seinen berühmtesten Erzählungen gehört in diesem
Zusammenhang auch ,, Der Sandmann" (1991), ursprünglich aus dem ersten Teil der
,,Nachtstücke" (1990, S.7ff.) von 1817; dort stellt er die verdrängten Ängste, Träume, Wünsche
und Phantasien des gemeinen Bürgers dar.
18
wird von der anmaßenden Behauptung noch unterstützt, ein Gespenst aus
seinem Wirkungsturnus heraus bei Bedarf mit einer feststehenden Gebets-
formel herbeizitieren und eigenen Zwecken dienstbar machen zu dürfen.
30
Allerdings bildet das letztere ohnehin die Ausnahme in Gespenster-
erzählungen. Das Motiv der willentlichen Anrufung dämonischer und anderer
unerklärlicher Kräfte gehört in das Gebiet des Satanismus hier sind die
Herausforderung des Jenseits und die Selbstermächtigung konstitutiv (vgl.
Cavendish, 1969, S.367ff.). Gespenstergeschichten hingegen wollen die Idee
des Fatalismus vermitteln, nicht den Gedanken an die fatalen Folgen des
eigenen Handelns.
Nun müssen auch in literarischen Breiten die Gespenster die Begrenzung ihrer
Spukzeit in Kauf nehmen, ein- und ausgeläutet meist durch die Burg- oder
Kirchturmuhr. Dieser Umstand nimmt ihnen jedoch nichts von ihrem Schrecken,
sondern steigert die Furcht der Wartenden und vermeintlich Wissenden noch.
Der berüchtigte Glockenschlag, der die Schnittstelle zweier Tage als eigentlich
nicht existente Zone auf akustische Weise bezeichnet, unterstützt als Symbol
der unwiderbringlichen Endgültigkeit noch das Ahnen und Fürchten und wird oft
mit gleichzeitigem Auftreten eines eisigen Windhauchs und plötzlich
schlagender Türen dargestellt.
31
Glockenklang, Weltangst, Jenseitsfurcht und
Gespenstererscheinung stehen in engem Zusammenhang und charakterisieren
als Ganzes die hintergründige Begebenheit des Übernatürlichen.
Im Motiv der Glocke verbinden sich im Laufe der Zeit das Vanitas-Denken des
Barock und seine Vergänglichkeitsmetaphorik mit der christlichen Apokalyptik
(vgl. Brittnacher, 1994, S. 78f.). Der Stundenschlag bedeutet das Zeitver-
streichen, der Hall des Klanges die Ewigkeit, in der die Zeit eingebettet ist. Der
Kult um die Glocke, wie er sich in unzähligen Gespenstergeschichten als letzter
Stundenschlag der Uhr wiederholt, mit deren Erklingen die Gespenster
erscheinen, hat zudem einen tieferen religionshistorischen Sinn. Die Glocke
stellt die kultische Verbindung zwischen Himmel und Erde dar. Vor allem aber
zeigt die Glocke das Vergehen der Zeit an ,, und damit die Nichtigkeit des
30
Anmaßend, weil der Eigensinn des Gespenstes, eingebunden in die festen Prinzipien der
literarischen Gespenstergeschichte, in keiner Weise verneint bzw. unterschätzt werden sollte.
Es ist zwar an Regeln gebunden, doch schließt dieser Umstand ein gewisses mentales
Eigenleben bezüglich seiner Wünsche, Bedürfnisse und seines Willens natürlich nicht aus.
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Originalausgabe
- Erscheinungsjahr
- 1999
- ISBN (eBook)
- 9783832415969
- ISBN (Paperback)
- 9783838615967
- Dateigröße
- 824 KB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- Universität Bremen
- Note
- 2,0
- Schlagworte
- gespenstergeschichten begriffsgeschichte volksglauben wertgeschichte blonder eckbart
- Produktsicherheit
- Diplom.de