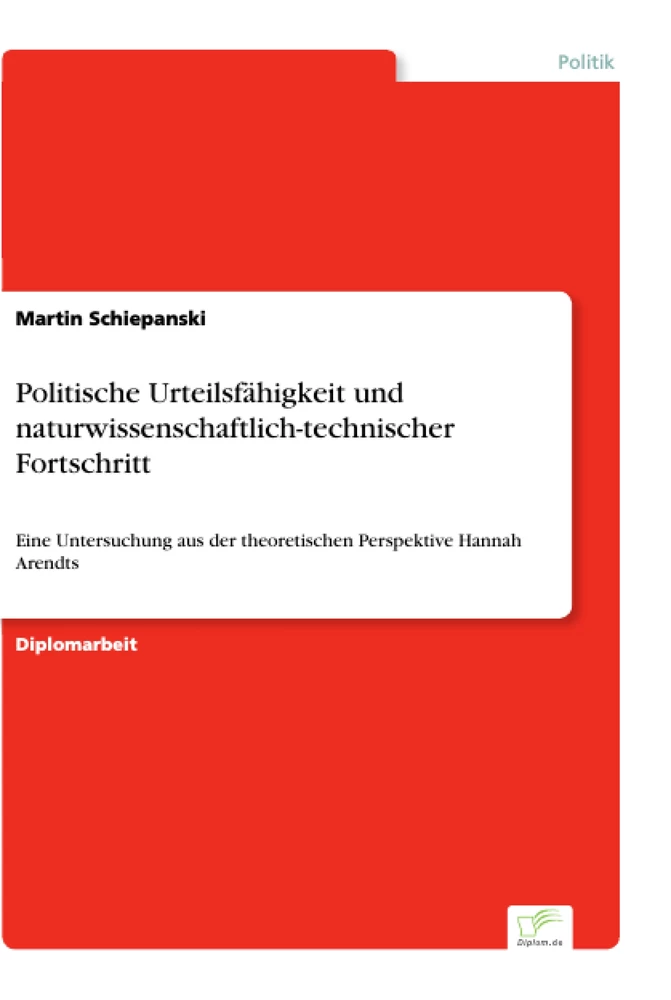Politische Urteilsfähigkeit und naturwissenschaftlich-technischer Fortschritt
Eine Untersuchung aus der theoretischen Perspektive Hannah Arendts
©1999
Diplomarbeit
90 Seiten
Zusammenfassung
Inhaltsangabe:Einleitung:
Der Fortschritt in der Technik und die naturwissenschaftliche Forschung waren lange Zeit Inbegriff für den Fortschritt der Menschheit allgemein. Spätestens nach den ersten Freisetzungen radioaktiver Strahlung wurde Naturwissenschaft und Technik nicht mehr vorbehaltlos als Segen für die Bevölkerung angesehen.
Die öffentliche Auseinandersetzung mit naturwissenschaftlich-technischen Innovationen ist noch sehr jung. Auch der Politik fällt es schwer gegenüber der Technik Stellung zu beziehen. Das Urteilen über Technik und Naturwissenschaft wird in dieser Arbeit thematisiert.
Es mag befremdlich klingen, daß ich ausgerechnet die Theorie Hannah Arendts als Grundlage für die Untersuchung benutze. Im Zusammenhang mit naturwissenschaftlichen Themen wurde sie selten diskutiert. Dennoch halte ich die Heranziehung ihrer Schriften für sehr interessant.
In ihrem Gesamtwerk finden sich theoretische Aspekte, die sich sowohl mit der Naturwissenschaft und der Technik als auch mit dem Urteilen sowie mit dem Handeln in der Gemeinschaft befassen. Meine Motivation für diese Arbeit erwächst aus dem Versuch, diese Elemente zu verbinden und auf den naturwissenschaftlich-technischen Komplex anzuwenden.
Gang der Untersuchung:
Im ersten Abschnitt der hier vorgelegten Arbeit werde ich die Gedankengänge Arendts nachzeichnen, ohne auf eine kritische Bewertung zu verzichten.
Im zweiten Teil beschreibe ich einen Aspekt ihres späten Schaffens: den des politischen Urteils. Ihr letztes, nur in Fragmenten vorhandenes und später, posthum, veröffentlichtes Werk Das Urteilen befaßt sich mit der politischen Urteilskraft, einem freien, nicht an Beispielen festgemachten Bewerten.
Das dritte Kapitel beschäftigt sich mit aktuellen naturwissenschaftlichen Problemen, unter Verwendung der Schriften von Ulrich Beck.
Im Anschluß daran befasse ich mich mit einem recht neuen poltischen Instrument, der Technikfolgenabschätzung, speziell mit dem Büro für Technikfolgenabschätzung im Bundestag (TAB).
Der anschließende Abschnitt handelt vom Vergleich des TAB mit der vorher entfalteten Theorie Hannah Arendts.
Im Mittelpunkt des vorletzten Kapitels steht die Verantwortung von Forschern, Ingenieuren und Mitarbeitern der Technikfolgenabschätzung, ehe im finalen Abschnitt ein Gesamtfazit erstellt wird.
Inhaltsverzeichnis:Inhaltsverzeichnis:
Danksagung5
Literaturhinweis6
Zur Einführung7
Vorwort8
1.Naturwissenschaftlich-technischer Fortschritt in der Moderne und die […]
Der Fortschritt in der Technik und die naturwissenschaftliche Forschung waren lange Zeit Inbegriff für den Fortschritt der Menschheit allgemein. Spätestens nach den ersten Freisetzungen radioaktiver Strahlung wurde Naturwissenschaft und Technik nicht mehr vorbehaltlos als Segen für die Bevölkerung angesehen.
Die öffentliche Auseinandersetzung mit naturwissenschaftlich-technischen Innovationen ist noch sehr jung. Auch der Politik fällt es schwer gegenüber der Technik Stellung zu beziehen. Das Urteilen über Technik und Naturwissenschaft wird in dieser Arbeit thematisiert.
Es mag befremdlich klingen, daß ich ausgerechnet die Theorie Hannah Arendts als Grundlage für die Untersuchung benutze. Im Zusammenhang mit naturwissenschaftlichen Themen wurde sie selten diskutiert. Dennoch halte ich die Heranziehung ihrer Schriften für sehr interessant.
In ihrem Gesamtwerk finden sich theoretische Aspekte, die sich sowohl mit der Naturwissenschaft und der Technik als auch mit dem Urteilen sowie mit dem Handeln in der Gemeinschaft befassen. Meine Motivation für diese Arbeit erwächst aus dem Versuch, diese Elemente zu verbinden und auf den naturwissenschaftlich-technischen Komplex anzuwenden.
Gang der Untersuchung:
Im ersten Abschnitt der hier vorgelegten Arbeit werde ich die Gedankengänge Arendts nachzeichnen, ohne auf eine kritische Bewertung zu verzichten.
Im zweiten Teil beschreibe ich einen Aspekt ihres späten Schaffens: den des politischen Urteils. Ihr letztes, nur in Fragmenten vorhandenes und später, posthum, veröffentlichtes Werk Das Urteilen befaßt sich mit der politischen Urteilskraft, einem freien, nicht an Beispielen festgemachten Bewerten.
Das dritte Kapitel beschäftigt sich mit aktuellen naturwissenschaftlichen Problemen, unter Verwendung der Schriften von Ulrich Beck.
Im Anschluß daran befasse ich mich mit einem recht neuen poltischen Instrument, der Technikfolgenabschätzung, speziell mit dem Büro für Technikfolgenabschätzung im Bundestag (TAB).
Der anschließende Abschnitt handelt vom Vergleich des TAB mit der vorher entfalteten Theorie Hannah Arendts.
Im Mittelpunkt des vorletzten Kapitels steht die Verantwortung von Forschern, Ingenieuren und Mitarbeitern der Technikfolgenabschätzung, ehe im finalen Abschnitt ein Gesamtfazit erstellt wird.
Inhaltsverzeichnis:Inhaltsverzeichnis:
Danksagung5
Literaturhinweis6
Zur Einführung7
Vorwort8
1.Naturwissenschaftlich-technischer Fortschritt in der Moderne und die […]
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
ID 1292
Schiepanski, Martin: Politische Urteilsfähigkeit und naturwissenschaftlich-technischer Fortschritt: Eine
Untersuchung aus der theoretischen Perspektive Hannah Arendts / Martin Schiepanski - Hamburg:
Diplomarbeiten Agentur, 1999
Zugl.: Bremen, Universität, Diplom, 1999
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte, insbesondere die der
Übersetzung, des Nachdrucks, des Vortrags, der Entnahme von Abbildungen und Tabellen, der
Funksendung, der Mikroverfilmung oder der Vervielfältigung auf anderen Wegen und der Speicherung
in Datenverarbeitungsanlagen, bleiben, auch bei nur auszugsweiser Verwertung, vorbehalten. Eine
Vervielfältigung dieses Werkes oder von Teilen dieses Werkes ist auch im Einzelfall nur in den
Grenzen der gesetzlichen Bestimmungen des Urheberrechtsgesetzes der Bundesrepublik
Deutschland in der jeweils geltenden Fassung zulässig. Sie ist grundsätzlich vergütungspflichtig.
Zuwiderhandlungen unterliegen den Strafbestimmungen des Urheberrechtes.
Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in diesem Werk
berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme, daß solche Namen im Sinne
der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei zu betrachten wären und daher von
jedermann benutzt werden dürften.
Die Informationen in diesem Werk wurden mit Sorgfalt erarbeitet. Dennoch können Fehler nicht voll-
ständig ausgeschlossen werden, und die Diplomarbeiten Agentur, die Autoren oder Übersetzer
übernehmen keine juristische Verantwortung oder irgendeine Haftung für evtl. verbliebene fehlerhafte
Angaben und deren Folgen.
Dipl. Kfm. Dipl. Hdl. Björn Bedey, Dipl. Wi.-Ing. Martin Haschke & Guido Meyer GbR
Diplomarbeiten Agentur, http://www.diplom.de, Hamburg 2000
Printed in Germany
2
Inhalt
DANKSAGUNG 4
LITERATURHINWEIS 5
ZUR EINFÜHRUNG 6
VORWORT 7
1 NATURWISSENSCHAFTLICH-TECHNISCHER FORTSCHRITT IN
DER MODERNE UND DIE DARAUS RESULTIERENDE GEFAHR 8
1.1 D
IE
V
ERSCHIEBUNG DES ARCHIMEDISCHEN
P
UNKTS
12
1.2 D
ER
V
ERLUST DER
S
PRACHE IN DER
N
ATURWISSENSCHAFT
16
1.3 D
ER
F
ORSCHER ALS
C
O
-A
KTOR UND DAS UNNATÜRLICHE
A
USLÖSEN
VON IRREVERSIBLEN
N
ATURPROZESSEN
17
1.4 D
IE
,,
HYPOTHETISCHE
" N
ATUR
20
1.5 D
ER
P
ROZEßCHARAKTER DER
N
ATUR
21
1.6 D
AS
V
ERSCHWINDEN DER
K
ONTEMPLATION UND DIE
F
OLGEN FÜR DEN
W
AHRHEITSBEGRIFF
22
1.7 T
ECHNISCH
-
INSTRUMENTELLES
D
ENKEN
25
1.8 F
OLGEN FÜR DAS POLITISCHE
S
YSTEM
27
2 DAS POLITISCHE URTEIL 29
2.1 D
IE UNPARTEIISCHE
P
OSITION DES
Z
USCHAUERS
31
2.2 R
EFLEKTIERENDES UND SUBSUMIERENDES
U
RTEIL
36
2.3 D
ER
G
EMEINSINN
37
2.4 E
XKURS
: D
ISKREPANZEN ZWISCHEN
A
RENDTS FRÜHEN UND SPÄTEREN
S
CHRIFTEN BEZÜGLICH DES
U
RTEILENS
40
3 DER UMGANG MIT DER TECHNIK IN DER RISIKOGESELLSCHAFT 46
3.1 T
ECHNIKREZEPTION UND DAS
I
NSTRUMENT DER
T
ECHNIKFOLGENABSCHÄTZUNG
53
3.2 D
AS
B
ÜRO FÜR
T
ECHNIKFOLGENABSCHÄTZUNG BEIM
D
EUTSCHEN
B
UNDESTAG
(TAB)
56
3
3.3 P
OLITIKBERATUNG UND
Ö
FFENTLICHKEITSARBEIT
: D
IE
Z
IELRICHTUNG
VON
TA
AM EXEMPLARISCHEN
B
EISPIEL DER
V
ORGEHENSWEISE DES
TAB
59
4 URTEILEN IN DER MODERNE 62
4.1 U
RTEILEN IM NATURWISSENSCHAFTLICH
-
TECHNISCHEN
B
EREICH
:
H
ANNAH
A
RENDTS NICHTGESCHRIEBENE
A
BHANDLUNG
63
4.2 G
EMEINSINN UND
TA
64
4.3 U
NPARTEILICHKEIT UND
TA
67
4.4
M
ITTEILBARKEIT UND
TA
68
4.4.1 M
ETHODEN UND IHRE
U
NZULÄNGLICHKEITEN
68
4.4.2 P
ARTIZIPATION UND
D
ISKURSIVITÄT
70
5 ÖFFENTLICHES HANDELN IM NATURWISSENSCHAFTLICH-
TECHNISCHEN KONTEXT 72
5.1 V
ERANTWORTLICHES
U
RTEILEN
72
5.2 D
IE
V
ERANTWORTUNG DER
I
NGENIEURE
74
5.3 T
ECHNISCHE
V
ERANTWORTUNG UND
G
ESELLSCHAFTSBILD
76
5.4 D
AS
TAB
UND DIE GESELLSCHAFTLICHE
V
ERANTWORTUNG
77
6 FAZIT ODER WAS VON HANNAH ARENDT ZU LERNEN IST 78
LITERATURVERZEICHNIS 81
ERKLÄRUNG 86
4
Danksagung
An dieser Stelle möchte ich all jenen herzlich danken, die zu der Entstehung die-
ser Arbeit beigetragen haben.
Mein Dank gilt Sabine Grützner, die während der gesamten Arbeitsphase viel Ge-
duld aufbrachte und mich mit kritischer Begutachtung und Hinweisen auf Fehler-
quellen bei der Ausarbeitung maßgeblich unterstützte.
Ich danke Werner Krauß, der mir mit zügigem Korrekturlesen die Endphase der
Fertigstellung erheblich erleichterte.
Vor allem danke ich Frau Professor Eva Senghaas-Knobloch für die engagierte
und umfassende Betreuung während der Diplomphase sowie für Anregungen und
Kritik. Ferner danke ich ihr für den Hinweis auf die Tagung 25 Jahre Technikfol-
genabschätzung in Deutschland, am 17. und 18. Juni 1998 in Bonn. Das bei der
dortigen Veranstaltung erfahrene, hat die vorliegende Arbeit zu einem nicht unbe-
trächtlichen Teil bereichert.
Martin Schiepanki
5
Literaturhinweis
Alle Werke Hannah Arendts, auf die in den Anmerkungen verwiesen werden, tau-
chen als Kürzel auf. Bei den Abkürzungen orientiere ich mich an den in der ein-
schlägigen Literatur gebräuchlichen. Im einzelnen handelt es sich um folgende
Kürzel und Werke (genaue Angaben zu den Schriften befinden sich im angefügten
Literaturverzeichnis):
EJ = Eichmann in Jerusalem
LG = Vom Leben des Geistes
MG = Macht und Gewalt
U = Das Urteilen
VA = Vita activa oder Vom tätigen Leben
WL = Wahrheit und Lüge in der Politik
6
Zur Einführung
Die Physiker
NEWTON: Wenn Sie da neben der Türe den Schalter drehen, was
geschieht, Richard?
INSPEKTOR: Das Licht geht an.
NEWTON: Sie stellen einen elektrischen Kontakt her. Verstehen Sie
etwas von Elektrizität, Richard?
INSPEKTOR: Ich bin kein Physiker.
NEWTON: Ich verstehe auch wenig davon. Ich stelle nur aufgrund von
Naturbeobachtungen eine Theorie darüber auf. Diese Theorie
schreibe ich in der Sprache der Mathematik nieder und erhalte
mehrere Formeln. Dann kommen die Techniker. Sie kümmern
sich nur noch um die Formeln. Sie gehen mit der Elektrizität
um wie der Zuhälter mit der Dirne. Sie nützen sie aus. Sie stellen
Maschinen her, und brauchbar ist eine Maschine erst dann,
wenn sie von der Erkenntnis unabhängig geworden ist, die zu
ihrer Erfindung führte. So vermag heute jeder Esel eine
Glühbirne zum Leuchten zu bringen - oder eine Atombombe
zur
Explosion.
1
1
aus: Dürrenmatt, Friedrich: Die Physiker. Eine Komödie in zwei Akten, Zürich 1985, S. 22 f
7
Vorwort
Der Fortschritt in der Technik und die naturwissenschaftliche Forschung waren
lange Zeit Inbegriff für den Fortschritt der Menschheit allgemein. Spätestens nach
den ersten Freisetzungen radioaktiver Strahlung wurde Naturwissenschaft und
Technik nicht mehr vorbehaltlos als Segen für die Bevölkerung angesehen.
Die öffentliche Auseinandersetzung mit naturwissenschaftlich-technischen Inno-
vationen ist noch sehr jung. Auch der Politik fällt es schwer gegenüber der Tech-
nik Stellung zu beziehen. Das Urteilen über Technik und Naturwissenschaft wird
in dieser Arbeit thematisiert.
Es mag befremdlich klingen, daß ich ausgerechnet die Theorie Hannah Arendts als
Grundlage für die Untersuchung benutze. Im Zusammenhang mit naturwissen-
schaftlichen Themen wurde sie selten diskutiert. Dennoch halte ich die Heranzie-
hung ihrer Schriften für sehr interessant.
In ihrem Gesamtwerk finden sich theoretische Aspekte, die sich sowohl mit der
Naturwissenschaft und der Technik als auch mit dem Urteilen sowie mit dem
Handeln in der Gemeinschaft befassen. Meine Motivation für diese Arbeit er-
wächst aus dem Versuch, diese Elemente zu verbinden und auf den naturwissen-
schaftlich-technischen Komplex anzuwenden:
Die Ursachen und Auswirkungen von naturwissenschaftlich-technischer For-
schung auf das politisch-soziale Verhalten der Menschen unter anthropologischer
Sichtweise. Auf die stiefmütterliche Behandlung Hannah Arendts bezüglich dieses
Aspekts weist auch Pieter Tijmes hin:
,,The importance of The Human Condition lies, in my opinion, not in Han-
nah Arendt's contribution to political philosophy, but in the philosophy of science
and technology that reflects on the implications of science and technology for our
8
culture. For a reason that for me is still a riddle, most books dedicated to her ne-
glect this aspect."
2
Hannah Arendt widmet sich vornehmlich im sechsten und letzten Kapitel der Vita
activa diesem Themenbereich. Hinweise lassen sich jedoch auch in anderen Wer-
ken entdecken.
Im ersten Abschnitt der hier vorgelegten Arbeit werde ich die Gedankengänge
Arendts nachzeichnen, ohne auf eine kritische Bewertung zu verzichten.
Im zweiten Teil beschreibe ich einen Aspekt ihres späten Schaffens: den des poli-
tischen Urteils. Ihr letztes, nur in Fragmenten vorhandenes und später, posthum,
veröffentlichtes Werk Das Urteilen befaßt sich mit der politischen Urteilskraft,
einem freien, nicht an Beispielen festgemachten Bewerten.
Das dritte Kapitel beschäftigt sich mit aktuellen naturwissenschaftlichen Proble-
men, unter Verwendung der Schriften von Ulrich Beck.
Im Anschluß daran befasse ich mich mit einem recht neuen poltischen Instrument,
der Technikfolgenabschätzung, speziell mit dem Büro für Technikfolgenabschät-
zung im Bundestag (TAB).
Der anschließende Abschnitt handelt vom Vergleich des TAB mit der vorher ent-
falteten Theorie Hannah Arendts.
Im Mittelpunkt des vorletzten Kapitels steht die Verantwortung von Forschern,
Ingenieuren und Mitarbeitern der Technikfolgenabschätzung, ehe im finalen Ab-
schnitt ein Gesamtfazit erstellt wird.
1
Naturwissenschaftlich-technischer Fortschritt in der
Moderne und die daraus resultierende Gefahr
Es mag befremdlich erscheinen, aus der theoretischen Perspektive Hannah
Arendts eine Diskussion über Folgen und Ursachen naturwissenschaftlich-
2
Tijmes, Pieter: The Archimedean Point and Eccentricity: Hannah Arendt's Philosophy of Sci-
ence and Technology, in: Inquiry, Nr. 35, 1992, S. 389-406, hier: S. 391
9
technischen Fortschritts zu betreiben, zumal die Forschung auf diesem Gebiet erst
in den letzten Jahren spektakuläre Ergebnisse erzielte.
Die theoretische Behandlung dieses Feldes beeinträchtigt das jedoch nicht. Haupt-
ausgangspunkt ist und bleibt der menschliche Eingriff in die Natur. Auch wenn in
den vergangenen dreißig Jahren neue Sachfragen entstanden, wie die Arendt-
Biographin Elisabeth Young-Bruehl anmerkt:
,,Zu der Zeit, als Hannah Arendt Vita activa schrieb, war dieses `Eingrei-
fen in die Natur' eine Frage der Kernspaltung; heute geht es dabei auch um die
DNS-Synthese, um Retortenzüchtungen, um Samenbanken, um Organtransplanta-
tionen und um die künstliche Verlängerung des Lebens."
3
Ausgangspunkt meiner Analyse ist der von Arendt konstatierte Freiheits-
und Sinnverlust in der Moderne.
4
Die Neuzeit mit der Rangerhöhung der Arbeit
habe zu einem Konsumverhalten des ehemals auf körperliche Arbeit festgelegten
Animal laborans geführt, das proportional mit der zunehmenden Freizeit steige.
Die in Folge der Verherrlichung der Arbeit entstandene Arbeitsgesellschaft werde
schließlich von einer ,,Gesellschaft von Jobholders" abgelöst, einer lethargischen,
automatisch funktionierenden Gesellschaft, der Arendt ein wenig gutes Zeugnis
ausstellt:
,,Es ist durchaus denkbar, daß die Neuzeit, die mit einer so unerhörten und
unerhört vielversprechenden Aktivierung aller menschlichen Vermögen und Tä-
tigkeiten begonnen hat, schließlich in der tödlichsten, sterilsten Passivität enden
wird, die die Geschichte je gekannt hat."
5
Auch wenn Arendt hier von der Neuzeit als präsente Zeit spricht, so hat je-
ne nach ihrer eigenen Begrifflichkeit schon zu ihrem Ende gefunden und die Mo-
derne begonnen. Ende der Neuzeit und Beginn der Moderne manifestieren sich an
einem Aspekt der Naturwissenschaft:
3
Young-Bruehl, Elisabeth: Hannah Arendt. Leben, Werk und Zeit, Frankfurt am Main 1996, S.
441f
4
vgl.: Passerin d' Entrèves, Maurizio: The Political Philosophy of Hannah Arendt, London
1994, S. 101
5
VA, S. 411
10
,,Der Trennungsstrich zwischen der Neuzeit und der modernen Welt, die
wir bewohnen, verläuft genau da, wo der Unterschied sich meldet zwischen einer
Wissenschaft, die bereits auf die Natur vom Standpunkt des Weltalls blickt und so
beginnt, sie vollkommen zu beherrschen, und einer nun wirklich ganz und gar
`universal' und kosmisch gewordenen Wissenschaft, die die Prozesse des Weltalls
in die Natur hineinleitet trotz des offenbaren Risikos, ihren Haushalt und damit
das Menschengeschlecht selbst, das in diesem Haushalt gebannt ist, zu vernich-
ten."
6
In diesem Zitat wird nicht nur Arendts Zeiteinteilung deutlich, sondern
gleichfalls ihre Skepsis, bezüglich der Forschung auf dem naturwissenschaftlichen
Sektor.
Doch noch einmal zurück zum Aufstieg der Arbeit. Die ursprüngliche Arbeit, als
weltlose Tätigkeit, die nie zu einem Ende kam, war allein auf die Reproduktion
des menschlichen Körpers bezogen. Die Natur hielt genug Nahrungsmittel parat.
Der Kapitalismus hingegen, der durch die Ausbeutung der Arbeit entstand, sorgte
dafür, daß der Mensch mehr arbeitete, als er für die eigene Lebenserhaltung
brauchte. In ihrer Beschäftigung mit Marx hob Arendt dessen Terminologie der
Arbeitskraft, nämlich jene menschliche Fähigkeit, mehr Ertrag zu leisten, als er in
seinem Leben verbrauchen kann, als besondere Erkenntnis hervor. Als Irrtum be-
zeichnet sie hingegen seine Annahme, daß die unproduktive Arbeit (was Arbeit im
ursprünglichen Sinne immer ist), zu verachten sei:
,,Angesichts der beispiellosen Steigerung der Produktivität in der moder-
nen Gesellschaft lag es nahe, das sich immer gleich bleibende `unproduktive' Ar-
beiten einfach als einen Restbestand aus der Vergangenheit abzutun und der Ar-
beit Qualitäten zuzuschreiben, die nur dem Herstellen zukommen, bzw. von dem
Animal laborans so zu sprechen, als sei es eigentlich Homo faber. Auf dieser
Verwechslung beruht nicht nur Marx' Arbeitstheorie, sondern überhaupt die Glo-
rifizierung der Arbeit in der Neuzeit, [...]"
7
Hannah Arendt kommt somit zu folgendem Schluß:
6
VA, S. 342
7
VA, S. 104 f
11
,,Weltentfremdung und nicht Selbstentfremdung, wie Marx meinte, ist das
Kennzeichen der Neuzeit."
8
Neben dem Arbeiten streicht Hannah Arendt in der Vita activa das Herstellen so-
wie das Handeln als die Tätigkeiten des aktiven Lebens heraus.
Das Herstellen, das einen Anfang und ein definitives Ende hat, sorgt für die Ge-
staltung der Welt, bietet den Individuen eine gewohnte Umgebung. Der Herstel-
lungsprozeß unterliegt der Zweck-Mittel-Kategorie, und Homo fabers Grunderfah-
rung ist nicht der Wechsel von qualvoller Anstrengung und Entspannung, sondern
der Gewalttätigkeit von Kraft und Stärke, müssen die zu bearbeitenden Materiali-
en doch in bestimmte, vorher von einem Modell festgelegte Formen gebracht wer-
den.
Schließlich nennt Arendt das Handeln, welches sie als die eigentlich politische
Tätigkeit beschreibt. Das Handeln konstituiert nach ihrer Theorie erst die öffentli-
che Sphäre, in der Politik stattfinden kann:
,,So steht das Handeln nicht nur im engsten Verhältnis zu dem öffentlichen
Teil der Welt, den wir gemeinsam bewohnen, sondern ist diejenige Tätigkeit, die
einen öffentlichen Raum in der Welt überhaupt erst hervorbringt."
9
Durch den Sprechakt offenbaren sich die Menschen. Sie setzen qua Han-
deln Prozesse in Bewegung, die unabsehbar sind und nicht rückgängig gemacht
werden können. Als Heilmittel existieren allerdings das Versprechen und Verzei-
hen.
10
Um den Themenkomplex nicht weiter zu vertiefen, sei hier abschließend gesagt,
daß Arendt in ihrem opus magnum eine Umwertung der menschlichen Tätigkeiten
ausmachte; das aktive verdrängte das kontemplative Leben.
Wolfgang Heuer, und das spannt den Bogen zum Kern dieser Arbeit, unterstreicht
den Aspekt des Aufstiegs der Wissenschaften als Hauptursache für diese Umwer-
tung:
8
VA, S. 325
9
VA, S. 249
10
vgl.: VA, Kap. 33 u. 34, S. 300-317
12
,,Der traditionelle Vorrang des Sehens und Denkens über das Tun, der vita
contemplativa über die vita activa, verwandelte sich unter dem Eindruck des Auf-
stiegs der modernen Wissenschaften radikal in sein Gegenteil. Nun diktierte nicht
mehr die Vernunft dem Handeln, sondern das Tun dem Erkennen die Regeln."
11
Im folgenden Teil werde ich mich vornehmlich deskriptiv mit den Gedanken
Arendts zum naturwissenschaftlich-technischen Fortschritt auseinandersetzen, oh-
ne jedoch Eckpunkte ihrer Theorie kritiklos zu rezipieren.
Den Begriff ,,Technik" benutze ich in Anlehnung an die Ausführungen Günter
Ropohls, der die ,,Technologie" als Wissenschaft von der ,,Technik" definiert:
,,Während also `Technik' einen bestimmten Bereich der konkreten Erfah-
rungswirklichkeit bezeichnet, meint ,,Technologie", die Menge wissenschaftlich
systematisierter Aussagen über jenen Wirklichkeitsbereich; sprachphilosophisch
formuliert, ist ,,Technik" ein objektsprachlicher, ,,Technologie" dagegen ein me-
tasprachlicher Ausdruck."
12
Das Wort ,,Technik" subsumiert also alle Aspekte der Nutzbarmachung
naturwissenschaftlicher Erkenntnisse. Auf den vorangestellten Wortteil ,,naturwis-
senschaftlich-" möchte ich nicht verzichten, damit noch in der Forschung befindli-
che Elemente, oder Produkte, die sich am Markt nicht durchsetzen konnten, be-
grifflich nicht a priori ausgeblendet sind.
Ich weise darauf hin, daß auch bei der Bewertung naturwissenschaftlich gewonne-
ner Innovationen von ,,Technikfolgenabschätzung" die Rede ist und nicht von
,,Technologiefolgenabschätzung".
1.1
Die Verschiebung des archimedischen Punkts
Im finalen Kapitel der Vita activa greift die Autorin das Thema der Entfremdung
noch einmal auf. Quasi als Steigerung zur Entfremdung der Welt stellt Arendt die
Folgen der Wissenschaften heraus:
11
Heuer, Wolfgang: Hannah Arendt, Hamburg 1997, S. 93
13
,,Jedenfalls hat, was die Neuzeit betrifft, Weltentfremdung den Gang und
die Entwicklung der modernen Gesellschaft bestimmt, während Erdentfremdung
von vornherein das Wahrzeichen der modernen Wissenschaft wurde."
13
Ein auf den ersten Blick banales Ereignis stellt Hannah Arendt an den Be-
ginn des Aufstiegs naturwissenschaftlicher Forschung: Die Erfindung des Tele-
skops durch Galileo Galilei. Neben der Entdeckung Amerikas und der Reformati-
on hat sie diesen Aspekt sogar zu einem von drei großen Ereignissen erhoben, die
den Anfang der Neuzeit bestimmten.
Dabei hält sie nicht die technische Entwicklung, sondern das Moment des Her-
stellens für einschneidend:
,,Es war weder die Vernunft noch der Verstand, sondern ein von Menschen
hergestelltes Instrument, das Teleskop, dem die Änderung des Weltbildes zuzu-
schreiben ist; es war weder betrachtendes Beobachten noch schließendes Speku-
lieren, das zu den neuen Erkenntnissen geführt hat, sondern ein Eingriff unmittel-
bar praktisch-aktiver Natur, das Eingreifen der machenden und herstellenden Fä-
higkeiten von Homo faber."
14
Auf fatale Weise wurde der Menschheit klar, daß sie ihren eigenen Sinnes-
gaben für das Erstellen der Wirklichkeit sowie der Vernunft zum Erkennen der
Wahrheit nicht mehr trauen, vielmehr noch, ihnen niemals trauen konnte. Durch
die Erfindung Galileis wurde der Mensch in seinem Glauben an die ihm qua Ge-
burt verliehenen geistigen Fähigkeiten stark verunsichert. Der archimedische
Punkt lag plötzlich außerhalb der Erde, die Vorgänge auf ihr konnten mit einem
Mal vom Universum aus betrachtet werden.
Entscheidend war für Arendt die Tatsache, daß nicht die Kontemplation zu dieser
neuen Erkenntnis führte, sondern ein von Menschenhand, von Homo faber herge-
stelltes Instrument. Somit war die Wahrheit plötzlich nur noch infolge von
menschlicher Aktivität erkennbar, die vita contemplativa erlitt eine empfindliche
Niederlage, die ihre Bedeutung bis heute zunehmend schwächte.
12
Ropohl, Günter: Technologische Aufklärung, Frankfurt am Main, 1991, S. 23
13
VA, S. 337
14
VA, S. 349
14
Als Antwort auf die neue Orientierungslosigkeit verlegte Descartes den archime-
dischen Punkt zurück in den Menschen, in dessen ureigenes Bewußtsein. Er zwei-
felte nicht nur an der Fähigkeit der menschlichen Sinne, sondern stellte auch die
herkömmlichen Begriffe von Wirklichkeit und Wahrheit zur Disposition, wie
Hannah Arendt anmerkt:
,,Der kartesische Zweifel zweifelt nicht einfach, daß das menschliche Ver-
standesvermögen nicht der ganzen Wahrheit mächtig oder daß das menschliche
Sinnesvermögen nicht allem Wirklichen geöffnet sei, sondern daran, daß Sicht-
barkeit überhaupt ein Beweis für Wirklichkeit und daß Verstehbarkeit überhaupt
ein Beweis für Wahrheit sei."
15
Das Zweifeln führt schließlich zu der Erkenntnis der eigenen Existenz,
denn durch den aktiven Vorgang des Zweifelns muß sich der, der zweifelt, dieser
Gedanken bewußt sein. So entstand immerhin aus dem Zweifeln heraus die Ge-
wißheit des eigenen Bewußtseins.
Brachte der kartesische Zweifel zwar der Philosophie durch die entstandene Mög-
lichkeit der Selbstreflexion eine neue Facette bei, so konnte er doch nichts am
Triumph der Naturwissenschaften ändern.
Arendt bleibt der antiken philosophischen Tradition treu, wenn sie den Wert der
Erkenntnisse Galileis für den Menschen als politisches Wesen in Frage stellt:
,,Das Naturbild der modernen Physik [...] zeigt uns schließlich ein Univer-
sum, von dem wir nicht mehr wissen, als daß es in bestimmter Weise unsere
Meßinstrumente affiziert; und das, was wir von unseren Apparaten ablesen kön-
nen, sagt über die wirklichen Eigenschaften, in dem Bilde Eddingtons, nicht mehr
aus, als eine Telephonnummer von dem aussagt, der sich meldet, wenn wir sie
wählen."
16
Pieter Tijmes kritisiert Arendts intensive Beschäftigung mit dem Teleskop und
seine Folgen für das geistige Leben der Menschen. Bezüglich des Instruments
15
VA, S. 350
16
VA, S. 333
15
glaubt er bei ihr eine Überreaktion ausmachen zu können, die zu einer unbrauch-
baren Folgerung führt:
,,[...] the metaphor of the telescope is not very felicitous. It did not deprive
the human senses of their function. The telescope shows what you cannot see with
your naked eye, in other words, it extends sight. [...] The same can be said of the
microscope. It is a means for my eye, even if a new world is opened up. The
fascination of telescope or microscope may have the consequence that one over-
looks what is near at hand."
17
Bei seiner Interpretation läßt Tijmes Arendts in der griechischen Tradition
verwurzeltes Denken außer acht, was ihn daran hindert, den Kern ihrer Gedanken
zu erkennen. Natürlich ist das Teleskop ein von Menschen erdachtes und fabri-
ziertes Instrument. Der Vergleich, den Tijmes bemüht, zeugt jedoch von einer
Fehlinterpretation Hannah Arendts. Der Verlust der Glaubwürdigkeit in die eige-
nen Sinne und das damit verbundene Verschwinden der Kontemplation, was ich
weiter oben bereits angesprochen habe, muß im Verbund mit der von Arendt po-
stulierten Weltentfremdung betrachtet werden. Die Erfindung des Teleskops ist
ein weiterer Schritt in diese Richtung. Das Interesse an dem, was außerhalb der
Erde, außerhalb des natürlichen Lebensraums des Menschen passiert, korrespon-
diert in keiner Weise mit den pluralen menschlichen Angelegenheiten auf der Er-
de. Es ist, und somit ist der Vergleich Tijmes' nicht gänzlich falsch, die Neugier-
de, gepaart mit den fabrizierenden Fähigkeiten Homo fabers, die bei der Ent-
wicklung von Mikroskop und Teleskop Pate standen. Auch der Ausführung Ti-
jmes', daß die Nutzung beider Instrumente dazu führt zu übersehen, was sich un-
mittelbar vor dem eigenen Auge abspielt, ist nachvollziehbar.
Dennoch übersieht er die weltentfremdende Konnotation, die Arendt dem Begriff
Teleskop gibt. Dem Mikroskop hätte sie mutmaßlich eine erdgebundene Konno-
tation verliehen.
17
a.a.O. (Anm. 2), S. 403
16
1.2
Der Verlust der Sprache in der Naturwissenschaft
Da das Handeln, für Arendt die eigentliche politische Tätigkeit, nicht ohne die
Sprache, ohne das gesprochene Wort funktioniert, sieht die Autorin in der Sym-
bolsprache der Naturwissenschaftler einen strukturellen Verlust kommunikativen
Handelns. Die Naturwissenschaft wird zu einer Disziplin, die sich nur noch mit
sich selbst beschäftigt und den Anspruch, der Menschheit zu dienen, marginali-
siert.
Ich werte es als eine Art ihrer zur Übertreibung neigenden Polemik, wenn Hannah
Arendt in der Einleitung von Vita activa das Ende des verbalen Verständigungs-
akts heraufbeschwört:
,,[...] Menschen sind nur darum zur Politik begabte Wesen, weil sie mit
Sprache begabte Wesen sind. Wären wir töricht genug, auf die von allen Seiten
neuerdings erteilten Ratschläge zu hören und uns dem gegenwärtigen Stand der
Wissenschaften anzupassen, so bliebe uns nichts anderes übrig, als auf das Spre-
chen überhaupt zu verzichten. Denn die Wissenschaften reden heute in einer ma-
thematischen Symbolsprache, die ursprünglich nur als Abkürzung für Gesproche-
nes gemeint war, sich aber hiervon längst emanzipert hat und aus Formeln besteht,
die sich auf keine Weise zurück in Gesprochenes verwandeln lassen."
18
Die von Arendt ausgemachte Sprachlosigkeit ist ihrer Ansicht nach der
Grund für die Unfähigkeit von naturwissenschaftlichen Forschern ihr eigenes
Handeln reflexiv zu beurteilen:
,,Was dagegenspricht, sich in Fragen, die menschliche Angelegenheiten angehen,
auf Wissenschaftler qua Wissenschaftler zu verlassen, ist nicht, daß sie sich be-
reitfanden, die Atombombe herzustellen [...] viel schwerwiegender ist, daß sie
sich überhaupt in einer Welt bewegen, in der die Sprache ihre Macht verloren hat,
die der Sprache nicht mächtig ist."
19
Arendts Verständnis nach sind die Vorgänge der Natur nicht a priori in
mathematischer Sprache abhandelbar. Die Naturwissenschaftler haben erst eine
18
VA, S. 11
19
VA, S. 11 f
17
Sprachform kreiert, die nicht mehr in kommunikative Interaktion umgewandelt
werden kann. Hiermit steht sie im krassen Gegensatz zu Positionen, die die ma-
thematische Ausdrucksweise als den Naturvorgängen inhärent ansehen, wie bei-
spielsweise Hans Joachim Störig:
,,Das große Buch der Natur liegt aufgeschlagen vor uns. Um es lesen zu
können, bedürfen wir der Mathematik, denn es ist in mathematischer Sprache ge-
schrieben."
20
Diese Auffassung kann Arendt nicht teilen, sieht sie doch das Beobachten
und Erklären von Ereignissen in der Natur aus der Perspektive einer philosophi-
schen Tradition, in der das Staunen im Mittelpunkt stand. Arendts Theorie folgend
hat die Natur von sich aus nichts mit der Mathematik gemein. Vielmehr war es das
Werk von Menschen, respektive Naturwissenschaftlern, die auf diese Weise ver-
suchten die Natur einzufangen und nach feststehenden Ausdrücken zu kategorisie-
ren.
1.3
Der Forscher als Co-Aktor und das unnatürliche Auslösen von
irreversiblen Naturprozessen
In Anlehnung an den Physiker Niels Bohr (1885-1962) spricht Peter Tijmes vom
Wissenschaftler als ,,co-actor", der sich nicht mehr mit dem Zusehen zufrieden
gibt.
21
Arendts Skepsis gegenüber den Erkenntnissen moderner Naturwissenschaft speist
sich aus eben dieser Rolle. Ihrer Ansicht nach verharrt der Naturwissenschaftler
nicht in der Position des Beobachters, sondern greift aktiv in die Geschehnisse der
Natur ein. Aus diesem Grunde warnt sie davor, die so gewonnenen Erkenntnisse
zu Entdeckungen über die Zusammenhänge der Natur hochzustilisieren.
20
Störig, Hans Joachim: Kleine Weltgeschichte der Philosophie, Bd. 1, Frankfurt am Main
1980, S. 287
21
a.a.O. (Anm. 2), S. 393
18
In theologischer Terminologie, ohne allerdings jene zur Argumentation heranzu-
ziehen, spricht sie von der Hybris des Menschen und seinen blasphemischen Ver-
suchen, natürliche Vorgänge selbst zu gestalten:
,,Wir tun [...] genau das, was seit Urzeiten als das Vorrecht eines Schöp-
fergottes, als das Resultat göttlicher `Schöpfung' galt."
22
Mit der Vokabel ,,Schöpfung" verweist die Philosophin implizit auf die
begriffliche Nähe dieses Ausdrucks zu der von ihr herausgearbeiteten Grundtätig-
keit des Herstellens. Sie selbst benutzt das Substantiv, um die Tätigkeit des Her-
stellens zu beschreiben:
,,Alles Herstellen ist gewalttätig, und Homo faber, der Schöpfer der Welt,
kann sein Geschäft nur verrichten, indem er Natur zerstört."
23
In diesem Satz ist nicht nur Arendts Gleichsetzung von Herstellen und na-
turwissenschaftlicher Forschung erkennbar. Homo faber muß nach ihrer Theorie
die natürlichen Dinge erst zerstören, um überhaupt produktiv sein zu können. Hin-
sichtlich dieser Analogie ist es nur allzu konsequent, den Naturwissenschaftler be-
grifflich zum Co-Aktor natürlicher Vorgänge zu machen.
Eine Grunderfahrung beim Herstellen ist nach Arendts Muster die Zweck-Mittel-
Kategorie, die den Herstellungsprozeß wesentlich bestimmt:
,,Das hergestellte Ding ist ein Endprodukt, weil der Herstellungsprozeß in
ihm an ein Ende kommt [...], und es ist ein Zweck, zu dem der Herstellungsprozeß
selbst nur das Mittel war."
24
Diese Kategorisierung läßt sich auf das Forschungsverhalten übertragen.
Der Mensch sieht den Naturabläufen nicht mehr nur zu, sondern greift aktiv in sie
ein. Bei der Nutzbarmachung von natürlichen Abläufen greift ebenfalls die Zweck-
Mittel-Kategorie. Am Beispiel der Kernenergie wird dieses deutlich. Die atomare
Strahlung, die im Universum, nicht jedoch auf der Erde vorhanden ist, wird mit-
tels naturwissenschaftlichen Kenntnissen künstlich hergestellt. Sie wird sodann in
Energie umgewandelt, die schließlich wieder für andere Dinge genutzt werden
22
VA, S. 343
23
VA, S. 165
24
VA, S. 168 f
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Originalausgabe
- Erscheinungsjahr
- 1999
- ISBN (eBook)
- 9783832412920
- ISBN (Paperback)
- 9783838612928
- Dateigröße
- 638 KB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- Universität Bremen – Unbekannt
- Produktsicherheit
- Diplom.de