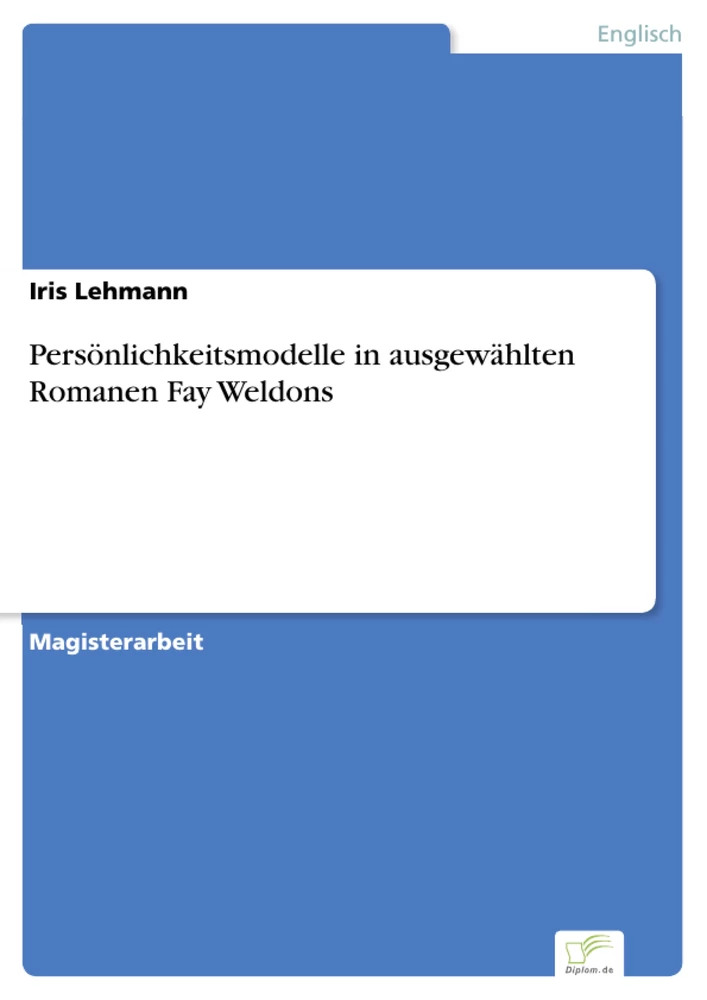Persönlichkeitsmodelle in ausgewählten Romanen Fay Weldons
©1997
Magisterarbeit
123 Seiten
Zusammenfassung
Inhaltsangabe:Gang der Untersuchung:
Die vier Hauptkapitel der Arbeit befassen sich mit jeweils einem Roman Fay Weldons. Verschiedene Theorien über die Konstitution der menschlichen Persönlichkeit aus den Bereichen Soziologie, Biologie, Philosophie und Psychologie werden zur Interpretation der Romane herangezogen. Insgesamt wird versucht, das Werk der Autorin in eine Strömung (post-)moderner Literatur einzuordnen, die sich zunehmend von der Vorstellung eines unveränderlichen Persönlichkeitskernes oder "wahren Selbst" distanziert.
Kapitel 2 behandelt Weldons zweiten Roman Down Among the Women (1971). Die Romanfiguren definieren sich zu Beginn - gemäß der anthropologischen Rollentheorie G.H. Meads - ausschließlich durch ihre sozialen Rollen. Dies hindert sie an der freien Entfaltung ihrer Persönlichkeit. Die Thematik spiegelt sich in der stereotypen und zweidimensionalen Darstellung der Charaktere wider, in der fragmentarischen Erzählstruktur und in der wechselnden Perspektive.
Kapitel 3 befaßt sich mit dem Roman Praxis (1978). Die Titelheldin ist ihr Leben lang vergeblich auf der Suche nach ihrem Selbst und erkennt schließlich, daß der Mensch sich ständig verändert und sich daher nie eindeutig definieren läßt. Die Erkenntnis stimmt weitgehend überein mit den Theorien der englischen Philosophen Locke und Hume, nach denen die Persönlichkeit die Summe aller Sinneseindrücke und Erfahrungen ist, die der Mensch im Verlauf seines Lebens sammelt. Die Unzuverlässigkeit der Erinnerung und damit des Selbstbildes wird durch die episodische Darstellungsweise und die Unzuverlässigkeit der Ich-Erzählerin unterstrichen.
Kapitel 4 untersucht den Roman The Life and Loves of a She-Devil (1983). Die extrem wandlungsfähige Protagonistin Ruth setzt die Existenzphilosophie Sartres von der absoluten Freiheit des Menschen, sich selbst zu erschaffen, wörtlich in die Tat um: Sie schlüpft in ständig wechselnde Rollen, um andere Menschen zu manipulieren, und gestaltet schließlich sogar ihren Körper neu. Durch die manipulierende Art ihrer Ich-Erzählung gelingt es ihr darüber hinaus, die Sympathien der Leser in die von ihr gewünschte Richtung zu steuern.
Kapitel 5 analysiert den Roman Splitting (1995). Protagonistin Angelica leidet unter einer Persönlichkeitsspaltung, die es ihr unmöglich macht, ein einheitliches Selbstbild zu entwickeln. Auch hier steht am Ende die Erkenntnis, daß es kaum möglich, geschweige denn wünschenswert ist, individuelle Eigenschaften zu unterdrücken, […]
Die vier Hauptkapitel der Arbeit befassen sich mit jeweils einem Roman Fay Weldons. Verschiedene Theorien über die Konstitution der menschlichen Persönlichkeit aus den Bereichen Soziologie, Biologie, Philosophie und Psychologie werden zur Interpretation der Romane herangezogen. Insgesamt wird versucht, das Werk der Autorin in eine Strömung (post-)moderner Literatur einzuordnen, die sich zunehmend von der Vorstellung eines unveränderlichen Persönlichkeitskernes oder "wahren Selbst" distanziert.
Kapitel 2 behandelt Weldons zweiten Roman Down Among the Women (1971). Die Romanfiguren definieren sich zu Beginn - gemäß der anthropologischen Rollentheorie G.H. Meads - ausschließlich durch ihre sozialen Rollen. Dies hindert sie an der freien Entfaltung ihrer Persönlichkeit. Die Thematik spiegelt sich in der stereotypen und zweidimensionalen Darstellung der Charaktere wider, in der fragmentarischen Erzählstruktur und in der wechselnden Perspektive.
Kapitel 3 befaßt sich mit dem Roman Praxis (1978). Die Titelheldin ist ihr Leben lang vergeblich auf der Suche nach ihrem Selbst und erkennt schließlich, daß der Mensch sich ständig verändert und sich daher nie eindeutig definieren läßt. Die Erkenntnis stimmt weitgehend überein mit den Theorien der englischen Philosophen Locke und Hume, nach denen die Persönlichkeit die Summe aller Sinneseindrücke und Erfahrungen ist, die der Mensch im Verlauf seines Lebens sammelt. Die Unzuverlässigkeit der Erinnerung und damit des Selbstbildes wird durch die episodische Darstellungsweise und die Unzuverlässigkeit der Ich-Erzählerin unterstrichen.
Kapitel 4 untersucht den Roman The Life and Loves of a She-Devil (1983). Die extrem wandlungsfähige Protagonistin Ruth setzt die Existenzphilosophie Sartres von der absoluten Freiheit des Menschen, sich selbst zu erschaffen, wörtlich in die Tat um: Sie schlüpft in ständig wechselnde Rollen, um andere Menschen zu manipulieren, und gestaltet schließlich sogar ihren Körper neu. Durch die manipulierende Art ihrer Ich-Erzählung gelingt es ihr darüber hinaus, die Sympathien der Leser in die von ihr gewünschte Richtung zu steuern.
Kapitel 5 analysiert den Roman Splitting (1995). Protagonistin Angelica leidet unter einer Persönlichkeitsspaltung, die es ihr unmöglich macht, ein einheitliches Selbstbild zu entwickeln. Auch hier steht am Ende die Erkenntnis, daß es kaum möglich, geschweige denn wünschenswert ist, individuelle Eigenschaften zu unterdrücken, […]
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
ID 765
Lehmann, Iris: Persönlichkeitsmodelle in ausgewählten Romanen Fay Weldons /
Iris Lehmann - Hamburg: Diplomarbeiten Agentur, 1998
Zugl.: Münster, Universität, Magister, 1997
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte, insbesondere die der
Übersetzung, des Nachdrucks, des Vortrags, der Entnahme von Abbildungen und Tabellen, der
Funksendung, der Mikroverfilmung oder der Vervielfältigung auf anderen Wegen und der Speicherung
in Datenverarbeitungsanlagen, bleiben, auch bei nur auszugsweiser Verwertung, vorbehalten. Eine
Vervielfältigung dieses Werkes oder von Teilen dieses Werkes ist auch im Einzelfall nur in den
Grenzen der gesetzlichen Bestimmungen des Urheberrechtsgesetzes der Bundesrepublik
Deutschland in der jeweils geltenden Fassung zulässig. Sie ist grundsätzlich vergütungspflichtig.
Zuwiderhandlungen unterliegen den Strafbestimmungen des Urheberrechtes.
Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in diesem Werk
berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme, daß solche Namen im Sinne
der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei zu betrachten wären und daher von
jedermann benutzt werden dürften.
Die Informationen in diesem Werk wurden mit Sorgfalt erarbeitet. Dennoch können Fehler nicht voll-
ständig ausgeschlossen werden, und die Diplomarbeiten Agentur, die Autoren oder Übersetzer
übernehmen keine juristische Verantwortung oder irgendeine Haftung für evtl. verbliebene fehlerhafte
Angaben und deren Folgen.
Dipl. Kfm. Dipl. Hdl. Björn Bedey, Dipl. Wi.-Ing. Martin Haschke & Guido Meyer GbR
Diplomarbeiten Agentur, http://www.diplom.de, Hamburg 2000
Printed in Germany
I
NHALT
INHALT
1
1. EINLEITUNG
1
2.
DOWN AMONG THE WOMEN: DIE SUCHE NACH DEM
SELBST HINTER DEN SOZIALEN ROLLEN
5
2.1 Das sozialbehavioristische Persönlichkeitsmodell
6
2.1.1 Der Vergesellschaftungsprozeß
7
2.1.2 Die Fügung in die Rollen
9
2.1.3 Die Lösung von den Rollen
12
2.1.4 Individualismus und Kollektivität
15
2.1.5 Fiction of ideas
16
2.2 Das empirisch-pragmatische Persönlichkeitsmodell
18
2.2.1 Das dualistische Wertdenken
19
2.2.2 Die Anerkennung der Eigenverantwortung
22
2.3 Der auktoriale Ich-Erzähler
24
2.4 Zusammenfassung
26
3. PRAXIS: KAUSALITÄT UND KONTINUITÄT
28
3.1. Kindheit, Vererbung und Gesellschaft
29
3.1.1 Die Kindheit
30
3.1.2 Determinismus
32
3.1.3 Die biologische Begründung der Geschlechterrollen
33
3.1.4 Die Dekonstruktion der sozialen Rollen
36
3.1.5 Die Möglichkeit zur aktiven Veränderung
37
3.2 Das empiristische Persönlichkeitsmodell
39
3.2.1 John Locke: Vergangene Selbstzustände
39
3.2.1.1 Die Flucht vor der Vergangenheit
40
3.2.1.2 Die Anerkennung der Eigenverantwortung
42
3.2.1.3 Der Bildungsroman
44
3.2.2 David Hume: Die Diskontinuität der Erlebniszustände
45
3.2.2.1 Die Unzuverlässigkeit der Erinnerung
46
3.2.2.2 Die Wandelbarkeit der Persönlichkeit
48
3.3 Der quasi-autobiographische Ich-Erzähler
49
3.4 Zusammenfassung
50
4.
THE LIFE AND LOVES OF A SHE-DEVIL: DIE FREIHEIT
ZUR SELBSTERSCHAFFUNG UND DIE AUFHEBUNG DER
OPPOSITIONEN
52
4.1 Das existentialistische Persönlichkeitsmodell
53
2
2
4.1.1 Determinismus und Rollenidentifikation
54
4.1.1.1 Metaphor-into-narrative
57
4.1.2 Die Lösung von deterministischen Beschränkungen und sozialen Rollen
58
4.1.3 Die Freiheit zur Selbsterschaffung
59
4.1.4 Die Wandelbarkeit der Persönlichkeit
61
4.1.5 Comedy of impersonation
64
4.2 Dualismus
65
4.2.1 Ruth: Erlöserin und Teufelin
67
4.2.2 Judge Bissop: Recht und Unrecht
68
4.2.3 Father Ferguson: Geist und Körper
69
4.2.4 Mary Fisher: Wahrheit und Lüge
71
4.3 Der manipulative Erzähler
73
4.4 Zusammenfassung
75
5. SPLITTING: DISSOZIATION UND MULTIPLIZITÄT
77
5.1 Aspekte psychologischer Persönlichkeitsmodelle
78
5.1.1 Die holistische Persönlichkeitspsychologie des zwanzigsten Jahrhunderts
78
5.1.2 Die Multiple Persönlichkeitsstörung
80
5.1.3 Die Funktion von Dissoziationsstrategien
83
5.1.4 Die Suche nach dem Gleichgewicht
85
5.2 Das narrative Selbst
88
5.2.1 Die Erzählung der persönlichen Geschichte
89
5.2.1.1 Androgynie und Transzendenz der Geschlechterrollen
92
5.2.2 Die Revision der persönlichen Geschichte
94
5.2.3 Der Verlust der persönlichen Geschichte
98
5.2.4 Ein Haus mit vielen Zimmern
99
5.3 Die multiple Perspektive
102
5.4 Zusammenfassung
104
6. FAZIT
106
LITERATURVERZEICHNIS
111
Primärliteratur
111
Sekundärliteratur
111
1
1
1. E
INLEITUNG
One of the commonplaces - or clichés - associated
with literary modernism is that the human indivi-
dual is neither unitary nor internally consistent, but
complex, contradictory and divided
.
1
In der Psychologie, der Philosophie und der Literatur der Moderne ist die
menschliche Persönlichkeit fortschreitenden Auflösungsserscheinungen ausge-
setzt. Zahlreiche Theoretiker und Autoren dieser Zeit distanzieren sich von der
essentialistischen Vorstellung, der Mensch habe einen festen Persönlichkeits-
kern oder ein gleichbleibendes Wesen, das von Geburt an feststeht. Statt dessen
wird die Persönlichkeitsbildung zum einen als kontinuierlicher Prozeß aufge-
faßt, der von diversen inneren und äußeren Faktoren beeinflußt wird; zum an-
deren wird angenommen, daß der Mensch aus einer Vielzahl unterschiedlicher
und wider-sprüchlicher Komponenten besteht, so daß die Integration zu einem
einheitlichen Individuum problematisch oder sogar unmöglich erscheint. Ver-
bunden mit dieser Vorstellung ist eine Skepsis bezüglich der Möglichkeit, ein
wahres Selbst zu entdecken oder sich als definierbare und ganzheitliche Per-
sönlichkeit wahrzu-nehmen.
2
Die Dissoziation der Persönlichkeit setzt sich in der Spätphase der Moderne,
der sogenannten Postmoderne, verstärkt fort. Die Postmoderne ist gekenn-
zeichnet durch einen Verfall absoluter Wert- und Bedeutungssysteme, welche
die Welt und den Menschen in ein bestimmtes Schema zu pressen versuchen.
Auch neuere philosophische und psychologische Diskurse beschreiben die Per-
1
Jeremy Hawthorn, Multiple Personality and the Disintegration of Literary Character (London: Edward
Arnold 1983), S. ix. Hawthorn argumentiert, daß diese Entwicklung bereits vor der Moderne einsetzt. Er
setzt den Beginn der Moderne jedoch erst im frühen zwanzigsten Jahrhundert an. Nach einem weiter
gefaßten Verständnis des Begriffes, das auch dieser Untersuchung zugrunde gelegt wird, umfaßt die
Moderne den Zeitraum der letzten 200 Jahre. Vgl. Kim L. Worthington, Self as Narrative (Oxford:
Clarendon Press, 1996), S. 1.
2
Zur Entwicklung des Selbst-Begriffs in den vergangenen 200 Jahren vgl. Worthington, S. 1-12. Zur
Pluralisierung und Dynamisierung des psychologischen Identitätsbegriffs im gleichen Zeitraum vgl.
Wolfgang Kraus, Das erzählte Selbst (Pfaffenweiler: Centaurus, 1996), S. 22-32.
2
2
sönlichkeit nicht als eine feststehende Einheit, sondern als eine dynamische
und heterogene Größe.
3
Bereits die Literatur des neunzehnten Jahrhunderts spiegelt die Diskussion um
die Multiplizität des Selbst wider. Eine multiple Konstitution der Persönlich-
keit wird angedeutet in der Thematik des Doppellebens in R. L. Stevensons
Roman The Strange Case of Dr Jeckyll and Mr Hyde, dessen Protagonist sich
in eine gute und eine schlechte Hälfte spaltet. Der Pluralisierungstrend setzt
sich bei Oscar Wilde fort, etwa in The Picture of Dorian Gray.
4
Im frühen
zwanzigsten Jahrhundert verarbeiten Autoren wie James Joyce oder Virginia
Woolf das Phänomen der dissoziierten Persönlichkeit und stellen es nicht als
Ausnahme, sondern als verbreiteten Zustand dar.
5
Auch Aldous Huxley be-
wertet Multiplizi-tät in seinem Werk überwiegend als natürlichen Zustand.
6
Diese Autoren vermit-teln die Thematik der Multiplizität häufig anhand inno-
vativer Erzähltechniken und Methoden der Charakterdarstellung, die vom
Standard des klassischen Realismus abweichen.
In der zeitgenössischen Literatur reihen sich Autoren wie Martin Amis, John
Fowles oder Margaret Drabble in diese Tradition ein.
7
Das Ziel der vorliegenden Untersuchung besteht darin, am Beispiel ausge-
wählter Romane der zeitgenössischen Autorin Fay Weldon zu zeigen, inwie-
weit sich das spezifisch moderne Selbstverständnis - die Prämisse einer geteil-
ten und wider-sprüchlichen Konstitution der menschlichen Persönlichkeit -
auch in ihrem Werk manifestiert.
Fay Weldon [...] established her reputation as a novelist by writing tart, intel-
ligent, and often comic fictions about the lives and natures of women.
8
In den
Romanen und Erzählungen der englischen Autorin stehen Frauen und deren
3
Zum Begriff des Selbst und seiner Auflösung in der Postmoderne vgl. Helga Schier, Going Beyond
(Tübingen: Niemeyer, 1993), S. 1-27.
4
Vgl. Lothar Fietz, Fragmentarisches Existieren (Tübingen: Niemeyer, 1994), S. 252/253.
5
Vgl. Kraus, S. 68.
6
Vgl. Lothar Fietz, Menschenbild und Romanstruktur Aldous Huxleys Ideenromanen (Tübingen: Nie-
meyer, 1969).
7
Eine umfassende Darstellung von Multiplizität und Fragmentarität in zeitgenössischen Romanen ist in
der oben genannte Untersuchung von Helga Schier enthalten.
8
Harriet Blodgett, Fay Weldon, in: Dictionary of Literary Biography, Vol. 14, British Novelists Since
1960, Part 2 (Detroit: Gale Research Company, 1983), S. 750.
3
3
zumeist problematische und komplexe Beziehungen zur Umwelt und zu ande-
ren Menschen im Mittelpunkt.
Aufgrund der zentralen Thematik - Frauen auf der Suche nach Selbstbestim-
mung - sind Weldons Romane überwiegend Gegenstand der feministisch orien-
tierten Literaturkritik. Die meisten Untersuchungen dieser Art versuchen, ihre
Texte in eine Tradition zeitgenössischer Frauenliteratur einzuordnen.
9
Daraus
resultieren häufig einseitige und oberflächliche Interpretationen, die der thema-
tischen Vielfalt und Komplexität der Erzählungen nicht gerecht werden.
Zudem werden Weldons Romane überwiegend unter inhaltlichen und nur sel-
ten unter formalen Gesichtspunkten analysiert. Zu den wenigen Ausnahmen
zählen Untersuchungen von David Lodge und Maggie Humm. Beide analysie-
ren Stil, Struktur und Perspektive des Romans Female Friends aus dem Jahr
1974 und konstatieren eine innovative Erzähltechnik, die Abweichungen vom
Standard des klassischen Realismus aufweist.
10
In der vorliegenden Untersuchung soll im einzelnen herausgearbeitet werden,
welche Konzeptionen der Persönlichkeit die Autorin den Darstellungen ihrer
Romanfiguren in den jeweiligen Romanen zugrunde legt.
Darüber hinaus soll ermittelt werden, wie sich Weldons Persönlichkeitsentwür-
fe im Verlauf des Untersuchungszeitraumes entwickeln und verändern.
Dabei soll auch berücksichtigt werden, ob und inwieweit die in den einzelnen
Romanen vermittelten Persönlichkeitsmodelle durch formale Mittel wie Ro-
man-struktur und Erzähltechnik mitgestaltet, verifiziert oder entkräftet werden.
Für die Untersuchung wurden vier Romane ausgewählt. Down Among the Wo-
men aus dem Jahr 1971 ist Fay Weldons zweiter Roman. Ihr sechster Roman
Praxis erschien 1978 und wurde im gleichen Jahr für den Booker Price nomi-
niert. The Life and Loves of a She-Devil aus dem Jahr 1983 ist einer der popu-
9
Vgl. zum Beispiel Rita Felski, Beyond Feminist Aesthetics (Cambridge, Mass.: Harvard University
Press, 1989), Gayle Greene, Changing the Story (Bloomington: Indiana University Press, 1991), Paulina
Palmer, Contemporary Women's Fiction (London: Harvester Wheatsheaf, 1989) und Patricia Waugh,
Feminine Fictions (London: Routledge, 1989).
10
Vgl. David Lodge, Mimesis and Diegesis in Modern Fiction, in: After Bakhtin (New York: Rout-
ledge, 1990), S. 26/27 und Maggie Humm, Postmodernism: Fay Weldon, Female Friends, in: Practic-
ing Feminist Criticism (London: Harvester Wheatsheaf, 1995), S. 126-133.
4
4
lärsten und zugleich am häufigsten analysierten Romane Weldons.
11
Splitting
erschien 1995 und ist ihr jüngster Roman. Durch diese Auswahl soll ein mög-
lichst repräsentativer Einblick in das Gesamtwerk der Autorin gegeben werden.
Darüber hinaus lassen sich anhand der langen Zeitspanne von fast 25 Jahren
Entwicklungen in Thematik und Struktur nachvollziehen.
Der Analyse der einzelnen Romane werden verschiedene Persönlichkeitsmo-
delle zugrunde gelegt, die zu Beginn des jeweiligen Kapitels kurz vorgestellt
werden. Einzelne Aspekte dieser Theorien, die für die Charakterisierung der
Roman-figuren relevant erscheinen, werden zur Interpretation herangezogen.
12
Es han-delt sich um Modelle aus unterschiedlichen Forschungsbereichen wie
der Sozio-logie, der Philosophie oder der Psychologie. Die meisten Modelle
definieren den Menschen als ein fragmentarisches Wesen und weisen eine
Konzeption der Persönlichkeit als unveränderbare Einheit oder Essenz zurück.
Entweder sie reduzieren den Menschen auf Teilaspekte seiner Persönlichkeit,
oder sie lassen die Integration zu einem ganzen Individuum problematisch,
wenn nicht sogar unmöglich erscheinen.
11
Der Roman wurde bereits zweimal verfilmt. Die erste Verfilmung - eine fünfteilige Fernsehserie der
BBC aus dem Jahr 1986 - ist Thema eines Aufsatzes von Bird und Eliot. Vgl. Liz Bird und Joe Eliot,
The Life and Loves of a She-Devil, in: George W. Brandt (Hrsg.), British Television Drama in the
1980s (Cambridge: Cambridge University Press, 1993), S. 214-233. Pamela Katz analysiert die Schwä-
chen der Hollywood-Verfilmung aus dem Jahr 1989. Vgl. Pamela Katz, They Should Have Called It
She-Angel, in: Regina Barreca (Hrsg.), Fay Weldon's Wicked Fictions (Hanover: University Press of
New England, 1994), S. 114-132.
12
Eine umfassende Beschreibung der Modelle ist nicht beabsichtigt und im Rahmen dieser Untersuchung
auch nicht möglich. Die Modelle müssen der Autorin nicht notwendigerweise als theoretische Basis für
die Konzeption der untersuchten Romane gedient haben.
5
5
2. D
OWN
A
MONG THE
W
OMEN
: D
IE
S
UCHE NACH DEM
S
ELBST
HINTER DEN SOZIALEN
R
OLLEN
Down here among the women who like to describe
people by their relationship with others. It makes
us feel more secure, or as if someone might notice
when we die.
1
Down Among the Women beschreibt das Leben einer Gruppe von Frauen über
einen Zeitraum von zwanzig Jahren und deren Versuche, ihren Platz in der Ge-
sellschaft zu finden.
2
Scarlet und ihre Freundinnen verkörpern verschiedene
Rollenfunktionen, die Frauen der Mittelschicht in den fünfziger und sechziger
Jahren offenstehen.
3
Der Roman schildert den Sozialisationsprozeß anhand
exemplarischer Episoden als eine fortschreitende Anpassung an gesellschaftli-
che Normen.
4
Die jungen Frauen fügen sich in stereotype Rollenbilder, persön-
liche Erfüllung bleibt ihnen jedoch verwehrt. Indem sie sich ausschließlich
durch ihre sozialen Beziehungen und Funktionen definieren, werden sie zum
homo sociologicus, dem Modellmenschen der soziologischen Rollentheorie,
der ausschließlich dem Erhalt der sozialen Ordnung dient. Die Ausprägung
einer komplexen und ausgeglichenen Persönlichkeit, wie etwa dem empirical
Me aus dem empirisch-pragmatischen Modell von William James, gelingt ih-
nen nicht.
Während die Persönlichkeit in der Literatur im allgemeinen in Auflösung be-
griffen ist, begeben sich viele Autorinnen in den sechziger und siebziger Jahren
in ihren Romanen auf die Suche nach dem Selbst hinter den sozialen Rollen.
5
Sie beschreiben die Selbstwerdung als einen Prozeß der Loslösung von Rolle-
nidentifikationen, der mit der Entdeckung von persönlicher Freiheit und Auto-
nomie sowie eines wahren Selbst abgeschlossen ist.
6
Kennzeichnend für die-
1
Fay Weldon, Down Among the Women (Harmondsworth, Middlesex: Penguin Books, 1973), S. 30. Im
folgenden Kapitel beziehen sich alle Seitenangaben in runden Klammern auf diese Ausgabe.
2
E. H. Erikson beschreibt die Identitätsbildung als einen Prozeß der adoleszenten Selbstfindung, gefolgt
von einer Erwachsenenzeit, die dadurch charakterisiert ist, daß der Jugendliche seinen [...] Platz in der
Gesellschaft gefunden hat. Wolfgang Kraus, Das erzählte Selbst (Pfaffenweiler: Centaurus, 1996), S.
2/3.
3
Vgl. Margaret Chesnutt, Feminist Criticism and Feminist Consciousness: A Reading of a Novel by Fay
Weldon, Moderna Sprak, No. 73 (1979), S. 8.
4
Vgl. Chesnutt, S. 9.
5
Vgl. Patricia Waugh, Feminine Fictions (London: Routledge, 1989), S. 22/23.
6
Vgl. Pilar Hidalgo, The Female Body Politic, in: Robert Clark und Piero Boitani (Hrsg.), English
Studies in Transition: Papers from the ESSE Inaugural Conference (London: Routledge, 1993), S. 290.
Hidalgo ordnet Weldons ersten Roman The Fat Woman's Joke (1967) in die Kategorie der mad housewife
novel ein, die einen solchen Erkenntnisprozeß beschreibt.
6
6
se Romane ist die quasi-autobiographische Form und eine Spaltung des Erzäh-
lers in ein erzählendes Ich und ein erlebendes Ich.
7
Auch in Down Among the Women durchlaufen die Frauenfiguren einen Ent-
wicklungsprozeß, in dessen Verlauf sie sich aus den Begrenzungen ihrer ein-
seitigen und fremdbestimmten Rollenexistenz befreien. Es handelt sich um eine
quasi-autobiographische Erzählung der Figur Jocelyn.
8
Die ironische Distanz
zum erzählten Geschehen und zu ihrem früheren Selbst, die die Ich-Erzählerin
in ihren Kommentaren, welche einzelne Kapitel einleiten, zum Ausdruck
bringt, illustriert den von ihr durchlaufenen Reifeprozeß: [S]he certainly ends
up as the most clear-sighted of the characters in the novel.
9
Doch dieser Reife-
prozeß ist nicht unbedingt einem erfolgreich abgeschlossenen Selbstfindungs-
prozeß gleichzusetzen. Durch die Lösung von den ihnen auferlegten Rollen
gelingt es Jocelyn und einigen anderen Frauen in Down Among the Women
zwar, Selbstbestimmung zu erlangen, es kommt jedoch nicht unbedingt eine
hinter den Rollen verborgene wahre Persönlichkeit zum Vorschein.
2.1 Das sozialbehavioristische Persönlichkeitsmodell
In seiner sozialbehavioristischen Rollentheorie entwirft George Herbert Mead
ein Bild vom Menschen, dessen Persönlichkeit ausschließlich von seinen so-
zialen Funktionen geprägt ist. Das vergesellschaftete Individuum, der homo
sociologicus, begreift sich als Bündel oder Aggregat seiner sozialen Rollen.
10
Das Verhalten des einzelnen ist laut Mead von den Erwartungen der Gesell-
schaft konditioniert und determiniert. Der Mensch wird so zu einem aus-
schließlich von äußeren Faktoren geformten und gänzlich fremdbestimmten
Wesen ohne eigenen Einfluß auf seinen Charakter und sein Verhalten.
11
Die Internalisierung der vorgegebenen Rollen - die Vergesellschaftung des In-
dividuums - ist für Mead die natürliche Voraussetzung für die Entwicklung
eines Identitätsbewußtseins: A person is a personality because he belongs to a
community, because he takes over the institutions of that community into his
7
Vgl. Waugh 1989, S. 25/26.
8
Abweichend ist ihre Verwendung der dritten Person anstelle der Ich-Form für die Schilderung ver-
gangener Ereignisse. Vgl. dazu Kap. 2.3.
9
Chesnutt, S. 16. Die Identität der Ich-Erzählerin wird erst im letzten Kapitel des Romans preisgegeben.
Vgl. auch dazu Kap. 2.3.
10
Vgl. Lothar Fietz, Fragmentarisches Existieren (Tübingen: Niemeyer, 1994), S. 75/76. Der Begriff
wurde erst später von Rolf Dahrendorf geprägt, der den homo sociolgicus in seinem gleichnamigen Werk
aus dem Jahr 1958 zum Modellmenschen der Soziologie erklärt. Vgl. Fietz 1994, S 78.
11
Vgl. Fietz 1994, S. 76.
7
7
own conduct.
12
Durch die Fügung in die ihm angebotenen Rollen und die Er-
füllung der damit verbundenen Erwartungen anderer Gemeinschaftsmitglieder
wird der einzelne zum Agenten der Gesellschaft, dessen Handlungen allein auf
den Erhalt der sozialen Ordnung ausgerichtet sind.
13
Selbstverwirklichung be-
steht für den homo sociologicus nicht in Individualisierung und freier Entfal-
tung, sondern in Typisierung, Anpassung und Zwang.
14
2.1.1 Der Vergesellschaftungsprozeß
Die Vergesellschaftung wird in Down Among the Women als desillusionieren-
der, aber unvermeidlicher Prozeß dargestellt und von der Erzählerin mit fol-
genden Worten kommentiert: There is no escape even for them [my women
friends]. There is nothing more glorious than to be a young girl, and there is
nothing worse than to have been one. (6) Die jungen Frauen streben keine
individuelle und eigenständige Existenz an, sondern hoffen auf ein erfülltes
Leben als Ehefrauen und Mütter: Happiness is something nebulous which au-
tomatically comes with husbands and children.
15
Sie definieren sich aus-
schließlich durch ihre sozialen Rollen. Sie sehen sich selbst als Töchter, Mütter
und vor allem als Ehefrauen, nicht aber als autonome Individuen. Damit folgen
sie dem Beispiel früherer Frauengenerationen, repräsentiert von Wandas
Selbsthilfegruppe Divorcees Anonymous: [T]hey can only seem to exist in
relationship with men. (104)
Die zentrale Figur des Romans ist Scarlet. Sie steht im Mittelpunkt des Ge-
flechts aus sozialen Beziehungen und stellt in ihrer Funktion als Wandas
Tochter, Susans Stieftochter, Byzantias Mutter und Freundin der übrigen Frau-
en eine Verbindung zwischen den verschiedenen Romanfiguren her.
Als ledige Mutter mit abgebrochenem Hochschulstudium hat Scarlet zu Beginn
der fünfziger Jahre schlechte Zukunftsaussichten. Sie glaubt, nur durch eine
Ehe finanzielle und emotionale Sicherheit sowie einen sozialen Status errei-
chen zu können, der ihr gesellschaftliche Akzeptanz garantiert: Like Jocelyn,
she wants to be married. But she is moved by desperation, not ambition. She
wants security and respectability. She wants to be looked after. (98)
16
12
G. H. Mead, Mind, Self, and Society From the Standpoint of a Social Behaviorist (Chicago, 1934;
141967), S. 162. Vgl. Fietz 1994, S. 77.
13
Vgl. Fietz 1994, S. 77.
14
Vgl. Fietz 1994, S. 78.
15
Chesnutt S. 15. Chesnutt vollzieht in ihrer strukturalistischen Romananalyse die Entwicklung von girl
zu woman nach.
16
Ambition ist die Motivation Jocelyns, die einen höheren sozialen Status durch die Ehe anstrebt (vgl.
S. 93).
8
8
Als Edwin ihr einen Antrag macht, willigt Scarlet daher sofort ein und heiratet
ihn. Edwin, Vertreter einer älteren Generation, hält an konventionellen Rollen-
vorstellungen fest: No wife of his goes out to work. (127) Scarlet erkennt,
daß der Status als respektable Ehefrau und Mutter nicht die gewünschte per-
sönliche Erfüllung, sondern die Einschränkung ihrer persönlichen Freiheit mit
sich bringt. Edwins Weigerung, die Ehe zu vollziehen, und seine Neigung, sei-
ne Frau zu kontrollieren und zu kritisieren, führen zu stetigen Auseinanderset-
zungen: Edwin becomes more critical, more anxious to find fault. They have
rows. (129) Scarlet entwickelt eine ambivalente Haltung zu ihrer Situation:
Sie ist hin und her gerissen zwischen einem Gefühl der Sicherheit und dem
Bedürfnis nach Selbständigkeit: She feels well looked after. [...] Scarlet waits
for him [Edwin] to die. (128)
Scarlets emotionale Situation bessert sich durch die Heirat nicht. Die Distanz
zu ihren Mitmenschen nimmt zu und steigert sich zum Gefühl der Isolation:
She is deserted by, has deserted, Wanda, Kim, family, friends. She makes no
new acquaintances here in Lee Green. They think she is snobbish, and they are
right. (132) Sie fühlt sich auf ihre Rolle reduziert: A fat, spotty, dreary hou-
sewife. (132) Unter Edwins Einfluß verkümmert Scarlets Persönlichkeit:
Scarlet walks like a zombie. Regard Scarlet's personality as if it were a plant.
Come the winter it goes underground. Come the spring it will force its way up,
cracking concrete if need be, to reach the light. (131/132)
Ähnliche Erfahrungen macht Scarlets gleichaltrige Stiefmutter. Susan betrach-
tet es als ihre vornehmliche Pflicht, die Bedürfnisse und Wünsche des Ehepart-
ners zu erfüllen und ihn glücklich zu machen: Susan thinks it's marvellous to
be married to Kim: she loves playing houses; she even loves Kim. [...] Susan
despises Kim's former wives for having failed to make him happy. (35). Sie ist
bemüht, eine vorbildliche Hausfrau und Mutter zu sein.
17
Für den Sohn opfert
sie ihre persönliche Freiheit, da sie sich ihrer Mutterrolle verpflichtet fühlt:
Simeon holds Susan prisoner. She is resigned to her captivity. She devotes her life to looking
after him. [...] Susan is not happy, but she has the consolation of feeling she is in the right. It
would be difficult to fault her, and she knows it. (95/96)
Susan macht sich zum Agenten der Gesellschaft. Sie sieht ihre Funktion in er-
ster Linie darin, die Institution der Familie aufrecht zu erhalten, obwohl dies
für sie, wie für Scarlet, mit der Aufgabe der eigenen Wünsche und mit Verein-
samung verbunden ist: She wishes there was someone, anyone in the whole
world she could trust. (53) Dennoch versucht Susan, nach außen die Fassade
einer glücklichen Ehefrau und Mutter aufrecht zu erhalten. Sie entwickelt wie
17
Vgl. Chesnutt, S. 16.
9
9
Scarlet eine ambivalente Einstellung zu ihrer Existenz als Ehefrau und Mutter.
Die Spannungen führen schließlich zu einer Spaltung ihres Selbstbildes in eine
unglückliche und eine zufriedene Susan: Poor Susan. [...] Lucky Susan. (51)
2.1.2 Die Fügung in die Rollen
Fay Weldon stellt die Frauenfiguren in Down Among the Women als fremdbe-
stimmte und ausschließlich von anderen definierte Personen dar. Sie überneh-
men nicht nur die Rollenmodelle, die die Gesellschaft ihnen vorgibt, und geben
dabei ihre individuelle Persönlichkeit auf, sondern sie lassen sich - zumeist von
ihren Ehemännern - im wörtlichen Sinn neu definieren.
Edwin hat von Beginn an eine falsche Vorstellung von Scarlet. Er wirft ihr se-
xuelle Zügellosigkeit vor, obwohl Sexualität für sie kaum bedeutend ist.
18
Er
macht ihr den nicht ernst gemeinten Vorschlag, sexuelle Erfüllung außerhalb
der Ehe zu suchen: 'If you do feel yourself to be sexually deprived I can only
suggest you go out for the night every now and then. It will break my heart [...]
but if you feel like a whore that is my cross and I must bear it.' (129) Scarlet
läßt sich zu einem einmaligen Seitensprung verleiten. Durch Edwins Definition
wird sie buchstäblich zur Hure: Scarlet feels she is at last a whore. She need
no longer resist Edwin's accusations. She can accept them gracefully and have
some peace. (133)
So wie Scarlet Edwins Definition akzeptiert, so fügt sich auch Audrey den Vor-
stellungen ihres Partners und späteren Ehemannes. Paul gibt ihr einen neuen
Namen: He thinks he will change her name to Emma. It suits her better. (33)
Audrey/Emma ist beeindruckt von Pauls Persönlichkeit und paßt sich seinen
Wünschen an:
He knows so much, and she has so much to learn. Even sex, at which she thought herself well
trained, now appears a mystery. [...] And what is she on this earth for? Why, first to fuck, and
then to learn, according to Paul Dick. (33)
18
Scarlet wird anhand ihres Namens beurteilt, der selbst ihre Freundinnen zu einer Fehleinschätzung
ihrer Persönlichkeit verleitet: Scarlet has for some time been considered by her friends as a girl of loose
sexual morality. It is not true. (47)
10
10
Für Paul gibt sie ihre Tätigkeit bei einer Frauenzeitschrift auf. Sie übernimmt
seine Ansichten und läßt ihn über ihr gesamtes Leben bestimmen: Emma-
Audrey is so overwhelmed by the masterful nature of this well-educated, culti-
vated young man [...]. (42) Sie läßt sich erst zum Sexobjekt, dann zur Sekretä-
rin und schließlich zur Hausfrau umgestalten. Die Transformation widerspricht
ihrer Persönlichkeit dermaßen, daß sie diese buchstäblich als schmerzhaft emp-
findet: After a few months of Suffolk life Emma either stops getting stomach
pains or grows used to them. (87) Nach und nach gibt sie ihre früheren Träu-
me und Wünsche auf und wird zu einem ausschließlich von Paul definierten
Menschen, was sie schließlich selbst erkennt: 'He told me I liked weaving, and
I believed him, more fool me.' (174) 'He wants me to be a dowdy housewife,
so that's what he's going to get.' (175)
Auch Jocelyn paßt sich den Erwartungen ihres Ehemannes Philip an. Ihm zu-
liebe unterdrückt sie ihre bis dahin offen ausgelebte Sexualität und Promiskui-
tät: Jocelyn, out of kindness to her husband, trains herself in sexual disinterest,
even distaste. Presently she is apologizing to the world for her frigidity. (115)
Sie betrachtet Sexualität als Lebensenergie: a kind of life force. (227) Doch
als Ehefrau hält sie es für ihre Pflicht, sich den vorgeblichen Gewohnheiten
ihres Mannes unterzuordnen und zwingt sich zur Enthaltsamkeit.
19
Scarlet be-
fürchtet zu Recht, daß Jocelyns Persönlichkeit unter den konventionellen
Zwängen des Ehelebens verkümmert: 'There are two sides to Jocelyn,' she
complains. 'There's the conventional side and the human side, and I'm afraid the
wrong one is winning. Bed's one thing, but marriage!' (108)
20
Als die Spannungen zwischen den ihr aufgezwungenen Prinzipien und ihrer
natürlichen Veranlagung zu stark werden, spaltet sich Jocelyns Persönlichkeit.
Sie teilt sich in eine bewußte, rationale und eine unbewußte, sinnliche Kompo-
nente. Jocelyn beginnt, ein Doppelleben zu führen. Sie sucht sich einen Partner,
der ihre sexuellen Bedürfnisse erfüllt, an den sie sich aber in ihrem normalen
Leben kaum erinnern kann: She can hardly remember the young man's name.
(162) Wenn Jocelyns Körper reagiert, schaltet ihr Verstand sich aus: Jocelyn's
19
Wie viele Männerfiguren in Weldons Romanen verstellt sich Philip seiner Frau gegenüber. Er ist ein
notorischer Fremdgänger, der seine sexuelle Befriedigung außerhalb der Ehe sucht.
20
Jocelyn weigert sich, sich ihre Unzufriedenheit einzugestehen, doch sie äußert sich auf einer symbo-
lischen Ebene in zahlreichen Unfällen: Jocelyn zerbricht Dinge, tötet versehentlich ihre Haustiere (vgl.
113/114, 148, 164 und 212) und verbrüht ihren Sohn (vgl. 230/231).
11
11
mind, brain and intentions seem to have nothing to do with her twice-weekly
afternoon behaviour. It is only her body which does the desiring [...]. It is not-
hing to do with her. (162)
Jocelyn bemerkt schließlich selbst, wie sehr ihre Einstellung durch ihre Erzie-
hung indoktriniert ist. Als Scarlet Edwin verlassen will, versucht Jocelyn, sie
von den Werten der Institution Ehe zu überzeugen: Jocelyn listens to herself
talking and is aghast. She hears her mother in every word. (163) Dennoch gibt
sie ihr Doppelleben auf und kehrt vorübergehend in ihre einseitige Rollenexi-
stenz zurück, die sie als todesähnlichen Zustand empfindet. Folglich erleidet sie
eine Fehlgeburt: How can someone so dead as she produce anything that is
alive and good? (163)
Philip macht ihr die Enthaltsamkeit schließlich zum Vorwurf: 'You are a fri-
gid, anti-sex, English bitch, he said.' (226) Als Jocelyn ihn darauf hinweist,
daß ihre Frigidität allein seinem Einfluß zuzuschreiben ist, ändert er seine De-
finition in das Gegenteil: 'Whore, he said. Slut.' (226) Jocelyn fügt sich
auch in diese ihr auferlegte Rolle: 'All right, [...] if that's what you want to
believe, that's what I am.' (226) Aus Trotz begleitet sie Philip als angebliche
Prostituierte zu einem geschäftlichen Treffen, das mit einem gemeinsamen Ge-
schlechtsakt vor den Augen seines Partners endet. Später berichtet sie Scarlet
von den Ereignissen, die zugleich das Ende ihrer Ehe besiegeln: 'I think it was
that he had, on that instant, ceased to see me as a wife and now saw me as a
whore'. (227) Sie fühlt sich gedemütigt und zu einem willenlosen Objekt re-
duziert: 'All sense of personal identity goes.' (229)
21
Erst in ihrer gleichberechtigten Beziehung zu Ben gelingt es Jocelyn, ein
Gleichgewicht zwischen ihrer sinnlichen und ihrer rationalen Seite herzustellen
und sich zu einer ausgeglichenen Persönlichkeit zu entwickeln:
'While I was living with Philip I was a very disagreeable person. Now I live with Ben I am quite
nice and reasonable. It was sex, of course, the whole thing, although I would have been horri-
fied by the suggestion at the time. If I couldn't get what I needed in bed - while denying the
need for it, of course - I'd bloody get what I could out of him in other ways.' (225
)
22
21
Jocelyn once said, when drunk, it was her secret ambition [...] to be a [...] street-corner whore. (19)
Dieser Wunsch wird ihr hier ironischerweise ausgerechnet von Philip erfüllt.
22
Hier spielt Jocelyn auf ihre Neigung an, die fehlende sexuelle Erfüllung in der Ehe durch Ver-
schwendungssucht zu kompensieren (vgl. 138 und 225).
12
12
Am Beispiel der Frauenfiguren in Down Among the Women stellt Weldon deut-
lich die Schwächen eines soziologischen Rollenmodells heraus, das den Men-
schen nicht nur unzureichend definiert, sondern ihn auf einen Teilaspekt seiner
Persönlichkeit reduziert. Die ausschließlich anhand ihrer Rollen charakteri-
sierten Frauen erscheinen als Wesen ohne Individualität, eigenen Willen oder
die Fähigkeit zur Selbstbestimmung. Bei dem vergesellschafteten Individuum,
das seine persönlichen Bedürfnisse zum Wohl der Gesellschaft zurückstellt, ist
eine komplexe Ausprägung und ungestörte Entwicklung der Persönlichkeit
kaum möglich.
Jocelyn bringt mit dem letzten Satz des Romans die optimistische Überzeu-
gung zum Ausdruck, daß sie der letzten Generation angehört, die sich aus-
schließlich durch geschlechtsspezifische Rollen definiert: We are the last of
the women. (234)
2.1.3 Die Lösung von den Rollen
Edwin setzt seine Versuche, Scarlet nach seinen Vorstellungen zu verändern,
auch nach der Trennung fort. Er überredet sie, sich einer psychoanalytischen
Behandlung zu unterziehen. Die Erkenntnis, daß Edwin sie zu einer Person
machen will, mit der sie sich nicht identifizieren kann, und ihre Tochter By-
zantia auf ähnliche Weise umzugestalten versucht, veranlaßt sie zum endgülti-
gen Abbruch der Beziehung.
23
Scarlet sieht sich in der Lage, bereit und auch
gezwungen, eine unabhängige Existenz zu führen: 'I can look after myself per-
fectly well.' [...] It is a useful discovery, because the following day she receives
a letter from Edwin's solicitors saying she will receive no more maintenance.
(180) Sie überwindet ihre Angst vor der Verantwortung und stellt sich den
Herausforderungen eines selbstbestimmten Lebens. Scarlet holt ihr Examen
nach und übernimmt ein Lektorat, um selbständig für sich und Byzantia sorgen
zu können. Sie begreift schließlich, daß die Festlegung auf eine bestimmte
Rolle ihrer Persönlichkeit widerspricht:
She is running away again. She has always run away, and always found it exhilarating. There
has always been, with Wanda, a new school, a new father, a new flat to run to; later a new man,
a new baby, a new life. Every new event ensures a host of old ones thrown out, run away from,
23
Edwins Versuche, Byzantia einen konventionellen Namen zu geben, ziehen sich als eine Art running
gag durch den Roman (vgl. 130, 137, 154, 156). Die Forderung, sie in Edwina umzubenennen, signa-
lisiert seine extreme Selbstbezogenheit (vgl. 178).
13
13
left undone. She remembers what it felt like to be a naughty little girl; excited by disaster and
her own wilfulness. (206)
Susan vollzieht die Loslösung von der Ehefrauenrolle unfreiwillig. Mit Scarlet
und Wanda fühlt sie Kims Vergangenheit in ihr Leben eindringen. Die Angst,
von dem ihr durch die Heirat rechtmäßig zustehenden Platz verdrängt zu wer-
den, stellt sich als berechtigt heraus. Ein vorübergehender Rollentausch wird
eingeleitet, als Scarlet ihre Tochter in Susans und Kims Ehebett zur Welt
bringt. Susan selbst wird ins Krankenhaus abgeschoben, wo sie unter traumati-
schen Umständen ihren Sohn zur Welt bringt.
24
When Kim comes to visit her,
Susan can hardly remember who he is. (60) Bei ihrer Rückkehr aus dem
Krankenhaus wird sie mit Kims offenkundiger Ablehnung konfrontiert, die ihre
Illusion eines erfüllten Familienlebens endgültig zerstört. Susan distanziert sich
von Kim und akzeptiert ihn als einen Teil seiner früheren Familie: He is not-
hing to do with her. He never has been. He is Scarlet's father, Byzantia's grand-
father, Wanda's husband. He has acknowledged it, and so can she. She has her
inner life back again. (193) Als Kim kurz darauf stirbt, verbessert sich Susans
psychischer Zustand. Durch Kims Tod entfällt die Notwendigkeit und auch die
Möglichkeit, die Rolle der Ehefrau und Mutter weiter auszufüllen. Sie ist ge-
zwungen, auf eigenen Füßen zu stehen, und die Verantwortung vermittelt ihr
ein neues Selbstwertgefühl: Her life begins. (198)
Auch Audrey löst sich von ihrer Hausfrauen- und Mutterrolle. Die Erkenntnis,
daß ihr Leben und ihre Persönlichkeit vollkommen von Paul bestimmt sind,
löst eine weitere extreme Transformation aus. Sie verläßt ihre Familie und be-
ginnt ein Verhältnis mit ihrem ehemaligen Arbeitgeber. In ihrem neuen Leben
kehrt sie bewußt die früheren Machtverhältnisse um: She, once imprisoned on
a poultry farm, now runs a women's magazine, bullies her lover and teases her
chauffeur. How's that for the wages of sin? (5/6) Im Gegensatz zu Jocelyn und
Scarlet gelingt es Audrey jedoch nicht, Selbsterfüllung zu finden. Sie befreit
sich zwar aus ihrer fremdbestimmten Existenz, aber nur, um sich in neue Rol-
len zu fügen. Sie wandelt sich von der Hausfrau zur Karrierefrau und von der
Ehefrau zur Geliebten. Die Identifikation mit ständig wechselnden und zum
Teil widersprüchlichen Rollen führt dazu, daß Audrey nicht in der Lage ist, ein
kohärentes Selbstbild zu entwickeln. Sie gesteht Helen ihr Unvermögen ein,
24
Alexander nennt diese Episode als ein Beispiel aus einer Reihe von sexual patternings im Roman. So
wird zum Beispiel Byzantia an dem Tag gezeugt, an dem Scarlet aus der Zeitung von Kims und Susans
Hochzeit erfährt. Vgl. Flora Alexander, Contemporary Women Novelists (London: Edward Arnold,
1989), S. 53/54. Crosland bezeichnet die Episode aufgrund der Absurdität, die charakteristisch ist für
Weldons Romane, als Weldonesque situation. Vgl. Margaret Crosland, Beyond the Lighthouse (Lon-
don: Constable, 1981), S. 204.
14
14
sich selbst zu definieren: 'I just want to be myself [...] I don't want to be mar-
ried, or do housework. [...] I tried all these years to be something I wasn't; now
I'm trying to be the opposite, and it's just as upsetting.' (209) Sie erkennt, daß
sie keinen festen und gleichbleibenden Persönlichkeitskern besitzt: 'I haven't
got a self to be,' complains Audrey. 'I change every five minutes.' (209)
25
Audreys Unsicherheit bezüglich der Frage, wie sie ihr Leben und ihre Zukunft
gestalten könnte, schlägt sich in inkonsequentem und widersprüchlichem Ver-
halten nieder, unter dem vor allem ihr Liebhaber zu leiden hat. Nur manchmal
gelingt es diesem, wie Paul seine Wünsche durchzusetzen. Unter diesem Druck
zersplittert Audreys Persönlichkeit vollständig in verschiedene Teile:
He finds that when he insists, she complies. [...] Although if he presses too hard, he discovers,
her personality disintegrates altogether, like a blob of mercury flying into bits, and when gathe-
red together again, has incorporated flecks of dust and foreign matter which take yet more get-
ting used to. (210/211)
Wie Audrey gelingt es auch Helen nicht, sich selbst zu definieren: 'What do I
mean when I say I?' asks Helen. 'I wondered that when I was six. I still don't
know. All I know is that I is the bit that suffers, and without I there would be
peace.' (221)
26
Als Y (Yvonne), die Ehefrau ihres Liebhabers X (Alex), auf-
grund seiner Seitensprünge und Helens Schwangerschaft Selbstmord begeht,
bekommt Helen die alleinige Verantwortung zugeschrieben: Helen [...] beco-
mes imprisoned in the role of temptress and destroyer assigned her by socie-
ty.
27
Sie identifiziert sich mit ihrer Rolle als femme fatale und sieht sich, als X
sie verläßt und sie diese Funktion verliert, nicht in der Lage, eine autonome und
selbstverantwortliche Existenz aufzubauen:
'I have never been without a man. I have always been someone's mistress. It will not suit me to
be an unmarried mother.' [...] 'I have never been responsible for anyone except myself. I can't
start now. I can't do anything new. Only the same as I did yesterday.' (203)
Anhand der Figuren Audrey und Helen macht Weldon deutlich, daß die Selbst-
findung ein komplexer Vorgang ist, der nicht einfach mit der Lösung von in-
authentischen Rollenidentifikationen abgeschlossen ist. Beiden Figuren gelingt
25
Audreys Probleme, sich selbst als einheitliche Person zu definieren, hängen auch mit der Änderung
ihres Namens zusammen. Sie ist anfänglich nicht in der Lage, sich zwischen Audrey und Emma zu
entscheiden (vgl. 43/44). Den Protagonistinnen aus Weldons Romanen Praxis und Splitting, die ebenfalls
wechselnde Namen haben, ergeht es ähnlich. Vgl. dazu Kap. 3.1.1 und 5.1.4.
26
Im Fall Helens liegen die Ursachen für ihr verwirrtes Selbst-Verständnis in ihrer Vergangenheit, die
von einem häufigen Verlust von Identifikationspersonen gekennzeichnet ist: ihre kommunistischen Eltern
kommen im Dritten Reich in Berlin ums Leben, die englischen Pflegeeltern sterben bei einem Bomben-
angriff. Helen hat bereits mit achtzehn eine gescheiterte Ehe hinter sich (vgl. 144/145). Helen ist als
einzige Romanfigur mit einer komplexen Vergangenheit ausgestattet, in die sich die Ursachen für ihr
zersplittertes Selbstbild zurückverfolgen lassen.
27
Chesnutt, S. 16.
15
15
es nicht, sich unabhängig von den Rollen zu definieren. Das entdeckte Selbst
stellt sich als eine veränderbare und undefinierbare Größe heraus. Auch im
Falle Scarlets und Susans, die einen Status erlangen, in dem sie über sich selbst
bestimmen können, bleibt dieses Selbst undefiniert.
2.1.4 Individualismus und Kollektivität
Das sozialbehavioristische Persönlichkeitsmodell ist ein betont anti-individua-
listischer Ansatz. Für den Sozialbehavioristen existiert der Mensch nicht als
eigenständiges Individuum, bevor er in soziale Prozesse eingebunden wird,
sondern wird erst durch die Einnahme einer bestimmten Position in der sozia-
len Ordnung zum Individuum.
28
Im Gegensatz zu individualistischen Theorien
begreift der Sozialbehaviorismus Identität nicht als Ausdruck individueller,
einmaliger und unverwechselbarer Persönlichkeitsmerkmale, sondern als
Identischsein mit anderen Gruppenmitgliedern.
29
Trotz ihres Strebens nach Unabhängigkeit vertritt Scarlet eine ähnlich anti-indi-
vidualistische Auffassung. Sie beklagt sich über das Unverständnis und die
Illoyalität, von denen die Beziehungen zu ihrer Mutter und zu ihren Freundin-
nen gekennzeichnet sind: 'I don't know what happens to everyone,' [...]. 'The
older we get the more we become ourselves. We were nicer when we were
younger and all little bits of other people.' (155) Der Begriff ourselves trägt
hier eine negative Konnotation. Für Scarlet ist das Selbst das Endprodukt eines
Individualisierungsprozesses, der von einem Zusammenbruch zwischen-
menschlicher Beziehungen begleitet ist. Sie bringt hier eine Skepsis gegenüber
dem modernen Autonomie-Verständnis zum Ausdruck. Durch die Betonung
seiner Individualität und Autonomie wird der Mensch zu einem Einzelwesen,
das unabhängig von seinen Mitmenschen existiert. Dies kann im Extremfall zu
Entfremdung und Isolation führen:
[I]f it is true that the breakdown and loss of shared systems of belief in transcendental meta-
narratives has facilitated the rise to supremacy of the individual, then it is also true that this new
individualistic focus brings with it the attendant dangers of alienation, solipsism, and isolati-
on.
30
Die Ablehnung eines rein individualistischen Selbstverständnisses wird am
Beispiel Jocelyns deutlich. Jocelyn findet den Gedanken, beliebig austauschbar
zu sein, unerträglich: 'We are all alike,' she says to Philip [...]. 'We are all just
28
Vgl. Fietz 1994, S. 77.
29
Vgl. Fietz 1994, S. 78.
30
Kim L. Worthington, Self as Narrative (Oxford: Clarendon Press, 1996), S. 3/4.
16
16
the same people. I can't bear it. I want to die.' (163/164) Sie versucht, ihre In-
dividualität durch distinguiertes Verhalten zu unterstreichen: She is a cool,
chic, childless young lady. [...] Her accent she sharpened into Upper English
Chelsea. Shopgirls pay attention when Jocelyn walks in: it seems an achieve-
ment. (138) Doch ihre Distanziertheit entfremdet sie von anderen Menschen
und treibt sie in die Isolation. Ein Selbstwertgefühl entwickelt sich erst, als sie
Verantwortung für andere Menschen übernimmt - zunächst für Helen, später
für ihre Kinder - und schließlich ihre Überlegenheit ablegt: 'I knew by then
[...] that I was really just like any other woman, and deserved as much and as
little; and once I knew that, all kinds of reasonable, sensible things became
possible.' (231)
31
Auch Scarlet löst sich aus ihrer Isolation. Sie entwickelt ein Gemeinschafts-
gefühl, das in dem Bedürfnis zum Ausdruck kommt, ihre Freundinnen von ih-
rem Erkenntniszuwachs profitieren zu lassen:
And Scarlet, conscious of her own years in darkness, tries to transmit, by simple touch, some of
her own harshly-acquired strength. Scarlet is generous. She wishes to share. She is prepared to
give at least a portion of her own happiness away. (205)
Am Beispiel der Frauenfiguren im Roman macht Weldon deutlich, daß sie Ex-
trempositionen ablehnt. Die sozialbehavioristische Rollentheorie läßt dem In-
dividuum keinen Raum für eine freie Entfaltung der Persönlichkeit. Doch auch
eine absolut autonome Existenz ist für Weldon nicht etwa ein unerreichbares
Ideal, sondern ein unerstrebenswerter Zustand, der zur Isolation führen kann.
Ein ausgewogenes Verhältnis von Individualität und Freiheit auf der einen,
Kollektivität und Gemeinschaft auf der anderen Seite, scheint jedoch ein
schwer zu verwirklichendes Ideal zu sein.
2.1.5 Fiction of ideas
Down Among the Women zeichnet sich durch eine episodische Struktur und
einen essentiellen, verdichteten Stil aus: The effect is clear-cut and incisive,
making for forceful statement of a theme rather than complex analysis.
32
Durch seine selektive und distanzierte Darstellungsweise weicht der Roman
31
Das hier angedeutete Konzept einer kollektiven Identität ist, laut Waugh, kennzeichnend für femi-
nistisch orientierte Literatur: Much women's writing can, in fact, be seen not as an attempt to define an
isolated individual ego but to discover a collective concept of identity subjectivity which foregrounds the
construction of in relationship. Waugh 1989, S. 10.
32
Alexander, S. 54.
17
17
vom Standard der realistischen Erzählform ab. Die ausgewählten Ereignisse
und Charakteranalysen besitzen eine eher symbolische Bedeutung. Diese Form
der Erzählung, die Palmer als fiction of ideas bezeichnet, stellt weniger die
psychologischen Konflikte der Figuren in den Vordergrund, sondern dient in
erster Linie der Vermittlung von Themen:
[T]he writers' chief interest lies not in the detailed delineation of individual character and per-
sonal relationships. The characters emerge in certain cases as mere briefly sketched profiles or
stereotypes. It lies, on the contrary, in the field of ideas [...].
33
Die Figuren in Down Among the Women wirken anfänglich wie Personifizie-
rungen stereotyper Rollenklischees. Übertreibungen und karikative Überzeich-
nung lassen ihr Verhalten oft grotesk und lächerlich erscheinen.
34
Die Absur-
dität der Verhaltensweisen wird unterstrichen durch den distanzierten und hu-
morvollen Erzählton, der charakteristisch ist für Weldons Romane und Erzäh-
lungen.
35
Die Figuren werden überwiegend durch zusammenfassende Beschreibungen
des Erzählers charakterisiert, oder sie charakterisieren sich selbst durch direkte
Aussagen in Dialogen oder inneren Monologen: They are artistically shaped
summaries clearly different from the psychological realist's attempt to capture
in language the complexity of an individual's inner life.
36
Sie wirken flacher
und weniger umfangreich charakterisiert, als die Figuren in Weldons späteren
Romanen.
37
Die Künstlichkeit der Charakterzeichnung und die daraus resultierende Zwei-
dimensionalität der Romanfiguren verstärken den Eindruck der Unzulänglich-
keit des sozialbehavioristischen Rollenmodells. Die sozialen Beziehungen ei-
nes Menschen und seine Funktion in der Gesellschaft können allein kein allum-
fassendes Bild von seiner Persönlichkeit ergeben. Auch die episodische Struk-
tur des Romans ermöglicht - wie das Rollenmodell - nur fragmentarische Ein-
blicke in die komplexe psychische Konstitution des Menschen.
In der Einleitung des fünften Romankapitels stellt die Erzählerin einen direkten
Bezug zur Thematik des Rollenspiels her. Sie schlüpft in die Rolle einer An-
sagerin, die ein Theaterpublikum durch das Programm führt:
33
Paulina Palmer, Contemporary Women's Fiction (London: Harvester Wheatsheaf, 1989), S. 8. Palmer
ordnet Weldons frühe Romane in eine Reihe ähnlich strukturierter Werke ein.
34
Vgl. Alexander, S. 52. Zum Vorwurf stereotyper Figurenentwürfe äußert sich Weldon in einem Inter-
view. Vgl. Olga Kenyon, Women Writers Talk (Oxford: Kunard, 1989), S. 196.
35
Vgl. Agate Nesaule Krouse, Feminism and Art in Fay Weldon's Novels, Critique 20, No. 2 (1978), S.
6. Der Aufsatz enthält unter anderem eine Analyse der Komik in Down Among the Women.
36
Krouse, S. 18.
37
Vgl. Harriet Blodgett, Fay Weldon, in: Dictionary of Literary Biography, Vol. 14 (Detroit: Gale
Research Company, 1983), S. 753.
18
18
There will now be a short intermission. Sales staff will visit all parts of the theatre, selling for
your delight whale-fat ice-cream whirled into pink sea waves at two shillings, or ten new pence,
the plastic cone; [...]. Or if you prefer, try a hamburger from our foyer stall at only two shil-
lings and sixpence, or thirteen new pence; dig your teeth into the hot pink rubber sausage. [...]
(61)
38
Durch die Theater-Analogie wird die Erzählung zum Theaterstück erklärt, der
Leser zum Zuschauer und die Figuren zu Schauspielern, die einstudierte Rollen
spielen, die nichts mit ihrer eigentlichen Persönlichkeit zu tun haben.
Die realistische Illusion wird hier bewußt durchbrochen. Diese Passage stellt
ebenso eine Abweichung von der konventionellen realistischen Erzählweise dar
wie einfließende Anekdoten (171), Witze (137), Gedichte (63) oder graphische
Darstellungen (73). Durch diese Stilmittel wir immer wieder auf den fiktiven
Charakter der Erzählung hingewiesen.
2.2 Das empirisch-pragmatische Persönlichkeitsmodell
William James betont in seinem empirisch-pragmatischen Ansatz ähnlich wie
Mead die soziale Dimension der Identität. Als Sozialtheorie definiert sie den
Menschen nicht als autonomes Einzelwesen, sondern als Bestandteil eines so-
zialen Beziehungsgeflechts. Im Gegensatz zu Mead entwirft James jedoch ein
komplexes Persönlichkeitsmodell, das nicht nur soziale Einflußfaktoren, son-
dern auch biologische, psychologische und erkenntnistheoretische Faktoren
berücksichtigt.
39
James bezieht auch materiale Besitztümer in seine Definition der Persönlich-
keit mit ein:
[...] a man's Self is the sum total of all that he can call his, not only his body, and his psychic
powers, but his clothes and his house, his wife and children, his ancestors and friends, his repu-
tation and works, his lands and horses, and yacht and bank-account.
40
Die Gesamtheit der Persönlichkeit, das empirical Me, besteht laut James aus
vier Einzelkomponenten. Die oben genannten Besitztümer bestimmen die Ei-
genansicht eines Menschen, das materiale Selbst. Das soziale Selbst summiert
sich aus den Ansichten Außenstehender über die Person. Das Bewußtsein der
eigenen psychischen und geistigen Fähigkeiten macht das geistige Selbst aus.
Die vierte Komponente ist das reine Selbst, das Gefühl einer personalen Iden-
38
Die Passage entwickelt sich in der Folge zu einem ironischen Kommentar zur chemischen Lebens-
mittelindustrie und die Manipulation durch Werbung.
39
Vgl. Fietz 1994, S. 74.
40
William James, Pinciples of Psychology, Vol. 1, (London 1891), S. 291. Vgl. Fietz 1994, S. 71. Die
Hervorhebungen stammen von Fietz.
19
19
tität im Sinne von Einheit und Kontinuität.
41
Die heterogenen Komponenten
des empirical Me begründen das Selbstgefühl, welches wiederum die Handlun-
gen leitet, die der Befriedigung der eigenen Ansprüche und der Selbsterhaltung
dienen.
42
2.2.1 Das dualistische Wertdenken
Wenn bei James von a man's Self die Rede ist, das sich durch den Besitz von
materiellen Gütern, Frau und Kindern definiert, kommen Zweifel an der Allge-
meingültigkeit seines Modells auf.
Die Frauenfiguren in Down Among the Women scheinen James' Modell tatsäch-
lich nur auf die Männer anwenden zu können. Susan empfindet Kim aufgrund
seines Alters und seiner Vergangenheit als komplexe und undurchschaubare
Persönlichkeit:
He is too real for her now; his past has been going on too long: he has accrued too much
strength from it. She sees him as a walking jigsaw, and every piece has been left by some other
person, some other event, of which she knows nothing. (53)
Sie selbst wird erst durch ihre Beziehung zu Kim zur Person und befürchtet,
durch eine Trennung ihre Existenzberechtigung völlig zu verlieren: Susan is
envious that Kim has a past and she has not. Sometimes she worries lest she
too, should become part of Kim's past. (35)
Ähnlich denkt Scarlet von Edwin: She is conscious of his past, stretching back
and back, of the whole great mysterious sum of his existence, now being offe-
red to her through the pressure of his lips. (121) Die Frauen haben dagegen
Probleme, ein entsprechend komplexes Selbstbild zu entwickeln. Dies ist nicht
nur auf ihr geringeres Alter und die geringere Lebenserfahrung zurückzuführen.
Auch die Malerin Y fühlt sich ihrem Ehemann X gegenüber minderwertig, ob-
wohl sie ihm auf künstlerischem Gebiet überlegen ist: How can she, so small,
so ordinary, so everyday, have the right to the totality of his being? (89)
43
Jocelyn faßt die Tatsache, daß die Frauen sich nur als Aspekte ihrer Männer
begreifen, in Worte: 'But you don't remain yourself when you marry,' [...].
'You take on your husband's level in the world. You take on his status, his in-
come, his friends and his way of life. His class, if you like. You become an
aspect of him.' (122) Sie kommentiert hier das dualistische Wertdenken in
41
Vgl. Fietz 1994, S. 71/72.
42
Vgl. Fietz 1994, S. 71.
43
Weldon führt diese Aussagen durch die Art der Charakterisierungen ad absurdum. Die männlichen
Romanfiguren sind noch skizzenhafter dargestellt als die Frauenfiguren.
20
20
einer Gesellschaft, in der Männer und Frauen nach unterschiedlichen Maßstä-
ben beurteilt werden. Während den Männern das Recht auf ihre Freiheit und
Individualität zugestanden wird, müssen die Frauen in der Lage sein, sich
wechselnden Bedingungen anzupassen.
44
Den auf ihre Ehefrauen- und Mutterrollen festgelegten Frauen in Down Among
the Women fällt es schwer, sich als empirical Me wahrzunehmen. Aufgrund
ihrer finanziellen Abhängigkeit haben sie keinen eigenen Besitz, der ihnen ein
Selbstgefühl vermitteln könnte. Folglich bleibt das materiale Selbst unausge-
prägt.
45
Sie definieren sich zwar durch ihre Beziehungen zu Ehemännern und Kindern,
doch diese Beziehungen sind - wie am Beispiel Susans und Scarlets bereits her-
ausgestellt wurde - von Ambivalenz geprägt. Auch Y fühlt sich von X und ih-
ren Kindern ihrer Eigenständigkeit beraubt: 'Look,' she says in her heart, 'you
have altered me for ever; you have given me children and I can never be myself
again, I must be part of them.' (170) Auch diesbezüglich werden Männer und
Frauen nach unterschiedlichen Maßstäben beurteilt. Für Y bleibt X trotz der
Ehe und der Kinder unverändert und erhält sich seine Autonomie: 'You stay
the same. You implant your seed in me and walk away and leave me to it.'
(170)
46
Die Frauen sehen sich selbst als unvollständige Individuen ohne autonome Exi-
stenz. Jocelyn hält einen Ehemann für eine unentbehrliche Komponente zur
Vervollständigung der eigenen Persönlichkeit: She wants everyone to know
that she, Jocelyn, is truly female, truly feminine, truly desired, is now to be
married and complete. (92) Dafür opfert sie bereitwillig ihre Eigenständigkeit.
Sie beurteilt auch Audreys bedingungslose Selbstaufgabe für Paul als die beste
Voraussetzung für eine glückliche Ehe (vgl. 93/94). Dagegen glaubt sie, daß
sich Philip durch eine Heirat nicht verändert: 'You're not a different person
[...] just because you're married.' (110) Helen und Y sind auf eine extreme Art
emotional abhängig von ihrem männlichen Partner. Für beide Frauen ist eine
Selbstdefinition ausschließlich in Verbindung mit X möglich. Beide begehen
Selbstmord als sie X verlieren. Helen fühlt sich ohne ihn auf einen Schatten
ihrer selbst reduziert (vgl. 217/218). Ihre Existenz verliert jeglichen Sinn: 'I
have invested everything of me in him. I have nothing left but him.' (202) 'I
44
Vgl. Waugh 1989, S. 22. In The Life and Loves of a She-Devil bringt die Protagonistin Ruth die
Grundzüge dieser Doppelmoral in der Litany of the Good Wife auf den Punkt. Vgl. Kap. 4.1.1.
45
Scarlet besitzt zeitweise nicht einmal eigene Kleidung (vgl. 33). Der Titelheldin aus Weldons Roman
Praxis ergeht es ähnlich: Die Tatsache, daß sie gebrauchte Kleidung trägt, beeinflußt die Entwicklung
ihres Selbstbildes. Vgl. dazu Kap. 3.1.1.
46
Fay Weldon äußert diese Auffassung in einem Interview: Men on the whole don't change. Women
change because they have children. John Haffenden, Novelists in Interview (London: Methuen, 1985), S.
314.
21
21
can't leave him,' Helen repeats. 'He is my existence.' (203) Die Selbstzerstö-
rung ist hier die logische Konsequenz.
Die weiblichen Romanfiguren verkörpern in erster Linie eine der vier Gesamt-
komponenten des empirical Me: das soziale Selbst, das von Außenstehenden
anhand seiner Rollen beurteilt wird. Das geistige Selbst, die Fähigkeit, sich als
denkendes Subjekt wahrzunehmen, verkümmert bei den Frauen, die auf ihre
Rolle als Hausfrauen beschränkt sind. So wie Scarlets Persönlichkeit verküm-
mert, leidet auch Jocelyn in ihrer Ehe unter geistiger Unterforderung. Sie wird
oberflächlich: '[S]he can talk of nothing but hairdressers and hats.' (116)
Während Audrey ihr Leben durch die Anzahl von Socken definiert, die sie wö-
chentlich waschen muß (vgl. 172/173), beurteilt Jocelyn die Struktur ihres Le-
bens anhand von Einrichtungsgegenständen und gemusterten Tapeten (vgl.
111).
47
Der Begriff Selbstgefühl ist bei James nicht ausschließlich positiv zu verste-
hen. Das Selbstgefühl kann sich sowohl in Stolz, Eitelkeit und Selbstgefällig-
keit als auch in Bescheidenheit, Scham oder Selbstverleugnung äußern.
48
In
Down Among the Women werden diese Ausprägungen der Selbsteinschätzung
überwiegend geschlechtsspezifisch zugeordnet. Der Roman beschreibt selbst-
gefällige Männer und sich selbst verleugnende Frauen.
49
Die Handlungen der Frauen, die aus der Selbsteinschätzung hervorgehen, die-
nen nicht der Befriedigung ihrer individuellen Ansprüche, sondern vor allem
dem Wohl und der Bequemlichkeit ihrer Familie. Die eigenen Bedürfnisse und
die sozialen Anforderungen sind für sie nicht miteinander vereinbar. Selbster-
haltung ist ihrer Meinung nach nur durch die Anpassung an gesellschaftliche
Normen möglich, was eine Schwächung des Selbstwertgefühls zur Folge hat.
47
Das Gefühl einer personalen Identität, das im empirisch-pragmatischen Modell das reine Selbst aus-
macht, entsteht durch reflexive Rückwendung des Subjekts, des geistigen Selbst, auf seine früheren
Selbstzustände und seine persönliche Geschichte. Nur wenn vergangenes und gegenwärtiges Selbst als
identisch empfunden werden, entsteht der Eindruck einer kontinuierlichen Identität. Vgl. Fietz 1994, S.
72. Der Vorgang der reflexiven Rückwendung auf die Vergangenheit wird durch die Erzählperspektive
im Roman nachvollzogen. Die Erzählerin Jocelyn verkörpert das geistige Selbst, das sich an die Vergan-
genheit zurückerinnert. Es findet jedoch keine Identifikation statt. Jocelyn beurteilt ihr früheres Verhalten
aus einer kritischen und ironischen Distanz heraus, die impliziert, daß ihr Re-flexionsprozeß nicht zum
Gefühl einer personalen Identität führt. Das reine Selbst bleibt unverwirklicht. Vgl. dazu auch Kap. 2.3.
48
Vgl. Fietz 1994, S. 73.
49
Die Begriffe männlich und weiblich werden mit gegensätzlichen Eigenschaften belegt, die Chesnutt
in einer Tabelle gegenüberstellt. Vgl. Chesnutt, S. 13. Der Begriff Frau ist im Roman auch von den
Frauen selbst überwiegend negativ definiert. Bereits der Titel Down Among the Women enthält eine
negative Konnotation: [I]ts title [...] is the theme song of devastating introductory passages of commen-
tary on the female condition. Blodgett, S. 753. Kenyon erklärt die verschiedenen Assoziationen des
Wortes down in der Titelzeile: Here she [Weldon] begins the poeticising of women's gruesome work.
Olga Kenyon, Women Novelists Today (Brighton: Harvester Press, 1988), S. 110.
22
22
Der Roman parodiert die masochistische Bereitschaft der Frauen, sich den
Wünschen der Männer zu fügen und sich selbst aufzuopfern.
50
Durch die Berücksichtigung verschiedenartiger Einflußfaktoren schafft James
einen komplexen und pluralistischen Ansatz, der keinen Anspruch mehr dar-
auf erhebt, ein Persönlichkeitsmodell zur Synthese der heterogenen Konstitu-
enten, Facetten und Ansichten einer Person bereitzustellen.
51
Das Bewußtsein
einer personalen Identität im Sinne einer geistigen Kontinuität muß sich dem-
nach nicht notwendigerweise einstellen.
52
Im Gegenteil läßt die Komplexität
und Heterogenität des pragmatischen Selbstbegriffs die Integration zu einem
ganzen Individuum problematisch erscheinen.
53
Daher gelingt es auch den Frauen in Down Among the Women nicht, ein ein-
heitliches Identitätsbewußtsein zu entwickeln. Sie müssen sich schließlich da-
mit abfinden, daß sie genau so komplexe und schwer definierbare Individuen
sind, wie ihre Männer.
2.2.2 Die Anerkennung der Eigenverantwortung
Der Selbst-Begriff bei James ist nicht essentialistisch und statisch, sondern
pluralistisch und dynamisch.
54
Die Identität ist laut James eine lose, sich ste-
tig verändernde Konstruktion. Die Menschen sind individuell gestaltete Colla-
gen aus diversen und variablen Persönlichkeitsfaktoren. Indem er den Identi-
tätsbegriff derart relativiert, distanziert er sich von Persönlichkeitstheorien, die
von einer vorgegebenen Substanz oder Seele ausgehen. Der Mensch hat seiner
Ansicht nach nicht die Möglichkeit, ein wahres Selbst zu entdecken. Doch er
kann sich, befreit von gesellschaftlichen oder psychologischen Beschränkun-
gen, zu einem gewissen Grad selbst erschaffen.
55
Im Einklang mit dem empirisch-pragmatischen Persönlichkeitsmodell entdek-
ken die Frauen in Down Among the Women am Ende des Romans kein wahres
oder essentielles Selbst hinter ihren Rollen. Statt dessen entdecken sie die
Möglichkeit, selbst über ihr Leben zu bestimmen und sich somit tatsächlich auf
gewisse Weise selbst zu erschaffen.
50
The word 'women' here carries ironic resonances. Weldon uses it as a synonym for a group of down-
trodden underlings. Palmer, S. 151.
51
Fietz 1994, S. 69.
52
Vgl. Fietz 1994, S. 72/73. James selbst räumt die Möglichkeit ein, daß die Menschen sich nicht als
ganzes Individuum, sondern als eine Ansammlung verschiedener, oft unvereinbarer Selbste begreifen.
53
Vgl. Fietz 1994, S. 74.
54
Vgl. Klaus-Jürgen Bruder, Subjektivität und Postmoderne (Frankfurt: Suhrkamp, 1993), S. 81/82.
55
Vgl. Bruder, S. 113/114.
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Originalausgabe
- Erscheinungsjahr
- 1997
- ISBN (eBook)
- 9783832407650
- ISBN (Paperback)
- 9783838607658
- Dateigröße
- 884 KB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- Universität Münster – Unbekannt
- Note
- 1,0
- Schlagworte
- existentialismus multiple persönlichkeitsstörung analyse charakterern struktur technik perspektive englischer empirismus sozialbehavioristische rollentheorie
- Produktsicherheit
- Diplom.de