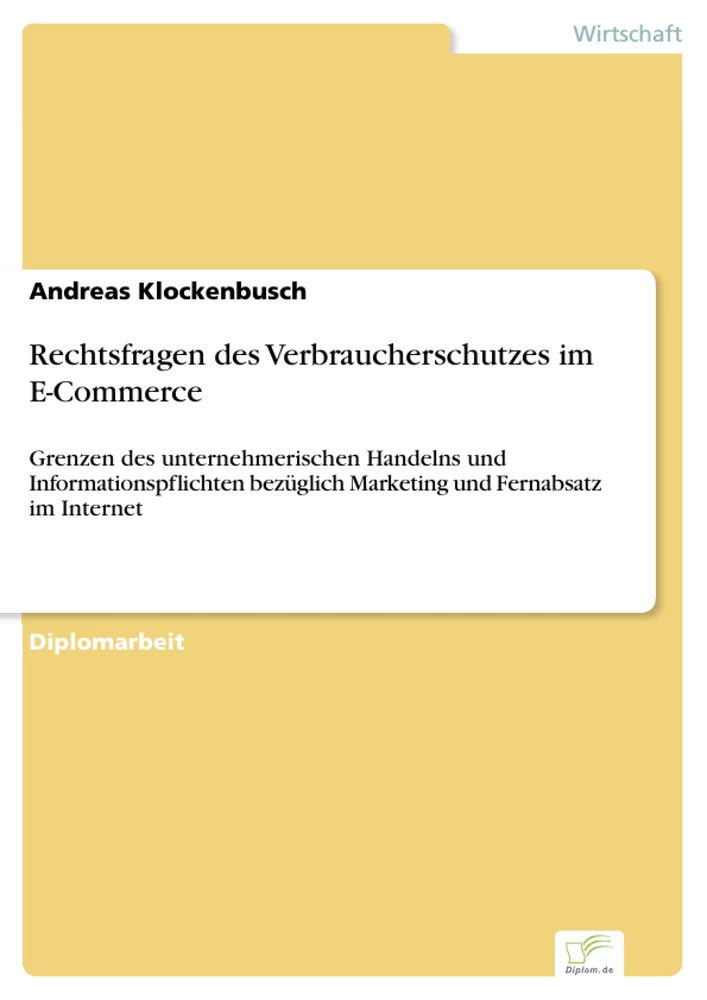Rechtsfragen des Verbraucherschutzes im E-Commerce
Grenzen des unternehmerischen Handelns und Informationspflichten bezüglich Marketing und Fernabsatz im Internet
Zusammenfassung
Dem Internet in seiner Funktion als virtueller Marktplatz kommt eine wachsende Bedeutung zu. Dabei findet die dominierende Nutzung des Internetzugangs im häuslichen Umfeld statt, so dass vor allem der private Endverbraucher einen potentiellen Kunden im Rahmen des E-Commerce im Internet darstellt. Dennoch bleibt für viele Anbieter der Business-to-Consumer-Bereich ein Stiefkind, in das trotz enormer Marktpotentiale nur zögerlich investiert wird. Grund für dieses Investitionshemmnis ist vor allem die bestehende Zurückhaltung der Verbraucher, die ihre Sicherheitsbedürfnisse beim Internet-Shopping nicht im wünschenswerten Maße gewahrt sehen.
Infolgedessen sind in den letzen Jahren auf europäischer und nationaler Ebene Anstrengungen unternommen worden, um gesetzliche Normen zu schaffen, mit denen dem Verbraucher im elektronischen Geschäftsverkehr das notwendige Schutzniveau zukommen soll. Die bis heute geschaffenen rechtlichen Rahmenbedingungen begrenzen den Handlungsspielraum der Unternehmen im Internet und knüpfen an die Initiative des Anbieters umfangreiche Informationspflichten. In weiten Bereichen befinden sich die deutschen Gesetze zum Schutz des Verbrauchers in einem dynamischen Anpassungsprozess, so dass sich vor diesem Hintergrund für beide Marktseiten die Frage stellt, welche Rechte und Pflichten zu erwarten bzw. zu beachten sind. Aus diesem Grunde verfolgt diese Arbeit das Ziel, die aktuellen und in naher Zukunft relevanten rechtlichen Grundlagen für das gewerbliche Handeln im Internet vorzustellen, die aus Verbraucherperspektive zur Risikoreduktion beitragen.
In diesem Zusammenhang wird nicht auf sämtliche technische Variationen des Mediums Internet eingegangen werden. Insbesondere bei der Umsetzung der Anbieterpflichten gibt es vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten, die nur exemplarisch angeführt werden. Auch findet im Bereich des Marketing, eine Beschränkung auf Teilgebiete der Werbung und Kundenprofilbildung statt. Dabei steht ebenfalls die Einzelfallbetrachtung im Rahmen des Wettbewerbs-, Urheber- oder Strafrechts nicht im Mittelpunkt dieser Arbeit. Vielmehr sollen die für den Verbraucherschutz relevanten Schwerpunkte des Multimedia- oder Onlinerechts hervorgehoben werden.
Gang der Untersuchung:
Zunächst wird nach den einleitenden Worten des ersten Kapitels auf die Notwendigkeit des Verbraucherschutzes im Internet eingegangen. Dabei werden im zweiten Kapitel insbesondere die technischen Besonderheiten des […]
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis
1 Zielsetzung und konzeptioneller Aufbau der Arbeit
2 Der Verbraucherschutz im elektronischen Netzwerk
2.1 Das Medium Internet
2.2 Die Entwicklung des E-Commerce im Internet
2.3 Der schutzwürdige Online-Verbraucher
3 Gesetzliche Bestimmungen zum Schutz des Verbrauchers im Internet
3.1 Richtlinien europäischer Harmonisierung
3.2 Deutsche Gesetze mit Schutzwirkung
3.3 Örtliche Gerichtszuständigkeit und anwendbares Recht
4 Die Werbung im Internet
4.1 Die kommerzielle Kommunikation
4.2 Die Verantwortlichkeit für Werbung im Internet
4.2.1 Haftung für eigene Werbeinhalte
4.2.2 Haftung für werbende Verweise
4.3 Informationspflichten des Werbenden
4.3.1 Anbieterkennzeichnung
4.3.2 Besondere Informationspflichten bei kommerzieller Kommunikation
4.4 Die Unzulässigkeit von Spamming
4.4.1 Die Rechtsprechung zu herkömmlichen Direktmarketingformen
4.4.2 Die Rechtsprechungspraxis zu unaufgeforderter E-Mail-Werbung
4.4.3 Änderung der Rechtsprechung durch europäische Regelwerke
4.4.3.1 Auswirkungen der Fernabsatzrichtlinie
4.4.3.2 Beurteilung nach der E-Commerce Richtlinie
4.4.4 Resümee für Unternehmer und Verbraucher
5 Das Online-Profiling im Internet
5.1 Verbraucherdaten als Wirtschaftsgut
5.2 Daten und Rechtsanwendung
5.3 Datenerhebung bei Telediensten
5.4 Gesetzliche Schranken der Datenerhebung
5.5 Anbieterpflichten im Rahmen der Datenerhebung
5.6 Rechtsfolgen der Nichtbeachtung
6 Der Fernabsatz im Internet
6.1 Expliziter Verbraucherschutz durch das Fernabsatzgesetz
6.1.1 Anwendungsbereich des Fernabsatzgesetzes
6.1.1.1 Sachlicher Geltungsbereich
6.1.1.2 Vertragsabschluss über ein Fernabsatzsystem
6.1.1.3 Einschränkungen des Anwendungsbereiches
6.1.2 Unterrichtung des Verbrauchers
6.1.2.1 Vorvertragliche Informationspflichten
6.1.2.2 Informationspflichten nach Abschluss des Vertrages
6.1.3 Das Widerrufs- und Rückgaberecht des Verbrauchers
6.1.4 Rechtsfolgen bei Verletzung der Informationspflichten
6.1.5 Die Abgrenzung zum Verbraucherkreditgesetz
6.2 Besondere Probleme bei Online-Rechtsgeschäften
6.2.1 Der dauerhafte Datenträger
6.2.2 Die Einbeziehung von Allgemeinen Geschäftsbedingungen
6.3 Ausblick auf die geplante Schuldrechtsmodernisierung
7 Defizite des Verbraucherschutzes im Internet
Literaturverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildungsverzeichnis
Abb. 1 Arbeitsteilung im Internet
Abb. 2 Hyperlink
Abb. 3 Deep-Link
Abb. 4 Inline-Link
Abb. 5 Framing
Abb. 6 Beispiel einer anbieterübergreifenden Datenerhebung mittels Cookies
1 Zielsetzung und konzeptioneller Aufbau der Arbeit
Im Zuge der Entwicklung neuer Informations- und Kommunikationstechnologien hat das Internet einen weitreichenden Einzug in Wirtschaft und Gesellschaft erhalten. Heute nutzen mehr als 24 Millionen Deutsche regelmäßig das Internet zur Kommunikation, Unterhaltung oder zur Durchführung geschäftlicher Transaktionen.[1] Dabei kommt dem Internet in seiner Funktion als „virtueller Marktplatz“ eine wachsende Bedeutung zu. Bereits jeder zweite Internetanwender nimmt die Möglichkeit der elektronischen Bestellung von Waren und Dienstleistungen in Anspruch.[2] Dabei findet die dominierende Nutzung des Internetzugangs im häuslichen Umfeld statt, so dass vor allem der private Endverbraucher einen potentiellen Kunden im Rahmen des E-Commerce im Internet darstellt.[3]
Dieser mit der Nutzeranzahl stetig wachsende Absatzmarkt und die speziellen Vorzüge des Internet als Verkaufsinstrument haben in den letzten Jahren zu einer Umsetzung der unternehmerischen Aktivitäten in den elektronischen Geschäftsverkehr geführt. Mittlerweile präsentieren sich nahezu 50 Prozent der deutschen Unternehmen mittels einer eigenen Homepage im Netz und treffen die technischen Vorkehrungen, um mit ihren Kunden in einen interaktiven Dialog treten zu können.[4] Daneben bleibt jedoch für viele Anbieter der Business-to-Consumer-Bereich ein „Stiefkind“, in das trotz enormer Marktpotentiale nur zögerlich investiert wird.[5] Grund für dieses Investitionshemmnis ist vor allem die bestehende Zurückhaltung der Verbraucher, die ihre Sicherheitsbedürfnisse beim Internet-Shopping nicht im wünschenswerten Maße gewahrt sehen.[6] Die fehlende Möglichkeit der Warenbesichtigung und -erprobung, besondere Risiken bei der Abwicklung und Rückabwicklung des Vertrages und namentlich die Gefahr, unseriösen Anbietern aufzusitzen, sind als die Hauptursachen dieses Verbraucherverhaltens zu nennen.
Während die Anbieter im Rahmen ihrer Marketing-Aktivitäten Überzeugungsarbeit am Kunden leisten, hat auch der Gesetzgeber dieses Problem erkannt. Infolgedessen sind in den letzen Jahren auf europäischer und nationaler Ebene Anstrengungen unternommen worden, um gesetzliche Normen zu schaffen, mit denen dem Verbraucher im elektronischen Geschäftsverkehr das notwendige Schutzniveau zukommen soll. Die bis heute geschaffenen rechtlichen Rahmenbedingungen begrenzen den Handlungsspielraum der Unternehmen im Internet und knüpfen an die Initiative des Anbieters umfangreiche Informationspflichten.
In weiten Bereichen befinden sich jedoch die deutschen Gesetze zum Schutz des Verbrauchers in einem dynamischen Anpassungsprozess, so dass sich vor diesem Hintergrund für beide Marktseiten die Frage stellt, welche Rechte und Pflichten zu erwarten bzw. zu beachten sind. Aus diesem Grunde verfolgt diese Arbeit das Ziel, die aktuellen und in naher Zukunft relevanten rechtlichen Grundlagen für das gewerbliche Handeln im Internet vorzustellen, die aus Verbraucherperspektive zur Risikoreduktion beitragen.
In diesem Zusammenhang kann nicht auf sämtliche technische Variationen des Mediums Internet eingegangen werden. Insbesondere bei der Umsetzung der Anbieterpflichten gibt es vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten, die nur exemplarisch angeführt werden. Auch findet im Bereich des Marketing, als umfangreicher „Planungs- und Durchführungsprozess der Konzeptionierung, Preisfindung, Förderung und Verbreitung von Ideen, Waren und Dienstleistungen“[7], eine Beschränkung auf Teilgebiete der Werbung und Kundenprofilbildung statt. Dabei steht ebenfalls die Einzelfallbetrachtung im Rahmen des Wettbewerbs-, Urheber- oder Strafrechts nicht im Mittelpunkt dieser Arbeit. Vielmehr sollen die für den Verbraucherschutz relevanten Schwerpunkte des Multimedia- oder Onlinerechts hervorgehoben werden.
Zunächst wird im folgenden Kapitel auf die Notwendigkeit des Verbraucherschutzes im Internet eingegangen. Dabei werden insbesondere die technischen Besonderheiten des Internet angeführt, die zu einer rasanten Entwicklung des E-Commerce führen und eine dem Medium angepasste staatliche Regulierung erfordern.
Um den Ausgangspunkt dieser Arbeit abzurunden, sind im dritten Kapitel die rechtlichen Rahmenbedingungen zusammengefasst, die vornehmlich als Argumentationsgrundlage Anwendung finden. Unter anderem wird die Beziehung von europäischen Richtlinien zu den nationalen Gesetzen verdeutlicht und die Anwendung des deutschen Rechts im internationalen Kollisionsfall geprüft.
Auf Basis der vorgenannten semantischen Grundlagen werden im vierten Kapitel die mit der Werbung verbundene gesetzliche Verantwortung und Informationspflichten des Online-Anbieters beschrieben. Ausführlich erfolgt an dieser Stelle die Darstellung des vom Gesetzgeber geforderten und von der Literatur kritisierten Umgangs mit unaufgeforderten Werbe-E-Mails.
Die im Rahmen einer zielgerichteten Werbung weitverbreitete Erstellung von Kundenprofilen im Internet unterliegt ebenfalls verbraucherschützenden Verpflichtungen, die im fünften Kapitel angeführt werden. Insbesondere werden in diesem Zusammenhang die gängigen Instrumente der Datenerhebung und die Möglichkeiten der Datenverwendung einer rechtlichen Prüfung unterzogen.
Grundsätzlich erfordert das auf den Vertragsschluss ausgerichtete Handeln im Fernabsatz eine bestimmte vor- und nachvertragliche Unterrichtung des Verbrauchers. Der Umfang dieser Unterrichtungspflicht und die daraus resultierenden Rechte des Verbrauchers sind Gegenstand des siebten Kapitels.
Abschließend erfolgt im letzten Kapitel eine kritische Würdigung der vorgestellten verbraucherschützenden Regelungen. Dabei soll beurteilt werden, ob mit den rechtlichen Vorkehrungen tatsächlich die gewünschte Sicherheit und das Vertrauen der Verbraucher im Internet geschaffen wird.
2 Der Verbraucherschutz im elektronischen Netzwerk
2.1 Das Medium Internet
Das Internet ist ein weltweiter Zusammenschluss von Rechnern, die über einen gemeinsamen Kommunikationsstandard, TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol), Daten austauschen können.[8] Bei diesem Austausch werden die Daten in kleine Pakete zerlegt. Jedes Paket enthält die Information, an welche Adresse es geschickt werden soll. Zu diesem Zweck erhält der Rechner im Internet eine weltweit einmalige Adressierung, die IP-Adresse (z.B. 195.247.68.5). Diese wird dem Rechner ständig oder auch temporär zugewiesen, so dass statische und dynamische IP-Adressen unterschieden werden. Das TCP sorgt dafür, dass die Datenpakete ohne das Zutun des Absenders beim Empfänger vollständig und in der richtigen Reihenfolge ankommen. Dabei wird nicht der kürzeste Weg gewählt, sondern der schnellste. Steht einer der Übertragungswege nicht zur Verfügung oder ist überlastet, wird ein anderer gewählt – das weitverzweigte Netz bietet genug Alternativen.[9]
Wenn jedoch vom Internet gesprochen wird, ist vielfach das World Wide Web (WWW) gemeint, das auf der ursprünglichen Internet-Technik aufbaut. Das WWW gewährleistet die Darstellung der versendeten Daten auf einer grafischen Benutzeroberfläche und bietet darüber hinaus die Möglichkeit, Informationen zwischen verschiedenen WWW-Seiten zu verknüpfen.[10] Bei diesen Seiten handelt es sich um Dokumente, die mit der „Seitenbeschreibungssprache“ HTML (Hypertext Markup Language) erstellt werden. In eine HTML-Seite können nicht nur Texte, sondern darüber hinaus Bilder, Musik und andere multimediale Inhalte eingebunden sein. Zum Öffnen einer HTML-Seite benötigt der Internet-Nutzer den Web-Browser als ein Programm zur Visualisierung der Inhalte.
Ein weiteres Kennzeichen des World Wide Web ist die Client-Server Architektur.[11] Server sind Programme, die permanent auf eintreffende Anfragen warten, die WWW-Seiten auf dem Server-Rechner abrufen wollen. Clients dagegen sind Software-Programme, die typischerweise Daten von Servern anfordern.
Auf der Client-Seite arbeitet der Internet-Nutzer mit dem Web-Browser. Für den Internet-Zugang wählt sich der Rechner des Nutzers zunächst über die Ortsvermittlungsstelle der Telekommunikationsanbieter bei einem Zugangsrechner (Terminal-Server) ein und meldet sich mit einem Passwort an. Im nächsten Schritt gibt der Nutzer die Adresse des Zielrechners an, auf dem die Web-Seite abgelegt ist. Die Eingabe erfolgt nicht mit einer IP-Nummer, sondern mit einer einprägsamen Namensadresse, dem so genannten Domain-Namen oder auch URL (Uniform Resource Locator). Der Browser schickt diese Adressanfrage an einen Proxy-Server, der die URL speichert, damit die später erfolgende Antwort des Web-Servers der Zieladresse des Anfragenden zugesendet werden kann. Sofern eine Übersetzung der URL in eine IP-Adresse notwendig ist, wird diese Information von einem Domain-Name-Server (DNS) bezogen. Anschließend sendet der Proxy-Server die Anfrage über Netzknoten (Router) an den Web-Server. Dieser antwortet und schickt die Daten der Website über die Stationen der Anfrage zum Client. Damit erscheint die WWW-Seite im Browser des Client.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 1 Arbeitsteilung im Internet (in Anlehnung an: Köhntopp/Köhntopp, CR 2000, S. 250)
Infolge dieser „Arbeitsteilung“ im Internet sind den beteiligten Akteuren unterschiedliche Rollen zugeordnet, so dass sie angelehnt an das Modell von Köhntopp in folgende Gruppen eingeteilt werden können:[12]
- Teilnehmer
Der Teilnehmer nutzt als so genannter Client verschiedene Dienste des Internet von einem lokalen Rechner aus. Insbesondere tritt der Teilnehmer an dieser Stelle als Rezipient der abgerufenen Inhalte in Erscheinung.
- Zugangsvermittler (Access-Provider)
Der Zugangsvermittler ist der Online-Diensteanbieter, der die Schnittstelle zum Internet zur Verfügung stellt einschließlich etwaiger Proxy-Betreiber. Hinzu kommen die Betreiber der Router, DNS-Server oder anderer Internet-spezifischer Infrastruktur. Auch bedient sich der Teilnehmer des Verbindungsaufbaus der Telekommunikationsanbieter, um Zugang zum Internet zu erhalten.
- Diensteanbieter (insbesondere Host-Provider)
Die verschiedenen Internet-Dienste werden von unterschiedlichen Beteiligten erbracht. Weit verbreitet ist das Bereitstellen von Speicherplatz auf einem Web-Server, um Inhalte über das World Wide Web zur Verfügung zu stellen.
- Inhaltsanbieter (Content-Provider)
Die Content-Provider sind für die eigentlichen Inhalte verantwortlich, die sie mit Hilfe anderer Provider zur Verfügung stellen.
Oftmals ist das Leistungsangebot eines Providers breitgefächert, so dass ihm mehrere Rollen zugeordnet werden können. Die bekanntesten Provider sind die großen Online-Diensteanbieter wie T-Online, CompuServe, Mircosoft Network (MSN) und American Online (AOL). Diese Diensteanbieter halten eigene oder fremde Informations- und Diensteangebote auf ihren Servern bereit und ermöglichen registrierten Teilnehmern den kostenpflichtigen Zugang darauf. Auch wenn dadurch die obige Systematisierung der Akteure und Rollen im Internet schwieriger wird, ist sie notwendige Voraussetzung, um die rechtliche Verantwortung der Anbieter bestimmen zu können.
2.2 Die Entwicklung des E-Commerce im Internet
Die Grundidee des Internet stammt aus der Zeit des „Kalten Krieges“. Ziel war es, ein Datennetzwerk zu schaffen, welches auch bei der Zerstörung einzelner Teilstrecken noch ordnungsgemäß funktioniert.[13] Aus dieser Zielsetzung entstand 1969 das Internet in einer militärischen Forschungseinrichtung der US-Regierung, der Advanced Research Projects Agency (ARPA), und diente im zivilen Bereich bis in die 80er Jahre hinein hauptsächlich der Kommunikation zwischen wissenschaftlichen Institutionen.[14] Auf breiter Basis gelang der Durchbruch jedoch erst durch die Entwicklung der grafischen Benutzeroberfläche des World Wide Web (WWW) zwischen 1989 und 1993. Das daraus resultierende Interesse der Allgemeinheit an virtueller Information und Unterhaltung löste die ersten Nutzungswünsche der Wirtschaft aus. Das Jahr 1993 gilt deshalb auch als das „Geburtsjahr“ der Internet-Ökonomie.[15] Etwa ab 1994 setzte dann ein wahrer Internet-Boom ein, der bis zum heutigen Tag anhält und ständig an Dynamik gewinnt.[16]
Im Zuge dieser Entwicklung hat sich das Internet zu einem diensteintegrierenden Netz mit einer Vielzahl von Multimedia-Anwendungen gewandelt. Das multimediale WWW verursacht inzwischen mehr als die Hälfte des Nutzungsaufkommens und ist damit neben der elektronischen Kommunikation (E-Mail) der am häufigsten genutzte Dienst des Internet.[17]
Mit diesem Wandel ging in zunehmendem Maße auch ein Übergang von der ursprünglichen wissenschaftlich-nichtkommerziellen zu einer wirtschaftlich-kommerziellen Nutzung des Internet einher. Kröger beschreibt diese Entwicklung in drei Schritten:[18]
1. Zunächst nutzten die Unternehmen den direkten Online-Kontakt zum Waren– und Dienstleistungsabnehmer für ihre Marketingstrategien.
2. Im nachfolgenden Schritt verschafften die Unternehmen ihren Kunden die Möglichkeit, über das Internet Bestellungen aufzugeben.
3. In einem dritten Entwicklungsschritt wurde der elektronische Geschäftsverkehr mit dem Zahlungsverkehr zu einem eigenständigen Distributionsweg abgerundet.
Der mit dieser Entwicklung verknüpfte Begriff des „Electronic-Commerce“ wird heute sehr unterschiedlich verwendet. Häufig wird er mit der elektronischen Anbahnung, Aushandlung und/oder Abwicklung von Transaktionen zwischen Wirtschaftssubjekten gleichgesetzt.[19] Allgemeiner definieren Picot/Reichwald/Wigand den E-Commerce als „jede Art wirtschaftlicher Tätigkeit auf der Basis elektronischer Verbindungen“[20]. Damit reicht die Bandbreite des E-Commerce von den elektronischen Hierarchien in einem Unternehmen über elektronisch gestützte Unternehmensnetzwerke bis hin zu elektronischen Märkten, wobei die digitale Abwicklung der Geschäftstätigkeit auch auf einer anderen technischen Plattform als der des Internet erfolgen kann.[21]
Elektronische Märkte, die sich zunächst nicht des Internets bedient haben, finden sich bereits seit den 70er Jahren im Business-to-Business Bereich, wie etwa die deutsche Terminbörse DTB oder computergestützte Reisereservierungssysteme (APOLLO, SABRE).[22] Angefangen mit dem Teleshopping via TV erfährt jedoch auch der Business-to-Consumer Bereich mit dem Online-Shopping über Computernetze eine zunehmende Verbreitung.[23] Mit wachsender Nutzung des „Personal Computer“ (PC) als Internet-Zugang werden immer mehr private Nutzungs- und Verbrauchsbedürfnisse über das Internet befriedigt.[24]
Diese letztgenannte, den Endverbraucher einschließende Perspektive steht im Mittelpunkt der folgenden Überlegungen.
2.3 Der schutzwürdige Online-Verbraucher
Mit der Eichung von Maßen und Gewichten durch Zünfte, der Kontrolle der Qualität importierter Lebensmittel oder der obrigkeitlichen Preisfestsetzung für Grundnahrungsmittel haben schon unsere Vorfahren versucht, die wirtschaftliche und soziale Position des Verbrauchers zu verbessern.[25] So begegnet man im Streifzug durch die Geschichte einem Arsenal von Maßnahmen, das direkt oder mittelbar bestimmt war, die Menschen in ihrer Situation als Verbraucher vor Gefahren für ihre Gesundheit, ihr Vermögen, ihr sittliches Wohl und ihre Entscheidungsfreiheit vor Produzenten und Anbietern, aber auch vor sich selbst, ihrer Unerfahrenheit, ihrem Leichtsinn, ihren Süchten und Trieben zu schützen. Dieser staatliche Eingriff, der über die allgemein geltenden Spielregeln hinaus die Gewerbe- und Vertragsfreiheit der Wirtschaftseinheiten beschränkt, wird mit dem Begriff „Regulierung“ bezeichnet.[26]
Begründet wird die Regulierung damit, dass der Konsument seiner Rolle im freiheitlichen Wirtschaftssystem als „Souverän der Wirtschaft“[27] nicht gerecht werden kann. Dies wird nur dann uneingeschränkt ermöglicht, wenn unter den Produzenten Wettbewerb herrscht und sich die Angebote am Markt behaupten, die die Konsumenten als die bessere Alternative ansehen.[28] Deshalb liegt es eigennützig orientierten Unternehmern nahe, sich den Spielregeln der Marktwirtschaft zu entziehen, die Entmachtung im Wettbewerb zu verhindern und ihre Macht entweder durch Zusammenarbeit oder durch das Streben nach individueller Beherrschung des Marktes mit Hilfe unlauterer Wettbewerbsmethoden zu gewinnen. Verstärkt wird diese Verhaltenstendenz durch den natürlichen Informationsvorsprung des Produzenten, den Sinn als Hauptproblem des Verbraucherschutzes beschreibt.[29] Traditionell besitzt der Produzent die vollständigen Produktinformationen, während sich die nur selten informative Werbung auf die Produktvorteile beschränkt. Aber nicht nur die Funktionsdefizite der Unternehmer, sondern auch die „Unvollkommenheit“ der Verbraucher stehen ihrer „Souveränität“ entgegen. Häufig wird der Konsum durch Werbung manipuliert, das Einkommen aufgrund mangelnder Intelligenz und geistiger Fähigkeit unklug verausgabt und die Markttransparenz durch die unüberschaubare Vielfalt des Warenangebots verhindert.[30]
Aus dieser natürlichen Beschränkung der Handlungs- und Entscheidungsfreiheit des Verbrauchers resultieren weithin akzeptierte verbraucherpolitische Hauptziele staatlicher Regulierung:[31]
- der Schutz von Sicherheit und Gesundheit
- der Schutz des Verbrauchers vor Unlauterkeit und Beschränkungen der Anbieterseite im Marktprozess und
- die Verbesserung der Markttransparenz.
Aufgrund dessen erfolgt die Regulierung in Abwägung der spezifischen Merkmale des Marktes und der daraus resultierenden Stellung des Verbrauchers.
Elektronische Märkte als Orte des virtuellen Tausches im Internet sind durch vier grundsätzliche Merkmale gekennzeichnet:[32]
- Ubiquität, d.h. die Ortslosigkeit oder Überallverfügbarkeit des Marktzugangs
- Transparenz im Sinne einer erheblichen Erleichterung der Informationsbeschaffung für die Marktteilnehmer
- Senkung der Transaktionskosten
- Offenheit des Marktzugangs.
Diese Eigenschaften elektronischer Märkte können die Intensivierung des Wettbewerbs ermöglichen und die Stellung des Verbrauchers stärken.[33] Die globale Reichweite und der kostengünstige Marktzutritt sorgen für eine erhöhte Angreifbarkeit nationaler Märkte. Die durch das Internet erhöhte Markttransparenz, unterstützt durch den Einsatz elektronischer „Shopping Roboter“ und Suchagenten[34], führt zu einem Abbau des traditionellen Informationsvorsprungs der Anbieter.[35] Insofern kann ein „Customer Empowerment“ angenommen werden.
Andererseits führt das Wachstum elektronischer Märkte zu einer Reihe von neuen Problemen, denen Verbraucher und Gesetzgeber gegenüberstehen. Beispielsweise erlangt die digitale Werbung mit unaufgeforderten Links und E-Mails neue Dimensionen, während sich der Nachfrager im Zuge der Verwertung persönlicher Online-Daten zu einem „gläsernen Verbraucher“ entwickelt und der Vertragsschluss aufgrund unklarer Begriffsbestimmungen zusätzliche Risiken birgt. Darüber hinaus gewinnt die Feststellung immer mehr an Bedeutung, dass es kein einheitliches Verbraucherschutzrecht gibt, das den international agierenden Online-Verbraucher schützt.[36] Obwohl die Ziele des Verbraucherschutzes in den westlichen Industriestaaten nahezu identisch sind, wird Umfang und Qualität des Schutzes durch nationale Verbraucherbilder unterschiedlich bestimmt. Während beispielsweise das italienische Rechtssystem von einem „Kritischen Verbraucher“ ausgeht, der selbst irreführende Werbeaussagen als solche erkenne und sich schwer täuschen lasse[37], greift das deutsche Werberecht auf das Bild eines „oberflächlichen, flüchtig hinsehenden“ und eher unmündigen Verbrauchers[38] zurück. Dieser lasse sich bereits durch die „erkennbarsten leichtesten Missverständlichkeiten“[39] in der Werbung täuschen und bedarf daher eines großzügigen Schutzes der Rechtsordnung.[40] Eine zwischen diesen Extremen vermittelnde Sicht nimmt das europäische Verbraucherbild eines durchschnittlich informierten, verständigen und aufmerksamen Verbrauchers ein.[41] Dieses basiert auf dem so genannten „Informationsmodell“ mit dem Regelungsziel, eine informationelle Unterlegenheit, insbesondere eine geschäftliche und rechtliche Unerfahrenheit des Verbrauchers durch die Bereitstellung von Informationen zu kompensieren.[42] Der europäische, an Informationen interessierte Verbraucher soll somit durch die gezielte Zurverfügungstellung von Informationen vor unlauteren Wettbewerbsmethoden geschützt werden. Mit Hilfe von Richtlinien und der allgemeinen Berücksichtigung des sekundären Gemeinschaftsrechts durch die einzelnen Mitgliedsstaaten findet heute eine Durchsetzung dieser Prinzipien zur Harmonisierung des europäischen Verbraucherschutzes statt.
Berücksichtigt man die skizzierten Anforderungen, so ist festzustellen, dass gerade für den Online-Verbraucher besondere Schutzbemühungen unternommen werden müssen. Neben der Anpassung der europäischen und nationalen Gesetze an die technischen Gegebenheiten der „Elektronischen Märkte“, stellt die fortschreitende europäische und internationale Harmonisierung den nationalen Gesetzgeber vor besondere Aufgaben zum Schutz des Verbrauchers.
3 Gesetzliche Bestimmungen zum Schutz des Verbrauchers im Internet
3.1 Richtlinien europäischer Harmonisierung
Der europäische Binnenmarkt soll nach Art. 7a Abs. 2 EGV ein Raum ohne Grenzen sein. Das Internet, als grenzignorierendes Medium, entspricht idealerweise diesem Ziel der EU-Staaten. Allein der unterschiedliche nationale, gemeinschaftliche und internationale Rechtsrahmen verunsichert Unternehmer und Verbraucher und behindert den grenzüberschreitenden E-Commerce.[43] Um jedoch zukünftig die Vorteile der schnellen Fortentwicklung der Informations- und Kommunikationstechnologien nutzen zu können, wird vor allem mit dem Einsatz von europäischen Richtlinien eine rechtliche Angleichung unter den Ländern des Binnenmarktes angestrebt.
Richtlinien enthalten juristische Standards, die von den einzelnen EU-Mitgliedstaaten in nationales Recht umgesetzt werden sollen. Sie sind nicht in allen Teilen verbindlich, sondern nur hinsichtlich der festgelegten Ziele. Im Sinne des Art. 249 EGV können die Ziele seitens der Mitgliedstaaten durch den Erlass von Gesetzen, Verordnungen oder durch den Abschluss eines völkerrechtlichen Vertrages mit den übrigen Mitgliedstaaten erreicht werden.[44] Bei der Wahl der Umsetzungsmittel haben die Mitgliedstaaten allerdings diejenigen zu ergreifen, die für die Gewährleistung der praktischen Wirksamkeit (effet utile) am besten geeignet sind.[45]
Richtlinien wirken nicht unmittelbar bei der horizontalen Begründung von Ansprüchen der Marktbürger gegeneinander.[46] Eine unmittelbare Wirkung kommt jedoch im Verhältnis zwischen Marktbürger und Mitgliedstaat in Betracht, wenn die Richtlinie nicht ordnungsgemäß oder nicht fristgerecht vom Mitgliedstaat in nationales Recht umgesetzt worden ist.[47] Dabei wird vorausgesetzt, dass die jeweilige Norm klar und genau, bedingungsunabhängig und ihrem Wesen nach geeignet ist, unmittelbar Wirkung zu entfalten und es zu ihrer Ausführung keiner weiteren Rechtsvorschriften des staatlichen Gesetzgebers bedarf.[48] Diese Wirkung ist allerdings nur für Richtlinien entwickelt worden, die dem einzelnen Marktbürger Ansprüche gegenüber dem Staat einräumen.[49] Generell können Richtlinien eine mittelbare Wirkung insoweit entfalten, als eine richtlinienkonforme Auslegung des nationalen Rechts auch schon vor Ablauf der Umsetzungsfrist möglich ist.
Die EU-Kommission hat sich in letzter Zeit intensiv um die Ausgestaltung eines adäquaten Rechtsrahmens für den elektronischen Geschäftsverkehr im europäischen Binnenmarkt bemüht und zahlreiche Richtlinien bzw. Richtlinienentwürfe verabschiedet. Insbesondere wurden durch die Fernabsatzrichtlinie 97/7/EG und die Richtlinie 2000/31/EG zum Electronic Commerce weitgehende Veränderungen im Gesetz und in der Rechtsprechung herbeigeführt.
Die Fernabsatzrichtlinie
Die Richtlinie 97/7/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Mai 1997 über den Verbraucherschutz bei Vertragsabschlüssen im Fernabsatz ist bereits zu einem großen Teil in deutsches Recht umgesetzt worden. Sie stützt sich auf Art. 100a EGV als Maßnahme zur Sicherung eines funktionierenden Binnenmarktes. Neben der Förderung der Akzeptanz neuer Kommunikationsmittel auf Unternehmerseite dient diese Richtlinie schwerpunktmäßig der Maßgabe des Verbraucherschutzes und der damit verbundenen Erleichterung des grenzübergreifenden Agierens der Verbraucher als Marktbürger des europäischen Wirtschaftsraumes.[50]
Grundsätzlich findet die Fernabsatzrichtlinie nach Art. 1 und 2 nur bei Vertragsabschlüssen zwischen Verbrauchern und Lieferern mit ausschließlicher Verwendung von Fernkommunikationstechnik Anwendung, also ohne physische Anwesenheit der Vertragsparteien.[51]
Die wesentlichen Anforderungen der Richtlinie beziehen sich gem. Art. 4 und 5 auf eine vor- und nachvertragliche Informationspflicht des Unternehmers und auf ein uneingeschränktes Widerrufsrecht des Verbrauchers gem. Art. 6.
Die Richtlinie über den Electonic-Commerce
Die Richtlinie 2000/31/EG über den Elektronischen Geschäftsverkehr (ECRL) vom 8. Juni 2000 ist bis zum 16. Januar 2002 in nationales Recht umzusetzen.[52] In der Richtlinienbegründung geht die EU-Kommission davon aus, dass die mit dem elektronischen Geschäftsverkehr verbundene Chance für Wirtschaftswachstum, Wettbewerbsfähigkeit und Schaffung neuer Arbeitsplätze durch unterschiedliche nationale Rechtsvorschriften gehemmt werde. Verändert werden soll die Situation, dass die Anbieter nicht nur die Vorschriften ihres Niederlassungslandes, sondern auch die der anderen 14 Mitgliedstaaten beachten müssen.[53] Darüber hinaus soll auch das Vertrauen der Verbraucher mit zahlreichen Informations- und Transparenzgeboten gefördert werden.[54]
Wie bei der Fernabsatzrichtlinie ist für die Anwendung der ECRL die fehlende physische Anwesenheit der Vertragsparteien sowie die Übertragung mit Hilfe von „Geräten für die elektronische Verarbeitung und Speicherung am Ausgangspunkt“ Voraussetzung.
Im Gegensatz zur Fernabsatzrichtlinie werden jedoch nicht nur die Modalitäten des Vertragsschlusses i.e.S. erfasst. Die Richtlinie zielt gem. Art. 1 ECRL auf den „freien Verkehr von Diensten der Informationsgesellschaft“ zwischen den Mitgliedsstaaten. Der Begriff „Dienst“, muss als „Dienstleistung“ i.S.d. Art. 60 EGV verstanden werden. Es ist nicht erforderlich, dass die Dienstleistung von demjenigen bezahlt wird, dem sie zugute kommt. Auf die Modalitäten der Finanzierung kommt es also nicht an, so dass auch die über das Internet angebotene Werbung von der Richtlinie erfasst wird.[55] Auch bezieht sich die Formulierung „Dienstleistung“ im Gegensatz zum deutschen Dienstvertragsrecht ebenfalls auf den Verkehr von Waren, wie elektronische Zeitungen, Leistungen freier Berufe und virtuelle Supermärkte.[56]
Wesentliche Neuerungen der deutschen Gesetzgebung entstehen durch die Einführung des Herkunftslandprinzips nach Art. 3 ECRL, einer Ergänzung der Anbieterkennzeichnung gem. Art. 5 ECRL und der Einführung des Begriffes der „Kommerziellen Kommunikation“ und den damit verbundenen Informationspflichten und Reglementierungen für die Online-Werbung in den Art. 6-8 ECRL.
3.2 Deutsche Gesetze mit Schutzwirkung
Die Regulierung zugunsten des Verbraucherschutzes in der Bundesrepublik Deutschland ist seit geraumer Zeit umfangreichen Änderungen unterworfen. Nur selten konnte die „traditionelle“ Gesetzgebung unverändert auf Rechtsfragen des E-Commerce angewandt werden. In den meisten Fällen hat der deutsche Gesetzgeber aus eigenem Antrieb oder aufgrund europäischer Vorgaben neue Gesetze geschaffen oder bestehende weitgehend der technischen Entwicklung angepasst.
Im Folgenden werden in kurzer Fassung die Gesetze vorgestellt, die entweder nach Wortlaut eine unmittelbare Schutzwirkung oder mittelbar die Sicherung der Verbraucherrechte im Internet ermöglichen und in Kernbereichen dieser Arbeit angewandt werden.
Das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb
Das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG) vom 7. Juni 1909 ist neben dem Kartellgesetz eine Hauptsäule des deutschen Wettbewerbsrechts, die trotz kleinerer Änderungen in ihren Grundzügen unangetastet geblieben ist.[57] Es ist die Aufgabe des UWG, Mitbewerber und Verbraucher gegen unlauteres Wettbewerbsgebaren, insbesondere unlauterer Verbraucherwerbung, zu schützen.[58] In diesem Zusammenhang ist festzustellen, dass sich auch die Online-Werbung nicht im rechtsfreien Raum abspielt, sondern der rechtlichen Beurteilung durch nationales autonomes Wettbewerbsrecht unterliegt.[59]
Von besonderer Bedeutung sind die Generalklauseln der §§ 1 und 3 UWG, die als große und kleine Generalklausel bezeichnet werden. Um die Lauterkeit wettbewerblichen Verhaltens aufrechtzuerhalten, sanktioniert § 1 UWG allgemein alle sittenwidrigen Wettbewerbshandlungen. Nach § 3 UWG kommt es nicht auf die Sittenwidrigkeit an. Vielmehr wird jede irreführende Angabe über geschäftliche Verhältnisse jeglicher Art erfasst. Die Generalklauseln der §§ 1 und 3 UWG sind nebeneinander anwendbar; insbesondere erfüllt eine Irreführung gem. § 3 UWG oftmals ebenso die Sittenwidrigkeit im Sinne des § 1 UWG. Deshalb steht auch im Regelfall nicht die Prüfung des unterschiedlich definierten Begriffes der Sittenwidrigkeit[60], sondern vielmehr die Bestimmung der potenziellen Irreführung und/oder Verwechslungsgefahr des Verbrauchers im Vordergrund. Anhand einer konkreten Situation ist die Frage zu erörtern, inwieweit der verständige Verbraucher Informationen kritisch prüft oder im Einzelfall flüchtig prüfen darf und infolgedessen einer Irreführung und/oder Verwechslungsgefahr ausgesetzt ist.[61] Das europäische Leitbild eines an Informationen interessierten Verbrauchers ist demnach in der Rechtsprechung zum Wettbewerbsrecht als situationsadäquater Maßstab zu berücksichtigen.
Voraussetzung für die Anwendung des Gesetzes ist die Tatbestandsvoraussetzung der Generalnormen, die eine rechtswidrige Handlung „im geschäftlichen Verkehre zu Zwecken des Wettbewerbes“ voraussetzt. „Im geschäftlichen Verkehre“ umfasst alle Tätigkeiten, die mit Erwerb oder Berufsausübung eines Einzelnen zusammenhängen und demnach nicht im privaten oder amtlichen Bereich stattfinden.[62]
Ein Unterlassungs- oder Schadensersatzanspruch nach dem UWG kann jedoch nicht vom einzelnen Verbraucher eingefordert werden. Die Klagebefugnis gem. § 13 Abs. 2 Nr. 3 UWG haben nur Verbraucherverbände, nicht jedoch der einzelne Angehörige der Marktgegenseite. Der Verbraucher kann sich an entsprechende Verbraucherverbände wenden, muss jedoch damit rechnen, dass nur Ansprüche vertreten werden, durch die wesentliche Belange der Verbraucher insgesamt berührt werden.
Teledienstegesetz
Lange Zeit erwies sich das Internet als ein „herrschaftsfreier Raum“[63], da die Ahndung insbesondere unlauterer Wettbewerbshandlungen nur schwer möglich war. Die Beantwortung der Frage, wann und in welchem Umfang gewerbliche Anbieter im Internet zivil- und strafrechtlich zur Verantwortung gezogen werden können, scheiterte schon an der fehlenden gesetzlichen Definition und Erfassung dieser Personenkreise.
Der deutsche Gesetzgeber hat entsprechend mit dem am 1. August 1997 in Kraft getretenen Informations- und Kommunikationsdienstegesetz (IuKDG)[64] des Bundes und dem Mediendienste-Staatsvertrag der Länder vergleichsweise zügig zentrale Rahmenbedingungen für die Entwicklung der neuen Dienste insbesondere im Internet geschaffen.[65] Mediendienste-Staatsvertrag und Teledienstgesetz schließen einander in der Anwendung aus. § 2 Abs. 1 TDG folgend gilt das Teledienstegesetz für alle elektronischen Informations- und Kommunikationsdienste, die für eine individuelle Nutzung von kombinierbaren Daten bestimmt sind und denen eine Übermittlung mittels Telekommunikation zugrunde liegt. Kein Teledienst liegt vor, soweit die redaktionelle Gestaltung zur Meinungsbildung im Vordergrund steht. Folglich sind Mediendienste gem. § 2 MDStV alle Informations- und Kommunikationsdienste, die an die Allgemeinheit gerichtet sind.
Die beiden Gesetze nennen jeweils im § 1 TDG/MDSTV als identisches Ziel „einheitliche wirtschaftliche Rahmenbedingungen für die verschiedenen Nutzungsmöglichkeiten der elektronischen Informations- und Kommunikationsdienste zu schaffen“. Weitgehende Übereinstimmung findet sich ebenfalls in der zentralen Frage der Verantwortlichkeit des Diensteanbieters gem. §§ 5 Abs. 1-3 TDG/MDStV. Fällt die Verantwortlichkeit für die Inhalte dem Diensteanbieter zu, so haftet er gem. §§ 5 Abs. 1 TDG/MDStV nach den allgemeinen Gesetzen, wie beispielsweise nach dem Strafgesetzbuch oder Wettbewerbsrecht. Darüber hinaus hebt sich der Mediendienste-Staatsvertrag durch seine umfangreicheren Vorschriften für die Anbieterkennzeichnung und strengeren Bestimmungen zum Inhalteangebot vom Teledienstegesetz deutlich ab. Die vieldiskutierte Trennung bei der Anwendung der beiden Gesetze ist nicht immer leicht umzusetzen[66] und soll im Folgenden nicht weiter betrachtet werden. Im Fordergrund steht der Unternehmer i.S.d. Teledienstegesetzes, der seine Kunden individuell informiert und mit ihnen Verträge schließt.
Im Rahmen der bis zum 16. Januar 2002 umzusetzenden E-Commerce-Richtlinie 2000/31/EG hat die Bundesregierung einen Artikelgesetzentwurf (EGG) verabschiedet, der umfangreiche Änderungen und Ergänzungen des Teledienstegesetzes vorsieht.[67] Diese jüngste Entwicklung muss in der vorliegenden Abhandlung berücksichtigt werden. Wie bereits in Abschnitt 3.1 erwähnt, kann schon vor der Umsetzungsfrist eine richtlinienkonforme Auslegung des nationalen Rechts erfolgen. Dies würde in den weiteren Ausführungen eine parallele Betrachtung des Teledienstegesetzes unter Einbeziehung der E-Commerce Richtlinie erfordern. Da jedoch die ECRL zu einem großen Teil wortwörtlich in die neue Fassung des TDG übernommen wird, bietet es sich an, die Paragraphen „neuer Fassung“ (n. F.) als Argumentationsgrundlage zu nutzen.
Die Länder bereiten zur Zeit einen Änderungsstaatsvertrag zum MDStV vor, der mit dem TDG n.F. zeitgleich in Kraft treten soll.[68] Ein entsprechendes Arbeitspapier liegt jedoch noch nicht vor, so dass auch aus diesem Grunde auf die Einbeziehung der Mediendienste verzichtet werden muss. Es ist jedoch darauf hinzuweisen, dass diese Vorgehensweise nicht zu einer gänzlichen Ausblendung des Rechtsgebietes im Rahmen von Mediendiensten führt. Die neuen Regelungen der beiden Gesetze sollen nahezu inhalts- und wortgleich übereinstimmen, so dass die angesprochenen Rechtsfragen weitgehend auch auf Mediendienste übertragen werden können.
Das Teledienstedatenschutzgesetz
Parallel zum Mediendienstestaatsvertrag ist am 1. August 1997 im Rahmen des IuKDG auch das Teledienstedatenschutzgesetz in Kraft getreten. Das TDDSG schafft für die zunehmende Datennutzung im Internet neue datenschutzrechtliche Normen und soll den jüngsten Risiken für das informationelle Recht auf Selbstbestimmung im Bereich von Telediensten entgegentreten.[69] Es enthält genaue Vorschriften darüber, welche Daten zu welchen Zwecken im Internet erhoben, verarbeitet und genutzt werden dürfen. Das TDDSG soll an das Instrumentarium des vorhandenen Datenschutzes, insbesondere des BDDSG anknüpfen und lex specialis zur Anwendung kommen, soweit die Risiken der neuen Teledienste dies erforderlich machen.
Der MDStV und das Teledienstedatenschutzgesetz sind hinsichtlich der Regelungen zum Datenschutz weitgehend wortgleich. Jedoch wird das TDDSG ebenfalls im Rahmen der Umsetzung des EGG novelliert, so dass auch in diesem Bereich eine Konzentration auf die Regelungen des TDDSG neuer Fassung stattfindet.
Die Vorschriften des Gesetzes dienen gem. § 1 Abs. 1 TDDSG n.F. dem Schutz personenbezogener Nutzer-Daten bei der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung durch einen Diensteanbieter. Ausschlaggebend für die Rechtsanwendung sind demnach die Begriffsbestimmungen der dem Gesetz unterfallenden Personengruppen, die wortgleich mit den Formulierungen des TDG übereinstimmen.
Diensteanbieter ist gem. § 3 Nr. 1 TDG n.F. „jede natürliche oder juristische Person, die eigene oder fremde Teledienste zur Nutzung bereithält oder den Zugang zur Nutzung vermittelt“.
Der Nutzer, insbesondere der Verbraucher, ist gem. § 3 Nr. 2 TDG n.F. „jede natürliche Person, die Teledienste in Anspruch nimmt, insbesondere um Informationen zu erlangen oder zugänglich zu machen“.
Der Teledienst als die Umgebung, in der Diensteanbieter und Nutzer zusammentreffen, ist nicht im TDDSG definiert. Im Umfeld des IuKDG muss hier auf die oben aufgeführte Erklärung im TDG zurückgegriffen werden.
Das Fernabsatzgesetz
Grundlegende Änderungen haben die bestehenden Verbraucherschutzvorschriften mit der Umsetzung der Fernabsatzrichtlinie 97/7/EG in dem am 29. Juni 2000 veröffentlichten „Gesetz über Fernabsatzverträge und andere Fragen des Verbraucherrechts sowie zur Umstellung von Vorschriften auf Euro“ erfahren.[70] Neben einem eigenständigen Fernabsatzgesetz enthält das Artikelgesetz über Fernabsatzverträge auch Gesetzesänderungen, die insbesondere zu erheblichen Anpassungen des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB), des Gesetzes zur Regelung des Rechts der Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGBG), des Verbraucherkreditgesetzes (VerbrKrG) und des Haustürwiderrufsgesetzes (HaustürWG) führen. Außerdem wird in das Einführungsgesetz zum BGB (EGBGB) eine Regelung über das auf Fernabsatzverträge anzuwendende Recht aufgenommen. Mit dem Gesetz über Fernabsatzverträge soll der Verbraucher vor irreführenden und aggressiven Verkaufsmethoden im Fernabsatz geschützt werden.[71]
Das Fernabsatzgesetz findet gem. § 6 Abs. 1 auf alle Verträge Anwendung, die nach dem 29. Juni 2000 unter ausschließlicher Verwendung von Fernkommunikationsmitteln abgeschlossen wurden. Unter Fernkommunikationsmittel fallen gem. § 1 Abs. 2 FernAbsG, alle Kommunikationsmittel, die zur Anbahnung oder zum Abschluss eines Vertrages zwischen einem Verbraucher und einem Unternehmer ohne gleichzeitige Anwesenheit der Vertragsparteien eingesetzt werden können, also insbesondere Briefe, Kataloge, Telefonanrufe, Telekopien, E-Mails sowie Rundfunk und Tele- und Mediendienste. Das FernAbsG ist gem. § 1 Abs. 4 nicht anzuwenden, soweit andere Vorschriften den Verbraucher besser stellen. Es gilt also stets das Recht, das den Verbraucher am stärksten schützt. Jedoch kommt dieses Gesetz gem. § 5 FernAbsG weiterhin zur Anwendung, wenn seine Vorschriften durch anderweitige Gestaltung verhindert werden soll. Demzufolge kann der Verbraucher weder durch eine Klausel in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Anbieters noch durch ausdrückliche Erklärung seinerseits auf die ihm zustehenden Rechte verzichten.[72] Mit dieser Regelung wird verhindert, dass durch eine einseitige Vertragsgestaltung der Schutz des Verbrauchers umgangen wird.
Schwerpunktmäßig enthält das Fernabsatzgesetz traditionelle Verbraucherschutzinstrumentarien, wie die Statuierung von umfassenden Informationspflichten und Widerrufsrechten.
Das Bürgerliche Gesetzbuch
Das Bürgerliche Gesetzbuch aus dem Jahre 1900 wurde, wie oben erklärt, durch das Gesetz über Fernabsatzverträge mit Regelungen zum Verbraucherschutz ergänzt.
Mit dem neuen § 361a BGB wurde ein allgemeines Widerrufsrecht von Verbraucherverträgen eingefügt. Dieses gilt allerdings nur, wenn einem Verbraucher durch Gesetz ein Widerrufsrecht nach Vorschriften des § 361a BGB eingeräumt wird, was insbesondere in § 3 Abs. 1 Satz 1 Fernabsatzgesetz, § 7 Verbraucherkreditgesetz und § 1 Haustürwiderrufsgesetz der Fall ist. Erwähnenswert ist weiterhin der eingeführte § 241a BGB, der klarstellt, dass durch die Lieferung unbestellter Sachen oder durch die Erbringung unbestellter sonstiger Leistungen an einen Verbraucher kein Anspruch gegen diesen begründet wird. Schließlich hat der Gesetzgeber in § 661a BGB die Fälle sanktioniert, in denen ein Unternehmer Gewinnzusagen oder vergleichbare Mitteilungen an Verbraucher sendet und durch die Gestaltung dieser Zusendungen den Eindruck erweckt, dass der Verbraucher einen Preis gewonnen hat. In der Neuregelung des § 661a BGB ist nunmehr bestimmt, dass der Unternehmer dem Verbraucher diesen Preis tatsächlich zu leisten hat.
Von besonderer Bedeutung für die Anwendung der Verbraucherschutzgesetze und für das Begriffsverständnis dieser Abhandlung ist die erstmals im deutschen Recht eingeführte Definition des Verbrauchers und Unternehmers.[73]
Ein Unternehmer ist lt. §14 Abs. 1 BGB
„.eine natürliche oder juristische Person oder eine rechtsfähige Personengesellschaft, die bei Abschluss eines Rechtsgeschäfts in Ausübung ihrer gewerblichen und selbständigen beruflichen Tätigkeit handelt.“
Ein Verbraucher ist lt. § 13 BGB
„.jede natürliche oder juristische Person, die Rechtsgeschäfte zu einem Zweck abschließt, der weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden kann.“
3.3 Örtliche Gerichtszuständigkeit und anwendbares Recht
Für den deutschen Verbraucher stellt sich jedoch häufig die Frage nach der Wirksamkeit der nationalen Schutzbestimmungen im weltumspannenden Netz von Abermillionen Computern, dem so genannten Cyberspace.[74] Dabei ist zunächst festzustellen, dass der Cyberspace kein eigener und schon gar kein rechtsfreier Raum ist und das Internet keine „Haftungsoase“ darstellt. Dennoch ist die Anwendbarkeit der restriktiven deutschen Verbraucherschutzbestimmungen keine Selbstverständlichkeit.
Grundsätzlich ist im internationalen Konfliktfall das Kollisionsrecht der beteiligten Länder heranzuziehen, das dem „materiellen Recht“ vorgelagert ist.[75] Das Kollisionsrecht ist von Staat zu Staat verschieden. Irreführend ist deshalb der Name des deutschen Kollisionsrechts; „Internationales Privatrecht“ (IPR), das im „Einführungsgesetz des Bürgerlichen Gesetzbuches“ (EGBGB) enthalten ist. Nach den Regeln des IPR ist zu entscheiden, ob der Sachverhalt nach deutschem oder nach dem Recht eines anderen Staates zu entscheiden ist.[76] Dies kann auch zur Anwendung von ausländischem Recht durch deutsche Gerichte führen. Trotz dieser scheinbar systematischen Bestimmung des anwendbaren Rechts führen die europäische Harmonisierung und die Berücksichtigung spezialgesetzlicher Bestimmungen zu einem unterschiedlichen Vorgehen in den Rechtsbereichen.
Anwendbares Wettbewerbsrecht
Im Falle einer möglichen rechtswidrigen Werbemaßnahme mit internationalem Bezug ist Art. 40 Abs. 1 EGBGB als Ausgangspunkt bei der Überlegung heranzuziehen, welches Recht zur Anwendung kommen könnte.[77] Dabei zählen Wettbewerbsverstöße nach dem internationalen Privatrecht zu den unerlaubten Handlungen i.S.d. Art. 40 EGBGB. Die Ansprüche aus unerlaubter Handlung unterliegen nach Art. 40 Abs. 1 Satz 1 EGBGB dem Recht des Staates, in dem der Ersatzpflichtige gehandelt hat. Anstelle des Handlungsortes kann jedoch der Verletzte gem. Satz 2 den Erfolgsort als Gerichtsstand verlangen. Auf die Unterscheidung zwischen diesen beiden Alternativen kommt es jedoch im Ergebnis nicht an. In Rechtsprechung und Literatur besteht Einigkeit darüber, dass Handlungs- und Erfolgsort auf dem relevanten Markt zusammenfallen, auf dem die Interessen der Parteien unmittelbar aufeinanderstoßen und durch unlauteres Verhalten beeinträchtigt werden können (Marktortprinzip).[78] Bei der Definition des Marktortes als Gerichtsstand spielt die subjektive Auswirkung von Werbemaßnahmen keine Rolle. Notwendig ist eine bestimmungsgemäße und nicht nur zufällige Handlung mit erheblicher Auswirkung.[79] Danach muss die Website einen Bezug zum deutschen Markt aufweisen. Die Werbung muss sich zumindest gezielt auf diesen Markt beziehen. Notwendig ist letztlich auch, dass das beworbene Produkt auf dem deutschen Markt überhaupt zum Kauf angeboten wird.[80] Sind diese Kriterien erfüllt, so kann sich der deutsche Verbraucher gem. Art. 40 EGBGB auf den Schutz des nationalen Wettbewerbsrechts, insbesondere des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb, berufen.
Während der „reine“ internationale Bezug die Prüfung des anwendbaren Wettbewerbsrechts nach dem Standard des Kollisionsrechts zulässt, ist im Zusammenhang mit der Zuständigkeit der Mitgliedstaaten innerhalb der Europäischen Union eine kontroverse Diskussion entstanden.
Auslöser dieser Diskussion ist das Herkunftslandprinzip, das sich in der Rechtsprechung des EuGH zu einem konstituierenden Bestandteil des Binnenmarktes entwickelt hat und mit der E-Commerce Richtlinie auch im Multimediarecht Anwendung finden soll.[81] Nach Art. 3 ECRL sollen die Anbieter von Telediensten im Rahmen des Herkunftslandprinzips ausschließlich den Bestimmungen ihres Niederlassungsstaates unterworfen sein. Infolgedessen müsste der Verbraucher auf die Anwendung des deutschen Rechts verzichten. Das nationale Recht des Niederlassungsstaates beinhaltet jedoch auch das Kollisionsrecht, das die Anwendung des materiellen Rechts eines anderen Staates gestatten kann. In Art. 1 Abs. 4 ECRL wird wiederum klargestellt, dass die Richtlinie keine zusätzlichen Regelungen im Bereich des internationalen Privatrechts schafft. Dies wirft die viel diskutierte Frage auf, ob mit dem Herkunftslandprinzip lediglich das innerstaatliche materielle Recht oder auch das Kollisionsrecht gemeint ist.[82]
In Deutschland wird diese Problematik mit dem § 4 Abs. 1 und 2 TDG n.F. zu Gunsten des Herkunftslandprinzips gelöst und von Härting wie folgt zusammengefasst:
„Diensteanbieter, die in einem EU-Mitgliedstaat niedergelassen sind, unterliegen bei der rechtlichen Beurteilung ihrer Teledienste nur dann dem nach den Regeln des internationalen Privatrechts maßgeblichen Recht eines anderen Staates, wenn diese Regelungen keine strengeren Anforderungen als das Recht des Staates aufstellen, in dem der Diensteanbieter niedergelassen ist.“[83]
Für den Verbraucher bedeutet dies, dass er sich zunächst auf das Kollisionsrecht berufen und gem. § 40 EGBGB die Anwendung des deutschen Wettbewerbsrechts fordern kann. Dem Unternehmer wird jedoch im Einzelfall der Einwand zugestanden, das nationale Recht des Verbrauchers enthalte strengere Bestimmungen und sei deshalb nicht anwendbar. Infolgedessen kann das deutsche Wettbewerbsrecht, das als eines der restriktivsten weltweit gilt, nur unter erschwerten Bedingungen zur Anwendung kommen.
Anwendbares Datenschutzrecht
„Das für den Schutz personenbezogener Daten geltende Recht“ bleibt gem. Art. 3 Abs. 4 ECRL und § 4 Abs. 4 Nr. 10 TDG n.F. vom Herkunftslandprinzip ausgeschlossen. Für die Bestimmung des einzelstaatlichen Datenschutzrechts ist der § 1 BDSG heranzuziehen. Die Frage nach dem anwendbaren Recht ist im Rahmen des Datenschutzes von besonderer Bedeutung. Viele Länder kennen überhaupt keinen Datenschutz oder haben ihn wesentlich geringer ausgestaltet als der deutsche Gesetzgeber.[84]
Gem. § 1 Abs. 2 BDSG a.F. war bisher für die Anwendung des deutschen Datenschutzrechts darauf abzustellen, an welchem Ort die Datenverarbeitung stattfand. Wenn sie in Deutschland erfolgte, war nach dem so genannten Territorialprinzip deutsches Recht anzuwenden, ansonsten das Recht des anderen Landes.[85]
Diese Rechtslage hat sich mit der am 23. Mai 2001 in Kraft getretenen Novellierung des BDSG aufgrund der Datenschutzrichtlinie 95/46/EG geändert.[86] Gem. Art. 4 Abs. 1 lit. a S. 1 der Datenschutzrichtlinie und § 1 Abs. 5 BDSG n.F. bestimmt sich zukünftig die örtliche Anwendbarkeit des Datenschutzrechts nach dem Niederlassungsort des für die Verarbeitung Verantwortlichen. Verantwortlich ist gem. § 3 Abs. 7 BDSG n.F. „jede Person oder Stelle, die personenbezogene Daten für sich selbst erhebt, verarbeitet oder nutzt oder diese durch andere im Auftrag vornehmen lässt“. Infolgedessen wurde im Rahmen der Umsetzung der EG-Datenschutzrichtlinie eine Wandlung vom Territorialprinzip zum Sitzlandprinzip vorgenommen, bei dem es nicht mehr auf den Ort der Datenverarbeitung ankommt.[87]
Im Ergebnis wird gem. § 1 Abs. 5 BDSG n.F. deutsches Datenschutzrecht angewendet, wenn ein Unternehmen mit Sitz in Deutschland in einem anderen Land seine Daten verarbeiten lässt oder mit Sitz in einem anderen Land seine Daten über deutsche Terminals verarbeitet.[88]
Anwendbares Vertragsrecht
Für Verträge zwischen dem Online-Verbraucher und einem Diensteanbieter gilt ebenfalls gem. Art. 3 Abs. 4 i.V.m. Anhang I ECRL die Ausnahmeregelung des Herkunftslandprinzips. Diese Ausnahme ist auch im § 4 Abs. 3 TDG n.F. festgeschrieben, wonach Verbraucherverträge, die im Rahmen von Telediensten geschlossen werden, vom Herkunftslandprinzip unberührt bleiben. Demzufolge richtet sich bei grenzüberschreitenden Rechtsgeschäften die Anwendbarkeit insbesondere des Fernabsatzgesetzes nach dem nationalen Kollisionsrecht.
Grundsätzlich ist gem. Art. 27 Abs. 1 S. 1 EGBGB die Anwendbarkeit des deutschen Rechts gewährleistet, wenn dies im Vertrag vereinbart wurde. Fehlt eine derartige Vereinbarung, ist nach Art. 28 Abs. 1 S. 1 EGBGB das Recht desjenigen Staates anzuwenden, mit welchem der Vertrag die engste Verbindung aufweist. Dabei wird nach Art. 28 Abs. 2 S. 1 EGBGB vermutet, dass dies derjenige Staat ist, in dem die Hauptleistung erbringende Partei ihren gewöhnlichen Aufenthalt bzw. die Hauptverwaltung hat. Dies gilt jedoch nur für Verträge zwischen Kaufleuten. Bei Verbraucherverträgen kann zwar das anwendbare Recht festgelegt werden, jedoch schreibt Art. 29 Abs. 1 EGBGB vor, dass dem Verbraucher durch diese Rechtswahl nicht der Schutz des Staates, in dem er seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat, entzogen werden darf. Dies ist insbesondere der Fall, wenn dem Vertragsabschluss ein ausdrückliches Angebot oder eine Werbung vorangegangen ist und der Verbraucher in diesem Staat die für einen Vertragsschluss erforderlichen Rechtshandlungen vorgenommen hat. Im Rahmen des E-Commerce erfüllt eine Website-Werbung diese Voraussetzung, da sie in dem Staat des Verbrauchers zugänglich gemacht wird.[89] Auch ist ein Angebot per E-Mail als ein „ausdrückliches Angebot im Aufenthaltsstaat des Verbrauchers“ anzusehen.[90] Daher werden auf Verbraucherverträge die zwingenden deutschen verbraucherschützenden Normen auch dann angewendet, wenn der Sitz des Unternehmens im Ausland liegt. Fehlt eine Vereinbarung über das anwendbare Recht, ist nach Art. 29 Abs. 2 EGBGB ohnehin das Recht anzuwenden, welches am gewöhnlichen Aufenthaltsort des Verbrauchers gilt.
Da jedoch Art. 29 EGBGB nur den Verbraucher schützt, der seinen Wohnsitz nicht verlässt, wurde im Zuge der Umsetzung der Fernabsatzrichtlinie ein neuer Art. 29a EGBGB eingeführt. Dieser schützt den sich in der Europäischen Union frei bewegenden Verbraucher, der dem Idealbild der Dienstleistungsfreiheit entspricht.[91] Unterliegt ein Vertrag aufgrund einer Rechtswahl nicht dem Recht eines Mitgliedstaates der Europäischen Union oder eines anderen Vertragsstaates des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum (EWR), so sind nach Art. 29a Abs. 1 EGBGB die im Gebiet dieses Staates geltenden Bestimmungen zur Umsetzung der in Art. 29a Abs. 4 EGBGB aufgelisteten Verbraucherschutzrichtlinien gleichwohl anzuwenden. Voraussetzung ist ein enger vertraglicher Zusammenhang mit dem Gebiet eines oder mehrerer Mitgliedstaaten der EU oder des EWR. Ein enger Zusammenhang kann gem. Art. 29a Abs. 2 EGBGB auch hier wieder festgestellt werden, wenn beispielsweise ein öffentliches Angebot oder eine öffentliche Werbung in einem Mitgliedstaat Wirkung entfaltet. Weist der Vertrag einen engen Zusammenhang zu mehreren EU-Mitgliedstaaten auf, so finden die Bestimmungen desjenigen Staates Anwendung, zu dem der engste Zusammenhang besteht.[92] Deutsches Recht kommt also nicht zwingend zur Anwendung. Der Verbraucher kann sich jedoch weitgehend darauf verlassen, dass er aufgrund der europäischen Richtlinienharmonisierung in jedem Mitgliedstaat eine nahezu einheitliche Rechtsgrundlage vorfindet. Abschließend ist jedoch zu bemerken, das Art. 29 EGBGB vor dem subsidiären Art. 29a EGBGB zu prüfen ist. Kommt gem. Art. 29 EGBGB somit deutsches Recht zu Anwendung, so kann dies durch Art. 29a EGBGB nicht mehr korrigiert werden.[93]
Festzuhalten ist, dass deutsches Rechts bei grenzüberschreitenden Aktivitäten erst nach einer detaillierten Einzelfallbetrachtung nach oben aufgeführten Richtlinien und Kollisionsnormen Anwendung findet. Um die weiteren Ausführungen nicht unnötig zu verkomplizieren, wird im Folgenden auf den internationalen Bezug verzichtet. Ferner wird von dem in Deutschland niedergelassenen Unternehmer ausgegangen, der Werbung und Vertragsschluss auf den Verkehrkreis des sich in Deutschland aufhaltenden Verbrauchers ausrichtet.
4 Die Werbung im Internet
4.1 Die kommerzielle Kommunikation
Die moderne Marktwirtschaft ist durch unzählige Mikromärkte und hybrides Kundenverhalten charakterisiert, so dass sich die Funktion eines modernen Unternehmens nicht mehr nur darauf beschränken kann, Produkte zu erzeugen und zu verkaufen. Kotler und Bliemel sprechen von einem Wandel zu einem neuen wertorientierten Ansatz, bei dem die kommunikative Wertvermittlung, insbesondere die Werbung, einen immer größeren Stellenwert erlangt.[94] Werbung ist der „bewusste Versuch, Menschen durch Einsatz spezifischer Kommunikationsmittel zu einem bestimmten, absatzwirtschaftlichen Zwecken dienenden Verhalten zu bewegen“[95]. Das Internet bietet hier weitreichende Möglichkeiten mit geringem Aufwand, aktuelle Informationen zur Verfügung zu stellen und darüber hinaus eine direkte und interaktive Kommunikation mit den ständig wachsenden Zielgruppen zu führen.[96] So entdecken die Anbieter von Waren und Dienstleistungen zunehmend das Medium „Internet“ als Werbeplattform.
Angesichts dieser Entwicklung muss auch der Gesetzgeber auf die zu erwartenden rechtlichen Probleme, die aus einer im Internet durchgeführten Werbemaßnahme entstehen können, vorbereitet sein. Ein wichtiger Schritt ist hier die gesetzliche Festschreibung der Werbung für elektronische Kommunikationsmittel, die europäische Richtlinien und deutsche Gesetze erst zur Anwendung kommen lässt. Im Definitionskalender des Art. 1 ECRL wird Werbung allgemein unter dem Begriff „kommerzielle Kommunikation“ geführt. Diese Begriffsbestimmung wird außerdem wortwörtlich im § 3 Nr. 5 TDG n.F. wie folgt umgesetzt:
„Kommerzielle Kommunikation ist jede Form der Kommunikation, die der unmittelbaren oder mittelbaren Förderung des Absatzes von Waren, Dienstleistungen oder des Erscheinungsbilds eines Unternehmens, einer sonstigen Organisation oder einer natürlichen Person dient, die eine Tätigkeit im Handel, Gewerbe oder Handwerk oder einen freien Beruf ausübt.“
Die Begriffsbestimmung umfasst Werbung im weitesten Sinn.[97] Von der Öffentlichkeitsarbeit, über die Verkaufsförderung bis hin zum Direktmarketing sind daher sämtliche Formen der Werbung eingeschlossen. Der Begriff der kommerziellen Kommunikation deckt sich im Ergebnis mit der Formulierung der Tatbestandsvoraussetzung der §§ 1 und 3 UWG, dem „Handeln im geschäftlichen Verkehre zu Zwecken des Wettbewerbs“, so dass auch die Wettbewerbshandlungen im Internet vom Anwendungsbereich des UWG erfasst werden.[98]
Ausgenommen sind jedoch Angaben wie Domain-Namen oder E-Mail-Adressen, die einen direkten Zugang zur Tätigkeit des Unternehmens ermöglichen.[99] Auch fallen beipielsweise Angaben auf einer privaten Website in Bezug auf Waren und Dienstleistungen oder das Erscheinungsbild eines Unternehmens, die ohne finanzielle Gegenleistung gemacht werden, nicht unter die Begriffsbestimmung.[100] Das für die Begriffsanwendung notwendige geschäftliche Handeln liegt auch dann nicht vor, wenn der private Inhaber einer Domain Werbung seines Providers gestattet um dadurch Providerkosten einzusparen.[101]
Im Internet sind verschiedene Erscheinungsformen der kommerziellen Kommunikation sichtbar, die im Folgenden vorgestellt werden. Aufgrund der rasanten technischen Entwicklung kann die Darstellung jedoch nicht für alle Zeit abschließend sein. Ebenso wie die im Anschluss behandelten Rechtsfragen zur Werbung im Internet sind auch die Werbeformen regelmäßigen Anpassungen unterworfen.
Eigenwerbung
Wirbt ein Unternehmen im WWW mit einer eigenen Internet-Seite für Leistungen, die es selbst erbringt, so spricht man von Eigenwerbung oder der direkten Produktwerbung.[102] Die Werbung kann sich dabei einerseits auf Produkte und Dienstleistungen beziehen, die direkt von der Website des Unternehmens bestellt und erworben werden können, wie beispielsweise beim Erwerb von Anwendungs-Software über das Internet. Andererseits können spezifische Produkte beworben werden, die nicht online bestellbar sind.[103] Dies hängt entscheidend von dem Vertriebsweg ab, den das werbende Unternehmen verfolgt. So ist etwa die direkte Bestellung von Fahrzeugen über die Homepage deutscher Automobilkonzerne bisher noch nicht möglich.
Bannerwerbung
So wie viele große Firmen auf der eigenen Homepage über ihre Angebote informieren, schalten sie auch auf den Internet-Seiten anderer Firmen Werbeblöcke. Im übertragenden Sinne handelt es sich bei der werbetragenden Website um eine virtuelle Litfass-Säule, die mit Werbe-Bannern bestückt ist.[104] Diese an der Popularität einer anderen Website partizipierende Bannerwerbung ist die früheste und heute dominierende Form der Internetwerbung. Mittlerweile ist eine Vielfalt von Bannerarten entstanden, die verschiedene Möglichkeiten der grafischen Darstellung und Interaktivität bieten.[105]
Während die ersten Banner noch rein statisch waren, ermöglichte die Weiterentwicklung der Browser-Technologie die Darstellung bewegter Sequenzen in animierten Bannern. Eine echte Interaktion boten erst die HTML-Banner, bei denen erstmals Pull-Down-Menüs, Dialogboxen, Adressfelder und weitere Elemente in die Banner integriert wurden. Den technisch größten Aufwand erfordert die Programmierung so genannter Nano-Site Banner, mit denen eine quasi eigene zweite Website auf der Ausgangsseite integriert wird, die der Teilnehmer aufrufen kann, ohne die Seite wechseln zu müssen. Der Trend der Bannerentwicklung bewegt sich in Richtung immer aufwendiger programmierter Rich-Media Banner, die neben Filmsequenzen auch Sprachwiedergabe oder Musikclips integrieren. Allen Bannerarten gemeinsam ist das rechteckige Format und die Platzierung auf einer Website als Werbeträger. Das Entgelt für die Bannerwerbung bemisst sich am Bekanntheitsgrad oder an der schon angesprochenen Popularität der werbetragenden Homepage.[106] Die Bewertung der Popularität ergibt sich aus den Zugriffszahlen auf diese, den sog. „page views“ oder „visits“. Handelt es sich bei dem Werbebanner um ein Angebot, mit dem der Nutzer auf die Website des Werbetreibenden gelangt, kann alternativ die Anzahl dieser Nutzer-Interaktionen, der sog. „ad clicks“, zur Entgeltbemessung herangezogen werden.
Werbende Links
Ein besonderes Charakteristikum des World Wide Web ist der reibungslose Informationsfluss innerhalb einer Netzstruktur von Servern und Websites, der erst durch elektronische Verknüpfungen von Inhalten, dem sog. „Linking“, ermöglicht wird.[107] Technisch wird ein Link[108] durch einen HTML-Befehl realisiert, wodurch der Nutzer über die automatische Verbindung mit einem entsprechenden URL einer anderen Seite im WWW verbunden wird. Ein „Link“ wird auf vielfältige Weise eingesetzt, um die Wirkung der Eigen- und Bannerwerbung zu entfalten.[109] Er kann direkt im fortlaufenden Text der Unternehmens-Homepage oder in den Werbe-Bannern enthalten sein und ermöglicht per „Mausklick“ einen Zugriff auf Websites, die weiterführende Produktinformationen oder das Angebot des Werbenden enthalten. Während es technisch nur eine einzige Form von „Link“ gibt, existieren eine Vielzahl gestalterischer Variationen, die aus rechtlicher Perspektive in drei Gruppen zu unterteilen sind.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten[109]
Abb. 2 Hyperlink
- Deep-Link
Führen Hyperlinks, unter Umgehung der Homepage der fremden Website direkt auf tieferliegende Inhalte, wird dies als ein „Deep-Link“ bezeichnet.[111] Der Nutzer kann oftmals nicht erkennen, ob die angezeigten Daten integraler Bestandteil der verweisenden Website oder eines dritten Inhalteanbieters sind, da er an der Eingangsseite vorbeigeleitet wird.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 3 Deep-Link
- Inline-Link und Framing
Bei einem Inline-Link wird ein „fester“ Link bereits in die verweisende Website eingebunden, so dass ohne weiteres Anklicken des Nutzers die fremden Inhalte automatisch beim Seitenaufbau in die Seite des Anbieters integriert werden.[112] Infolgedessen kann aus Sicht des Nutzers der Eindruck gewonnen werden, dass der fremde Inhalt zu der Website des Anbieters gehört.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 4 Inline-Link
Ein Verfahren mit ähnlicher Systematik bietet das sog. „Framing“. Dabei wird der Bildschirm in mehrere eigenständig aktivierbare Rahmen aufgeteilt.[113] So führt das Aktivieren eines Links nicht mehr automatisch zum Verlassen der Website, denn nur der Inhalt des Fensters ändert sich. Charakteristisch wird die Website in einen oder zwei kleinere, am Bildschirmrand befindliche Rahmen eingeteilt, in denen Linklisten angeboten werden.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 5 Framing
Beim Anklicken einer dieser „Links“ wird die angewählte Website in einen Hauptrahmen geladen, der zur Darstellung der eigentlichen Inhalte dient. Dabei gibt es Formen, bei denen im Adressfenster der Browser-Software der Site-Wechsel angezeigt wird, aber auch solche, bei denen dies nicht geschieht. Folglich können auch mittels der Frame-Technik, für den Betrachter nicht sichtbar, vollständige WWW-Seiten Dritter in das Gerüst der eigenen integriert werden.
E-Mail-Werbung
Die elektronische Post (E-Mail) ist einer der meistgenutzten Internet-Dienste, mit dem Nachrichten und Dateien zwischen den Teilnehmern im Internet ausgetauscht werden können. Der Teilnehmer benötigt dafür eine eigene E-Mail-Adresse und einen virtuellen Postkasten, der von Diensteanbietern wie beispielsweise T-Online mit begrenzter Speicherkapazität zur Verfügung gestellt wird. Gegenüber herkömmlichen Direkt-Marketing-Formen wie der Brief-, Telefon- und Telefax-Werbung bietet E-Mail den Vorteil, eine elektronisch erstellte Werbebotschaft beliebig vervielfältigen und anschließend kostengünstig und schnell an eine Vielzahl von Adressaten verschicken zu können.[114] Gleichzeitig ist diese Art der Werbung besonders effektiv, da Verbrauchergruppen nach bestimmten Merkmalen gezielt angesprochen werden können.[115] Auf Grund ihrer ökonomischen Bedeutung nimmt diese Werbeform sogar politische Dimensionen an. Die Parteien haben für die nächste Bundestagswahl im Jahr 2002 angekündigt, die Wählerbevölkerung zusätzlich mit Werbe-E-Mails zu informieren.[116]
[...]
[1] Vgl. Eimeren et al. (2001), veröffentlicht im Internet [Stand 30.10.2001], S. 383; O.V. (2000), veröffentlicht im Internet [Stand 17.11.2001], S. 2.
[2] Vgl. O.V. (2001), veröffentlicht im Internet [Stand 17.11.2001], S. 4.
[3] Vgl. Eimeren et al. (2001), veröffentlicht im Internet [Stand 30.10.2001], S. 385.
[4] Vgl. O.V. (2000), veröffentlicht im Internet [Stand 19.11.2001], S. 2.
[5] Vgl. ebd., S. 4.
[6] Vgl. ebd., S. 7, 10.
[7] Vgl. Kotler/Bliemel (2001), S. 25.
[8] Vgl. Münz/Nefzger (1999), S. 19-21.
[9] Vgl. Flohr (CHIP 2001), S. 230.
[10] Vgl. Münz/Nefzger (1999), S. 31.
[11] Vgl. ebd., S. 21-24.
[12] Vgl. Köhntopp/Köhntopp (CR 2000), S. 249 f.
[13] Vgl. Fechner (2000), S. 241.
[14] Vgl. Fritz (1999), S. 3.
[15] Vgl. Zerdick et al. (1999), S. 142.
[16] Vgl. Kotler et al. (1999), S. 979.
[17] Vgl. Zerdick et al. (1999), S.142.
[18] Vgl. Kröger (2000), S. 444 f.
[19] Vgl. Clement et al. (1998), S.49.
[20] Vgl. Picot et al. (1998), S. 317.
[21] Vgl. Picot et al. (1998), S. 317; Bliemel et al. (1999), S. 2.
[22] Vgl. Picot et al. (1998), S. 318; Zerdick et al. (1999), S. 147 ff.
[23] Vgl. Picot et al. (1998), S. 324.
[24] Vgl. Rüßmann (K&R 1998), S. 129.
[25] Vgl. Stromer von Reichenbach (1975), S. 97-112.
[26] Vgl. Müller/Vogelsang (1979), S. 19.
[27] „Konsumentensouveränität“ bedeutet, dass sich die Produktion von Waren und Dienstleistungen an den Wünschen der Konsumenten ausrichtet (Vgl. Pöhlmann, H. ,Wirtschaftpolitische Chronik 1974, S. 52 f.).
[28] Vgl. Prosi (1984), S. 68 f.
[29] Vgl. Sinn (1988), S.6.
[30] Vgl. Bauer (1996), S. 11 f.
[31] Gröner/Köhler (1987), S. 17.
[32] Vgl. Schmidt (Wirtschaftsinformatik 1993), S. 468; Brandtweiner/Greimel (WiSt 1998), S.38.
[33] Vgl. Fritz (1999), S. 112 ff.
[34] Z.B. Bargain Finder, der von Anderson Consulting angeboten wird, um dem Web-Benutzer Preisvergleiche zu ermöglichen.
[35] Vgl. Zerdick et al. (1999), S. 151 ff.
[36] Vgl. Rüßmann (K&R 1998), S. 129.
[37] Vgl. Tribunale di Milano (06.06.1968), Repertorio generale annuale di giurisprudenza del Foro italiano I 1968, S. 2316 f. (m.w.H.); Corte dApello di Milano (10.10.1969), Repertorio generale annuale di giurisprudenza del Foro italiano I 1970, S. 617 f. (m.w.H.).
[38] Vgl. BGH (Beitragsrechnung, GRUR 1992), S. 450; OLG Hamburg (Erzeugerwerbung, WRP 1980), S. 273; BGH (Westfalenblatt II, GRUR 1968), S. 435.
[39] Vgl. BGH (Westfalenblatt II, GRUR 1968), S. 433-435; BGH (Maraschino, GRUR 1982), S. 112; BGH (Monatlicher Ratenzuschlag, GRUR 1990), S. 609 f.
[40] Vgl. Baumbach/Hefermehl (1996): S. 854-857.
[41] Vgl. EuGH (Lifting-Creme, WRP 2000), S. 289; EuGH (Becel-Diät-Käse, WRP 2000), S. 158 f.; EuGH (6-Korn-Eier Gut-Springheide, WRP 1998), S. 848.
[42] Vgl. Groeschke/Kiethe (WRP 2001), S. 230 ff.
[43] Vgl. Maennel (MMR 1999), S. 187.
[44] Vgl. Schrick (MMR 2000), S. 402.
[45] Vgl. EuGH (Rs. 48/75 Royer 1976), S. 497 ff., 517.
[46] Vgl. EuGH (Rs. 152/84 Marshall I, 1986), S. 723 f.
[47] Vgl. EuGH (Rs. 8/81 Becker, 1982), S. 53, 70 ff.
[48] Vgl. EuGH (Rs. 152/84 Marshall I, 1986), S. 723 f.
[49] Vgl. ebd.
[50] Vgl. Hoffmann (1999), S. 63; Kröger (2000), S. 447.
[51] Vgl. Kröger (2000), S. 446.
[52] Vgl. Bröhl (MMR 2001), S. 67.
[53] Vgl. Apel/Grapperhaus (WRP 1999), S. 1247 f.
[54] Vgl. Maennel (MMR 1999), S. 187 f.
[55] Vgl. Spindler (MMR Beilage 2000), S. 4 f.
[56] Vgl. Hoeren (MMR 1999), S. 193.
[57] Vgl. Nordemann (1996), S. 29.
[58] Vgl. Freitag (2000), S. 379.
[59] Vgl. Schack (MMR 2000), S. 59 f.
[60] Vgl. Nordemann (1996), S. 53-57.
[61] Vgl. Groeschke/Kiethe (WRP 2001), S. 230.
[62] Vgl. Nordemann (1996), S. 45.
[63] Vgl. Barton (1999), S. 3.
[64] Das IuKDG beinhaltet u.a. das Teledienstegesetz und das Teledienstedatenschutzgesetz.
[65] Vgl. Barton (1999), S. 12.
[66] Vgl. Pernice (2000), 7.
[67] Entwurf des „Elektronischer Geschäftsverkehr-Gesetz“ (EGG); Abrufbar unter http://www.bmj.bund.de/ggv/egg.pdf.
[68] Vgl. Bröhl (MMR 2001), S. 67.
[69] Vgl. Imhof (CR 2000), S. 110.
[70] Vgl. Börner et al. (2000), S. 9.
[71] Vgl. ebd.
[72] Vgl. Börner et al. (2000), S. 12.
[73] Vgl. Härting/Schirmbacher (MDR 2000), S. 917.
[74] Vgl. Schack (MMR 2000), S. 59.
[75] Vgl. ebd.
[76] Vgl. Fechner (2000), S. 834.
[77] Vgl. Kiethe (WRP 2000), S. 618.
[78] Vgl. Schack (MMR 2000), S. 59-61; Sack (WRP 2000) S. 272.
[79] Vgl. BGH (Tampax, 1971), S. 151-153; Dieselhorst (ZUM 1998), S. 294 f.
[80] Vgl. Dieselhorst (ZUM 1998), S. 294 f.
[81] Vgl. Tettenborn (K&R 1999), S. 252.
[82] Vgl. Apel/Grapperhaus (WRP 1999), S. 1247-1251; Gierschmann (DB 2000), S. 1315-1316; Hoeren (MMR 1999), S. 192-195; Spindler (MMR Beilage 2000), S. 4-9
[83] Härting (CR 2001), S. 273.
[84] Vgl. Erd (JJ 2000), S. 457 f.
[85] Vgl. Moos (2000), S. 415 f.
[86] Vgl. Püttmann (K&R 2000), S. 494.
[87] Vgl. ebd.
[88] Vgl. Erd (2000), S. 457 f.
[89] Vgl. Kaiser/Voigt (K&R 1999), S. 446.
[90] Vgl. Scherer/Butt (DB 2000), S. 1011.
[91] Vgl. Tonner (BB 2000), S. 1418 f.
[92] Vgl. BT-Drucks. 14/2658, S. 50; Staudinger (RIW 2000), S. 418.
[93] Vgl. Ring (2000), S. 227; Tonner (BB 2000), S. 1419.
[94] Vgl. Kotler/Bliemel (1995), S. 133.
[95] Nieschlag et al. (1997), S. 1085.
[96] Vgl. Gesmann-Nuissl (2001), S. 80.
[97] Vgl. Brisch (CR 1999), S. 238; EGG-Entwurf S. 31.
[98] Vgl. EGG-Entwurf S. 32.
[99] Vgl. Gierschmann (DB 2000), S. 1317.
[100] Vgl. EGG-Entwurf, S. 31.
[101] Vgl. LG München I (Bannerwerbung auf privater Homepage – saeugling.de, MMR 2001), S. 545.
[102] Vgl. Kiethe (WRP 2000), S. 617.
[103] Vgl. Leupold et al. (WRP 2000), S. 576.
[104] Vgl. Kiethe (WRP 2000), S. 617.
[105] Vgl. O.V. (2001), veröffentlicht im Internet [Stand 20.11.2001].
[106] Vgl. ebd.
[107] Vgl. Plaß (WRP 2000), S. 599.
[108] Link [engl.] = Bindeglied
[109] Vgl. Leupold et al. (WRP 2000), S. 580.
[110] Vgl. Kochinke/Tröndle (CR 1999), S. 191.
[111] Vgl. Kochinke/Tröndle (CR 1999), S. 191; Wiebe (WRP 1999), S. 735; Plaß (WRP 2000), S. 600.
[112] Vgl. Engels/Köster (MMR 1999), S. 522; Wiebe (WRP 1999), S. 735; Völker/Lührig (K&R 2000), S. 21; Plaß (WRP 2000), S. 599.
[113] Vgl. Gabel (K&R 1998), S. 555; Wiebe (WRP 1999), S. 735; Engels/Köster (MMR 1999), S. 522 f.; Völker/Lührig (K&R 2000), S. 21; Plaß (WRP 2000), S. 599.
[114] Vgl. Lettl (GRUR 2000), S. 977.
[115] Vgl. Schrick (MMR 2000), S. 399.
[116] Vgl. Knaup/Scheidges (2000), veröffentlicht im Internet [Stand 20.11.2001], S.1-4.
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Originalausgabe
- Jahr
- 2001
- ISBN (eBook)
- 9783832449285
- ISBN (Paperback)
- 9783838649283
- DOI
- 10.3239/9783832449285
- Dateigröße
- 1.1 MB
- Sprache
- Deutsch
- Institution / Hochschule
- Universität Paderborn – Wirtschaftswissenschaften
- Erscheinungsdatum
- 2002 (Januar)
- Note
- 1,3
- Schlagworte
- recht electronic commerce verbraucherschutz marketing fernabsatz